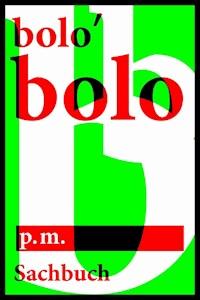Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein zwölfbändiges Tagebuchwerk in Schmuckkassette eines gewissen Roberto Manetti, das im Züricher Ammann Verlag erschien, lässt reihenweise seine Leser verschwinden. Paul Meier macht sich auf die Suche nach den Verschwundenen und will das Geheimnis der Lektüre lüften. Seine Suche führt ihn aus der Schweiz u.a. in die Toscana, die Provence, nach Paris und schließlich auf eine geheimnisvolle Schiffspassage. Unversehens befindet er sich in einer entspannt faszinierten Auseinandersetzung mit den brennenden Fragen unserer Zeit. Eine neue Lebensweise zeichnet sich immer klarer ab: neu eingebettete Subsistenzgesellschaften in lokalen, offenen Gemeinschaften, weltweit vernetzt. Das gute Leben und Luxus für alle! Ein literarisches Antidepressivum, das Lust auf Leben macht!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
P. M.MANETTI LESEN
ODERVOM GUTEN LEBEN
ROMAN
Edition Nautilus Verlag Lutz Schulenburg
Schützenstraße 49 a · D-22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten · © Edition Nautilus 2012
Originalveröffentlichung · Erstausgabe August 2012
Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburg
www.majabechert.de
Druck und Bindung: CPI books
1. Auflage
Print ISBN 978-3-89401-761-3
E-Book EPUB ISBN 978-3-86438-084-6
E-Book PDF ISBN 978-3-86438-085-3
»Doch vermag die milde Narkose, in die uns die Kunst versetzt, nicht mehr als eine flüchtige Entrückung aus den Nöten des Lebens herbeizuführen und ist nicht stark genug, um reales Elend vergessen zu machen.«
Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur, 1931
»Se as pessoas prestassem um pouco mais de atenção nas minhas atitudes, perceberiam com facilidade tudo aquilo que eu não consigo dizer.«
Anonym
»Die Müdigkeit hat ein weites Herz.«
Maurice Blanchot
»Heilig ist nicht der Tag des um-zu, sondern der Tag des nicht-zu, ein Tag, an dem der Gebrauch des Unbrauchbaren möglich wäre. Er ist der Tag der Müdigkeit.«
Byung-Chul Han
»Woran es fehlt, ist eine Vision, die emotional und identitätsträchtig ist, eine Formulierung der Frage, wie man im Jahr 2025 eigentlich leben möchte.«
Harald Welzer
»Die Reue ist ein Weltreich, unendlich und unermesslich an Ausdehnung.«
Robert Walser
»Alles war schön, alles, alles.«
Robert Walser
Grafik aus: David Graeber, Schulden. Die ersten 5000 Jahre
1.
Roberto Manetti ist vor elf Jahren gestorben. Letztes Jahr sind seine Notizbücher in einer Faksimile-Ausgabe herausgekommen. Sie besteht aus zwölf schwarzen, fingerdicken Notizbüchern in einem ebenso schwarzen Schuber, Format A5. Im Unterschied zum Original trägt jedes der Notizbücher auf dem Rücken und vorn auf dem Deckel eine Zahl von 1 bis 12 in Goldprägung. Die Form der Ziffern ist dick und altmodisch, sodass man den Eindruck hat, Objekte aus den zwanziger oder dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts in den Händen zu halten. Sonst aber entsprechen sie genau den Originalen, die Seiten sind blau kariert, unnummeriert, und natürlich ist der ganze Text in einer digitalen Annäherung an Manettis schöne, leicht leserliche Handschrift gehalten. Es gibt nur wenige Zeichnungen und Skizzen. Die Bände enthalten keine gedruckten Hinweise auf Verlag, Jahr, den Autor. Erst der Schuber verrät, dass der Herausgeber der Ammann Verlag ist, das Jahr der Publikation 2009, der Autor Roberto Manetti (1941–1999). Auf dem Schuber findet man den Strichcode, die ISB-Nummer, eine kurze Notiz darüber, woher die Notizbücher kommen und wie die Beinahe-Faksimile-Ausgabe hergestellt wurde.
Egon Ammann hat mit der Herausgabe von Manettis Notizbüchern sein Gespür für literarische Qualität wieder einmal unter Beweis gestellt. Eine teure Faksimile-Ausgabe des einzigen Werks eines unbekannten, verstorbenen und schwer fassbaren Autors herzustellen, war ein immenses verlegerisches Risiko, das ein anderer kaum eingegangen wäre. Obwohl die Ausgabe teuer ist (550 Franken), ist sie ein voller Erfolg. In der Schweiz hat die Auflage 12000 erreicht, in Deutschland ist sie bei 8000 (hauptsächlich in Berlin), in Österreich bei 200 (ein paar Exil-Zürcher). Dabei muss man berücksichtigen, dass man den Text ohne intimste Kenntnisse der Zürcher Szene kaum verstehen kann. (Die Berner und Genfer Szene kommt auch vor, die Basler Szene kaum, aber da viele Basler in Zürich leben, gibt es sicher auch Leser in Basel.)
Wenn man bedenkt, dass Manettis Familie aus Pietät auf ein Honorar verzichtet hat, dann kann man erahnen, dass der Ammann Verlag mit diesem Produkt finanziell gut gefahren ist.
Und nun habe ich mir also – mit einem Jahr Rückstand – auch meinen Manetti gekauft. Man kann es sich praktisch nicht mehr leisten, Roberto Manetti nicht gelesen zu haben, alle reden von ihm, er ist überall latent präsent, er hat die Szene (welche auch immer das ist) vollständig durchseucht. Manetti lesen heißt immer Manetti kaufen. (Auch das erklärt die hohe Auflage.) Man kann ihn nicht ausleihen, er wird quasi zu einem Teil der Intimsphäre wie die Zahnbürste, er wird persönlich. Roberto Manetti scheint zu jeder Leserin, zu jedem Leser direkt zu sprechen. Was umso paradoxer ist, als er nie für ein mögliches Publikum geschrieben hat und schon eine Weile tot ist. Der Ort, von dem aus er zu uns spricht, ist schon ein anderer.
Bei Manettis Notizbüchern handelt es sich nicht um Tagebücher. Tagebücher sind ja im Prinzip unlesbar. Die Wahrheit ist dem Menschen zwar zumutbar, wie Ingeborg Bachmann meinte (zu Unrecht, denn auf die Zerbrechlichkeit des Menschen muss man durchaus Rücksicht nehmen), aber echte, intime Tagebücher erregen höchstens Ekelgefühle. Nicht gemeint sind damit schon für ein zukünftiges Publikum geschriebene Tagebücher, wie jene des Schlaumeiers Max Frisch, die wohl überlegt und perfekt redigiert sind. Manettis Texte sind also keine spontanen Ergüsse, keine beliebigen Impressionen, sondern sie sind auf eine seltsame Weise gültig, ohne jedoch künstlich zu wirken. Dabei ist die Sprache völlig unauffällig, nicht aufdringlich elegant oder gar mit Bildungsmüll überladen. Wahrscheinlich hat er sich seine Sätze mehrmals zurechtgelegt, bevor er sie niederschrieb. Obwohl wir jetzt zwölf Bände à 200 Seiten haben, also um die 2400 Seiten, hat er eigentlich nicht viel geschrieben, denn die Notizbücher decken die Periode von 1975 bis 1999, insgesamt 24 Jahre, ab. Wann genau die Einträge erfolgten, erfährt man nicht, man kann es höchstens an Hand von zeitgeschichtlichen Bezügen, die bisweilen durchschimmern, erahnen. Wie erreicht man es, Texte leicht und spontan wirken zu lassen, die sich bei genauerer Analyse als raffiniert durchkomponiert herausstellen? Manetti hat es auch geschafft, auf das, was man als »Stimme« des Autors bezeichnet, zu verzichten. Er hat keine erkennbare Stimme, er sagt seine Sachen einfach. Es gibt keinen typischen Manetti-Stil. Da er nicht für Leser schrieb, musste er auch niemanden beeindrucken. Wer Manetti liest, liest ihn daher mit Bestimmtheit zwei Mal. Das erste Mal aus Neugier, das zweite Mal aus Verwunderung, dass es solche Texte überhaupt geben kann.
Was Manetti zu sagen hat, ist nicht besonders originell. Da er eine umfassende humanistische Bildung genossen hatte und rundum belesen war, entdeckt man Bezüge zur neueren Schweizer Literatur – Frisch, Dürrenmatt, Bichsel, Loetscher, Muschg – ohne weiteres. Originalität ist etwas, das man für sich selbst nicht braucht. Wenn er redet, hat man das Gefühl, dass er einem aufmerksam zugehört hat, ja, dass er das besser sagt, was man gerade sagen wollte. Manetti hat tatsächlich in Zürich Psychologie und Philosophie studiert. Er hat über einen obskuren Vorsokratiker namens Hekataios von Milet promoviert. In den Medien ist viel über ihn und das Phänomen seines Erfolgs geschrieben worden. Seine Schwester Elsa – ein Name, der mich immer an eine Firma für Elektronikteile erinnert, aber Namen sind Namen, da kann man nichts machen – hat eine ganze Reihe von Interviews gegeben. Inzwischen kennt man Roberto Manetti ziemlich gut. Wahrscheinlich bin ich ihm oft begegnet, ohne ihn zu beachten. Er war bei verschiedenen Ereignissen dabei, bei denen ich auch dabei war: zum Beispiel bei der ersten Besetzung des Zürcher AJZ, bei einer Demo für das alternative Kulturzentrum Rote Fabrik, bei der Tschernobyl-Demo in Bern, beim Stauffacher-Tribunal gegen Immobilienspekulanten auf dem Helvetiaplatz, bei der Veranstaltung im Schauspielhaus zum »leergeglaubten Staat« (anlässlich des 700-Jahre-Jubiläums 1991), bei vielen Konzerten und Ausstellungen. Er ist aber nie prominent aufgetreten, er muss sich immer am Rand aufgehalten haben. Was nicht heißt, dass er in entscheidenden Momenten nicht aktiv gewesen sein könnte. Elsa hat keine Fotos von ihm veröffentlichen lassen. Aber ich weiß, wie er aussah: groß, hager, immer mit teuren, weißen Tennisschuhen und Jeans, dazu dezente helle Pullover, meist über die schmalen Schultern drapiert. Er hatte schütteres blondes Haar, ein dünnes Bärtchen und einen Schnurrbart. Seine Nase war markant, er trug eine randlose Brille und hatte graue Augen. Er war immer zugänglich und freundlich, auch in angespannten Situationen. Wie ein guter Geist tauchte er auf und verschwand. Ich habe ihn gekannt, aber wahrscheinlich nie direkt mit ihm geredet.
2.
Von Thomas Schneider, seinem ersten Leser und Lektor, habe ich weitere Details über Manettis Leben erfahren. Die Notizbücher wurden ja nur darum publiziert, weil Schneiders Freundin K. mit Elsa bei einer Szenographie in einer abgelegeneren Halle der Expo.02 zusammenarbeitete. Beide waren sie Bekannte von Pippilotti Rist. Klar, in Zürich ist praktisch jeder ein Bekannter von Pippilotti Rist – ich habe damals bei einer literarischen Modenschau (bunte Hemden, Fische mit Zähnen) mitgewirkt, die von ihren Freundinnen organisiert wurde. Das Hemd habe ich immer noch, und kürzlich hat mir ein alter Schulfreund sogar den auf Schreibmaschine getippten Programmablauf zugesandt, den er beim Aufräumen fand. Aber zurück zu Roberto Manetti.
Es war Mitte Juli, als ich Thomas Schneider wieder einmal im Grand Café am frisch beruhigten Limmatquai traf. Thomas trägt immer einen eleganten, absichtlich zerknitterten Anzug, dazu eine unauffällige Krawatte. Er geht selten zum Coiffeur und verunstaltet sein Gesicht mit einer monströsen Hornbrille, die wahrscheinlich an Max Frisch erinnern soll. Typisch für ihn ist auch, dass er nie etwas bei sich hat. Er bittet einen dauernd um Schreibzeug, um Feuer, um die Benutzung des Mobilfons. Dabei sagt er nicht einmal: »Hättest du Feuer, bitte?«, sondern fuchtelt einem nur vor der Nase herum. Selbstverständlich hat er auch nie Geld dabei – es scheint ihm nicht aufgefallen zu sein, dass ich seinen Kaffee (mit oder ohne Croissant) seit Monaten bezahle. Aber da er ein liebenswürdiger Zeitgenosse ist und viele Interna zu berichten weiß, macht mir das gar nichts aus.
Während also drei Tische hinter uns Hugo Loetscher die NZZ las, erfuhr ich einiges über die Familie Manetti. (Hugo Loetscher sitzt manchmal auch im Odeon. Er ist das Urbild eines Literaten – gebildet, weit gereist, belesen, aufmerksam. Er kann gut formulieren. Er hasst Muschg, weil Muschg sich als Frisch-Ersatz betrachtet und immer wieder völlig umständliche, nichtssagende, aber manifestartigumfassende Stellungnahmen zum Zeitgeschehen abgibt. Wenn man sie gelesen hat, fragt man sich: Was hat Muschg jetzt gesagt? Wenn man also mit Muschg nichts anfangen kann, dann passt einem Loetscher gerade. Loetscher schreibt seit Jahren auf einem Computer, der ihm geschenkt wurde. Schade, man hätte ihn doch gerne noch nervös Zigaretten rauchend an einer Hermes-Baby sitzen sehen. Aber er ist ein echter Literat, er hat auf jede Frage eine einigermaßen bemerkenswerte Antwort. Meist kommt er auf seine Jugend in Aussersihl, auf seine Zeit beim du oder auf Brasilien zu sprechen. Loetscher ist lesbar – aber natürlich kein Vergleich mit Manetti. Der übrigens auch lange in Brasilien lebte.)
»Die Manettis stammen ursprünglich aus dem Aosta-Tal«, begann Thomas, als er sich eine meiner Zigaretten mit meinem Feuerzeug angezündet hatte, »sie waren wahrscheinlich Waldenser und im Seidenhandel tätig. Also hatten sie immer schon Beziehungen nach Lyon und Zürich. Dann kamen die Verfolgungen. Gegenreformation. Sie verloren alles und siedelten nach Bergamo über, wo sie einen Gemischtwarenladen eröffneten. Sie verhielten sich religiös unauffällig – das ist die Stadtpräsidentin.«
Er lenkte meinen Blick auf eine elegant gekleidete junge Frau mit blondem Wuschelschopf, die über die erhöhten Randsteine bei der Tramstation hüpfte und Richtung Rathaus eilte.
»Sie hat nichts dabei«, bemerkte ich.
»Wahrscheinlich trägt man ihr alles nach. Eine Stadtpräsidentin mit bauchiger Ledermappe wäre ja auch ein ziemliches Stilverbrechen. Man hat alles im Kopf oder kann es auf dem iPhone abrufen. Eine mittlere Akte hat kaum fünfzig Kilobyte, ein Roman im Layout vielleicht zwei Megabyte. Ein Mensch, der noch Unterlagen herumträgt, ist praktisch ein Neandertaler.«
»Vielleicht ist die Goldbrosche an ihrem Lederjäckchen ein 16-Giga-USB-Stick.«
»Darin könnte man alles Wesentliche über die westliche Zivilisation unterbringen.«
Hinter uns räusperte sich Hugo Loetscher. Thomas hatte ein bisschen zu laut gesprochen. Er hat diese Angewohnheit: Wenn er etwas Zitierbares sagt, dann will er, dass man es rundherum hört. Insofern gleicht er Muschg.
»Diesen Herbst werde ich von Corine Mauch meinen Literaturpreis entgegen nehmen«, prahlte Thomas vor sich hin.
»Warum du? Du hast doch nichts geschrieben!«
»Klar nicht – aber ich habe etwas gelesen, vor allen andern. Und ich habe daraus ein Buch gemacht.«
Eigentlich logisch, dass für ein Buch, das keinen greifbaren Autor hat, der erste Leser und Lektor einen Anerkennungspreis bekommt. Wer sonst?
»Natürlich kenne ich Corine schon lange, sie ist mit meiner Freundin befreundet. Beide sind seit langem in der SP.«
Wieder räusperte sich Hugo Loetscher – war er nicht auch in der SP?
»Wir waren beim Gemischtwarenladen in Bergamo stehen geblieben.«
»Am Anfang des letzten Jahrhunderts rutschten sie in den Kaffeehandel und begannen, eine kleine Kaffeerösterei zu betreiben. Sie waren sehr erfolgreich und eröffneten bald Filialen in Milano, Como und dann in Chiasso. Sie erfanden eine bartaugliche Espressomaschine und bauten eine kleine Fabrik in Milano. Dann kam Mussolini, und sie dislozierten nach Lugano.«
»Warum? Was hatten sie von ihm zu befürchten?«
»Nun, es gab Gerüchte über eine Großmutter, die Levi hieß.
Die Manettis hatten Erfahrungen mit Verfolgungen und wollten vorsichtig sein. Zudem stellte sich der Umzug später als geschäftlicher Geniestreich heraus. In den fünfziger Jahren griff die italienische Kaffeekultur auf die Schweiz über. Sie expandierten nach Zürich und wurden nach einigen Jahren Bürger von Zürich. Roberto besuchte hier das Gymnasium. Er sollte Wirtschaftswissenschaften studieren, um das elterliche Geschäft zu übernehmen. Er ging brav nach St. Gallen und eignete sich betriebswirtschaftliches Wissen an, brach aber das Studium bald ab. Um seine Eltern nicht zu enttäuschen, begann er, sich um das Geschäft zu kümmern, schrieb sich aber zugleich an der Universität Zürich ein. Er studierte dies und das, Romanistik, Mathematik, Geschichte, Psychologie, hörte Emil Staiger zu, las Max Frisch, was man halt Anfang der sechziger Jahre so tat.«
Man kann all das in Max Frischs Tagebüchern nachlesen. Seltsamerweise kommt der große Literaturstreit (»Dann frage ich Sie: in welchen Kreisen verkehren Sie?«) nur nebenbei vor. Genau genommen war es ja gar kein richtiger Streit. Man kann ganz gut zu Mozart zurückkehren und trotzdem über Prostituierte, Kriminelle und Drogensüchtige schreiben. Die Sitten zu Mozarts Zeiten waren auch nicht besser als heute. Hätte ich damals etwas zu sagen gehabt, so wäre ich wahrscheinlich sogar mit Staiger einig gewesen. Warum soll Literatur sich immer nur mit Spezialfällen wie Verdingkindern, Alkoholikern, Mördern, Rebellen und andern Randfiguren befassen? Einfach weil es interessant ist? Ist doch reiner Voyeurismus! Die Opfer der Gesellschaft brauchen die Verteidigung durch die Literaten sowieso nicht. Sollen sie doch der SP beitreten und etwas für eine bessere Altersversicherung tun. Auch ganz normale Leute haben große Probleme. Außerdem: warum müssen sich Romane überhaupt mit Problemen befassen? Man kann ja einfach mal was schreiben. Klar liest das dann niemand – aber das ist halt das Los der verkannten Künstler. Manetti schreibt ja auch nicht über spezifische Themen, man könnte keine Manetti-Partei gründen, trotzdem liest man ihn gern, ja, er macht richtig süchtig.
Inzwischen war Thomas bei Manettis Philosophiestudium angelangt, das dieser parallel zu Geschäftsaktivitäten in Brasilien, Ostafrika und Costa Rica betrieb. Er entdeckte neue Kaffeelieferanten, während er sich einerseits durch die Philosophiegeschichte, andererseits durch Kurse in Phänomenologie und Logik arbeitete.
»Da ist Leupi, samt Velo«, bemerkte Thomas, »der grüne Fraktionschef. Ich wette, er ist nächstes Jahr Stadtrat. Sicher geht er zu einer Besprechung mit Corine.«
»Was kann man mit Corine Mauch besprechen?«, fragte ich, während er wieder eine Zigarette erwedelte, »bisher hat sie noch gar nichts gesagt. Noch weniger als Elmar Ledergerber, der wenigstens die Ökoterroristen erfand.«
»Sein politischer Selbstmord.«
Ich träumte kurz, dass Corine aus aktuellem Anlass von Finanz- und Immobilienterroristen reden könnte. Vielleicht war sie schon nahe daran, die Worte wollten nur nicht über ihre Lippen kommen.
»Sie wird nie etwas sagen«, seufzte ich, »das hat sie aus seinem Schicksal gelernt. Sie wird einfach da sein und aufgeschlossen lächeln.«
Thomas paffte und nickte. »Aber was willst du denn? Dass sie die Bevölkerung zur Revolution aufstachelt? Die Polizei zur Unterstützung von Hausbesetzern gegen die Immobilienspekulanten losschickt?«
»Klingt gut.«
»Du hast ja keine Ahnung.«
»Okay. Manetti reiste also herum und studierte Logik.«
»Vor allem Brasilien war für Manetti eminent wichtig«, fuhr Thomas fort, »manchmal war er monatelang dort, nach dem Lizentiat war er zwei ganze Jahre dort verschwunden. Auf jeden Fall florierte die Firma Manetti, ihr Kaffee ist überall. Ihre Kaffeemaschinen sind Kult.«
Hugo Loetscher war durch mit der NZZ. Er stand umständlich auf, nickte uns im Vorbeigehen freundlich zu – wahrscheinlich kannte er Thomas vom Sehen. Oder er hatte den Begriff »westliche Zivilisation« aufgeschnappt. Wir beobachteten, wie er die Straße überquerte und sich in Richtung seiner Wohnung bewegte. Wahrscheinlich würde er dort auf seinem berühmten Computer an seinen Memoiren schreiben. In einem gewissen Sinn waren Manettis Notizbücher Live-Memoiren, Direktreportagen aus dem Leben eines Zeitgenossen. Aber nicht nur das, wie ich herausfinden sollte. Lebt man nur, um sich wenigstens an etwas erinnern zu können, um einen Stoff zu haben? Das deutsche Wort »erinnern« ist ja erstaunlich: Die Welt ist draußen, dann wird sie erinnert und dann ist sie innen. Quasi eine Definition des Lebensprozesses: Man wird in die Welt gesetzt und dann nimmt man sie herein. Verdaut sie. Und dann endet es. Man scheißt es heraus. Was immer »es« war. Der Zyklus ist beendet.
»Wir überlegen uns eine Übersetzung ins Englische«, war Thomas fortgefahren, »aber das wird schwierig.«
»Kann man Erinnerungen übersetzen?«
»Man kann alles übersetzen. Manetti reiste nicht nur nach Brasilien, sondern auch nach Paris, wo er Meienberg traf, nach London und New York.«
»Da wird aber kein Kaffee angebaut«, warf ich ein.
»Aber getrunken. Darum ging es jedoch nicht. Wer die Weltstädte nicht kennt, kennt die gängigen Moden nicht. Manetti wollte die Welt kennen, ein bisschen wie dieser Hekataios. Das ist nicht verwunderlich. Die Verbindung zwischen Philosophie und Geschäft ist offensichtlich. Die griechische Philosophie begann in den ionischen Handelsstädten – zum Beispiel in Milet. Das griechische Alphabet, das nichtmythische Denken – alles Produkte der Polis, des Geschäfts, des Rechnens, des Reisens; Handel, Austausch, Planen und Riskieren, abstraktes Denken – all das gehört zusammen. Manetti war ein Handelsreisender, er machte Geld, viel Geld.«
»Er profitierte von seinem Wissensvorsprung.«
»Genau. Wie Voltaire. Der spekulierte im karibischen Zuckerhandel, machte ein Vermögen, das auf Sklavenarbeit beruhte. Er kaufte sich seine Denkzeit durch die Ausbeutung von Sklaven. Was sie dachten, weiß keiner – vielleicht wussten sie mehr über eine etwas andere Aufklärung als er selbst. Bei Manetti war es im Prinzip nicht anders. Fortschritt hat seinen Preis.«
Sein letzter Satz wäre nicht nötig gewesen. Fortschrittszynismus ist nun wirklich ein alter Hut. Ich fragte mich, was Manetti wohl mit Meienberg in Paris besprochen hatte. Vielleicht hatten sie peripatetisch die Place des Vosges umschritten und über die schweizerische Bourgeoisie gelästert – aus genauer Kenntnis. Vielleicht hatte er versucht, Meienberg auf eine andere Bahn zu bringen. Er hat es nicht lange geschafft.
»Er machte sehr viel Geld«, murmelte Thomas, fasziniert.
»Und seine Schwester hat es geerbt.«
»Ja. Darum brauchte sie auch die Honorare für die Bücher nicht. Sie hat übrigens eine Stiftung gegründet, die Schulen für Mädchen in islamischen Ländern finanziert.«
In den sechziger Jahren studierte Manetti also Wittgenstein, Husserl, Heidegger, Sartre, aber auch Freud, Adler, Jung, machte Geschäfte, verschwand in exotischen Ländern, tauchte wieder auf.
»1969 starb seine Mutter Dora«, berichtete Thomas, »relativ jung, im Alter von 50 Jahren. Das war ein harter Schlag für Manetti, obwohl er damals ja schon 28 Jahre alt war. Seine Mutter hatte ihm viel bedeutet, mehr als sein Vater Carlo, der ja auch viel älter war, damals schon 70.«
»Das heißt«, rechnete ich, »als Manetti 1941 geboren wurde, war seine Mutter 22 Jahre alt, sein Vater aber 42.«
»Ja, sie war seine zweite Frau. Die erste war in den dreißiger Jahren bei einem Verkehrsunfall umgekommen – in einem Bugatti. Am Comer See. Sie war allein am Steuer.«
»Dem Vater starben die Frauen weg«, bemerkte ich, während ich mir eine schicke Frau in einem offenen Bugatti vorstellte. Aber was hatte sie in Italien zu suchen?
»Manetti hielt noch ein paar Jahre durch, bis 1973, als Carlo an einem Herzversagen verstarb. Dann verkauften er und Elsa die Firma für 255 Millionen. Und damit war ihr aktives Erwerbsleben abgeschlossen. Von nun an gab’s für Elsa nur noch die Kunst, und für Roberto – nun, da muss man eben seine Bücher lesen.«
Die Kunst! Die Kunst!
»Komischerweise habe ich von einer Elsa Manetti im Kunstbetrieb noch nie etwas gehört. Hat sie gemalt?«
Thomas lachte auf.
»Sie hat gar nichts gemacht. Sie war nur Mäzenin, Sammlerin, Organisatorin, Galeristin, Konservatorin. Sie hat immerhin Kunstgeschichte studiert. Sie war im Hintergrund tätig, hat gefördert, koordiniert, lobbyiert. Nur bei der Expo, da hat sie sich etwas engagiert und eben dafür gesorgt, dass Pippilotti künstlerische Leiterin wurde. Was ja dann in die Hose ging.«
»Wie alt ist denn Elsa?«
»Jahrgang 1955.«
»Ein Nesthäkchen. Vierzehn Jahre jünger als Roberto.«
In diesem Moment fragte ich mich ernsthaft, warum ich mich überhaupt für diesen reichen Müßiggänger interessieren sollte – Husserl hin oder her. Ich meine: Seine Sorgen konnten kaum meine Sorgen sein. Selbstverständlich ist es leicht, die Welt detachiert und detailliert zu beobachten, wenn man auf einigen Millionen sitzt. Und dazu kamen noch Häuser in Zürich, im Tessin, in Brasilien, Costa Rica, Wohnungen in Paris und New York. Der Mann hatte ausgesorgt. Genug Zeit für jede Art von Onto- und Phänomenologie. Was konnten Leute wie ich für ihn sein? Höchstens interessante Fälle. Ameisen in einem Ameisenhaufen.
»Neidisch?«, entlarvte mich Thomas grinsend.
»Klar. Nichts gegen Neid. Neid ist ein edles Gefühl, immer berechtigt. Nur die Reichen beklagen sich über den Neid der Armen. Die Armen, nicht nur arm, sollen sich auch noch schämen müssen, neidisch zu sein.«
»Du spielst wieder mal Oscar Wilde. Einfach widersprechen und schauen, was dabei herauskommt.«
»Oscar Wilde hat schließlich Recht bekommen.«
Thomas schmunzelte. »Ab 1975 begann er, in seine Notizbücher zu schreiben«, beendete er seinen Bericht, »dann starb er 1999 – wahrscheinlich an Krebs.«
»Was heißt da: wahrscheinlich?«
»Er starb, und Elsa hat sich um alles gekümmert. Es gab keine Trauerfeier, keine Nachrufe – er war ja völlig unbekannt, nichts. Er war erst 58 Jahre alt.«
»Ähnlich jung wie seine Mutter. Und jetzt hat Elsa auch seine Millionen.«
»Sei nicht pietätlos – sie hatte ohnehin schon genug Geld. Sie war sehr traurig. Und hat sich dann in diese Expo-Sache gestürzt.«
»Bei der nichts Gescheites herausgekommen ist.«
»Ja, sie hat uns nicht wirklich glücklich gemacht.«
»Eher deprimiert«, versetzte ich.
»Eine schlechte Lektüre.«
Thomas griff nach meinem linken Arm, um nachzuschauen, wie spät es war.
»Scheiße, Egon wartet auf mich, ich muss los.«
Und weg war er. Irgendetwas schien ihn zu beschäftigen. Sonst hatte er jede Menge Zeit, jetzt hatte er seltsam gehetzt gewirkt. Ich glaubte nicht, dass Egon Ammann der Grund dafür war.
Ich bezahlte.
3.
Ich hätte gleich damit beginnen sollen, Manetti zu lesen. Er stand zu Hause auf dem Büchergestell bereit. Ich hätte mir viel Ärger und Umstände ersparen können. Doch ich war noch nicht ganz so weit. Manetti sollte man angeblich an einem Stück lesen, das würde einige Wochen dauern. Am besten mietete man eine Wohnung in einem Seitental im Tessin und machte nichts anderes, als Manetti zu lesen, unterbrochen von der Zubereitung von Mahlzeiten und etwas Schlaf. (Das Einkaufen erledigte man möglichst für die ganze Leseperiode in einem Gang.) Das sah nach einer Art Überlebensübung à la Thoreau aus. Aber war das die richtige Art, Manetti zu lesen? Und was kam dabei heraus?
Es hatte im Tages-Anzeiger Magazin drei längere Gespräche mit Manetti-Lesern (genau genommen zwei Frauen und einem Mann) gegeben, die berichteten, wie sie Manetti gelesen hatten. Ich hatte die Nummer aufbewahrt – wahrscheinlich haben Sie das auch getan. Sie bildeten für eine gewisse Zeit das Stadtgespräch – bis eben fast alle (außer mir) ihn selbst gelesen hatten.
Zu jener Zeit musste ich aus meinem Umfeld Dinge hören wie: »Gerade du solltest Manetti lesen.« »Es ist typisch, dass du dich sträubst, Manetti zu lesen.« »Alle lesen Manetti – und was machst du? Du schnüffelst bloß herum.« »Hättest du Manetti gelesen, müssten wir diese Diskussion jetzt nicht führen.« »Natürlich hältst du dich wieder einmal für etwas Besonderes.« Ein gewisser Manetti-Druck baute sich um mich herum auf. Ich musste korrigiert werden. Umso widerspenstiger wurde ich natürlich. Ich lasse mich nicht gern manettisieren.
Dabei hatte ich mir durchaus schon einige Manetti-Lese-Szenarien zurechtgelegt. Ich hatte sogar schon meine Fühler nach einem Maiensäss auf der Alp Flix ob Sur ausgestreckt.
Wenn ich Manetti-Leser nach ihrer Leseerfahrung fragte, bekam ich nur ausweichende Antworten des Typs: »Wenn du ihn gelesen hättest, würdest du das nicht fragen.« Noch seltsamer war es, dass ich in jenem Sommer keine Manetti-Leser mehr traf, die ich fragen konnte. Thomas Schneider war zwar noch da, aber sonst herrschte Manetti-Leser-Flaute. Was war los?
So kam ich auf die Idee, eine dieser Manetti-Leserinnen aufzusuchen. Sie war die erste der interviewten Frauen und hieß Margrit Limacher. Sie hatte Manetti vor etwa einem halben Jahr in einem Dorf im hintersten Verzasca-Tal gelesen, mitten im Winter. Sie hatte ein abgelegenes Rustico, das man nur mit dem Kamin heizen konnte, gemietet und sich mit Lebensmitteln für vier Wochen eingedeckt. Von der Endstation des Postautos bis zu diesem Steinhaus war es eine halbe Stunde zu Fuß. Wenn man von der internationalen Logistik-Faustregel für Lebensmittelversorgung von zwei Kilo pro Person und Tag ausgeht, dann musste sie mindestens 60 Kilo Ware den Berg hinaufschleppen. Dazu kamen natürlich ihre persönlichen Effekten sowie Manettis Notizbücher, die auch noch zwei Kilo wiegen. (Um Manetti zu lesen, musste man zuerst Manetti tragen.) Sie berichtete im Magazin, dass sie den Weg drei Mal mit je 20 Kilo Last machte. Holz befand sich zum Glück schon genug beim Haus. Es hatte auch Strom, was wichtig war für Kühlschrank und Kühltruhe, obwohl es so kalt war, dass sie verderbliche Lebensmittel auch einfach draußen hätte lagern können. Aber da gab es natürlich Marder und Füchse. Bären oder Wölfe waren in diesem Tal noch nicht gesichtet worden.
Aber beginnen wir mit dem Anfang.
Margrit Limacher sitzt auf dem Foto im Magazin auf einem hellen Sofa in ihrer Dreizimmer-Altbauwohnung im Kreis 3 (Nähe Idaplatz). Sie ist 43, Physiotherapeutin, zugewandert aus dem Luzernischen. Sie sieht gesund, frisch, athletisch aus. Ihr Haar ist streng zurückgekämmt, dunkelblond, mit einem Stich ins Kupferne, ihre Augen sind grün-blau, der Mund etwas zu groß, die Nase etwas zu breit, das Kinn eher spitzig. Der Teint leicht gerötet. Sie trägt einen beigen Pullover. Ihr Blick wirkt leicht verdutzt, als ob gerade etwas Unerwartetes geschehen wäre. (Vielleicht war die Fotografin eine besonders schwierige Patientin von ihr.)
Das Foto nimmt eine ganze Seite ein. Viele Fragen stellen sich: Was macht eine relativ gut aussehende Frau von 43 allein in einer Dreizimmerwohnung? Hat sie einen Freund, eine Freundin? War sie verheiratet? Hat sie Kinder?
Links vom Bild und auf den folgenden Seiten ist das Gespräch abgedruckt.
Nora Nauer: Frau Limacher, wie sind Sie zu Roberto Manettis Buch gekommen?
L.: Ein Patient hat es erwähnt. Er wurde mit Rückenproblemen in meine Praxis überwiesen und hatte Manetti gelesen. Während ich an seinem Rücken arbeitete, erzählte er von Manettis Notizbüchern. Ich spürte zuerst zunehmende Verhärtungen, dann eine starke Entspannung. Nach fünf Sitzungen war sein Rücken wieder in Ordnung. Nur ich selbst war innerlich gespannt, wegen der Dinge, die er über Manetti gesagt hatte. Manettis Aufzeichnungen setzen im Jahr 1975 ein, da war ich erst 7 Jahre alt. Ich wusste nicht, dass es damals in Zürich Wohngemeinschaften gab, eine intensive Debatte über Gewalt in der Politik, Drogen, Demonstrationen … Mein Vater hatte ein Elektrogeschäft in Emmen. Man redete über nichts. Als ich dann nach Zürich kam, war die Achtziger-Bewegung auch schon wieder vorbei. Erst in den neunziger Jahren holte ich zu Manetti auf. Ich muss ihn damals oft gesehen haben, in der Helvetia-Bar, in illegalen Bars …
N.: Wo haben Sie denn Manettis Notizbücher gekauft?
L.: Bei Buch und Wein, dem Laden von Rosmarie Gwerder, drüben im Kreis 4. Viele haben ihn dort gekauft, oder auch im Paranoia-City-Laden. Irgendwie war es wichtig, die Buchhändlerin schon gekannt zu haben, bevor sie einem den Manetti überreichte.
N.: Warum denken Sie, war es wichtig, die Buchhändlerin zu kennen, bei der man Manetti kaufte?
L.: Haben Sie Manetti gelesen?
N.: Nein, noch nicht.
L.: Dann werden Sie Mühe haben, das zu verstehen.
N.: Wie wurde Ihnen Manetti denn überreicht?
L.: Oh, Rosmarie machte das ganz liebevoll und sorgfältig. Wie es sich gehört. Der Manetti stand ja nie im Schaufenster. Ich wusste von meinem Rückenpatienten, wo ich ihn bekommen konnte. Zuerst tranken wir an einem Tischchen ein Glas Wein, und Rosmarie zündete eine Kerze an. Es war an einem dieser dunklen, feuchten, hoffnungslosen Novembernachmittage, ein Donnerstag. Ich hatte gerade fünf Patienten hinter mir – ich erinnere mich noch an eine ziemlich schwierige Schulterpatientin mit Schmerzen Stufe 7. 10 ist die höchste Stufe – sie gilt bei Geburten. Sie müssen nicht meinen, die Schmerzen meiner Patienten lassen mich kalt. Ich fühle mit, aber ich habe auch gelernt, mich zu distanzieren. Wir plauderten über dies und das. Rosmarie war dabei, ihren Laden aufzugeben. Sie suchte eine neue Herausforderung. Ich suchte keine neue Herausforderung. Ich bin ganz zufrieden damit, Physiotherapeutin zu sein. Die Wirtschaftskrise war damals ein großes Thema, die Buchhändler spürten sie stark, ich aber gar nicht, im Gegenteil. Muskelschmerzen sind ja nicht nur physisch verursacht, das ist auch psychosomatisch. Bei Gefahr und Angst verspannt man sich. Als die Börsenkurse runtergingen, nahmen die Nackenprobleme zu. Man merkte: Jetzt muss etwas Neues kommen. Aber darüber redeten wir nicht. Eher über Frauensachen.
N.: Und dann verkaufte sie Ihnen den Schuber?
L.: Nicht sofort. Sie machte noch einen Kaffee, und wir probierten ihren Grappa. Es war sehr angenehm, richtig gemütlich, keine weiteren Kunden. Wir redeten über die Zukunft: Wie würde es in zehn Jahren sein? Würden wir arm sein, würde es Unruhen geben? Es kursierte ja damals die lustige Geschichte, dass die Reichen vom Zürichberg kleine Eigentumswohnungen im Kreis 4 und 5 kauften, um die Unruhen besser zu überleben. Aber das war sicher nur eine Legende. In Zürich gibt es keine Unruhen – höchstens etwas Unruhe. Manetti erklärt ziemlich genau, warum das so ist. Andererseits ist er schon vor zehn Jahren gestorben …
N.: Aber schließlich bekamen Sie die Notizbücher?
L.: Ja, schon, aber das hatte eine Vorgeschichte. Ich war schon zwei Wochen vorher in Rosmaries Laden gewesen, um den Manetti zu kaufen. Sie hatte noch fünf am Lager, aber alle waren schon bestellt oder versprochen. Sie versicherte mir, dass sie tun würde, was sie konnte. Ein paar Tage später rief sie mich an und teilte mir mit, dass sie noch ein Exemplar habe finden können. Erst dann ging ich in ihren Laden, an jenem Novemberdonnerstag.
N.: Hat die Buchhändlerin etwas gesagt, als sie Ihnen die Notizbücher übergab?
L.: Ja, Rosmarie hatte Manetti schon vorher gelesen. Nicht alle, die Manetti verkaufen, haben ihn ja auch gelesen. Ich vermute, viele, die über ihn reden, haben ihn gar nicht gelesen. Sie hatte ihn im Sommer im Piemont gelesen, in einem Haus einer Freundin. Ihr Grappa kam ja auch aus dem Piemont. Sie nahm meine Hand und sagte: Lies Manetti, aber lies ihn auf deine Art. Ich kann dir nicht sagen, was geschehen wird. Dazu muss man ihn eben selber lesen. Lies ihn nicht zu schnell – nicht mehr als siebzig Seiten pro Tag. Dann sagte sie noch ein paar Dinge, die ich nicht wiederholen will. Sie gab mir Ratschläge, wie man Manetti lesen soll. Sie packte ihn in mattes schwarzes Papier ein und band ihn mit einer silbernen Schlaufe zusammen. Das Paket sah ein bisschen aus wie ein … eine Art Sarg? Ein feierliches Objekt. Ich sollte es erst aufmachen, wenn ich am Ort der Lektüre angekommen sei. Sie überreichte mir das Paket mit beiden Händen und blickte mir in die Augen. ›Das ist dein Manetti‹, sagte sie. Endlich hielt ich den Manetti in meinen Händen. Als ich Manetti hielt, spürte ich, dass etwas Entscheidendes geschehen würde, dass ich an einer tiefgreifenden Wende in meinem Leben angelangt war.
N.: Und dann gingen Sie nach Hause?
L.: Zuerst bezahlte ich noch, 550 Franken, in bar, fünf Hunderternoten und eine Fünfzigernote. Den Manetti bezahlt man ja immer in bar, und immer mit sechs Banknoten. Ich übergab ihr das Geld in einem verschlossenen Kuvert, so wie es sich gehört.
N.: Das heißt, dass die Buchhändlerin das Geld nicht nachzählte?
L.: Das war nicht nötig, wir kannten uns ja. Ich kaufte noch eine Flasche piemontesischen Grappa, den, den wir getrunken hatten. Ich kaufte nebenan im Welschlandladen ein Stück Gruyère, hatte aber kaum Hunger. Das Paket stellte ich auf dieses Tischchen hier, ohne es aufzumachen, selbstverständlich.
N.: Sie öffneten es erst hinten im Verzascatal …
Margrit Limacher hatte ihre Lektüre gut organisiert. Sie hatte berechnet, wie viel Polenta, Reis, Teigwaren sie für einen Monat brauchen würde, wie viel Butter, UHT-Milch, Frühstücksflocken, Wein, Gemüse, Kaffee, Trockenfrüchte, Käse usw. Auch den Grappa nahm sie mit, für alle Fälle. Die Menge, die dabei herauskam, lag unterhalb der internationalen Logistikfaustregel. Margrit Limacher legte auch den normalen Tagesablauf fest. Als fitnessbewusste Frau setzte sie zwei Stunden Bewegung ein: ein schnelles Walking am Morgen, Übungen am späten Nachmittag. Als sie eingeschneit wurde, musste sie sich den Walking-Parcours (zweihundert Meter hinauf und hinab) frei stampfen. Sie verordnete sich eine Stunde Sonne pro Tag (sie schien dort maximal vier Stunden, wenn überhaupt), um dem Vitamin-D-Mangel vorzubeugen. Zur Sicherheit hatte sie einige Röhrchen Multivitamintabletten dabei. Es galt, sich bei Freundinnen und Freunden abzumelden, Patienten umzubuchen und an Kolleginnen zu überweisen, Rechnungen zu bezahlen, Zeitungen abzubestellen, die Post zurückbehalten zu lassen. Nur die Freundin, von der sie das Rustico gemietet hatte, wusste, dass sie dort war. Aber sie gab ihre Nummer auch der Leiterin der Coop-Filiale in Sonogno, die wiederum ihre Freundin gut kannte. Sie würde jeden Tag einmal kurz anrufen, damit niemand sich Sorgen machte.
Margrit Limacher zündete zuerst Feuer im Kamin an, dann verstaute sie Lebensmittel, Kleider, Toilettenartikel. Sie platzierte das schwarze Paket mit dem silbernen Band auf einem Beistelltischchen neben dem Sofa. Von dort aus sah es zu, wie sie sich eine Gemüsesuppe machte, sich ein Glas Rotwein einschenkte, in der Pfanne rührte, aus dem Fenster ins Tal hinausschaute. Sie summte vor sich hin, murmelte: Olivenöl ist immer gut. Es war später Nachmittag, die Sonne beschien noch die Felswände im Osten.
Margrit Limacher verschwand im Schlafzimmer und machte das Bett zurecht – es war eiskalt. Sie trug einen dicken Wollpullover. Sie legte Holz auf die Glut.
Eine Stunde später aß sie ihre Suppe mit einem Stück Brot und einem weiteren Glas Merlot. Sie ging vor die Tür und schaute zum klaren Sternenhimmel empor. Sie atmete die kalte Luft ein, die nach Rauch roch.
Danach setzte sie sich auf das Sofa. Sie packte den Manetti aus, ohne das Papier zu zerreißen, rollte das silberne Band auf, betastete den Schuber, schnüffelte an ihm.
Sie zog den ersten Band heraus, langsam, behutsam, streichelte den schwarzen Kunstlederumschlag. Sie schlug die erste Seite auf. Sie blätterte im Band, roch an den Seiten. Das war nun also der Manetti.
Und dann las Margrit Limacher ihren Manetti. Was darin steht, darüber sprach sie nur in sehr allgemeinen Termini. Tiefgreifende Wende! Endlich jemand, der zuhört! Kein Manetti-Leser würde mehr sagen.
Wenigstens erfuhr man einiges über Margrit Limacher – die meisten Fragen blieben jedoch offen. Ich musste sie also schon persönlich aufsuchen, wenn ich mehr erfahren wollte.
Und das wollte ich, denn es formte sich in mir eine Ahnung, dass von diesem Manetti eine seltsame Attraktion ausging. Ich wollte mich nicht auf etwas einlassen, das außer Kontrolle geraten konnte.
Ich fand Margrit Limachers Adresse und Telefonnummer ohne größere Schwierigkeiten mit Tel-Search. »Margrit Limacher kann Ihren Anruf momentan nicht entgegennehmen. Eine Nachricht können Sie nach dem Pieps-Ton hinterlassen. Pieps.«
Ich hatte nichts anderes erwartet. Nachforschungen müssen schwierig sein, sonst machen sie keinen Spaß.
Ich begab mich an die Adresse der Arztpraxis, wo sie arbeitete. Sie war in der Nähe des Bullingerplatzes. Die Praxishilfe (Lirjete Berisha) gab mir freundlich Auskunft: Frau Limacher war seit Anfang Juli im Urlaub. Sie machte irgendwo eine Weiterbildung. Nein, sie hatte keine Adresse hinterlassen. Ihre Stellvertreterin, Frau Bannwart, eine sehnige Frau mit schwarzem Pferdeschwanz, wusste auch nichts, bemängelte jedoch meine Haltung. Meine Haltung zu bemängeln, scheint das globale Hobby des 3. Jahrtausends zu sein.
Nun hatte ich noch ihre Wohnadresse. Es war nicht weit. Ein Haus, Backstein, etwa 1920 erbaut, mit Hinterhof. Ihr Name stand neben dem Klingelknopf. M. Limacher. (Klar, dass da eine Frau wohnte, Männer schreiben ihre Vornamen aus.) Ich klingelte. Nichts geschah.
Neben dem Hauseingang befand sich ein edles Secondhand-Kleidergeschäft. Kurz entschlossen ging ich hinein und fragte die Inhaberin: »Kennen Sie zufällig Frau Limacher?«
Die Inhaberin, eine ältere Frau mit kurzen grauen Haaren und grüner Brille, antwortete: »Frau Limacher ist abwesend. Es hat keinen Sinn, sie zu suchen.«
Das klang ziemlich definitiv, also ging ich wieder hinaus. Nun hatte ich noch die Journalistin, eine Nora Nauer.
Ich zückte mein Mobilfon und rief den Tages-Anzeiger an.
»Nora Nauer arbeitet nicht mehr bei uns. Sie hat keine Nummer hinterlassen.«
Da Buch und Wein nicht weit entfernt war, begab ich mich dorthin.
Der Laden war geschlossen, denn ein Schild hing hinter der Tür: Vorübergehend geschlossen.
Rosmarie Gwerder hatte sich auf den Weg zu einer neuen Herausforderung begeben.
Margrit Limacher hatte es geschafft, ihre Spuren zu verwischen.
4.
Ich ging nach Hause und las das zweite Gespräch im Magazin nochmals durch: Marcel Lüthi hatte sich auf dem Turbinenplatz, vor dem Puls-5-Gebäude, fotografieren lassen. Er war um die fünfzig, blond, mit Schnauz, breites, etwas teigiges Gesicht, blaues Jackett, weißes T-Shirt, schwarze Hose. Er wirkte nicht sehr fit, aber das kann täuschen. Als Beruf gab er Sachbearbeiter an. Um welche Sachen es sich handelte, erfuhr man nicht. Wahrscheinlich Versicherungen. Wo Marcel Lüthi interviewt worden war, wurde nicht gesagt.
Nora Nauer: Herr Lüthi, wann haben Sie zum ersten Mal von Roberto Manetti gehört?
L.: Das war im Sphères, als ich eine Freundin traf. Ich wohne ja hier in der Nähe. Die Freundin sagte, dass man Manetti im Sphères nicht kaufen könne. Das stimmte aber nicht, denn Bruno konnte ihn irgendwie beschaffen. Damals redeten schon alle von Manetti. Ich dachte, dass mich das nichts anging.
N.: Wieso dachten Sie das?
L.: Ich bin nicht der literarische Typ. Ich interessiere mich eher für Musik und Film. Ich lese wenig. Zudem halte ich nichts davon, in der Vergangenheit herumzugrübeln. Vergangen ist vergangen. Es geht um die Zukunft.
N.: Wie kamen Sie dann aber trotzdem zu Ihrem Manetti?
L.: Eben diese Freundin. Wir saßen vor dem Sphères bei einem Cappuccino, da sagte sie: ›Schau, da ist dieser Riniker, er kommt im Manetti vor.‹ Ich kannte natürlich Paul Riniker von seinen Filmen. Riniker ging Richtung Wiedikon, über die schöne neue Brücke. Aber ich kannte Manetti nicht, ich wusste nicht, warum und wie man in ihm vorkommen konnte. Meine Freundin erklärte es mir. Es war gut möglich, dass ich in ihm auch vorkam, denn ich hatte in den neunziger Jahren im vorderen Kreis 5 gewohnt und kannte viele Leute vom Bad Oberer Letten. Meine Freundin sagte mir, dass der Obere Letten oft im Manetti vorkam, auch die Drogenszene, das Wohlgroth, das Kanzlei, das Kino Xenix, all diese Szeneorte.
N.: Hatte ihre Freundin denn Manetti gelesen?
L.: Ich glaube kaum. Sie sprach immer nur davon, was andere über das Buch sagten. Die, die Manetti wirklich gelesen haben, reden kaum über ihn. Es wird vieles über ihn gesagt, das gar nicht im Buch steht. Zum Beispiel die Sache mit der Opernhausdemo. Manetti war keine der frühen Kulturleichen, er stieß erst später dazu. Er hat nie nackt demonstriert, war nur am Rande dabei.
N.: Haben Sie nackt demonstriert?
L.: Ich habe überhaupt noch nie demonstriert. Demonstrationen sind nutzlos. Der ganze politische Zirkus … Veränderungen geschehen real in der Gesellschaft, im Alltag.
N.: Und da kommt Manetti ins Spiel.
L.: In einem gewissen Sinn. Nur interessierte sich Manetti nicht für gesellschaftliche Veränderungen. Er glaubte nicht daran. Alles dreht sich im Kreis. Seit den alten Griechen. Alles ist schon einmal da gewesen. Wir sind Puppen in einem absurden Drama.
N.: Es hat Sie dann doch interessiert, was es mit diesem Manetti auf sich hatte.
L.: Ja, es war wohl kein Zufall, dass ich laufend auf ihn stieß. Etwas schob mich in seine Richtung. Manetti berichtet davon, wie dumm all diese griechischen Philosophen waren. Während sie ihre raffinierten Theorien entwickelten, übersahen sie, wie die Wälder abgeholzt und die Grundlagen der Zivilisation langsam vernichtet wurden. Je intelligenter man zu sein meint, umso eher sieht man das Wesentliche nicht mehr. Auf Kreta gab es einmal Zwergelefanten – sie wurden ausgerottet. Sie waren kaum so groß wie Kühe. Sie hatten noch nie mit Menschen zu tun gehabt und waren völlig zutraulich. Und diese sanften Elefäntchen haben wir ausgerottet. Wir sind die, die diese Elefäntchen ausgerottet haben, das sagt doch wohl alles aus über uns. Die griechischen Philosophen waren natürlich rein geistig sehr fortgeschritten – aber war es das wert? Griechenland steckt heute jedenfalls tief im Dreck.
N.: Aber mit der Ausrottung des kretischen Zwergelefanten hat das nun nichts zu tun.
L.: Auch das wollige Zwergnashorn auf Sizilien wurde ausgerottet – von edlen Wilden. Es war ein absolut hinreißendes Tier. Was Manetti meint, ist aber etwas anderes: Die endgültige Bewertung von Fortschritten, auch von unseren Fortschritten, steht noch aus. Die Periode von 1975 bis 1999 war die Zeit der Abrechnung, der Rechenschaftslegung, der Evaluation. Was hatten wir am Anfang? Helikopter, die die letzten US-Bürger aus Saigon flogen. Und am Schluss? Fischer und Schröder an der Macht. Und was haben sie daraus gemacht? Nichts. Jetzt ist in Deutschland wieder die CDU an der Macht und verlängert die Betriebsdauer der AKWs. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesagt.
N.: Und all das haben Sie in Manettis Notizbüchern gelesen?
L.: Nein, nichts davon. Aber auf diese Gedanken haben mich Manettis Notizbücher gebracht.
N.: Und wie haben Sie denn Manetti gelesen?
L.: In Hotels, zwischen Zürich und Lissabon. Ich war mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, Busse, Regionalbahnen. Ich fuhr immer am Morgen zwei, drei Stunden, suchte dann ein Hotel und las Manetti. Das dauerte zwei Monate – dann war ich in Lissabon. Weiter geht’s ja nicht.
N.: Sie hatten Manetti im Gepäck.
L.: Genau. Ich hatte nur eine Reisetasche dabei. Unterwäsche, Toilettenartikel – und zwei Kilogramm Manetti. Ich bezog billige Bahnhofshotels in Provinzstädten und las nachmittags im Bett Manetti. Dann ging ich abendessen.
N.: Das heißt, Sie haben Manetti als eine Art Subtext zu einer Pilgerfahrt genommen.
L.: Auf die Idee wäre ich nie gekommen.
Und dann dankte Frau Nauer Herrn Lüthi für seine Ausführungen. Allmählich begann ich zu erahnen, worum es bei Manetti ging. Er war eine Art sokratischer Katalysator. Er hatte selbst keine besonderen Ansichten, regte aber seine Leser an, solche zu entwickeln. Ein idealer Lehrer. Aber irgendetwas musste ja in seinen Notizbüchern stehen, sonst könnte man sie nicht lesen. Nur Katalysieren geht nicht.
Die ausgerotteten Elefäntchen gaben vielleicht einen Hinweis: Manetti hatte Mitleid mit den Schwachen. Er hatte vielleicht keine Meinung, aber Haltungen. Haltungen sind definitiv tiefer als Meinungen, da konnte man Margrit Limachers Andeutungen über Manettis »Tiefen« gut verstehen.
Marcel Lüthi zu finden, war kein Problem. Er stand im Telefonbuch, wohnte immer noch in einer der Eigentumswohnungen im Puls 5 und war bereit, mich abends um halb sechs im Sphères zu treffen. Seine Stimme klang allerdings leicht defensiv.
Im Sphères weiß ich nie, wo ich mich hinsetzen soll. Zum Glück war es trocken und warm, und ich setzte mich davor. Marcel Lüthi entsprach seinem Foto im Magazin.
»Lehmann«, sagte ich.
»Lüthi«, sagte er.
»Sie sind also nicht verschwunden«, begann ich.
»Wieso sollte ich verschwinden?«, fragte er mit brüskem Ton.
»Nun, Margrit Limacher ist verschwunden – und sie hat auch Manetti gelesen.«
»Davon weiß ich nichts.«
Er starrte mich lauernd an, als ob ich etwas wissen könnte, das ich nicht wissen sollte. Er wirkte gehetzt.
»Haben Sie Manetti gelesen?«, fragte er mich.
»Nein.«
»Das sollten Sie aber. Dann würden sie nicht solche Fragen stellen.«
Da war er wieder: der Manetti-Druck.
»Ich würde also nicht fragen, wieso Margrit Limacher verschwunden ist.«
»Nein, das würden Sie dann nicht fragen.«
»Aber Sie sind ja nicht verschwunden.«
Er lächelte angespannt. »Nein, ich bin noch da. Ich habe noch zu tun.«
»Sie haben noch zu tun.«
Marcel Lüthi nahm einen Schluck von seinem Espresso. Er blickte suchend um sich und fragte mich:
»Haben Sie sich schon gefragt, warum es so wichtig ist, in Mitteleuropa zu wohnen?«
»Nein, warum sollte ich?«
»Eben. Wir sind einfach da und nehmen an, dass das in Ordnung ist. Es könnte aber doch sein, dass wir hier zur falschen Zeit am falschen Ort sind.«
»Sie meinen, wir werden anderswo dringend gebraucht …«
»Das nicht. Wir könnten anderswo besser leben. Oder wir sind hier überflüssig. Oder wir sind hier eine Belastung, mit unserem ökologischen Fußabdruck, mit unseren 9000 Watt Energieverbrauch.«
»Ah, Sie meinen rein ökologisch.«
»Das war nur ein Beispiel. Vielleicht sind wir auch politisch am falschen Ort, oder sozial. Vielleicht hätten wir an andern Orten bessere Freunde. Die Welt ist groß, wir könnten überall leben.«
»Doch hier kennen wir uns aus. Wir wissen, wie wir Trambillette lösen können.«
(Das war noch, bevor die neuen Automaten installiert wurden.)
»Schon nach einem Monat in New York, Hongkong oder Bangkok ist uns alles genauso vertraut.«
Herr Lüthi forderte mich also dazu auf, meinen Wohnort zu hinterfragen: War ich in Zürich am richtigen Ort? Sollte ich nicht eher in Saint Louis leben, oder in Sydney, oder vielleicht in Spanien? Oder eben in Sur? Auch in Rom ist einem schnell alles vertraut. In London ist das Herumkommen mit der Oyster Card ein Kinderspiel. Sogar in Nigeria kommt man irgendwie durch. Aber vielleicht ging es um etwas ganz anderes.
»Nun gut, Herr Lüthi. Was genau hat denn Manetti in Ihnen ausgelöst?«
Marcel Lüthi liebte diese Frage nicht. Er schaute einem vorbeiratternden Cobra-Tram nach, und einer blonden Frau auf einem Herrenvelo.
»Ich kenne Sie nicht, Herr …«
»Lehmann.«
»Aber ich will Ihnen einen Hinweis geben. Wir sind daran, diesen Planeten zu ruinieren, ihn in einen durch und durch unangenehmen Ort zu verwandeln. Wir sind auch daran, mit unseren Mitmenschen kalt und grausam umzugehen. Wir haben Zwergelefanten, Dodos und Riesenkängurus ausgerottet. Und den tasmanischen Tiger. Wir haben versucht, uns gegenseitig auszurotten. Sind aber immer noch sieben Milliarden. Wir können zwischen zwanzig Sorten Joghurt wählen, haben aber keine Ahnung, was wir tun sollen. Was soll da Manetti?«
»Ich werde ihn lesen«, sagte ich mit fester Stimme.
»Genau. Und Sie werden nichts erfahren. Aber Sie werden eine zusätzliche Option haben.«
»Welche?«
»Das werden Sie sehen. Wenn Sie es sehen. Nicht alle, die Manetti lesen, sehen sie. Nicht alle können überhaupt lesen.«
Er kam fast außer Atem.
»Das heißt: Manetti lesen heißt lesen lernen.«
»Vielleicht.«
Mehr wollte oder konnte mir Herr Lüthi nicht sagen. Er brach abrupt auf und hastete davon. Etwas stimmte nicht mit ihm. Er war ganz klar unter Druck. Ich hatte ganz vergessen, ihn zu fragen, was für Sachen er denn bearbeitete. Ich fragte mich auch, was eine zusätzliche Option ist. Hat man nicht immer eine zusätzliche Option? Aber der meinte etwas ganz Bestimmtes. Immer diese Geheimnistuerei.