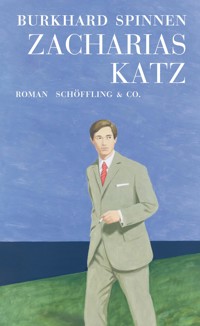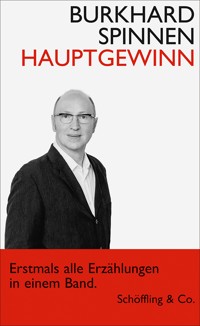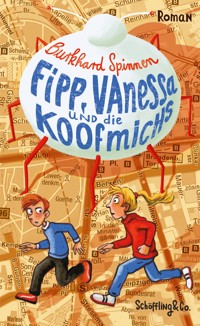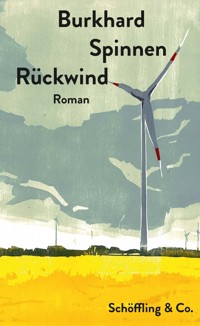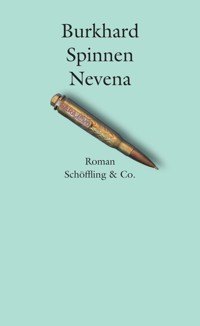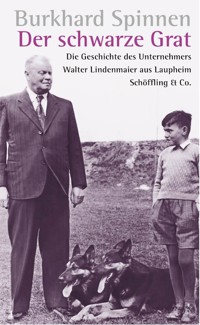7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lange Zeit hat er es nicht bemerkt. Das langsame Versinken seiner Mutter in die Demenz stellt Burkhard Spinnen vor eine Aufgabe, die ihn stets aufs Neue überfordert und sein Leben völlig durcheinander bringt. Unvermittelt verkehren sich alle Verhältnisse, die Mutter-Sohn-Beziehung erfährt eine radikale Veränderung. Dazu belastet die dauernde Konfrontation mit der Krankheit der Mutter den eigenen Lebensentwurf. Die letzte Fassade ist ein ehrliches, ein bewegendes und glänzend geschriebenes Buch über die neue Volkskrankheit Demenz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das ist die E-Book-Ausgabe des im Jahr 2019 im Verlag Schöffling & Co. erschienenen Buchs.Erste Auflage 2019© Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung GmbH,Frankfurt am Main 2019Alle Rechte vorbehalten© Umschlagmotiv: Burkhard SpinnenE-Book-Konvertierung: Fotosatz Amann, MemmingenISBN 978-3-7317-6162-4
www.schoeffling.deMelden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an und bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuerscheinungen bei Schöffling & Co.!
Inhalt
Liebe Mama
Das Warten
Der Absturz
Das Interregnum
Das Heim
Die Familie
Die Polin
Der Umzug
Der Abbruch
Das Jetzt
Schluss
Autorenporträt
Liebe Mama,
ich schreibe ein Buch über dich, besser gesagt, über uns; aber du weißt nichts davon. Ich habe es dir nicht gesagt, und ich hoffe, niemand anders wird das tun. Wärst du noch der Mensch, der du vor fünf Jahren warst, würdest du vielleicht nicht gutheißen, wenn ich aus deinem und meinem Leben berichte. Jetzt aber würdest du es gar nicht mehr verstehen, egal wie und wie oft ich versuchte, es dir zu erklären. Es würde dich vermutlich nur sehr irritieren, und in deinen Grübeleien würde der Umstand immer andere Gestalten annehmen. Keine Erklärung würde helfen, keine Beschwichtigung, so wie eigentlich nie Erklärungen und Beschwichtigungen helfen. Denn in den meisten Fällen vergisst du, manchmal innerhalb von Sekunden, was man dir sagt oder was du selbst gesagt und gedacht hast. Einzig die Irritationen haben Bestand und kehren immer wieder, ebenso die Unruhe und die Angst.
Vor fast vier Jahren habe ich ganz offiziell die Verantwortung für dein Leben übernommen, weil du sie nicht mehr tragen konntest. Ich habe seitdem weitgehend alleine entschieden, wo und wie du lebst, welcher Arzt zu dir kommt, was mit deinem Eigentum geschieht und viele alltägliche Dinge mehr. Ebenso alleine habe ich jetzt entschieden, dass ich ein Buch über unser Leben in den letzten Jahren schreibe. Dass ich es soll und darf.
Das war keine leichte Entscheidung. Denn darf ich das wirklich?
Nun, ich bin Schriftsteller, seit fast dreißig Jahren; und Schriftsteller besitzen das Gewohnheitsrecht, ihr eigenes Leben und die Menschen, die darin vorkommen, als Material für ihre Literatur zu benutzen. Nur zwei Beispiele dafür: Natürlich habe ich an Papa gedacht, als ich in der Titelgeschichte meines ersten Buches »Dicker Mann im Meer« einen korpulenten Schwimmer mit einer Herzattacke kämpfen und diesen Kampf zugleich geheim halten ließ. Und in dem kleinen Band »Lego-Steine« habe ich Episoden aus meiner Kindheit geschildert, vielleicht nicht so, wie sie sich zugetragen haben, doch genau so, wie ich sie in Erinnerung hatte. Auch darin kamen Papa und du bereits vor.
Allerdings ist es das eine, Papas Herzangst in eine literarische Figur hineinzuschreiben oder meine Kindheitserinnerungen zu sammeln; etwas ganz anderes ist es, über die traurigen Umstände und Auswirkungen deiner Demenzerkrankung zu schreiben. Meine literarischen Texte wollten noch vermitteln, was meines Erachtens alle Literatur trägt: nämlich die Überzeugung, dass das Bessere grundsätzlich möglich ist. Literatur mag Katastrophen und Abgründe darstellen; aber sie tut es nur, um zu beweisen, dass die Vorstellung vom Gegenteil, nämlich vom Glück und vom gelingenden Leben, stark und vielleicht sogar mächtig genug ist, um die Dinge zum Guten zu wenden.
Doch wenn ich jetzt über uns und deine Demenzerkrankung schreibe, bleibt mir auch dann die Freiheit zur literarischen Verwandlung? Mag sein, dass ja. Andere haben solche Texte über die Demenz geschrieben. Ich selbst aber bin nicht imstande, mir diese Freiheit zu nehmen. Vielmehr fühle ich mich verpflichtet, möglichst sachlich und unverändert wiederzugeben, was uns zugestoßen ist. Seitdem ich über uns schreibe, ist mir immer, als müsste ich dem Papa, der schon lange nicht mehr bei uns ist, auf diesem Wege berichten, was sich ereignet hat. Und ich weiß, der Papa würde sich einen Text verbitten, der versuchte, so zu gelingen, wie ein literarischer Text das will und womöglich kann. Papa würde auf den Fakten bestehen. Wer weiß, ob er mir auch nur erlaubte, hier und da ein Gefühl unter die Tatsachen zu mischen.
Und selbst wenn ich mir die Freiheit zu einer literarischen Verwandlung unserer gemeinsamen Geschichte nehmen könnte, so gäbe es noch einen Grund, der dagegen spräche. Unsere Geschichte der letzten Jahre ist nämlich wie die meiner Kindheit keine besondere, keine irgendwie herausragende und erst recht keine sensationelle Geschichte. Genau so oder ganz ähnlich wie uns ergeht es heute vielen alten Menschen und ihren Kindern. Ich glaube sogar, dass unsere Demenzgeschichte, verglichen mit manch anderer, zu den eher leisen und unauffälligen gehört. Wir haben es in all dem Elend nämlich gar nicht so schlecht getroffen. Es sind keine schweren Unfälle passiert, du bist finanziell versorgt und wirst mittlerweile sehr gut betreut. Es könnte alles schlimmer sein, sehr viel schlimmer sogar. Nein, es gibt nichts Außergewöhnliches, nichts Einzigartiges zu berichten. Unsere Geschichte taugt nicht zum Stoff für Romane.
Schließlich muss gesagt werden, dass die Demenz längst kein vernachlässigtes oder verschwiegenes Thema mehr ist. Ich habe in den letzten Jahren, zumal seit wir selbst betroffen sind, vieles darüber gelesen, gesehen und gehört. Da gibt es zunächst die wissenschaftlichen Artikel und Sendungen, die Ratgeber und Flyer, die sich mit der Krankheit im Allgemeinen befassen und sachdienliche Informationen für die Betroffenen und ihre Angehörigen bereithalten. Und daneben gibt es die Versuche in Literatur und Film, das Phänomen Demenz an fiktiven Einzelfällen darzustellen und damit fassbar zu machen.
Beides, Information und Fiktion, hat seinen Sinn und seine Berechtigung. Noch immer, und noch auf lange Zeit, bedarf es der Aufklärung in der Sache; zudem ist die Demenz in einer immer älter werdenden Gesellschaft ein relevantes Thema für Schriftsteller oder Drehbuchautoren. Vor fünfzig Jahren prägten und belasteten die Zeitgeschichte und die Jugendkultur das Verhältnis zwischen den Generationen, heute tut das unter anderem die Altersdemenz.
Mich hat allerdings vieles, was ich gelesen und gesehen habe, unzufrieden oder sogar verzweifelt zurückgelassen. Das ist nicht als Vorwurf gemeint! Zumal die Informationen über die Krankheit und den Umgang mit ihr höchst nützlich waren. Aber niemand konnte mir erklären, wie ich mit dem Gefühl des permanenten Scheiterns leben sollte, einem Gefühl, das mich beherrscht, seit ich mich um dich kümmere. Aufklärung ist hilfreich, aber ist sie auch tröstlich?
Die besagten Romane und Filme hatten dagegen fast alle die Absicht, Trost zu spenden. Meistens taten sie das, indem sie eine Art modernes Märchen erzählten, in dem der Demenzkranke als weiser oder skurriler Narr auftritt, den die Menschen in seiner Umgebung allmählich zu verstehen und zu tolerieren lernen. Dabei waren die meisten dieser Filme und Texte allerdings sehr darauf konzentriert, »brillante Komödien« oder »ergreifende Trauerspiele« zu sein; und das machte, dass sie, ohne es zu wollen, unserem täglichen Leben geradezu spotteten. Denn das Leben meiner Mutter und meines sind weder Komödie noch Trauerspiel, sondern eine Mischung aus Katastrophe und Normalität.
Was also, liebe Mama, bleibt mir zu tun, zu schreiben? Ich will, zunächst einmal für mich, durch das Erzählen ein wenig Ordnung in unsere streckenweise ganz chaotische Geschichte bringen. Ich vertraue auf das Erzählen, es ist die gerechteste und weiseste Ordnungsmacht von allen. Und es vermag zu trösten. Ich werde von dir und deiner furchtbaren Krankheit berichten, so gut ich euch beide bislang verstehe, dazu von meiner alltäglichen Überforderung und von unserem immer noch andauernden, unspektakulären Scheitern, aus dem es wohl keinen Ausweg geben wird. Die Märchen, Komödien und Trauerspiele bleiben außen vor.
Ich werde dabei allerdings auch keinen Ratgeber verfassen, in dem steht, was man wann und wie tun soll, wenn Mutter oder Vater dement werden. Ich habe zwar in den letzten Jahren Erfahrungen gemacht, aber ich bin nicht derart klug und souverän geworden, dass ich sie in Lehrstoff verwandeln und so an andere weitergeben könnte. Ich will nur versuchen, möglichst alles beim richtigen Namen zu nennen. Nach meiner Erfahrung wächst immer weiter ins Ungeheure und ins Schwarze, was man klein und schön zu reden versucht. Und gerade die Demenz mit allen ihren Folgen beim richtigen Namen zu nennen, scheint mir äußerst wichtig. Diese Krankheit ist heute, was früher die Pest war, eine Geißel der Menschheit, gegen die es bislang keine Medikamente und Therapien gibt. Jahr für Jahr arbeitet sie sich weiter vorwärts in unsere alternde Gesellschaft, droht sie immer mehr Menschen und ihren Angehörigen. Da kann es einstweilen wenigstens helfen, die richtigen Worte dafür zu finden. Die Wahrheit, so die Dichterin Ingeborg Bachmann, ist dem Menschen zumutbar. Und das Aussprechen der Wahrheit, so meine Überzeugung, wirkt lindernd.
Deshalb, liebe Mama, dieses Buch.
Dein Sohn Burkhard
Das Warten
Wenn mein Vater sich nicht gut fühlte, bekam er große Angst um seine Gesundheit, ging aber nicht gleich zum Arzt. Wenn er dann endlich ging, berichtete er zwar von seinen Symptomen, spielte sie aber herunter. Sein Hausarzt, den er seit Jahrzehnten auch privat kannte, ließ sich auf dieses gefährliche Verdrängungsspiel in der Regel ein; bislang war mein Vater ja nie ernstlich krank gewesen. Seit seiner Militärzeit im Zweiten Weltkrieg hatte er nur eine Woche im Krankenhaus verbracht, für einen Routineeingriff. Meistens lautete der Rat des Arztes, mein Vater solle sich keine Sorgen machen. Man werde eben älter, das sei alles. Damit hatte er auch lange Recht.
Im Alter von dreiundsiebzig Jahren geriet mein Vater an eine Praxisvertretung, die hinter seinen bagatellisierten Symptomen etwas Ernstes vermutete. Wenige Tage später erhielt er die Diagnose eines tödlichen Nierenkarzinoms. Der Arzt, mit dem ich kurz darauf sprach, erläuterte mir die Statistik: Nach einem Befund wie dem meines Vaters belaufe sich die Lebenserwartung des Betroffenen auf sechs Monate bis maximal zweieinhalb Jahre. Der Krebs habe bereits gestreut; die Chance, ihn vollständig zu vernichten, sei praktisch gleich Null.
Mein Vater wurde operiert, eine Niere wurde entfernt. Die folgende Behandlung mit Medikamenten schlug nach Aussage der Ärzte so gut an, wie man überhaupt hoffen durfte. Daher lebte mein Vater noch beinahe die vollen zweieinhalb Jahre – wenngleich mit all den scheußlichen Nebenwirkungen der Medikamente und mit einer Todesangst, die ihn wohl keine Minute mehr verließ. Er erholte sich körperlich, um dann wenige Monate vor seinem Tod rapide zu verfallen. Psychisch blieb er während fast der ganzen Zeit er selbst, wenngleich etwas leiser und langsamer. Einige wenige Male sprach er mit mir über seinen Zustand; auch von der Angst und der Todeserfahrung während seiner Jahre im Krieg war jetzt die Rede. Ich hatte das Gefühl, dass er, der höchst sachliche und zupackende Mann der Wirtschaftswunderjahre, am Ende seines Lebens manchmal in die Gefühlswelt seiner von Politik und Krieg verdorbenen Jugend zurückkehrte. Meistens allerdings behandelte er seine Erkrankung wie einen Betriebsunfall, der ihm vor allem peinlich war und den es, wenn irgend möglich, zu überspielen galt, auch wenn das viel Kraft kostete. Erst kurz vor Schluss ließen ihn die Schmerzmittel verstummen und verdämmern.
An einem heißen Tag mit dem albernen Datum des 9. September 1999 wurde mein Vater begraben. Meine Mutter, sechsundsiebzig Jahre alt, war jetzt Witwe, so wie er es ihr immer prophezeit hatte und so wie ihre Mutter und ihre Großmütter es auch gewesen waren. Doch niemand hätte sie, da sie nun, nach über fünfzig Jahren, ohne ihren Ehemann war, für vereinsamt oder gar gebrochen halten können. Das war auch überhaupt nicht der Fall. Sie hatte viel Erfahrung damit, allein zu sein und Dinge nur für sich zu tun. Wahrscheinlich lag eine Neigung dazu schon in ihrem Charakter begründet. Ich glaube, ich kann das beurteilen; vermutlich habe ich diesen Wesenszug von ihr geerbt.
Nach ihrem Volksschulabschluss hatte meine Mutter, die wie mein Vater aus einfachen, ja ärmlichen Verhältnissen stammt, eine Hilfstätigkeit in der Textilindustrie erlernt, die in einen Beruf als Arbeiterin mündete. Niemand in ihrer Familie und in ihrem Umfeld war willens und imstande gewesen, sie irgendwie zu fördern; dazu fehlte auch schlicht das Geld. Außerdem war ihr als Frau sowieso nichts anderes beschieden, als Hausfrau und Mutter zu werden.
Meine Mutter war ein hübsches Mädchen von sechzehn Jahren, als der Krieg ausbrach. Rasch wurde sie eine attraktive junge Frau. Mit neunzehn hatte sie einen deutlich älteren Freund, der schon im Berufsleben stand. Im Krieg war er Feldwebel. Er hätte meine Mutter geheiratet und versorgt; eine Verlobung soll er nur abgelehnt haben, weil er fürchtete, den Krieg nicht zu überleben. Tatsächlich verliert sich die Spur des Mannes, der nach dem Willen meiner Mutter der Vater ihrer Kinder hätte werden sollen, in den Wirren eines Rückzugs an der Ostfront.
Bei Kriegsende war meine Mutter zweiundzwanzig. Mit Hilfe von Freundinnen, die das Handwerk beherrschten, hatte sie sich das Schneidern beigebracht. Der Zweck war anfangs der, Kleider zu besitzen, die zu teuer waren, als dass man sie hätte kaufen können. Doch in der Ehe mit meinem Vater, den sie kurz nach Kriegsende kennengelernt hatte, wurde ihre Schneiderei allmählich eine Art diskreter Beruf. Meine Mutter gab die höchst ungeliebte Arbeit in der Fabrik auf und nähte stattdessen für Verwandte, Bekannte und Nachbarn, von den einfachsten bis zu den anspruchsvollsten Kleidungsstücken. Der Bedarf war gewaltig.
Ich erinnere mich gut, ja, es ist eine der stärksten Erinnerungen an meine frühe Kindheit um 1960: Wir sind in der kleinen, ofengeheizten Küche unserer Wohnung unter dem Dach. Die Nähmaschine steht rechts von mir in einer Ecke vor dem Fenster, der Küchentisch ist mit einer dicken Decke zum Schneidertisch umfunktioniert. An der Tür hängt ein großer Spiegel, und davor steht eine Frau, die ein Kostüm anprobiert. Meine Mutter steckt gerade noch ein paar Änderungen mit Nadeln ab. Ich beobachte das Ganze, kniend auf der roten Couch hinter dem Tisch. Die Frau vor dem Spiegel hat Tränen in den Augen. Mir ist das peinlich, aber ich weiß, sie weint vor Glück. Meine Mutter hat ihr dieses Kostüm geschneidert, in dem ihre vom neuen Wohlstand ramponierte Figur wieder weibliche Konturen zeigt. Auf der anstehenden Hochzeit, Erstkommunion oder Geburtstagsfeier wird sie sich fühlen wie ein Filmstar. Und das sagt sie auch, mehrmals, mit genau diesen Worten.
Mit solchen Arbeiten verdiente meine Mutter jahrelang das gesamte Haushaltsgeld, später floss der Ertrag in ihre eigene Garderobe. Sich schick anzuziehen war eine ihrer drei großen Leidenschaften. Verständlicherweise blieb ihr Modegeschmack irgendwo in den frühen siebziger Jahren hängen, aber ich behaupte: Mit achtzig war sie geschmackvoller und weiblicher gekleidet als neunzig Prozent ihrer Altersgenossinnen.
Bei ihren Näharbeiten, für die sie später einen eigens ausgebauten Kellerraum besaß, war meine Mutter also alleine gewesen, abgesehen von mir in meinen Kinderjahren und den Besuchen ihrer Kundinnen. Und auch ihre zweite Leidenschaft hatte sie im Wesentlichen alleine praktiziert. Wieder ohne Anleitung, hatte sie sich mit etwa fünfzig das Modellieren in Ton beigebracht. Meistens kopierte sie traditionelle Figuren und Ensembles, vor allem für Weihnachtskrippen. Auch diese Figuren fanden zahlende Abnehmer, so dass meine Mutter ihr Hobby vor meinem Vater und vor sich selbst noch einmal als Nebenerwerb legitimieren konnte. Ihr Meisterstück war eine fast lebensgroße Madonnenfigur, die Platz in einer neu gebauten Kapelle fand. Um das Teil brennen zu können, nutzte meine Mutter den professionellen Brennofen meines ehemaligen Kunstlehrers, der unter uns Schülern als Freak gegolten hatte. Ihn mit meiner Mutter fachsimpeln zu sehen, war ein äußerst merkwürdiges Erlebnis.
Als mein Vater starb, hatte meine Mutter die Schneiderei und das Modellieren zwar weitgehend aufgegeben, nicht aber ihre selbstgenügsame und häusliche Lebensweise. Sie war gesund und fit; und wenn sie durch die Krankheit und den Tod meines Vaters, der es gern gesellig gehabt hatte, den Anschluss an Freunde und Bekannte teilweise verlor, so litt sie nicht sehr darunter. Die Hauptsache war, dass ihr das Wichtigste blieb, ihre dritte und größte Leidenschaft: das Haus.
Wenn sich damals, 1999, jemand Sorgen um ihr zukünftiges Leben machte, dann war das ich. Irgendwann, dachte ich damals, wird sie das viel zu große Haus verlassen müssen, weil sie es nicht mehr alleine versorgen kann. Sollte sie es da nicht lieber bald tun, um sich rasch in den neuen Lebensraum einzugewöhnen und möglichst lange davon zu profitieren? Sie könnte zum Beispiel in die Innenstadt ziehen, in die Nähe der Modeläden, die sie immer so interessiert hatten. Und vielleicht sogar gleich in eine Einrichtung, wo man ihr, wenn das einmal nötig wäre, viele Arbeiten abnehmen könnte. Oder wie wäre es mit einem Umzug in meine Stadt, um ihrem einzigen Kind, ihrer Schwiegertochter und ihren beiden Enkeln näher zu sein? Unsere Söhne waren damals neun und sechs, ein perfektes Alter für rührige Großmütter.
Tatsächlich aber habe ich nicht ein einziges Mal mit meiner Mutter über einen möglichen Umzug gesprochen. Ich habe es nicht gewagt. Schon der Vorschlag wäre nämlich ein Affront, wenn nicht gar ein Sakrileg gewesen. Ihr Haus war nämlich nicht nur ein Haus, ein angenehmer Platz zum Leben. Für meine Mutter war es vielmehr das Symbol ihres sozialen Aufstiegs und der Repräsentant ihres Selbstwertes.
Als Kind hatte sie in einem Haus gelebt, das kaum diesen Namen verdiente, schon der Umzug ihrer Eltern in das notdürftig ausgebaute Dachgeschoss eines ziemlich schäbigen Altbaus war damals eine große Verbesserung. Ich habe diese Wohnung meiner Großeltern noch kennengelernt; die Küche ein lichtloser Verschlag, die Toilette teilte man sich mit anderen Mietern, ein Bad gab es nicht. Nach ihrer Heirat 1949 wohnten meine Eltern zur Untermiete in zwei Zimmern, erst mit meiner Geburt 1956 zogen sie in eine Wohnung mit Küche, Bad und drei Räumen, allerdings wiederum unter einem schrägen Dach. Der Flur besaß keine verschließbare Tür zum Treppenhaus, was bei einer sehr neugierigen und chronisch unterbeschäftigten Vermieterin zu einem dramatischen Verlust an Privatsphäre führte. Selbst ich habe damals diese Wohnung als irgendwie komisch und ungeschützt empfunden, verglichen mit denen meiner Mitschüler in der Nachbarschaft. Meine Eltern müssen sehr darunter gelitten haben. Dass ich keine Geschwister bekam, wurde später mit dieser etwas skurrilen Wohnsituation erklärt.
Und bei solch bescheidenen Verhältnissen hätte es durchaus bleiben können. Mein Vater war mit einundzwanzig Jahren aus dem Krieg zurückgekehrt. Er besaß zwar einen Schlossergesellenbrief; doch einige mittelschwere Verwundungen waren nicht richtig auskuriert und hätten leicht zu einer dauerhaften Invalidität führen können. Tatsächlich galt mein Vater zeit seines Lebens offiziell als kriegsbeschädigt. Noch bis in die sechziger Jahre arbeiteten sich immer wieder Granatsplitter durch seine Haut, und wenn wir morgens nebeneinander an den beiden Waschbecken im Badezimmer standen, musste ich mir Mühe geben, nicht auf seine zerrissenen und deformierten Füße zu sehen. Im Mai 1945 hatte meinem Vater gedroht, einer der kriegsversehrten Soldaten zu werden, die nicht mehr in die Zivilgesellschaft zurückfinden, geschweige dort Karriere machen.
Aber das Glück, das ihn lebend aus dem Krieg geführt hatte, blieb meinem Vater fünfzig Jahre lang treu. Mehr noch, der Krieg selbst entschädigte ihn für die Jugend, die er ihm genommen hatte. In einer normalen Gesellschaft hätte mein Vater es mit seiner Schlosserausbildung bestenfalls zum Werkmeister bringen können; das heißt, er hätte sein Leben für einen mittleren Stundenlohn zwischen Maschinen zugebracht. Aber die Nachkriegsgesellschaft war nicht normal. Es fehlte ihr die mittlere Generation gut ausgebildeter Männer in Führungspositionen. Die waren auf den Schlachtfeldern gestorben, was dazu führte, dass man wie kaum jemals zuvor aus bescheidenen Anfängen heraus eine geradezu sagenhafte Karriere machen konnte. Mein Vater, dessen Schlosserlehre seinen Fähigkeiten überhaupt nicht entsprochen hatte, absolvierte noch pro forma einen Meisterkurs, doch nur, damit seine Beförderungen in der Firma nicht allzu normbrechend erschienen. Schon Mitte der fünfziger Jahre ging er im Anzug mit weißem Hemd und Krawatte in ein Büro; er war Angestellter geworden und leitete schließlich in einer Maschinenfabrik mit viertausend Mitarbeitern eine zentrale Abteilung.
Ich habe dort ein paar Mal in den Schulferien gejobbt. Kinder sollten das tun, weil sie ihre Eltern sonst niemals wirklich kennenlernen. Mein Vater war ständig unterwegs oder er telefonierte. Er wurde dauernd etwas gefragt, und offenbar wusste er über alles Bescheid. Da seine Abteilung unter anderem für die Fertigungsplanung zuständig war, übersah er praktisch die ganze Firma. In einer militärischen Einheit wäre er der Kompaniefeldwebel gewesen, auf einem Schiff der Steuermann. Irgendwann hörte ich ihn sagen, seine Magenbeschwerden seien eine Managerkrankheit. Das Wort Manager war damals ganz neu im Sprachgebrauch, es galt als besonderer Ehrentitel, für den man Magenprobleme in Kauf nahm. Als er mit dreiundsechzig, erschöpft von vierzig Jahren Berufsleben, in Pension ging, teilte man seine Stelle und vergab die beiden Posten an Akademiker.
Natürlich hatte sich diese Karriere im Gehalt meines Vaters niedergeschlagen. Deshalb wagte er, obwohl in privaten Angelegenheiten eher übervorsichtig, Mitte der sechziger Jahre das Projekt des Hausbaus. Die treibende Kraft dabei war allerdings meine Mutter. Ich sehe sie heute noch, wie sie die Einrichtung plante, indem sie kleine Papptäfelchen, die Grundrisse unserer Möbel, auf dem Bauplan des Hauses arrangierte. Fast täglich und bei jedem Wetter besuchten wir die Baustelle, und sie war es, die dort immer noch etwas auszumessen oder zu erwägen hatte.
Nach einem äußerst aufregenden Jahr der Bauzeit zogen wir ein. Ich selbst wurde mit dem neuen Haus nie so recht warm, es war in unsere kleine Familie gekommen wie ein Nachzüglerkind, ein Nesthäkchen, das plötzlich alle Aufmerksamkeit forderte. Natürlich freute ich mich über den zusätzlichen Platz für mich und meine Basteleien. Um das Haus als Ausdruck unseres sozialen Aufstiegs richtig begreifen oder gar feiern zu können, war ich freilich viel zu jung. Es ist bezeichnend, dass ich mir einen Platz zum Lesen ausgerechnet in einer Abseite auf dem Speicher einrichtete. Der Zugang war derart eng, dass nur jemand hineinkommen konnte, der so klein und schmal war wie ich.
Meinem Vater war ein gewisser Stolz auf sein Eigentum anzumerken, doch vor allem war er froh, die Anstrengung von Planung und Umzug hinter sich zu haben. Wenn er vor anderen das Haus lobte, dann eher indirekt, indem er erzählte, dass er jetzt unserer neugierigen Vermieterin entkommen war und sich endlich ungeniert benehmen konnte.
Meine Mutter hingegen verschmolz von Anfang an mit dem neuen Haus. Sie nahm nahezu jeden Quadratzentimeter unter ihre Observanz, sie besiedelte und kultivierte nach und nach die Kellerräume, die Terrasse und den Garten; stets arbeitete sie an einer diskreten Liste mit anstehenden Umbauten oder Renovierungen, die sie nach und nach durchsetzte, oft gegen den Willen meines Vaters. Das Haus, das sie aus eigenem Antrieb eigentlich nur für Einkäufe verließ, wurde ihr zweites, dingliches Selbst, gleichzeitig Schutzraum und Dekor.
Wie hätte ich also meiner Mutter nach dem Tod meines Vaters vorschlagen können, dieses Haus für etwas »Praktischeres« zu verlassen? Genauso gut hätte ich einem Priester vorschlagen können, zur Messe etwas »Praktischeres« als den Talar anzulegen. Meine Bekannten, mit denen ich damals gelegentlich über meine Befürchtungen sprach, bestätigten mich dann auch darin, dass es am besten sei, gar nichts zu unternehmen. Jedes Jahr in der gewohnten Umgebung, sagten sie alle, sei für die alten Leute ein gutes Jahr, jeder Monat, jede Woche, jeder Tag. Ich stimmte gerne zu. Wer schätzt nicht Ratschläge, deren Quintessenz es ist, dass man gar nichts tun muss.
So wurde meine Mutter achtzig, sie wurde fünfundachtzig, und irgendwann war unbemerkt der Zeitpunkt überschritten, bis zu dem man überhaupt noch sinnvoll über etwas »Praktischeres« hätte nachdenken können. Jetzt würde nur noch eine schwere Erkrankung meine Mutter aus ihrem Haus und um ihr Haus bringen. Doch das hieß zugleich: Nun war erst recht zu hoffen, dass ihr ein Auszug möglichst lange erspart bleiben würde, denn die nächste Station wäre ein Alters- oder Pflegeheim.