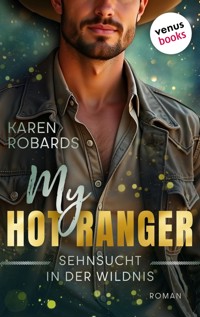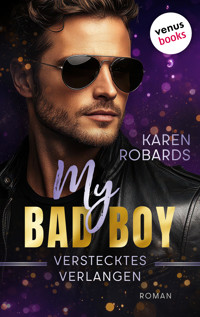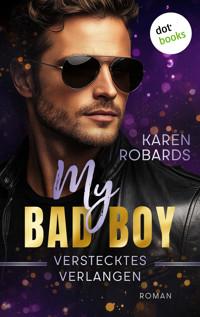Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Lady in Not – ein Schurke, der sich verhält wie ein Gentleman … Sie findet einen unerwarteten Beschützer … Als ihre Kutsche von Räubern überfallen wird, muss die junge Lady Isabella zum ersten Mal in ihrem Leben Todesangst leiden: Denn die groben Männer haben es keinesfalls nur auf ihre Juwelen abgesehen … Doch noch bevor Schlimmeres geschehen kann, wird sie gerettet – ausgerechnet durch den geheimnisvollen Alec, der selbst eine zwielichtige Vergangenheit zu verbergen scheint. Je näher Isabella ihn jedoch kennenlernt, desto mehr spürt sie, dass sie ihm vertrauen kann – und dass ihr Herz in seiner Gegenwart immer schneller schlägt. Ein Gefühl, dem sie auf keinen Fall nachgeben darf, denn zuhause wartet ihr Ehemann auf sie … »Karen Robards verwebt Spannung und Romantik geschickt wie keine andere!« Albany Times Union Ein historisches Romantik-Highlight für die Fans von Kristin McIver!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie findet einen unerwarteten Beschützer … Als ihre Kutsche von Räubern überfallen wird, muss die junge Lady Isabella zum ersten Mal in ihrem Leben Todesangst leiden: Denn die groben Männer haben es keinesfalls nur auf ihre Juwelen abgesehen … Doch noch bevor Schlimmeres geschehen kann, wird sie gerettet – ausgerechnet durch den geheimnisvollen Alec, der selbst eine zwielichtige Vergangenheit zu verbergen scheint. Je näher Isabella ihn jedoch kennenlernt, desto mehr spürt sie, dass sie ihm vertrauen kann – und dass ihr Herz in seiner Gegenwart immer schneller schlägt. Ein Gefühl, dem sie auf keinen Fall nachgeben darf, denn zuhause wartet ihr Ehemann auf sie …
Über die Autorin:
Karen Robards ist die New York Times-, USA Today- und Publishers Weekly-Bestsellerautorin von mehr als fünfzig Büchern. Sie veröffentlichte ihren ersten Roman im Alter von 24 Jahren und wurde im Laufe ihrer Karriere mit zahlreichen Preisen bedacht, unter anderem mit sechs Silver Pens. Sie brilliert in der Spannung ebenso sehr wie im Genre Liebesroman.
Die Website der Autorin: karenrobards.com/
Die Autorin bei Facebook: facebook.com/AuthorKarenRobards/
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin die Thriller »Keiner wird dir helfen«, »Und niemand hört dein Rufen«, die historischen Liebesromane »Die Rose von Irland«, »Die Liebe der englischen Rose«, »Die Gefangene des Piraten« und »Die Geliebte des Piraten« sowie die Exotikromane »Im Land der Zimtbäume« und »Unter der heißen Sonne Afrikas«.
***
eBook-Neuausgabe März 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1989 unter dem Originaltitel »Tiger's Eye« bei Avon Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1991 unter dem Titel »Die Augen der Katze« bei Heyne
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1988 by Karen Robards
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1990 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Motives von ana / Adobe Stock sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-652-5
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Karen Robards
Die Liebe der englischen Rose
Roman
Aus dem Amerikanischen von Eva Malsch
dotbooks.
Kapitel 1
Donner krachte, ein langer gezackter Blitz zerriß den Himmel, und sein grelles weißes Licht beleuchtete nur für wenige Sekunden die Straße. Doch diese Zeitspanne genügte, um fünf unheimliche Reiter zu enthüllen, die aus dem Eichenwäldchen an der Biegung auftauchten und der Kutsche entgegengaloppierten.
»Halt! Geld oder Leben!«
Der beängstigende Ruf aus der stürmischen Nacht setzte diesem Tag, der für alle vier Reisenden eine Qual gewesen war, die Krone auf. Ein Musketenschuß verlieh dem Befehl Nachdruck. Der mit einem Wappen geschmückte Wagen schwankte heftig, als der überrumpelte Will Coachman, der auf dem Kutschbock gedöst hatte, hochschreckte und die Zügel instinktiv fester umfaßte. Die Räder rutschten durch den Schlamm, und neben dem Fahrer fiel Jonas, der junge Stallknecht, beinahe von der Bank. Hastig hielt er sich fest und tastete nach der uralten Schrotflinte, die Will vor der Abreise in letzter Minute unter den Sitz geschoben hatte. Ehe seine Hand das kalte Metall berührte, knallte eine andere Muskete, und die Kugel sauste haarscharf am Kopf des Knechts vorbei. Fluchend duckte er sich und gab seine heldenhaften Bemühungen auf.
Will überlegte kurz, ob er die Peitsche schwingen und einen Fluchtversuch wagen sollte. Aber die Pferde waren seit dem Aufbruch in Thetford schon ziemlich lange unterwegs und genauso müde wie er selbst.
Der Graf hatte angeordnet, die Fahrt dürfe nur diesen einen Tag dauern, da er nicht beabsichtige, die unnötige Übernachtung auf einem Gasthof zu bezahlen. Noch an diesem Februarabend sollte Mylady in London ankommen. Will, das übrige Personal und auch die Lady hatten ihr Bestes getan, um die Wünsche des Grafens zu erfüllen, obwohl nur zwei Tage für die Reisevorbereitungen geblieben waren. Und wohin hatte dieser lobenswerte Gehorsam geführt? Zu einem Überfall auf einer dunklen, verlassenen Straße, wo nun fast ein halbes Dutzend Räuber Musketen schwenkten. Hatte es jemals einen schwärzeren Tag gegeben?
Zuerst hatte eines der Pferde gelahmt und durch ein Tier von der Poststation ersetzt werden müssen – eine zusätzliche Ausgabe, die dem geizigen Grafen sicher mißfallen würde. Dann war die Postroute vom eisigen Regen in einen Morast verwandelt worden und die Kutsche in den Straßengraben gerutscht. Es hatte der kräftigen Rückenmuskeln eines hilfsbereiten Farmers und seines Sohnes, sowie Jonas’ und Wills bedurft, den Wagen auf die Straße zurückzubefördern. Durch diese Mißgeschicke war es zu einer erheblichen Verspätung gekommen. Und jetzt, um zehn Uhr abends, wurden sie erneut aufgehalten.
Diese Betrachtungsweise wurde der Situation – einem Angriff von fünf bewaffneten Banditen – vielleicht nicht ganz gerecht. Aber Will sah die Lage nun einmal so, zumindest in diesen ersten Sekunden seiner Verblüffung. Immerhin war ein solcher Überfall im Jahr 1814, wo Napoleon Bonaparte auf dem ganzen Kontinent Amok lief und England fast aller anständigen Männer beraubt wurde, nicht ungewöhnlich. Wenn wir diesen Dieben geben, was sie verlangen, dachte der alte Mann hoffnungsvoll, werden wir keinen größeren Schaden erleiden als den Verlust von Myladys Juwelen. Zum Glück würde sie ihm – Gott segne sie – keineswegs verübeln, daß er das Unmögliche nicht hatte verhindern können.
Schwarzgekleidete Gestalten umzingelten die Kutsche und erlösten ihn von seinem Dilemma. Das Einzige, was er mit einem Fluchtversuch erreichen würde, wäre sein und Jonas’ Tod. Und so brachte er den langsam dahinrollenden Wagen endgültig zum Stehen. Zwei Schurken packten die Zügel, und die Pferde, an eine so unsanfte Behandlung nicht gewöhnt, bäumten sich auf und wieherten schrill.
In der Kutsche richtete sich Lady Isabella Georgiana Albans St. Just kerzengerade auf dem Samtsitz auf, als die Räder zum Stillstand kamen. Wie Will hatte sie fast geschlafen und den Kopf an die Rückenlehne gelegt. Dadurch hatte sich ihr feines braunes Haar aus den Spangen und Nadeln gelöst. Es dauerte eine Weile, bis ihr bewußt wurde, daß die gedämpften Geräusche, die sie aufgeschreckt hatten, von draußen kamen und nicht zu einem Alptraum gehörten.
Wenn ihre helle Haut noch etwas bleicher wurde, so war das im schwachen Licht der Kutschenlampe nicht zu erkennen. Ihre zierliche Gestalt im unmodischen, schlichten blauen Wollkleid verharrte reglos, während sie lauschte. Nur die langen, schmalen Finger umschlossen die Handtasche auf ihrem Schoß etwas fester. Diese krampfhafte Bewegung wurde allerdings von dem Plaid verborgen, das über ihren Beinen lag. Ihre Zungenspitze befeuchtete Lippen, die etwas zu breit waren, um als schön zu gelten. Während sie tief Atem holte, bebten die zarten mit Sommersprossen bedeckten Nasenflügel.
Dann beruhigte sich ihr Atem. Sie reckte das Kinn etwas vor, straffte die schmalen Schultern und wartete gefaßt die Entwicklung der Dinge ab.
»Mylady, was ...?« Ihr gegenüber saß Jessup, die magere, blasse Zofe, die der Gefahr viel ängstlicher entgegenblickte. Der erste Musketenschuß hatte sie aus tiefem Schlaf gerissen. Als der Wagen hielt, schaute sie bestürzt um sich und schlang die dünnen Finger so fest ineinander, daß die Knöchel weiß hervortraten. Sobald sie merkte, was draußen in der Dunkelheit geschah, schnappte sie entsetzt nach Luft.
»Beruhige dich, Jessup«, bat Isabella. »Du hilfst uns nicht, wenn du in Panik gerätst.«
»Mylady, wir werden überfallen! Sicher wollen uns die Schufte vergewaltigen und ermorden! Oh, warum muß das ausgerechnet uns zustoßen!« So leicht ließ sich Jessup nicht beschwichtigen. Stattdessen versuchte sie ihre Herrin vom Ausmaß der drohenden Gefahr zu überzeugen.
Unmutig runzelte Isabella die Stirn. Eine so heftige Angst konnte ansteckend wirken, und sie wollte nicht die Beherrschung verlieren. Wie sie bereits festgestellt hatte, überstand ein mutiges Herz fast alle Gefahren. »Sei nicht so dumm! Sie haben keinen Grund, uns etwas anzutun. Wenn wir ihnen geben, was sie verlangen, werden sie sofort verschwinden. Ich habe etwas Geld in meiner Handtasche, und du mußt ihnen meinen Schmuck aushändigen, falls sie danach fragen. Sobald sie ihr Ziel erreicht haben, müssen wir sicher nichts mehr befürchten.«
Isabella war keinesfalls so unbesorgt, wie sie tat. Doch sie hatte die zahlreichen Wechselfälle ihres dreiundzwanzigjährigen Lebens tapfer gemeistert und sah keine Notwendigkeit, wegen eines kurzen, wenn auch unangenehmen Zwischenfalls den Kopf zu verlieren. Ganz bestimmt konnte die Situation bereinigt werden, und eine Stunde später würde sie in London eintreffen.
»Es ist einfach unnatürlich, daß Sie immer so ruhig bleiben, Mylady.« Jessups Stimme klang fast anklagend. Ihre eigene Aufregung war offensichtlich, da sie nicht mehr stillzusitzen vermochte.
Obwohl Isabella ihre Aufmerksamkeit mehr auf die Ereignisse außerhalb des Wagens als auf die nervöse Zofe richtete, gestand sie sich ein, daß Jessup nicht unrecht hatte. Angeblich besaßen die meisten vornehmen Damen empfindliche Gemüter, und viele empfindsame Damen würden vermutlich in Ohnmacht fallen, wenn neben ihren Kutschen Schreie gellten und Schüsse krachten. Aber sie war nie besonders emotional gewesen und ließ sich lieber von ihrem gesunden Menschenverstand leiten. »Meine vernünftige Isabella«, hatte ihr Vater sie einmal dem Mann gegenüber beschrieben, der damals – ohne ihr Wissen – bestimmt hatte, sie zu seiner Frau zu machen. Wenn sie jetzt zurückdachte, erschien ihr diese Einschätzung durchaus zutreffend. Zu jener Zeit war ihr das allerdings nicht bewußt geworden. Jedenfalls hatte sie es niemals sinnvoll gefunden, irgendwelchen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Weder Tränen, noch gelegentliche Bitten hatten ihr erspart, Bernard heiraten zu müssen, und sie ebensowenig vor dem Ehebett gerettet. Nach der demütigenden Katastrophe in der Hochzeitsnacht hatte sie sich gelobt, keine einzige Träne mehr zu vergießen, und seither hatte sie tatsächlich nicht mehr geweint.
»Mylady ...«
Der Wagenschlag wurde aufgerissen. Ein Mann stand davor, eine Hand auf dem Türgriff, in der anderen eine Pistole. Sogar Isabellas Atem stockte. Kreischend drückte sich Jessup in die Ecke der Sitzbank. Außer dem Angreifer war in der Dunkelheit nichts zu sehen. Groß und drohend stand er im zittrigen Lichtkreis der Kutschenlampe, maskiert, eine Kapuze über dem Kopf, so daß Isabella kaum etwas sah, das ihr später helfen könnte, ihn zu identifizieren. Sie registrierte nur, daß er kräftig gebaut sein mußte, und durch die Augenschlitze der Maske funkelten harte, braune Augen.
»Lady Isabella?« Er schaute sie an, die kalte Stimme paßte zu seinem Blick. Plötzlich wurde auch sie von Furcht befallen. Wieso kannte er ihren Namen?
»Das ist alles, was ich habe.« Sie hatte Mühe zu sprechen. Dann hielt sie ihm ihre Tasche hin. »Nehmen Sie es, und gehen Sie!«
»So leicht werden Sie mich nicht los, Mylady.«
Sein Akzent war ihr fremd, ließ sich nicht mit der wohlmodulierten Sprechweise der Aristokratie vergleichen, auch nicht mit dem sanften Norfolk-Dialekt, an den sie sich seit ihrer Hochzeit gewöhnt hatte. Doch sie fand keine Zeit, um über seine Herkunft nachzudenken. Er riß ihr den Beutel aus der Hand und stopfte ihn in eine Tasche, die sich zwischen den Falten seines weiten Umhangs verbarg. Dann starrte er sie wieder an. Obwohl sie nur seine Augen sah, glaubte sie, daß er grinste. Ein bösartiges Grinsen ... Mehrere Sekunden lang musterten sie einander. Ihr Herz schlug immer schneller, ihr Magen krampfte sich zusammen. »Jessup, gib ihm die Schmuckschatulle!« Wenn ihre Stimme scharf klang, dann nur deshalb, weil sie keine andere Möglichkeit hatte, ihre Angst zu verbergen.
»Hier!« flüsterte Jessup und reichte ihm das Kästchen, das er abschätzend in der linken Hand wog.
»Das sind sehr kostbare Juwelen«, erklärte Isabella.
»Aye.« Der Mann nickte, er war offenbar vom Gewicht des Geschmeides beeindruckt. Er warf das Kästchen einem Spießgesellen zu und wandte sich dann wieder Isabella zu. Sie mußte ihre ganze Selbstbeherrschung aufbieten, um unter seinem Blick nicht zusammenzusinken.
»Jetzt haben Sie alles, also können Sie gehen.« Ihre Aufforderung klang erstaunlich gelassen.
»Nein.« Zu ihrem Entsetzen umschloß seine große, grobe Hand ihren Arm, und seine Finger gruben sich schmerzhaft in das weiche Fleisch unterhalb des Ärmels. In diesem Moment wußte sie, daß die alptraumhafte Begegnung keineswegs das erwartete rasche Ende finden würde.
»Lassen Sie mich los!« rief sie, nun von ernsthafter Angst erfaßt, und schlug mit ihrer freien Hand auf seinen Arm. Genausogut hätte sie mit ihrer Faust gegen einen Eichenstamm hämmern können.
Schreiend wich Jessup wieder in ihre Ecke zurück, während ihre Herrin aus dem Wagen gezerrt wurde. Nur die Finger, die Isabellas Arm umklammerten, verhinderten ihren Sturz in den Schlamm. Ihre Schuhe versanken tief darin, ihr Rocksaum schleifte durch schleimigen Morast. Die beißenden Nadeln des Eisregens trommelten auf ihren ungeschützten Kopf herab. Nach wenigen Sekunden war sie naß bis auf die Haut. Eine ebenso kalte Furcht nahm ihr Herz gefangen.
Als sie ihr Gleichgewicht wiedererlangte, machte sie die Umrisse von drei oder vier schemenhaften Gestalten und Pferden aus, die um den Wagen herumtänzelten. In einiger Entfernung entdeckte sie Will Coachman und Jonas, die im hohen Gras am Straßenrand lagen, zusammengeschnürt wie Weihnachtsgänse. Da sie unbedeckt dem Regen ausgesetzt waren, würden sie sich in absehbarer Zeit eine Lungenentzündung oder eine noch schlimmere Krankheit zuziehen.
Aber im Augenblick drohte Isabella und ihrer Dienerschaft eine viel unmittelbarere Gefahr. Keine Räuberbande, die eine zufällig des Weges kommende Kutsche überfiel, würde den Namen ihres Opfers kennen oder sich die Mühe nehmen, die Dienstboten zu fesseln. Isabella wurde übel, als sie den unausweichlichen Schluß zog, daß ihr Wagen mit Absicht ausgesucht worden war. Diese Männer verfolgten einen ganz bestimmten Zweck ...
»Was wollen Sie von mir?« Ihre Stimme klang plötzlich heiser. Nicht nur die Kälte ließ sie frösteln. Sie strich sich triefnasse Haarsträhnen aus dem Gesicht und wandte sich mit der ganzen Würde, die sie trotz ihrer aufkeimenden Panik wahren konnte, zu dem großen maskierten Mann. Instinktiv zwang sie sich zur Ruhe. Einen klaren Kopf zu behalten, war jetzt ihre einzige Chance.
Er lachte auf unangenehme Weise und versetzte ihrer Schulter einen heftigen Stoß, so daß sie taumelte und beinahe hinfiel. Gleich darauf packte er ihr Handgelenk und riß sie wieder hoch. Sie schrie auf, als er auch das andere Handgelenk ergriff und beide mit einem Lederriemen zusammenband. Im nächsten Moment wurden ihre Augen mit einem übelriechenden Fetzen verbunden. Nacktes Entsetzen verursachte einen bitteren Geschmack in ihrem Mund. Was immer diese Männer planten, es handelte sich nicht um einen schlichten Raubüberfall.
Da ihr die Sicht genommen war, hörte sie die Geräusche in ihrer Nähe um so deutlicher. Mit dem rauschenden Regen und dem heulenden Sturm drang ein rhythmisches schlammiges Plätschern an ihr Ohr, das die Ankunft von mindestens zwei Pferden verkündete.
»Was wollen Sie von mir?« wiederholte sie, fast am Ende ihrer Kraft. Ein Grunzen war die einzige Antwort.
Ohne Vorwarnung wurde sie herumgewirbelt, ein zusammengeknüllter Lappen, zwischen ihre Zähne geschoben, erstickte ihren Schrei. Ein starkes Schwindelgefühl erfaßte sie, als man sie hochhob. Mit dem Kopf nach unten, hing sie über der Schulter eines Mannes. Ihr Instinkt riet ihr, sich nicht zu rühren, während er sie davontrug. Hinter sich hörte sie Jessup kreischen, die offenbar aus der Kutsche gezogen und sofort zum Schweigen gebracht wurde. Offenbar hatte man ihr einen Faustschlag verpaßt. Dieses Schicksal oder ein noch schlimmeres würde auch Isabella erleiden, wenn sie den Banditen Ärger machte – das fühlte sie. Sinnloser Widerstand würde ihre Lage nur verschlechtern. Es war besser, ruhig zu bleiben und eine Gelegenheit zur Flucht abzuwarten.
Ohne auf ihre zierlichen Knochen oder die zarte Haut Rücksicht zu nehmen, warf man sie bäuchlings über einen Sattel. Das Leder knarrte, als ein Mann hinter ihr aufstieg. Ihr Gesicht lag auf dem nassen Fell des Pferdes. Dann spürte sie, wie sich die Muskeln des Tieres anspannten, die Hufe setzten sich in Bewegung. Der Mann hielt Isabella mit einer Hand fest. Ihr Kopf baumelte nach unten, und während sich wachsende Übelkeit in ihrem Magen ausbreitete, mußte sie sich die Wahrheit eingestehen. Sie wurde entführt, zu welchem Zweck auch immer.
Kapitel 2
Nach einem qualvollen Ritt über unebenes Gelände zügelten die Reiter – Isabella hörte, daß es mehrere waren – endlich die Pferde. Der Mann hinter ihr stieg ab. Es hatte zu regnen aufgehört, aber es wurde immer kälter.
Wie ein Kartoffelsack wurde Isabella vom Sattel heruntergehoben und wieder über eine männliche Schulter gehievt. Der Bandit trug sie wortlos in eine Behausung, wo es wärmer war. Mehrere Gerüche stürmten gleichzeitig auf sie ein. Es roch nach Gewürzen, nach Torffeuer, Staub, Talg und Moder.
»Ihr habt sie also?« Es war eine Frauenstimme, leise und heiser.
»Wie du siehst.«
»Sehr gut. Was für ein zerbrechliches kleines Ding! Nicht so vornehm gekleidet, wie ich dachte. Immerhin ist sie eine Gräfin. Ist das auch ganz sicher die Richtige?«
»Klar, sie ist die Gräfin.«
»Bringen wir sie nach oben. Ich habe das Zimmer hergerichtet.«
Isabella wurde eine schmale, steile Treppenflucht hinaufgetragen, deren Ausmaße ihr schmerzlich zu Bewußtsein kamen, weil ihr Kopf mehrmals gegen die Wand schlug. Im Oberstock erreichte der Mann nach wenigen Schritten eine Tür, öffnete sie und ging hindurch. Als er seine Gefangene abrupt losließ, landete sie unsanft auf einer stachligen, mit Stroh ausgestopften Matratze. Sie stieß einen Schreckensschrei aus, den der Knebel dämpfte.
»Niemand kann sie hören, wenn sie um Hilfe ruft«, meinte die Frau. »Also ist es nicht nötig, daß das arme Ding halb erstickt.«
Der Fetzen wurde aus Isabellas Mund gezogen. Ihre Zunge fühlte sich trocken und geschwollen an, ihre Kiefer schmerzten. Sie preßte die Lippen zusammen – und schluckte krampfhaft. Dann wurde sie auf den Rücken gedreht, jemand löste ihre Fesseln.
»Sie ist klatschnaß«, sagte die Frau. »Sicher ist sie froh, wenn ich sie ausziehe.«
»Es macht doch keinen Unterschied, ob sie naß ist oder nicht.«
»Möchtest du sie vielleicht pflegen, wenn sie krank wird?«
»Mach, was du willst«, erwiderte der Mann gleichmütig.
»Außerdem würde mir das Kleid gefallen.« Die Frau berührte Isabellas Rock. »Das ist ein sehr guter Stoff.«
Er schnaufte höhnisch. »Aye, und wenn du dich selber halbierst, kommst du vielleicht sogar rein.«
Empört schrie die Frau auf, Isabella hörte eine schallende Ohrfeige und die Geräusche eines eher spielerischen Gebalges. Ihre Hände waren jetzt frei. Vorsichtig drehte sie sich um. Sie hoffte, die beiden wären zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um auf sie zu achten. Doch als sie nach der Augenbinde griff, schlug der Mann ihre Finger beiseite. »Versuchen Sie das bloß nicht noch mal! Sonst prügle ich Sie nach London. Verstanden?«
»Ja«, flüsterte sie.
Einer ihrer Arme wurde hochgehoben, ein Strick schlang sich um das Handgelenk, und sie spürte, wie sie an einen Bettpfosten gefesselt wurde.
»Wie soll ich sie denn jetzt ausziehen?« fragte die Frau enttäuscht, als Isabella an Armen und Beinen festgebunden war.
»Das ist dein Problem. Aber du darfst nichts unternehmen, wenn ich nicht dabei bin, ist das klar? Wenn sie flieht, würdest du’s bitter bereuen.«
»Drohst du mir etwa, du ...«
»Ob das klar ist!« Plötzlich klang die Stimme eiskalt.
»Ja, natürlich«, seufzte sie. »Vielleicht könnte ich das Kleid aufschneiden. Aber was hätte ich dann davon?«
»Wenn du’s tragen willst, mußt du’s ohnehin weitermachen«, entgegnete er mitleidlos.
Die Schritte der beiden entfernten sich auf knarrenden Bodenbrettern. Die Tür wurde geschlossen, ein Schlüssel knirschte im Schloß. Isabella blieb allein zurück, an ein eisernes Bettgestell gefesselt. In ihrer feuchten Kleidung zitterte sie vor Kälte, und sie fürchtete sich wie noch nie in ihrem Leben.
Kapitel 3
Während sich die Stunden der Gefangenschaft zu Tagen dehnten, wurde Isabella nicht nur von ihrer Angst gepeinigt, sondern auch von anhaltenden körperlichen Unannehmlichkeiten. Zweimal am Tag wurde sie von den Stricken befreit und durfte die Augenbinde abnehmen, um verhältnismäßig ungestört einen Nachttopf zu benutzen. Ein Mann – sie nahm an, daß es derjenige war, der sie am ersten Abend ins Haus getragen hatte – wartete im Flur vor der offenen Tür. Wenn sie sich auf seinen Befehl hin wieder die Augen verbunden hatte, kehrte er ins Zimmer zurück, drückte ihr eine Scheibe Brot und manchmal auch ein Stück Fisch oder Wildbret in die Hand. Nachdem sie gegessen hatte, hielt er ihr einen Becher mit Wasser an die Lippen. Sie trank ein paar Schluck, dann wurde sie wieder ans Bett gefesselt. Jedes Mal protestierten ihre Muskeln heftig, doch sie gab keinen Laut von sich. Die brutale Gleichgültigkeit des Mannes ließ keinen Zweifel daran, daß er sie bewußtlos schlagen würde, wenn sie Schwierigkeiten machte.
Ihr Gefängnis war winzig und nur mit dem Eisenbett, einem wackeligen Nachtkästchen und einem Waschtisch eingerichtet. Sie erhielt keine Gelegenheit, letzteren zu benutzen. Von der Spinnweben verhangenen Decke bis zum staubigen Boden starrte das Zimmer vor Schmutz. Es gab keine Bettwäsche, nur eine zerrissene altersgraue Steppdecke, die Isabella in kalten Nächten zu schätzen wußte, obwohl ihr davor ekelte. Die eisigen Stunden der Dunkelheit verstrichen, ohne daß ein Feuer im rußgeschwärzten Steinkamin entzündet wurde. Frierend lag sie unter der unappetitlichen Decke und sagte sich, daß sie mehr zu fürchten hatte als Läuse – zum Beispiel den Tod.
Als sie das erste Mal losgebunden worden war, hatte ihr Molly – so redete der Mann sie an – befohlen, sich auszuziehen und damit eine Antwort auf die problematische Frage gefunden, ob sie das ersehnte Kleid aufschneiden sollte oder nicht. Schüchtern wandte Isabella ein, sie habe nichts anderes, was sie tragen könne. Wenig später wurde ihr ein Kleid aus rauhem Stoff zugeworfen, das seinem Umfang nach aus Mollys Garderobe stammen mußte. Es war so groß, daß Isabella zweimal hineinpaßte. Angewidert starrte sie es an. Aber Molly, die auf dem Flur wartete, drohte ihr, sie gewaltsam zu entkleiden, wenn sie nicht gehorchte. Um dieser Gefahr zu entrinnen, zog sich Isabella splitterfasernackt aus, da ihre Wärterin auch die Wäsche haben wollte, und schlüpfte in das kratzige, schmutzige Kleid. Es reichte ihr nur bis zu den Waden, ansonsten hing es formlos an ihrer zierlichen Gestalt herab. Ihre Stiefel durfte sie behalten. Offenbar wußte Molly, daß die schmalen Schuhe ihr nicht paßten. Sogar die Strümpfe wurden ihr weggenommen.
Nach diesem Kleidertausch fror Isabella noch schlimmer als zuvor. Nachdem Molly ihr Ziel erreicht hatte, schien sie jedes Interesse an ihr zu verlieren. Manchmal spürte Isabella die Anwesenheit der Frau im Zimmer, wenn irgendetwas erledigt werden mußte. Sie redeten aber nie miteinander.
Isabella vermutete, daß Molly für die Männer zu kochen und noch andere Bedürfnisse zu stillen hatte, die sie sich lieber nicht vorstellen wollte. Obwohl ihre Angst vor einer Vergewaltigung nachließ, ganz konnte sie den Gedanken daran nicht verdrängen. Und so fand sie es beruhigend, daß die andere Frau offenbar diesen Wünschen der Männer nachkam.
Den Stimmen, die hin und wieder von unten heraufdrangen, entnahm Isabella, daß sie von fünf bis sechs Männern gefangengehalten wurde. Man wollte Lösegeld erpressen. Das hatte sie aus einzelnen Gesprächsfetzen herausgehört. Oberflächlich betrachtet, war sie dafür eine ideale Kandidatin, die wesentlich jüngere Ehefrau eines Grafen, die älteste Tochter eines Herzogs. Die Entführer konnten nicht wissen, wie wenig sie beiden Männern bedeutete. Ihr Gemahl gab offen zu, sie nur wegen der großen Mitgift geheiratet zu haben, die ihm – einem leidenschaftlichen Spieler – den Schuldturm ersparte. Und ihr Vater hatte sie Sarah, seiner neuen jungen Herzogin zuliebe unter die Haube gebracht, nachdem ihm diese in sechsjähriger Ehe drei Kinder geschenkt hatte, darunter als jüngstes den ersehnten Erben. Daraufhin war Isabella im väterlichen Schloß überflüssig und unerwünscht gewesen. Weder der Graf noch der Herzog würden also eine größere Summe opfern, um sie zu retten, da ihnen nichts an ihr lag.
Trotzdem würden sie das Lösegeld zahlen, weil sie einen Skandal heraufbeschwören könnten, wenn sie sich weigerten. Die hohe Summe würde Sarah zu einer Ohnmacht veranlassen, aber schließlich widerwillig hingenommen werden. Oder der Herzog forderte seinen Schwiegersohn auf, den Entführern die restliche Mitgift zu übergeben – eine Lösung, die Sarah sicher bevorzugen würde.
Jedenfalls würde die geforderte Summe früher oder später entrichtet werden, auch wenn deswegen ein Familienstreit drohte. Deshalb konnte Isabella ihre Freilassung in Ruhe abwarten und dann die Reise nach London fortsetzen, als wäre nichts geschehen. Es war ihr zwar immer noch rätselhaft, warum ihr Mann sie dorthin bestellt hatte. Oder sie durfte vielleicht gleich nach Blakely Park heimkehren. Wie auch immer, sie mußte den Zorn ihres Gatten fürchten, der womöglich gezwungen wurde, ihre Mitgift zu verwenden, um sie freizukaufen. Nichts ärgerte Bernard mehr, als für seine Frau Geld ausgeben zu müssen.
Einen ersten Hinweis auf eine Änderung ihrer Lage erhielt sie am sechsten Abend ihrer Gefangenschaft. Der Mann erschien wie gewohnt und band sie los, damit sie essen und den Nachttopf benutzen konnte. Als sie fertig war, kam er ins Zimmer zurück, ohne – wie sonst üblich – den festen Sitz der Augenbinde zu prüfen. Darüber war sie froh, denn sie hatte sich das Tuch wegen pochender Schmerzen in den Schläfen nur locker um den Kopf geschlungen. Sie machte sich keine Gedanken über seine Nachlässigkeit, bis er sie wieder am Bett festband. In stummem Protest gegen die unnatürliche, qualvolle Haltung ihres Körpers, die sie nun schon so lange erdulden mußte, drehte sie den Kopf zur Seite. Dabei rutschte ihr die Augenbinde herunter, und sie starrte in das bärtige Gesicht des Entführers. Mit wachsendem Entsetzen begegnete sie seinem finsteren Blick. Würde er sie töten, weil sie nun wußte, wie er aussah? »Oh, das Licht blendet mich ...«, stammelte sie und kniff hastig die Lider zusammen. Hoffentlich glaubte er, daß das schwache Flämmchen der Kerze auf dem Nachttisch genügte, um eine Gefangene, die tagelang des Lichts beraubt worden war, zu blenden.
Zu ihrer Überraschung bekam sie keine Ohrfeige, und er verzichtete auch darauf, ihr das Tuch wieder um den Kopf zu binden. Stattdessen warf er es auf den Boden. »Das spielt keine Rolle mehr, nun steht das Ende bevor.« Er sprach mehr zu sich selbst als mit Isabella. Den Kerzenleuchter in der Hand, wandte er sich zur Tür.
Aufgeregt öffnete sie die Augen. »Dann haben Sie das Lösegeld also erhalten? Werde ich freigelassen?«
Der Mann schaute über eine breite Schulter zu ihr zurück und setzte ein Grinsen auf, das eher einer Grimasse glich. »Aye, wir lassen Sie laufen.«
»Wann?« Ihre Stimme klang schrill. Erst jetzt, wo die Freilassung winkte, wurde ihr voll und ganz bewußt, wie schrecklich sie sich während der ganzen Gefangenschaft gefürchtet hatte.
Statt einer Antwort zuckte er nur die Achseln, verließ das Zimmer und schloß die Tür. Isabella blieb in der Dunkelheit zurück und stieß einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus. Doch dann runzelte sie die Stirn. Irgendetwas stimmte da nicht. Sie hatte ihn deutlich gesehen, konnte seine Gesichtszüge in allen Einzelheiten beschreiben. Das wußte er, und es störte ihn nicht. Warum war es ihm gleichgültig?
Während sie darüber nachdachte, begann sie zu zittern. Es gab nur eine einzige Erklärung. Die Entführer hatten das Lösegeld bekommen, wollten sie aber nicht freigeben, sondern töten. Sie konnte keine anderen Schlüsse aus dem Verhalten des Mannes ziehen. Stets hatte er großen Wert darauf gelegt, daß sie weder ihn noch seine Komplizen sah – bis zu diesem Tag. Falls man sie gehen lassen wollte, würde man alles tun, um eine spätere Identifizierung zu verhindern. Und wenn die Bande aufgrund einer genauen Personenbeschreibung gefaßt wurde, mußte sie mit einer langen Haftstrafe, vielleicht sogar mit dem Galgen rechnen.
Also hatte man beschlossen, sie zu ermorden. In wachsender Panik biß sie sich auf die Unterlippe. An Händen und Füßen gefesselt, war sie völlig hilflos. Jeden Augenblick konnte jemand hereinkommen, um sie zu erschießen, zu erwürgen oder mit einem Kissen zu ersticken oder ...
Verzweifelt riß sie an den Fesseln, obwohl die Stricke schmerzhaft in ihr Fleisch schnitten, und versuchte gegen die Eisenpfosten zu treten. Krachend stieß das Bettgestell gegen die Wand.
»Was ist denn los?« Der bärtige Mann war zurückgekommen. Er stand in der Tür, hielt den Kerzenleuchter in der Hand und beobachtete Isabellas vergebliche Anstrengungen. Bis jetzt war sie eine mustergültige Gefangene gewesen und hatte den Entführern keine Schwierigkeiten bereitet, in der Hoffnung, ihre Gefügigkeit würde die Bande veranlassen, sie anstandslos freizulassen, wenn es soweit war. Aber wie sie nun wußte, würde dies niemals geschehen. Auch jetzt machte er sich nicht die Mühe, sein Gesicht zu verbergen.
Entschlossen bekämpfte sie ihre Furcht. Sie mußte sich irgendetwas einfallen lassen. Während sie den Mann anstarrte, rang sie nach Fassung. Ahnte er, was sie inzwischen erraten hatte? Wenn ja – würde er sie auf der Stelle töten? Nein, sie durfte nicht in neue Panik geraten, das würde sie um alle Chancen bringen. Es mußte einen Ausweg geben.
»Was soll der Aufruhr?« Er trat ins Zimmer, der Kerzenschein tauchte das Bett in goldenes Licht. Sein Gesicht wirkte unheilvoll und gefährlich.
Isabella unterdrückte einen Schrei. Bloß nicht die Nerven verlieren, sagte sie sich. Geistesgegenwart war ihre einzige Waffe. »Eine – eine Maus ist im Bett«, stotterte sie. Die Eingebung war aus dem Nichts gekommen, und sie klammerte sich daran, hoffte und betete. »Oh, bitte! Sie versteckt sich unter der Decke. Helfen Sie mir! Oh ...« Sie begann sich wieder umherzuwerfen und schrie wie am Spieß. »Oh! Oh!« Das Bett rutschte über die staubigen Bodenbretter. »Retten Sie mich! Die Maus ist direkt unter mir.«
Der Mann zog die Brauen zusammen und kam näher. »Um Himmels willen«, murmelte er und stellte die Kerze auf den Nachttisch. Isabella fuhr fort, sich kreischend hin und her zu winden, während er ihre Fußfesseln löste. Sobald ihre Beine befreit waren, strampelte sie mit aller Kraft und mimte meisterhaft die Hysterie einer albernen, schwachen Frau, die aus Angst vor harmlosem kleinem Ungeziefer halb verrückt wurde. »Seien Sie still, sonst ...« Die Drohung wurde von einem Grunzen begleitet, als er auch ihre Hände losband.
Isabella sprang zitternd vom Bett auf. Unmutig starrte er sie an, dann richtete er seine Aufmerksamkeit auf die zerknüllte Decke. Vielleicht war dies ihre einzige Chance. Irgendwie mußte sie diesen riesenhaften, kräftigen Mann überwältigen. Aber wie?
Mit beiden Händen tastete er die Decke ab. »Ich finde keine Maus.« Isabellas Blick heftete sich auf den dreckigen Waschkrug, der links von ihr in der ebenfalls schmutzigen Schüssel stand. Nach dem Zustand der Gefäße zu schließen, waren beide seit mindestens einem Jahr nicht mehr mit Wasser in Berührung gekommen.
»Sie ist aber da«, rief sie, während er sie mißtrauisch über die Schulter hinweg anstarrte. »Oh, bitte, Sie müssen Sie fangen!«
Beschwichtigend wandte er sich wieder dem Bett zu. Isabella trat lautlos neben den Waschtisch und ergriff den Krug. Der Mann beugte sich immer noch über das Bett, aber jetzt drehte er wieder den Kopf zu ihr. »Sie ...«
Was er sagen wollte, sollte sie niemals erfahren. Von ihrer Todesangst getrieben, ließ sie den Krug auf die Schläfe des Entführers hinabsausen. Er blinzelte, während sie ihn atemlos beobachtete und fürchtete, sie könnte nicht hart genug zugeschlagen und ihn nur in Wut gebracht haben. Würde er sich gleich wieder zu seiner beängstigenden Größe aufrichten und sie augenblicklich ermorden?
Doch dann sank er in sich zusammen und fiel quer über das Bett.
Kapitel 4
Nur wenige Sekunden stand Isabella wie erstarrt da. Sie wußte nicht, wie lange er ohne Besinnung bleiben würde – vermutlich nicht allzu lange. Sollte sie ihn fesseln? Nein, damit würde sie kostbare Zeit verschwenden. Sie hatte auch nicht genug Kraft, die Stricke so fest zu verknoten, daß er sich nicht befreien konnte. Sicher war es besser, diese wertvollen Minuten zur Flucht zu nutzen.
Sie lief zur Tür und blieb lauschend stehen. Stimmen drangen herauf. Molly saß mit den anderen Männern im Erdgeschoß. Wenn Isabellas Wärter nicht bald zurückkehrte, würde man zweifellos nach ihm sehen. Dieser Gedanke bewog sie, den Schlüssel aus dem Schloß zu ziehen, die Tür zu schließen und von innen zu versperren.
Der Mann auf dem Bett stöhnte und bewegte sich. Erschrocken rannte sie zu ihm. Anscheinend kam er zu sich. Sie packte den schweren Messingleuchter, den er heraufgebracht und auf den Nachttisch gestellt hatte, und schwang ihn hoch. Als er erneut ächzte und den Kopf hob, beförderte sie ihn mit einem weiteren Schlag ins schwarze Nichts zurück. Wie ein Stein blieb er liegen.
Es war unmöglich, durch die Tür und über die Treppe zu fliehen. Also mußte sie durch das Fenster klettern. Zur Sicherheit schlug sie dem Entführer noch einmal den schweren Leuchter auf den Hinterkopf, dann trat sie ans Fenster. Es war sehr schmal und mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Isabella zerrte am Griff und hoffte verzweifelt, es würde sich öffnen lassen. Widerstrebend bewegte sich der Fensterflügel, und es gelang ihr, ihn so weit aufzuziehen, daß ein Spalt entstand, der breit genug war, um hindurchzuschlüpfen.
Der Mann stöhnte wieder. Isabella spürte den Angstschweiß auf der Stirn. Sie rannte zum Bett zurück, hob den Leuchter und schlug noch einmal zu. Er gab keinen Laut mehr von sich. Sie eilte wieder zum Fenster, zog sich am Sims hinauf und streckte ihre Beine durch die schmale Öffnung. Erst jetzt konnte sie sehen, wie weit sie noch vom Boden entfernt war.
Doch es gab keine andere Möglichkeit. Sie mußte es wagen und darum beten, daß sie gut unten ankam. Mit angehaltenem Atem rutschte sie noch weiter hinaus, bis nur noch ihr Kopf und die Schultern im Fenster waren. Nach einem letzten angstvollen Blick zum Bett schob sie ihren ganzen Körper nach draußen. Schließlich hing sie über dem Boden und hielt sich nur noch mit beiden Händen am Fensterbrett fest. Lange würde sie es nicht aushalten, in dieser Stellung zu bleiben. Aber sie fürchtete sich plötzlich davor loszulassen.
Blindlings tastete sie mit ihren Füßen nach einem Halt, fand aber keinen. Sie wagte einen Blick nach unten, und das war ein Fehler. Trotz der Nebelschwaden sah sie, wie tief der Boden unter ihr lag. Er war übersät mit Steinen und ohne ein Gebüsch, das den Sturz bremsen würde.
Als wieder ein Stöhnen aus dem Zimmer drang, ließ sie das Sims los. Hart landete sie auf den Fußballen, dann sank sie vornüber auf die Knie. Ihre Beine protestierten mit heftigen Schmerzen, versagten ihr aber nicht den Dienst. Sie vergeudete nur wenige Sekunden, dann kroch sie vom Haus weg.
Hinter ihr war es still. Niemand verfolgte sie. Nach einem gehetzten Blick zu dem erleuchteten Fenster floh sie zu einer Baumgruppe, die am Ende eines Feldes stand.
Kurz bevor sie den Wald erreichte, trat eine große Gestalt zwischen den Stämmen hervor.
Kapitel 5
»Still, Mädchen! Brüllen Sie doch nicht so!«
Die geflüsterten Worte hätten genausogut arabisch sein können, so wenig Beachtung fanden sie bei Isabella. Völlig entnervt stieß sie einen zweiten gellenden Schrei aus. Der Mann packte sie und preßte eine Hand auf ihren Mund.
»Verdammt, bring sie zum Schweigen, Paddy! Da können wir unsere Ankunft ja gleich mit einem Hornsignal verkünden!« Der Befehl und das darauffolgende angewiderte Murmeln stammten von einem anderen Mann, nicht ganz so groß und kräftig wie der erste. Er war aber groß und kräftig genug, um Isabella Angst einzujagen.
Von muskulösen Armen an eine harte Brust gepreßt – breit genug, um zwei Männern zu gehören – mußte sich Isabella geschlagen geben. Ihre Gegenwehr erlahmte. Mit vor Angst weit auf gerissenen Augen sah sie über die riesige Hand hinweg, die die Hälfte ihres Gesichts bedeckte. Da sie ihrem Angreifer den Rücken kehrte, gewann sie keinen Eindruck von ihm. Dafür sah sie den zweiten Mann. Er war hochgewachsen, breitschultrig und hatte einen wohlgeformten Kopf. Das goldbraune Haar, im Nacken zusammengebunden, bewegte sich in einer sanften Brise, und wenn ihr die Fantasie im diffusen Silberlicht keinen Streich spielte, schimmerten die Augen im gleichen Goldton.
Ein weiterer Mann kam hinzu, dann noch einer und noch einer. Im Ganzen waren es fünf, die Isabella mißtrauisch oder feindselig anstarrten. Der Mann mit den Goldaugen musterte sie nachdenklich, was ihr einen Schauer über den Rücken jagte. Überlegte er womöglich, wie er sie am besten beseitigen konnte?
Verzweifelt sagte sie sich, daß sie erneut in Gefangenschaft geraten war. Hatten diese Männer von ihrer Flucht gewußt? Sie hätte schwören können, daß mindestens drei Banditen im Erdgeschoß des Farmhauses gesessen hatten, als sie aus dem Fenster gekrochen war. Und der vierte, ihr Wärter, hatte es bestimmt nicht geschafft, ihr vorauszueilen und sie am Waldrand zu erwarten. Gab es noch mehr Bandenmitglieder, als sie vermutet hatte? Hielten diese Leute im Umkreis des Hauses Wache?
Wer sie waren, das spielte keine Rolle. Nur aufs Überleben kam es an. Sie öffnete den Mund, um zu fragen, was sie mit ihr vorhatten, brachte unter der Hand, die sie halb erstickte, aber nur ein schwaches Wimmern zustande.
»Paddy!« stieß der goldäugige Mann in heiserem Flüsterton hervor, um ihrem Angreifer erneut zu befehlen, er möge für ihr Schweigen sorgen.
»Seien Sie doch still, Mädchen!« Die leise Stimme, die dicht an Isabellas Ohr ertönte, klang flehend, aber auch warnend. Es war unmöglich, sich von den starken Armen loszureißen. In dieser Umklammerung fühlte sie sich hilflos wie ein Kind. Doch der Mann schien nur einen geringen Teil seiner zweifellos gewaltigen Kräfte einzusetzen, als wollte er ihr nicht wehtun und möglichst sanft mit ihr umgehen. Würde er es bedauern, wenn der andere ihm auftrug, ihr den Hals zu brechen? Selbst wenn es so wäre – sie wußte instinktiv, daß er widerspruchslos gehorchen würde. Die unumstrittene Autorität des goldäugigen Mannes war vom ersten Moment an zu spüren gewesen. Der Riese und die restlichen Männer würden alle seine Wünsche erfüllen.
»Jesus, was treibt eine gottverdammte Frau um diese Zeit im Wald? Das nächste Dorf liegt fünf Meilen entfernt. Tod und Teufel, was sollen wir mit ihr machen?« Obwohl der Anführer mit sich selbst sprach, bekam er eine Antwort von Paddy.
»Wir könnten sie laufen lassen ...«
»Aye, und dann würde sie sich die Seele aus dem Leib schreien oder ins Haus laufen, um Parren und seine Leute vor uns zu warnen. Schau doch, wie sie angezogen ist. Das kann kein anständiges Mädchen sein. Ich halte sie eher für die Hure eines dieser Banditen.« Er musterte Isabella, die ihn über der Pranke des Riesen angstvoll ansah. »Wenn Sie schreien, bricht Ihnen Paddy den Hals. Jetzt wird er die Hand von Ihrem Mund nehmen. Sie müssen einige Fragen beantworten. Wenn Sie die Wahrheit sagen, lassen wir Sie vielleicht laufen.«
Er beabsichtigte nicht, sie freizugeben. Das hörte sie aus seiner Stimme heraus, die ihr etwas kultivierter erschien als die seines Gefährten. Doch sie durfte nicht zeigen, daß sie es wußte, und so nickte sie, um seine Bedingungen zu akzeptieren.
Auf ein Zeichen des goldäugigen Mannes hin, nahm Paddy seine Hand langsam von Isabellas Gesicht, und sie holte tief Luft. Sie wurde zwar immer noch festgehalten, aber nun konnte sie wenigstens atmen.
»Wie viele Leute sind im Haus?« Wie eine Musketenkugel wurde die Frage auf Isabella abgefeuert. Sie schluckte, um ihre trockene Kehle zu befeuchten und etwas Zeit für hastige Überlegungen zu finden. So gut sie es vermochte, wollte sie antworten, sofern es nicht ihre eigene Person betraf. Offensichtlich hatten diese Männer keine Ahnung, wer sie war. Und wenn sie von Lady Isabella St. Justs Entführung wußten, brachten sie die schäbig gekleidete junge Frau, die sie am Waldrand gefangengenommen hatten, nicht mit der Gräfin in Verbindung. Ehe sie herausbekam, worum es hier überhaupt ging, hielt sie es für besser, ihre Identität zu verschweigen. Sowohl für die eine wie auch für die andere Räuberbande würde sie sonst nicht viel mehr darstellen als eine reiche Beute.
»Nun?« Ungeduldig runzelte er die Stirn.
Sie sah zu ihm auf, mit arglosem Blick, wie sie hoffte.
»Ich glaube, fünf.«
»Wer sind sie?«
»Ihre Namen kenne ich nicht. Drei oder vier Männer und eine Frau. Soviel ich mich entsinne, heißt sie Molly.«
»Was hat Sie veranlaßt, mitten in der Nacht vom Haus wegzulaufen?«
»Ich, ich hatte Angst und wollte heim.« Das war die reine Wahrheit. Isabella beobachtete, wie er leicht verwirrt blinzelte, und um das auszunutzen, fuhr sie hastig fort: »Wenn Sie mich freilassen, gehe ich nach Hause und werde Sie nie wieder belästigen. Ich erzähle auch niemanden von unserer Begegnung, das schwöre ich.«
»Warum hatten Sie Angst?« Sein Blick wanderte wieder über ihre Gestalt, und seine Stirnfalten vertieften sich. Den letzten hoffnungsvollen Teil ihrer Antwort ignorierte er. »Wurden Sie vergewaltigt?«
»Nein!« erwiderte sie empört. Diese Frage ließ sie erröten. Niemals brachte ein Gentleman vor einer Dame ein solches Thema zur Sprache. Aber natürlich war er kein Gentleman, und er wußte nichts von ihrem Stand. Nicht, daß er das berücksichtigt hätte, wäre es ihm bekannt gewesen.
»Sie sind nackt unter diesem Kleid. Weshalb?«
»Ich bin nicht ... Wie können Sie es wagen? Oh!« quietschte sie, als er unvermittelt eine ihrer Brüste umfaßte. Die Berührung war nur kurz. Aber die Brustwarze, von der Kälte bereits erhärtet und durch den dünnen Kleiderstoff sichtbar, reagierte sofort. Isabella zuckte zurück. Sie war in ihrer Bewegungsfreiheit durch Paddys eisernen Griff stark beeinträchtigt. Doch diese instinktive Abwehr erwies sich als überflüssig, denn der goldäugige Mann hatte sie schon wieder losgelassen.
Ohne ihre Schamröte und die ungewollte Reaktion zu beachten, bemerkte er lässig: »Sie tragen nicht einmal eine Faser unter diesem Kleid. Halbnackt sind Sie vom Haus weggelaufen, und Sie sagen, Sie hätten sich gefürchtet. Leben Sie mit Parren zusammen? Wie ich höre, geht er ziemlich grob mit seinen Frauen um.«
»Nein.«
Er seufzte ungehalten. »Ich schlage vor, Sie verraten mir jetzt ohne weitere Umschweife, wer Sie sind und was das alles soll. Und ich warne Sie, ich hasse Lügen.«
Mit großen Augen starrte sie ihn an. Sie konnte unmöglich behaupten, sie sei eine Dienstbotin. Sobald sie den Mund aufmachte, würde er wissen, daß sie flunkerte.
Als sie beharrlich schwieg, verhärtete sich der kalte Glanz in seinem Blick, und er schaute über ihren Kopf hinweg auf Paddy. »Wir verschwenden nur unsere Zeit, und die haben wir nicht, wenn wir bei Tagesanbruch wieder in London sein wollen. Aber sie muß festgehalten werden. Bring sie in den Wald und sieh zu, daß sie den Mund hält!«
»Aye.«
Ohne Isabella noch einmal anzusehen, wandte sich der goldäugige Mann ab und ging davon. Die anderen folgten ihm, bis auf Paddy, der sie immer noch mit seinem starken Arm umklammerte. »Seien Sie jetzt ein braves Mädchen, ich möchte Ihnen nicht wehtun.« Nun wurde sie von der eisernen Umschlingung befreit, aber dafür packte er ihr Handgelenk und zog sie in den Wald.
Willig folgte sie ihm, und sie erkannte, daß nun, da Paddy ihren Unterarm fast sanft umschloß und die Augen auf den dunklen Weg richtete, der günstigste Augenblick zur Flucht da war. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit mußte sie der Gefangenschaft entrinnen. Und dazu bedurfte es nur einer gewissen Raffinesse ...
Sie tat so, als stolperte sie über eine Wurzel, und fiel auf die Knie. Unwillkürlich ließ Paddy sie los, und als er nach ihr greifen wollte, war sie bereits aus seiner Reichweite gekrochen. Sie sprang auf, raffte ihren Rock und stürmte den Weg hinab, so schnell wie früher in ihrer Kindheit.
»Kleines Biest! Kommen Sie zurück! Verdammt und zugenäht!« Krachend brach Paddy hinter ihr durch das Unterholz, und sie hoffte, seine bullige Größe würde seine Geschwindigkeit drosseln.
Wie ein Banner wehte das Haar hinter ihr her, ihr Herz schlug wie rasend. Das schwache Mondlicht durchdrang das Laubwerk nicht, und der Wald war dunkel wie eine Höhle. Ein Zweig peitschte in Isabellas Gesicht, schreiend duckte sie sich, und sie verlor das Gleichgewicht, wenn auch nur für ein paar Sekunden. Aber im selben Augenblick hörte sie Schritte, dicht hinter sich. Sie waren zu flink und zu leichtfüßig, um Paddys Ankunft zu verkünden.
Während sie weiterrannte, warf sie einen verängstigten Blick über die Schulter. Und da wurde ihr fliegendes Haar gepackt und nach hinten gerissen. Erschrocken kreischte sie auf, als sie an einer breiten Männerbrust landete. Ein harter Arm legte sich um ihren Hals und würgte ihr grausam die Stimme und den Atem ab. Der Geruch von Leder, Pimentrum und Tabak stieg ihr in die Nase, während sie verzweifelt nach Luft rang. Er hielt sie fest, daß sich die Knöpfe seines Jacketts in ihren Rücken drückten. Mit aller Kraft wehrte sie sich und krallte ihre Nägel in den Arm, der ihr Leben bedrohte, doch ohne Erfolg. Sie wußte, wer der Angreifer war, und gab ihren Widerstand auf.
Kapitel 6
»Sie Nervensäge! Wenn Sie noch einmal schreien, breche ich Ihnen das Genick, verstanden?«
Der Zorn nahm seiner Stimme den gewissen kultivierten Schliff, der Isabella zuvor aufgefallen war. Jetzt klang ein etwas vulgärer Cockney-Akzent durch. Wer immer er sein mag, ein Gentleman ist er bestimmt nicht, dachte sie und zerrte wieder an dem Arm, der sie umklammert hielt.
Endlich lockerte er den Griff. Sie schöpfte zitternd Atem. In diesem Augenblick trampelte Paddy den Pfad herab. Als er die beiden sah, verlangsamte er seine Schritte und rief keuchend: »Tut mir leid, Alec!« Beschämt blieb er stehen und senkte den Kopf. »Ein Glück, daß du schneller zu Fuß bist als ich.«
Alec schnaubte verächtlich, aber was immer er entgegnen wollte, er kam nicht zu Wort. Ein anderer Mann lief zu ihm und zischte: »irgendetwas geht in diesem Haus vor!«
Ein Ruck ging durch Alecs Körper. Er schob Isabella zu Paddy hinüber und befahl: »Paß auf, daß dir dieses lautstarke Miststück nicht wieder entwischt! Ich habe einfach keine Zeit, um die Kleine andauernd für dich einzufangen.« Abrupt wandte er sich ab und lief den Pfad zurück. Der dritte Mann folgte ihm auf den Fersen wie ein getreuer Wachhund.
Paddy schlang seine dicken Finger um Isabellas Unterarm, und es kam ihr so vor, als wäre sie durch eine eiserne Handschelle mit ihm verbunden. Offensichtlich war er fest entschlossen, einen weiteren Fluchtversuch zu vereiteln. Das nahm sie ihm nicht übel. Soeben hatte sie am eigenen Leib erfahren, was es bedeutete, wenn man sich Alecs Zorn zuzog.
»Das war gar nicht nett, was Sie da getan haben«, murmelte Paddy vorwurfsvoll und zog sie den Weg hinauf. Am Waldrand blieb er stehen, nahe der Stelle, wo sich Alec mit den anderen postiert hatte, den Blick auf das Haus gerichtet. Auch Isabella konnte die plötzlichen Aktivitäten beobachten.
Offensichtlich hatten die Hausinsassen inzwischen festgestellt, daß sie entkommen war. Ein Mann stand vor der Tür, hielt sich den Kopf und schaute hektisch nach allen Seiten. Auf dem gefrorenen Boden zu seinen Füßen flackerte eine Laterne. Zwei andere überquerten das Feld, sie waren ebenfalls mit Lampen ausgerüstet, während ein vierter erbost brüllte: »Verdammt, das Biest ist weg! Was sollen wir jetzt machen?«
»Natürlich müssen wir sie finden. Du Idiot, wie konntest du dieses schwächliche blaue Blut davonlaufen lassen? Wenn er’s erfährt, wird dich das den Hals kosten.«
»Sie hat mich überlistet.«
»Pah! Du mit deinem Spatzenhirn, Harris! Alle müssen nach ihr suchen. Sie kann noch nicht weit sein.«
Offenbar ahnten die Gauner nichts von der Anwesenheit einer zweiten Bande, die sie vom Wald aus beobachtete. Isabella überlegte, daß die Männer, die sie jetzt festhielten, anscheinend nicht zu ihren Entführern gehörten. Aber wer mochten sie sein? Vielleicht ein Rettungstrupp, von ihrem Vater oder Bernard angeheuert? Oder sogar Polizisten? Diesen Gedanken verwarf sie sofort. Sie bezweifelte entschieden, daß sie auf der Seite des Gesetzes standen. Und wenn sie tatsächlich die entführte Gräfin befreien wollten, würde sie noch genug Zeit finden, um ihre Identität bekanntzugeben. Sie mußte lächeln bei der Vorstellung, wie zerknirscht Alec sein würde, wenn er erfuhr, daß er die Frau beziehungsweise Tochter seines Auftraggebers mißhandelt und beleidigt hatte. Dieser arrogante Bursche verdiente eine Vergeltung ... Aber es waren ja alles nur Vermutungen.
Alec trat zwischen den Bäumen hervor und auf das freie Feld. Bleiches Mondlicht versilberte sein Haar. Isabella betrachtete seine Silhouette vor dem nun hell erleuchteten Haus, die breiten Schultern und schmalen Hüften. Ein schwarzes Band hielt sein Haar im Nacken zusammen. Er war einigermaßen gut gekleidet. Er trug einen Gehrock und modisch enge Kniehosen, die seine muskulösen Schenkel betonten. Seine Füße bedeckten hohe, staubige Stiefel. In seiner rechten Hand lag eine Pistole.
Isabella starrte auf die Waffe, und ihr Herzschlag beschleunigte sich wieder, als sie merkte, daß auch seine drei Begleiter bewaffnet waren.
Ein weiterer Mann kam aus dem Haus, gefolgt von Molly. Jedes der insgesamt sechs Bandenmitglieder war nun mit einer Laterne und einer Pistole ausgestattet.
»Verteilt euch und sucht sie! Aber schießt nur, wenn es sein muß! Ich will kein Blut sehen.«
Isabella erkannte die Stimme des Mannes, der sie aus der Kutsche gezerrt hatte, und ein Schauer rann ihr über den Rücken. Offenbar war er der Anführer. Und wer mochte ›er‹ sein, der immer wieder erwähnt wurde? Der oberste Bandenchef? Vielleicht – o Graus – Alec? Hatte es einen Zwist zwischen den Dieben gegeben? Das kam ihr wahrscheinlicher vor als die Möglichkeit, er könnte einen Rettungstrupp befehligen.
»Guten Abend, Parren.«
Abgesehen von dem harten Unterton hätte Isabella diesen Gruß aus Alecs Mund fast freundschaftlich genannt. Die Wirkung auf den Mann, der soeben das Haus verlassen hatte, zeigte sich augenblicklich. Er erstarrte, dann fuhr er zu dem Sprecher herum, als hätte er eine Stimme aus dem Himmel oder aus der Hölle vernommen. Auch die anderen wirkten wie versteinert.
»Tod und Teufel, das ist der Tiger!«
»Oh, verdammt noch mal!«
»Ich sag’s euch ja. Er hat das zweite Gesicht.«
»Halt den Mund!« Dieses Kommando kam aus dem Mund des Mannes, der Isabella aus dem Wagen geholt hatte – Parren, wie Alec ihn nannte.
Umringt von seinen Leuten, verharrte er reglos wie das Kaninchen vor der Schlange, während Alec zu ihm hinschlenderte. Isabella konnte Parrens Gesichtsausdruck im Halbdunkel nicht erkennen, aber die Körperhaltung verriet, daß seine Nerven zum Zerreißen gespannt waren. Die Laterne in seiner Hand zitterte. »Ich – eh – hatte nicht erwartet ...«, stotterte er.
»Versuchst du mir mitzuteilen, du hättest nicht gedacht, mich in dieser schönen Nacht fern von London anzutreffen? Wie kurzsichtig du bist, Parren!« Alecs Stimme klang seidenweich, und hätte Isabella vorhin nicht jenen Cockney-Akzent gehört, würde sie ihn jetzt trotz allem für einen Gentleman halten. Aber hinter seiner Fassade verbarg sich etwas Unheimliches, das sie frösteln ließ.
Parrens Laterne begann noch heftiger zu schwanken. »Wir – wir wollten dich keinesfalls um deinen Anteil betrügen, Tiger, das – das schwöre ich. Sobald wir nach London gekommen wären, hätten wir’s dir gegeben. Aber der Gentleman, der uns den Auftrag erteilte, hatte es furchtbar eilig, und ...« Die Stimme blieb ihm im Hals stecken, als Alec – Tiger? – fast bedauernd den Kopf schüttelte.
»Du weißt, wie gern ich vorher über solche Dinge informiert werde, Parren. Leider hast du einen Fehler begangen, der dich teuer zu stehen kommen wird.«
»Wieviel? Du bekommst die Hälfte, Tiger.«
»Ich will alles.«
»Alles?« krächzte Parren entrüstet.
»Und die Lady auch. Lebendig.«
»Aber, aber wir haben bereits ein Geschäft mit ihrem Pa abgeschlossen und unser Geld gekriegt. Das war ein verdammt hartes Stück Arbeit. Glaub mir, Tiger, mehr wird für die Lady nicht gezahlt.«
»Außerhalb von London wird kein Geschäft ohne meine Billigung ausgehandelt. Das weißt du.« Parren schwieg, und Alec fügte hinzu: »Du hättest nicht versuchen sollen, mich zu betrügen. So etwas mißfällt mir. Da kannst du alle fragen. Zum Beispiel Harry Givens.«
»Der ist doch abgekratzt.«
»Genau. Und das wirst du auch tun, wenn du mir noch einmal unter die Augen trittst. Leider wirst du deine schmutzigen kleinen Geschäfte von jetzt an in einer anderen Stadt abwickeln müssen, Parren. London ist für dich verschlossen.«
»Das kannst du nicht machen. Bildest du dir ein, die ganze verdammte Stadt gehört dir?«
»Etwa nicht?« Gleichmütig hob Alec die Pistole, seine Männer folgten diesem Beispiel. Eine starke Spannung lag in der Luft. Isabella glaubte in der plötzlichen Stille ein metallisches Klicken zu hören ...
»Achtung!«
Unvermittelt ließ Parren seine Laterne fallen, wieder schrie jemand, dann ein Pistolenknall. Paddy schob Isabella fluchend in den Schatten des Waldes. »Laufen Sie, Mädchen!« Während er zwei Pistolen aus seinem Hosenbund riß, rannte er auf das Feld. Weitere Schreie und Schüsse hallten durch die Nacht.
Als Paddy mit feuerspeienden Waffen den Waldrand verließ, sah Isabella, daß Alec bäuchlings auf dem harten Boden lag, umgeben von seinen Leuten.
Paddy hatte ihr empfohlen davonzulaufen. Das ließ sie sich nicht zweimal sagen. Den Rock um die Knie geschürzt, floh sie vor dem Kugelhagel. Sie sprang gerade über einen umgestürzten morschen Baumstamm, der ihr den Weg versperrte, als sie einen wuchtigen Aufprall zwischen den Schulterblättern spürte. Sie wurde herumgewirbelt, schrie auf und tastete instinktiv nach ihrem Rücken, wo sich ein brennender Schmerz ausbreitete. Die Stelle war unerreichbar, aber sie fühlte etwas Warmes, Feuchtes, Klebriges. Rasch hob sie die Hand vor die Augen und starrte entsetzt auf die dunkle, dickflüssige Substanz an ihren Fingern. Ein Schuß hat mich getroffen, dachte sie, ehe sie bewußtlos zusammenbrach.
Kapitel 7
Alec Tyron stand auf, wischte den Staub von seiner Hose und musterte mit kühlem Interesse Cook Parrens Leiche. Der Narr hätte niemals versuchen dürfen, ihn zu hintergehen. Andere waren auf die gleiche Idee verfallen, und die meisten hatten mit dem Leben dafür bezahlt.
Nur weil er gut aussah und einen bemerkenswerten Humor besaß, war Alec keineswegs zum König der Londoner Unterwelt aufgestiegen. Um den Distrikt Spitalfields-Whitechapel-Kensington zu beherrschen, mußte man stark, skrupellos und klug sein. Ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel, als er daran dachte. Ja, er war in der Tat ein Herrscher, zumindest in den Slums. Der König von Whitechapel. Vielleicht sollte er sich eine Krone anschaffen.
»Warum grinst du?« Paddy tauchte neben ihm auf und runzelte die Stirn. Er war ein Kirchgängertyp, keineswegs geeignet für ein Leben unter Taschendieben, Mördern, Straßenräubern und Bordellwirtinnen. Da er ein Gewissen besaß, plagten ihn unangenehme Moralbegriffe, um die sich Alec mit seinem messerscharfen Verstand stets herumlaviert hatte.
Seit sie als schmutzige, zerlumpte Gassenjungen die Londoner Straßen nach Brotkrumen durchstöbert hatten, um Leib und Seele zusammenzuhalten, teilten sie ihren Lebensweg. Sie ergänzten einander perfekt. Paddy mit seiner enormen Größe und Muskelkraft und Alec, ein paar Jahre jünger, mit seiner hellwachen Intelligenz. Diese Kombination von Klugheit und körperlicher Stärke hatte die beiden dahin geführt, wo sie jetzt standen. Paddy war der einzige Mensch auf der Welt, dem Alec rückhaltlos vertraute.
»Wo ist die Edelganz – eh – die Lady?« Alec hatte lang und hart gearbeitet, um sich den Straßenjargon abzugewöhnen. Aber manchmal geriet er ins alte Fahrwasser, vor allem in Augenblicken starker Anspannung. Wenn das geschah, war er sehr unzufrieden mit sich selbst. Die Sprechweise charakterisierte einen Mann ebenso wie Schlamperei oder kriecherische Haltung. Um sich aus dem allerniedrigsten Stand zu erheben, aus dem er stammte, hatte er nicht nur seine Ausdrucksweise ändern müssen, sondern fast alles an seiner Person. Mit großer Mühe war es ihm gelungen.
Doch gerade dann, wenn er es am wenigsten erwartete, tauchten Merkmale seiner Herkunft auf, für die er sich schämte.
»Die kleine Dirne? Als die Schießerei losging, sagte ich ihr, sie solle davonlaufen. Ich sah dich zu Boden stürzen und dachte, Parren hätte dich endgültig erwischt.«
»Das hättest du besser wissen müssen. Und die ›klei- ne Dirne‹ ist keine, zumindest nicht, was ihre Abstammung angeht, sondern sehr wahrscheinlich die Lady, die wir suchen.«
»Was?« Paddy hob skeptisch die Brauen.
»Sie ist Parren und seinen Leuten entkommen und wir haben sie gefunden. Was glaubst du, wie viele Frauen sich um diese nächtliche Stunde im Wald herumtreiben?«
Paddys Zweifel ließen sich nicht so leicht ausräumen. »Sie sieht aber nicht wie eine Lady aus, ist nicht fein genug.«
Alec schüttelte den Kopf, steckte die Pistole ein und kniete neben Parrens Leiche nieder. »Du Riesenidiot! Es sind die Puffmütter, die schicke Sachen tragen und sich parfümieren. Wirklich feine Damen machen sich nicht so zurecht, die kleiden sich eher schlicht.«
»O ja, sie ist tatsächlich sehr schlicht gekleidet.« Paddy begann zu grinsen. »Und du hast deine Hand auf ihre ...«
»Nun ja, da glaubte ich noch, sie wäre eine Hure.« Die Erinnerung an die kleine Brust mit der harten, sehnsüchtigen Brustwarze an seiner Handfläche bereitete Alec plötzlich Unbehagen. Er wandte sich von Paddy ab und durchstöberte systematisch die Taschen des Toten.
»Immerhin war sie halbnackt. Das führte mich auf eine falsche Fährte. Sonst hätte ich schon früher gemerkt, wer sie ist.«
»Wirst du dich entschuldigen?« Grinsend schob sich Paddy die zwei Pistolen in den Hosenbund. Wie er wußte, hatte sich Alec noch nie im Leben bei irgendjemandem für irgendetwas entschuldigt.
Ein vernichtender Blick beantwortete die Frage. »Daß ich sie vor Parren gerettet habe, dürfte wohl als Entschuldigung reichen. Er wollte sie umbringen.«
»Aye.« Paddy wurde sofort ernst. »Ich halte nichts davon, Frauen zu ermorden.«
»Das weiß ich.«
Wenn seine gewaltigen Körperkräfte auch darüber hinwegtäuschen mochten – Paddy war ein friedliebender Mensch. Es fiel ihm schon schwer, Männer hart anzufassen, von Frauen gar nicht zu reden.
Nachdem die Durchsuchung von Parrens Taschen beendet war, sprang Alec auf und schlug seinem Freund auf die Schulter. »Wir haben ihr das Leben gerettet, falls das dein Gewissen besänftigt. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Das heißt, du wirst sie aufspüren.«
»Wieso ich?« fragte Paddy gekränkt.
Alec zuckte die Schultern und ging langsam auf das Haus zu, gefolgt von seinem Gefährten. »Du hast sie weggeschickt, also mußt du sie wiederfinden – oder auch nicht, ganz, wie’s dir beliebt. Es wäre zwar nicht gerade nett von uns, sie im Wald erfrieren zu lassen, nachdem wir sie vor Parren bewahrt haben. Aber die Entscheidung liegt ganz bei dir.«
»Sie könnte überall in diesem Wald sein.«
»Das bezweifle ich. Außerdem ist es kein besonders großer Wald. Nimm ein paar Leute mit. Du wirst sie sicher bald finden.«
»Wir haben sie halb zu Tode erschreckt. Wenn sie merkt, daß wir ihr folgen, wird sie sich wie eine Füchsin irgendwo verkriechen.«
»Sag ihr, wir wollen sie in den Schoß ihrer Familie zurückgeleiten.«
Paddy schnaufte. »Falls ich überhaupt nahe genug an sie rankomme, um mit ihr zu reden ... Und wir kennen ihre Familie nicht. Wir wissen nicht einmal, wie sie heißt – nur, daß Parren beauftragt wurde, eine vornehme Lady zu entführen und zu töten. Verdammt, wenn er nach unseren Regeln vorgegangen wäre, hätten wir uns gar nicht darum gekümmert.«
»So läuft’s nun mal.«
»Würdest du mir bitte verraten, was du zu tun gedenkst, während ich mir auf der Suche nach dieser Lady den Hintern abfriere?«