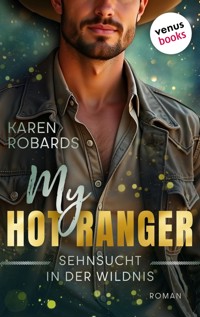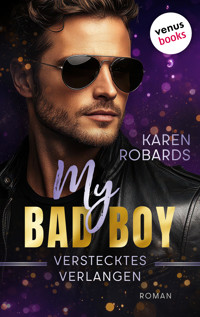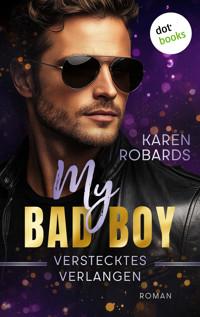Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Packende Spannung aus der Perspektive einer gleichermaßen starken wie verletzlichen Frau Sie kämpft für die Schwächsten … Seit ihre kleine Tochter Lexie vor 7 Jahren entführt wurde, lebt Sarah nur noch für ihren Beruf als Staatsanwältin. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit klammert sie sich noch immer an die Hoffnung, ihre Tochter eines Tages wiederzusehen. Als sie den Anruf einer unbekannten Nummer entgegennimmt und plötzlich Lexies Stimme aus der Leitung hört, kann sie nichts mehr davon abhalten, die Spur zu verfolgen. Auch ihr engster Freund Jake, ein ehemaliger FBI-Agent, hilft ihr bei der Suche, obwohl er schon lange nicht mehr an Lexies Überleben glaubt. Doch dann verschwindet wieder ein kleines Mädchen und Sarah spürt, wie der Albtraum von damals erneut beginnt – kann sie die Entführer diesmal aufhalten? »Karen Robards ist eine grandiose Geschichtenerzählerin!« Chicago Tribune Dieser fesselnde Thriller der amerikanischen Bestsellerautorin wird Fans von Joy Fielding und Karin Slaughter in seinen Bann ziehen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie kämpft für die Schwächsten … Seit ihre kleine Tochter Lexie vor 7 Jahren entführt wurde, lebt Sarah nur noch für ihren Beruf als Staatsanwältin. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit klammert sie sich noch immer an die Hoffnung, ihre Tochter eines Tages wiederzusehen. Als sie den Anruf einer unbekannten Nummer entgegennimmt und plötzlich Lexies Stimme aus der Leitung hört, kann sie nichts mehr davon abhalten, die Spur zu verfolgen. Auch ihr engster Freund Jake, ein ehemaliger FBI-Agent, hilft ihr bei der Suche, obwohl er schon lange nicht mehr an Lexies Überleben glaubt. Doch dann verschwindet wieder ein kleines Mädchen und Sarah spürt, wie der Albtraum von damals erneut beginnt – kann sie die Entführer diesmal aufhalten?
Über die Autorin:
Karen Robards ist die New York Times-, USA Today- und Publishers Weekly-Bestsellerautorin von mehr als fünfzig Büchern. Sie veröffentlichte ihren ersten Roman im Alter von 24 Jahren und wurde im Laufe ihrer Karriere mit zahlreichen Preisen bedacht, unter anderem mit sechs Silver Pens. Sie brilliert in der Spannung ebenso sehr wie im Genre Liebesroman.
Die Website der Autorin: karenrobards.com/
Die Autorin bei Facebook: facebook.com/AuthorKarenRobards/
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin die Thriller »Keiner wird dir helfen«, »Und niemand hört ihr Rufen«, die historischen Liebesromane »Die Rose von Irland«, »Die Liebe der englischen Rose«, »Die Gefangene des Piraten« und »Die Geliebte des Piraten« sowie die Exotikromane »Im Land der Zimtbäume« und »Unter der heißen Sonne Afrikas«.
***
eBook-Neuausgabe April 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2006 unter dem Originaltitel »Vanished« bei G.P. Putnam’s Sons, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2006 by Karen Robards
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2008 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-579-5
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Karen Robards
Und niemand hört ihr Rufen
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Evelin Sudakowa-Blasberg
dotbooks.
Widmung
Für Christopher, zu Ehren Deines
sechzehnten Geburtstags in diesem Monat.
Das ist doch besser als ein Auto, ja? Nein?
In Liebe, Mom.
Kapitel 1
Sarah Mason hatte sich den Tod, wenn er sie dereinst zu sich holen würde, attraktiver aussehend vorgestellt. Ungefähr so wie Brad Pitt in Rendezvous mit Joe Black. Der Typ Mann, mit dem man sich ganz gerne davonmacht. Der Kerl mit der Halloween-Totenkopfmaske aus billigem Plastik jedoch war ungefähr zwanzig Jahre alt, etwa eins siebzig groß und dürr, mit langem, fettigem, schwarzem Haar, einem einzelnen dicken Silberohrring und einem fusseligen Ziegenbart, der unter der Maske hervorguckte. Er trug knöchelhohe Turnschuhe, ein rotes, extrem weites Hornets-T-Shirt, und seine Jeansbermudas waren so weit, dass sie bei einer zu plötzlichen Bewegung herunterzurutschen drohten. Mit anderen Worten, heute Abend war der Tod eindeutig nicht in Gestalt des romantischen Herzensbrechers unterwegs.
Die Waffe, die er auf sie richtete, war groß und böse. So groß und böse, dass Sarah bei ihrem Anblick zunächst der Atem stockte, während ihr Hirn nach der ersten Schockstarre langsam wieder auf Minimalfunktion schaltete.
»He, Sie da! Lady! Rüber zur Kasse!«
Es gab keinen Zweifel. Die Maske bedeckte zwar seinen Mund, doch er brüllte sie an, zielte mit dieser großen schwarzen Waffe auf sie. Seine Bewegungen waren fahrig und nervös. Durch die ovalen Löcher in der Plastikmaske konnte sie seine Augen sehen. Sie waren von jener glänzenden Schwärze, die auf erweiterte Pupillen durch Drogenmissbrauch hindeutete, und flackerten unruhig, als er sich blitzschnell in dem Gang des Supermarkts umblickte, in dem er sie abgefangen hatte.
Sie stand stocksteif da und war außerstande, sich zu bewegen. Gefangen in diesem scheintotartigen Zustand, in dem das entsetzliche Geschehen zunächst so unwirklich wie ein böser Traum erschien, konnte Sarah den Mann nur benommen anstarren.
Das kann nicht wahr sein. Ich bin doch nur hier, um Hundefutter zu kaufen ...
»Beweg dich!«, schrie er, da sie sich nicht rührte.
Ihr Herzschlag setzte aus. Ihre Gedanken rasten. Sie schluckte krampfhaft.
»Ja. Ja, okay.«
Durch den schrillen Klang seiner Stimme wieder in die grauenhafte Realität zurückgerissen, drückte Sarah die große blaue Schachtel mit Trockenfutter an die Brust, wegen der sie spätabends kurz nach elf in den Quik-Pik gefahren war, und setzte sich in Bewegung.
»Los, los! Beeilung!« Von einem Bein auf das andere tretend, fuchtelte er erregt mit der Waffe herum und zielte in ihre Richtung, während sein Blick hin und her huschte.
»Alles okay.« Sie beschwor jeden einzelnen Tag herauf, den sie in ihrer vierjährigen Berufspraxis als stellvertretende Staatsanwältin von Beaufort County, South Carolina, mit Kriminellen verbracht hatte, um ihrer Stimme Festigkeit zu verleihen. Als Leiterin der Abteilung für Kapitalverbrechen hatte sie solche erbärmlichen Kleinganoven wie dieses Bürschchen zum Frühstück verputzt. Doch dies hier war kein Gerichtssaal, und es stand auch nicht die Zukunft dieses Typen auf dem Spiel, sondern ihr Leben. Jetzt sollte oder vielmehr musste sie alles daransetzen, um eine persönliche Beziehung aufzubauen. Das war ein elementarer Grundsatz des Kurses »Frauen gegen Vergewaltigung«, den sie mitgestaltete: Sorgt dafür, dass der Angreifer euch als Person wahrnimmt, denn das erhöht eure Chance, heil davonzukommen. »Alles in Ordnung. Bleiben Sie ganz ruhig.«
»Ich bin ruhig. Erzähl du mir bloß nichts von ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Wer glaubst du, wer du bist?«
Okay, falscher Spruch.
»Beweg deinen Arsch zur Kasse!« Er wippte auf den Fußballen, stieß die Waffe wie ein Florett in ihre Richtung, und aus Angst, ein Schuss könnte sich lösen, spannte sich Sarah instinktiv an. »Los!«
Sarah verabschiedete sich von dem Konzept, eine Beziehung zum Angreifer aufzubauen, beschleunigte ihren Schritt und senkte den Blick, während sie verzweifelt darüber nachsann, wie sie aus dieser Misere wieder herauskommen könnte. Sobald ihr klar geworden war, dass im vorderen Teil des Ladens ein Raubüberfall stattfand, hatte sie auf ihrem Handy die 911 angerufen. Das war die gute Nachricht. Das Handy am Ohr und das Hundefutter in der Hand, war sie danach in Richtung des vermeintlichen Hinterausgangs geflohen, quer durch die Halle, von der die Toiletten abzweigten. Ehe sie Gelegenheit gehabt hatte, auf die Anfrage der Leitstelle zu antworten, war dieser Typ aus dem Damenklo herausgeschossen und durch die Halle gerannt, worauf sie gezwungenermaßen die Richtung geändert und ihr – wie sie hoffte – nach wie vor mit der Leitstelle verbundenes Handy in die Handtasche geschoben hatte.
Doch es war ihr privates Handy, und das bedeutete: Selbst wenn der Typ von der Leitstelle die Verbindung nicht abbrechen und den Anschluss überprüfen würde, würde er lediglich ihre Privatadresse herausfinden. Es wäre unmöglich, den Anruf bis hierher zurückzuverfolgen.
Das war die schlechte Nachricht.
Und damit nicht genug. Selbst wenn die Cops Kenntnis von dem Überfall erhielten, würden sie vermutlich schnurstracks wieder kehrtmachen, sobald sie erkennen würden, dass sie diejenige war, die Hilfe benötigte. Sie war sich nämlich ziemlich sicher, dass sie auf der polizeiinternen Liste der unbeliebtesten Personen zurzeit den ersten Platz belegte.
»Dämliche Schlampe«, sagte der Räuber. Seine Worte wurden durch die Maske kaum gedämpft.
Augenblicklich schoss Sarahs Adrenalin in die Höhe. Schlampe war eines jener Wörter, auf das sie wie auf Knopfdruck reagierte, obwohl man meinen sollte, sie habe diesen Ausdruck inzwischen schon oft genug gehört, um gelassen darüber hinweggehen zu können. Bleib cool, mahnte sie sich. Jetzt war sie fast auf gleicher Höhe mit ihm, nah genug, um seinen strengen Geruch wahrzunehmen. Entweder hielt er nichts vom Duschen, oder er war so nervös, dass sein Deodorant schlicht versagt hatte. Wie auch immer, er stank. Der Durchgang war nur knapp einen Meter breit. Um zur Kasse zu gelangen, müsste sie sich im Abstand von wenigen Zentimetern an dem Mann vorbeischieben. Bei der Vorstellung überlief sie eine Gänsehaut. Dafür könnten natürlich auch die Kühltruhen zu ihrer Linken verantwortlich sein, deren eisiger Atem um ihre nackten Beine und Arme strich – wegen der draußen herrschenden Hitze von zweiunddreißig Grad war sie lediglich in Shorts und Tank-Top gekleidet –, doch das glaubte sie nicht. Sie war sich ziemlich sicher, dass ihre Angst die Ursache für das Kribbeln war, das sie verspürte.
Was, auf eine verquere Art und Weise, auch eine positive Seite hatte, denn sie war bisher überzeugt gewesen, sie habe ihre Angst vor dem Tod irgendwann im Verlauf der letzten sieben schrecklichen Jahre verloren. Nachts, wenn das Grauen am schlimmsten war, sah sie dem Tod sogar mit einer gewissen Vorfreude entgegen. Wahrscheinlich geriet sie einfach in Panik, weil sie mit einer Waffe bedroht wurde, was völlig verständlich war. Kein Mensch, der bei vollem Verstand war, wollte eine Kugel in den Kopf kriegen. Vor allem nicht, wenn man nur schnell Hundefutter kaufen wollte.
»Hast du Scheiße im Hirn oder was? Beweg dich, hab ich gesagt!« Der Totenkopfkerl funkelte sie an. Ungeduldig sprang er auf und ab, sodass die in seiner Hosentasche befindlichen Münzen oder ein Schlüsselbund oder irgendwelche anderen Metallteile klimperten.
»Ja, okay«, sagte Sarah in beruhigendem Ton, während sie demonstrativ schneller ging. Ihre Flipflops verursachten auf dem harten, glatten Boden ein weiches, klatschendes Geräusch. Es war interessant zu beobachten, dass ihr Herz umso schneller schlug, je näher sie dem Typen kam. Ihr Körper revoltierte eindeutig gegen die Aussicht auf den möglichen Tod. Sie atmete schnell und registrierte, dass ihr am ganzen Körper der kalte Schweiß ausbrach und ihr Magen sich verknotete. Auch ihre Knie schlotterten.
Was sagte das über ihr Leben aus, wenn sich die Todesangst als positive Empfindung erwies!
»Alles okay da hinten, Mann?«, rief der zweite Räuber vom vorderen Bereich des Ladens aus.
»Ja«, antwortete der Totenkopfkerl. »Alles unter Kontrolle.« Und schon schaute er wieder Sarah an. Er senkte die Stimme. »Ich warne dich: Verarsch mich ja nicht. Los, beweg dich gefälligst etwas schneller!«
Als er die Waffe auf sie richtete, wurde der Ausdruck in seinen Augen gefährlich. Sarah hatte den Eindruck, dass er jetzt sein Image als harter Kerl unter Beweis stellen musste, und fiel folgsam in einen leichten Trab. Regel 101 für den Überlebenskampf auf der Straße: Versuch niemals am Image eines Irren zu kratzen. Den Blick gesenkt und mit hängenden Schultern machte sie sich so klein wie möglich. Sie sah ihn absichtlich nicht an, vermied bewusst jeden Augenkontakt. Und nur deshalb, weil sie den Blick gesenkt hielt, erspähte sie, als sie an dem Kerl vorbeistapfte, das kleine Mädchen unter dem mit abgepackten Donuts beladenen runden Tisch am Ende des Gangs.
Auf dem Tisch lag eine lange weiße Plastikdecke. Auf dieser Seite fehlten gut zwanzig Zentimeter bis zum Boden. Das Mädchen lag zusammengerollt unter dem Tisch, und Sarah sah nur zwei dünne, dicht an die Brust gezogene gebräunte, schmutzige Beine; zwei gleichermaßen gebräunte, dünne, schmutzige Arme, die um die Beine geschlungen waren; ein hellgelbes T-Shirt; nackte Füße; und ein kleines Gesicht, halb verdeckt von langen, verfilzten, kaffeebraunen Haaren. Das Mädchen sah Sarah direkt an, seine Augen groß und dunkel und voller Angst.
Sarah blinzelte. Ihr Atem geriet ins Stocken. Für einen intensiven Moment, der sich zu einer herzzerspringenden Ewigkeit auszudehnen schien, verhakten sich ihrer beider Blicke. Sarahs Herz begann wie wild zu pochen – doch dann setzte ihr Verstand wieder ein, und sie fand die Kraft, sich von dem Anblick loszureißen und wegzusehen. Er könnte ihrem Blick gefolgt sein ...
Bitte, Gott, lass ihn das Kind nicht finden.
»Mach die verdammte Kasse auf!«, brüllte der andere Räuber – offenbar waren die Räuber nur zu zweit – der Frau hinter der Ladentheke zu.
»Ja, Sir.«
Im selben Moment, als Sarah aus dem Gang hervortrat, sprang die Kasse mit einem Rattern und einem hellen Ping auf. Jetzt sah sie die Frau hinter der Theke, die auf den noch zitternden Schubwagen der Kasse schaute, und den Räuber auf der anderen Seite der Theke, der mit seiner Waffe auf die Frau zielte. Die großmütterlich wirkende Kassiererin war ungefähr sechzig Jahre alt, klein und gedrungen, mit grau meliertem Haar, das sich um ihr Gesicht lockte, und einer roten Dienstuniform, deren Jacke über ihren Matronenbrüsten spannte. Ihre Lippen bebten, und sie sah den Räuber voller Furcht an.
»Pack es hier rein.« Er schob der Frau eine abgenutzte weiße Plastiktüte zu. Am ganzen Leib zitternd kam sie dem Befehl nach und schob mit fahrigen, ungeschickten Bewegungen das Geld in die Tüte. Dieser Mann war größer und bulliger als der Totenkopfkerl. Und er wirkte auch ruhiger. Zumindest hielt er seine Knarre gerade, statt ständig damit herumzufuchteln, und er bimmelte und klingelte auch nicht wie ein Glockenspiel im Sturm. Er war ebenfalls ein eher dunkler Typ mit fettigem Haar, und Sarah fragte sich flüchtig, ob die beiden wohl Brüder seien. Der zweite Räuber hatte sein Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, wodurch die wulstige weiße Narbe an seinem Hals zu sehen war. An seinem Ohr blitzten sechs oder sieben Diamantstecker, die von unten nach oben immer kleiner wurden. Kein Ziegenbart, zumindest keiner, der unter der grauen Wolfman-Plastikmaske zu sehen gewesen wäre. Die Ärmel seines schwarzen T-Shirts waren abgeschnitten, sodass eine Tätowierung auf dem linken Bizeps zu sehen war. Sarah kniff die Augen zusammen. Die Tätowierung sah aus wie eine Art Vogel – vielleicht ein Adler? Was immer sie darstellen sollte, sie würde sie definitiv wiedererkennen.
Das Ziel des heutigen Abends: Überleben, um für eine Jury diese Tätowierung identifizieren zu können.
»Hast du überall nachgesehen? Ist außer ihr niemand mehr da?«, fragte Wolfman eindringlich, während er sich ihnen zuwandte. Sarah achtete darauf, dem Blick seiner kalten schwarzen Augen auszuweichen, in denen nichts von der Nervosität zu erkennen war, wie sie der Totenkopfkerl an den Tag legte. Dieser Typ war der böse Bube, wurde Sarah bewusst, derjenige, der das Sagen hatte. Er war der Anführer. Und wenn es hart auf hart ginge, vermutlich auch der Mörder. Der Gedanke jagte ihr einen Schauer über den Rücken.
»Klar«, erwiderte der Totenkopfkerl.
»Bist du sicher?«
»Scheiße, ja, Mann. Warum behandelst du mich ständig so, als wäre ich ein gottverdammter Trottel?«
»Ich hab nur gefragt.«
»Hör auf mit der Fragerei, lass uns das hier lieber zu Ende bringen.«
Durch das große Ladenfenster konnte Sarah sehen, dass die Tankstelle menschenleer war. Bis auf ihren blauen Sentra war der Parkplatz wie ausgestorben. Auch die Kreuzung vor dem Quik-Pik war leer. Jenseits des erleuchteten Parkplatzes war die Nacht schwarz und still. Sarah und die Kassiererin und das kleine Mädchen unter dem Tisch waren ganz auf sich gestellt. In den großen, runden Überwachungsspiegeln, die den Ausgang flankierten, beobachtete sie, wie der Totenkopfkerl dicht hinter ihr auftauchte. Immer wieder blickte er nervös hinaus auf den Parkplatz, klimperte mit dem Wechselgeld in seiner Hosentasche und scharrte mit den Füßen. Der Lauf seiner Waffe zitterte ein wenig, als er auf ihren Rücken zielte.
Bei der Vorstellung, jeden Moment von einer Kugel zerfetzt werden zu können, geriet Sarahs Herzschlag ins Stolpern. Theoretisch mochte sie vielleicht mit dem Tod liebäugeln, doch heute Abend wurde ihr hier, in diesem überklimatisierten Quik-Pik bewusst, dass sie definitiv nicht sterben wollte.
»Ist das alles?« Drohend lehnte sich Wolfman über die Theke, worauf die Kassiererin, über deren Wangen nun Tränen liefen, versuchte, ihm die halb gefüllte Plastiktüte zu überreichen. Mit einer heftigen, groben Geste wehrte er die Tüte ab. »Heb das Schubfach hoch. Da werden doch die Scheine aufbewahrt. Glaubst du, ich weiß das nicht? Versuch ja nicht, mich für dumm zu verkaufen!« Sein Blick wanderte von der Kassiererin zu einem Punkt über Sarahs linker Schulter: zum Totenkopfkerl. »Hast du die Klos überprüft?«
»Hab ich doch gesagt. Ja, verdammt!«
»Okay, okay, wollte mich nur noch einmal vergewissern.«
Als die Kassiererin das leere schwarze Plastikschubfach aus der Kasse hob, spürte Sarah, wie sich etwas in den unteren Teil ihres Rückens bohrte. Ein Blick nach oben in den Spiegel bestätigte ihre schlimmste Befürchtung. Der Totenkopfkerl war direkt hinter ihr – und die Mündung seiner fetten, schwarzen Knarre presste sich in ihren Rücken. Sie konnte nichts anderes tun, als sich ruhig zu verhalten. Jede unerwartete Bewegung könnte seinen nervösen Zeigefinger am Abzug dazu verleiten, sich zu krümmen. Ihre ganze Willenskraft aufbietend, blieb sie reglos stehen und biss die Zähne zusammen, während ihr aus jeder Pore der kalte Schweiß strömte. Im Spiegel sah sie auch sich: kreidebleich, mit aufgerissenen Augen, wildem Blick und im wahrsten Sinn des Wortes zu Tode erschrocken. Ihre fest zusammengepressten Lippen waren dünn und blutleer, ihr kurzes, gestuftes schwarzes Haar, noch feucht vom Duschen im Fitnessstudio, war an ihren Kopf geklatscht, sodass ihre Augen und die kräftigen Wangenknochen ihr Gesicht dominierten, und ihr Rücken war gekrümmt wie bei einer buckligen alten Frau, während sie die Großpackung Hundefutter mit beiden Armen an ihren zu dünnen Körper presste. Sie war erst einunddreißig Jahre alt, sah aber älter aus, sogar wesentlich älter, wie sie schockiert feststellte. Sicher, es mochte an der Angst liegen, die alles Blut aus den Adern schwemmte, oder am Fehlen jeglichen Make-ups oder an der grässlichen Beleuchtung, woran auch immer – doch Fakt war, dass sie die hagere, hohläugige Frau, die ihr verzweifelt aus dem Spiegel entgegenstarrte, kaum wiedererkannte.
Einstmals, vor langer Zeit, so lange her, dass sie sich kaum daran erinnern konnte, war sie hübsch gewesen ...
»Wo ist die Scheißkohle?«
Wolfmans Gebrüll ließ Sarah zusammenzucken und lenkte ihre Aufmerksamkeit schlagartig wieder auf die Szene vor ihr zurück. Wolfman schwang sich gerade über die Theke und packte die Kassiererin, die eine einzelne Fünfzigdollarnote umklammerte, an den Haaren. Der Fünfziger flatterte neben Sarahs Füßen zu Boden. Die Geldtüte fiel mit einem Plopp auf die Theke. Die Kassiererin gab einen hohen, schrillen Laut von sich, der augenblicklich verstummte, als Wolfman ihren Kopf mit einem metallischen Klonk gegen die Kasse knallte.
Sarah wurde übel. Ihr Mund wurde trocken. Von Mitleid und Entsetzen übermannt, starrte sie zu der Kassiererin hinüber.
»Willst du es mir endlich sagen? Hä? Hä?«
Während der Totenkopfkerl den heruntergefallenen Fünfziger aufsammelte, schlug Wolfman den Kopf der Kassiererin zwei weitere Male in rascher Folge mit der Stirn gegen die Kasse.
»Hä? Hä?« Klonk. Klonk.
Innerlich schrie Sarah. Deshalb biss sie die Zähne zusammen, ballte in ohnmächtigem Zorn die Fäuste, rührte sich aber nicht vom Fleck. Sie müsste irgendetwas tun – doch sie konnte nichts tun, außer in stummem Entsetzen zuzusehen. Wenn sie reagieren würde, würde sie lediglich die Gewalt auf sich lenken.
Bei dem Gedanken brach ihr erneut der kalte Schweiß aus.
Die schrillen Schreie der Kassiererin gingen in schluchzende Stöhnlaute über, als Wolfman ihre Stirn mit gewollter Brutalität gegen das unnachgiebige Metall der Kasse schlug. Auf das Stöhnen der Frau erfolgte eine Antwort, ein kaum hörbares Wimmern, das von dem kleinen Mädchen unter dem Tisch kam. Sarahs Augen weiteten sich, als ihr das bewusst wurde. Sie hielt den Atem an, vermied es aber, in Richtung des Tisches zu blicken.
Sie schwitzte Blut und Wasser. Ihr Herz klopfte dumpf in ihrer Brust.
Sei still. Sie konzentrierte all ihre Willenskraft auf diese telepathische Nachricht. Und für den Fall, dass das Kind die Nachricht nicht empfangen haben sollte, flehte sie noch einmal zu einer höheren Macht: Bitte, Gott, mach, dass sie still bleibt. Lass nicht zu, dass die Kerle sie finden.
Allein bei dem Gedanken gefror Sarah das Blut in den Adern. So ambivalent sie auch über ihr eigenes Leben denken mochte, sie könnte es nicht ertragen, wenn ein Kind, ein kleines Mädchen, verletzt werden würde. Denn dass sie selbst und die Kassiererin verletzt oder noch schlimmer enden würden, daran hatte Sarah keinen Zweifel. Mit einem flauen Gefühl im Magen stellte sie sich der traurigen Wahrheit, dass sich die Situation unaufhaltsam verschlimmerte. Aus Erfahrung wusste sie, dass Gewalt, sobald sie einmal entfacht war, die Tendenz hatte zu eskalieren.
Die Erkenntnis war bitter, und Sarah kämpfte gegen ihre aufsteigende Panik. In dem Moment riss Wolfman den Kopf der Kassiererin brutal hoch. Die Frau schluchzte und schnappte hörbar nach Luft. Ihre Augen waren aufgerissen, ihr Mund stand offen. Hinter Sarah klimperte der Totenkopfkerl lauter denn je. Die Klimaanlage dröhnte. Die Kühltruhen brummten. Es gab so viele verschiedene Geräusche, dass Sarah offenbar die Einzige war, die das Wimmern des Mädchens vernommen hatte – oder zumindest die Einzige, die diesen Laut einzuordnen wusste.
Komm nicht raus!, befahl sie dem Mädchen telepathisch. Sie spürte, wie Schweißbäche zwischen ihren Schulterblättern herunterrannen. Ihr Herz klopfte wie bei einem Langstreckenläufer. Ihr Mund war so trocken, dass sich die Zunge wie Leder anfühlte.
»Wo ist die Scheißkohle?«, brüllte Wolfman abermals und ließ nun endlich das Haar der Kassiererin los.
Ohne eine Antwort zu geben, sackte die benommene, weinende Frau nach vorne auf die Theke und stützte sich mit den Ellbogen ab. Ihr Schluchzen war schrecklich anzuhören. Direkt über der linken Augenbraue klaffte eine etwa fünf Zentimeter große Wunde, die so tief war, dass man an den Rändern einen weißen Fettstreifen erkennen konnte. Vor Angst wie erstarrt und gleichzeitig in grässlicher Sorge um das unter dem Tisch versteckte Kind, konnte Sarah nur hilflos zusehen, wie das Blut aus der Wunde quoll und über das Gesicht der Frau strömte. Die Kassiererin – ihr Name war Mary, wie Sarah auf ihrem Namensschild lesen konnte – sah auf, und einen atemlosen Moment lang trafen sich ihrer beider Blicke. Die tränennassen Augen der Frau waren geschwollen und dunkel vor Angst und Schmerzen. Die Iris war von einem weichen Blau, verwaschen vom Alter. Hilf mir, schienen ihre Augen zu flehen, und der Blick brach Sarah fast das Herz. Doch sie konnte nichts tun. Wenn sie eingreifen würde, würde sie die Situation für alle nur verschlimmern.
Patsch! Wolfman verpasste Mary eine Ohrfeige, worauf ihr Kopf zur Seite fiel.
»Oh.« Mechanisch hob sie die Hand an die Wange. Sie sackte noch mehr zusammen, zitterte heftig. Ihre Augen waren riesige Teiche aus Angst.
»Wo ist die Scheißkohle?«
»Das ist alles. Ich schwöre, das ist alles.« Marys Stimme war vom Weinen so belegt und heiser, dass die Worte kaum zu verstehen waren. Als Wolfman drohend seine Hand vor ihrem Gesicht zur Faust ballte, begann sie lauter zu schluchzen und senkte den Blick auf die Theke, als hätte sie Angst, ihn anzusehen. »O Gott, bitte, haben Sie Erbarmen mit mir. O Gott, bitte, haben Sie Erbarmen.«
Aus den Augenwinkeln nahm Sarah ein weißes Flattern wahr. Die Tischdecke hatte sich bewegt, wurde ihr bewusst. Das kleine Mädchen musste die Stellung gewechselt haben, um besser sehen zu können.
Sarahs Herzschlag setzte einen Takt lang aus. Ihr Atem geriet ins Stocken. Das Flattern konnte auch den Räubern nicht entgangen sein – doch nach einigen bangen Sekunden stellte sie erleichtert fest, dass die beiden offenbar nichts bemerkt hatten.
Bleib dort unten, befahl sie dem Mädchen stumm, während sie den Blick auf die schluchzende Mary geheftet hielt. Bitte, bitte, verhalt dich um Himmels willen ruhig und komm nicht raus.
Wolfman umkreiste den Totenkopfkerl. »Hast du nicht gesagt, um diese Uhrzeit haben die hier ein paar Tausender?«
»Ja, Duke, das stimmt. Genauso ist es.«
Wolfman wurde sehr ruhig. Sein Blick schien den Totenkopfkerl zu durchbohren. Die Luft zwischen ihnen knisterte förmlich vor Anspannung. Ein neuer Schrecken durchfuhr Sarah, als ihr bewusst wurde, was sie soeben gehört hatte: Wolfmans Name lautete Duke. Sie – und Mary und das Kind – kannten jetzt seinen Namen.
Die Lage hatte sich damit deutlich verschlechtert.
»Hast du eben meinen Namen gesagt? Bist du blöd, oder was?«, zischte Duke wutentbrannt, ehe er sich wieder der Kassiererin zuwandte. »Ich werde dich nur noch einmal fragen: Wo ist das Geld?«
Mary schnappte nach Luft. Ihre Miene verriet blanke Panik.
»Sie ... sie haben das Geld heute Abend schon früher abgeholt. Kurz nach ... nach zehn. Das ist alles, was ich seitdem eingenommen habe. Ich lüge Sie nicht an. Jesus ist mein Zeuge, ich lüge Sie nicht an. « Tränen und Blut vermischten sich auf ihren Wangen. Unter der Schicht aus geronnenem Blut war ihre Haut aschgrau.
»Verdammte Scheiße!« Duke wandte sich um und warf dem Totenkopfkerl einen wütenden Blick zu. Im selben Moment erhaschte Sarah aus den Augenwinkeln erneut ein weißes Flattern. Sie konnte den angstvollen Blick des Mädchens förmlich spüren. Ihre Kehle schnürte sich zusammen. Ihr Magen verkrampfte sich.
Beweg dich nicht. Mach kein Geräusch ...
»Du kannst doch mir nicht die Schuld geben«, protestierte der Totenkopfkerl.
»Scheiße, kann ich wohl.« Dukes Blick wanderte zu Sarah. »Nimm ihr die Handtasche ab.« Während der Totenkopfkerl Sarah die Handtasche von der Schulter riss, sprach Duke sie direkt an. »Ist da was drin?«
»Ungefähr vierzig Dollar. Und Kreditkarten.« Sarah war verblüfft, wie fest ihre Stimme klang. Innerlich glich sie eher einem bebenden Häufchen Wackelpudding. Ihre Beine fühlten sich schlapp wie zu lange gekochte Spaghetti an, und ihr Herz schlug wie die Flügel eines gefangenen wilden Vogels. Sie gab sich keinen falschen Hoffnungen mehr hin: Irgendwann innerhalb der nächsten paar Minuten würden Mary und sie sterben. Und wenn das kleine Mädchen nicht ruhig und in seinem Versteck bleiben würde, würde es ebenfalls sterben.
Was immer auch passiert, lass sie das Kind nicht finden.
»Wo ist deine Handtasche?«, fragte Duke Mary. Man merkte, dass er allmählich unter Druck geriet. Der Totenkopfkerl hatte aufgehört zu klimpern. Ein leises Rascheln verriet Sarah, dass er gerade ihre Handtasche durchwühlte.
Mary hing nach wie vor zusammengesackt über der Theke. Sie atmete mühsam, blutete, zitterte, weinte. Stetig tropfte Blut aus ihrer Stirnwunde auf die schwarze Theke und besprenkelte sie mit roten Flecken.
»Im ... im hinteren Bereich.« Ihre Stimme war schwach, zitternd.
Im hinteren Bereich. Toll. Großartig. Genau dort, wo sie lieber nicht hingehen sollten. Es bedurfte keiner medialen Fähigkeiten, um zu erkennen, dass »im hinteren Bereich« eine üble Sache war. Solange sie hier vorne waren, gab es zumindest die Chance, dass draußen ein Kunde vorfuhr, der die Situation erkennen und die Polizei benachrichtigen würde.
»Wie viel Geld ist in deiner Tasche?« Als Mary nicht sofort antwortete, packte Duke sie am Arm und schüttelte sie. »Wie viel?«
»Ein paar Dollar.«
»Scheiße.« Er warf dem Totenkopfkerl einen giftigen Blick zu. »Dieses ganze Ding ist nichts als ein Haufen Scheiße.«
Er trat einen Schritt zurück, riss die Waffe hoch und schoss Mary ins Gesicht. Einfach so. Ohne jede Vorwarnung. Sarah klappte der Unterkiefer runter, und noch ehe sie überhaupt begriff, dass es jetzt passierte, zerfetzte eine Explosion ihr Trommelfell, und Marys linke Gesichtshälfte war plötzlich weg. Blut und Gewebeteile stoben in einer Wolke aus rotem Nebel nach hinten, besprenkelten die Zigarettenstangen und den Überwachungsmonitor und den zweiten der beiden großen, runden Spiegel und alles andere jenseits der Theke mit scharlachroten Spritzern. Mary kreischte nicht, schrie nicht auf. Sie fiel einfach wie ein Stein um, verschwand hinter der Theke, war nicht mehr zu sehen. Der Aufschlag ihres Körpers musste ein dumpfes Geräusch verursacht haben, doch das grässliche Klingeln in Sarahs Ohren übertönte alles andere. Ein neuer Geruch – die Übelkeit erregende Mischung aus Blut und Körperausdünstungen, wie sie bei einer frischen Leiche auftrat – stieg ihr in die Nase.
Ihr wurde übel. Ihr Herzschlag setzte aus. Der Sack mit Hundefutter glitt ihr aus den plötzlich tauben Armen. Auch diesen Aufprall hörte sie nicht. Alles, was sie hören konnte – und die Laute waren teilweise überdeckt von dem Geklingel in ihren Ohren – waren die unablässigen Flüche des Totenkopfkerls und ein hoher klagender Laut, der, wie sie annahm, ihrer eigenen zugeschnürten Kehle entspringen musste.
Doch plötzlich dämmerte ihr, dass ihre Annahme falsch war, und gleichzeitig dämmerte ihr voller Entsetzen, woher der Laut kam. Ihr Blick glitt zur Seite. Das Kind ...
»Mary! Ma-riiiie!«
Sarah schlug das Herz bis zum Hals, als das kleine Mädchen unter dem Tisch hervorschoss und auf die Kasse zuraste, wobei das verfilzte dunkle Haar wie eine Fahne hinter ihm herwehte. Durch das plötzliche Aufspringen des Mädchens fiel der Tisch mit einem Knall um. Schachteln mit Donuts segelten durch die Luft, landeten in alle Richtungen verstreut auf dem Boden.
»Was, zum Teufel ...?« Duke wirbelte herum. Der Totenkopfkerl, dem sein letzter Fluch im Halse stecken blieb, tat es ihm gleich. Für den Bruchteil einer Sekunde waren beide offensichtlich zu verdattert, um irgendetwas anderes tun zu können, außer das Mädchen, das, wie eine Sirene kreischend, auf sie zustürmte, mit offenen Mündern anzustarren.
»Scheiße!« Duke erwachte aus seiner kurzen Erstarrung. Er hob die Waffe und zielte auf das schreiende Kind.
Kapitel 2
»Nein!«, kreischte Sarah. Angetrieben von einem Adrenalinstoß, drehte sie sich um und schubste Duke so fest sie konnte. Von dem Angriff überrumpelt, da seine Aufmerksamkeit auf das Mädchen gerichtet gewesen war, taumelte er gegen die Theke – und ließ seine Waffe fallen. Mit hellem Klappern landete sie auf dem Boden und rutschte auf das Regal mit den Chips in der Mitte des nächsten Gangs zu.
Sarah konnte es kaum fassen.
Eine Chance. Sie hatten eine Chance ...
Das Herz klopfte ihr bis zum Hals, und das Blut dröhnte in ihren Ohren, als sie die Chance ergriff und an dem Totenkopfkerl vorbeisprang, noch bevor dieser überhaupt blinzeln konnte. Sie packte das kleine Mädchen, das mittlerweile fast bei ihnen angekommen war, am Arm. Noch während das nach wie vor schreiende Kind sie mit großen, braunen, entsetzten Augen anstarrte, drehte sich Sarah blitzschnell um und zog das Kind, dessen Vorwärtsbewegung ausnutzend, in einem wahnwitzigen Spurt hinter sich her in Richtung der Tür.
»Schnell!«
Sarah achtete nicht darauf, ob das Mädchen sich sträubte oder ob es sich freiwillig mitschleifen ließ. Es war klein, mit zarten Knochen wie ein Vögelchen, federleicht und, wie Sarah schätzte, nicht älter als sechs oder sieben Jahre. Alles war in Bewegung. Ringsum herrschten nur Lärm, Verwirrung und Tumult. Das Kind kreischte weiterhin schrill wie eine Sirene, als Sarah es hinter sich herschleifte. Der Totenkopfkerl fluchte, drehte sich um die eigene Achse, hob seine Waffe und versuchte, Sarah und das Kind ins Visier zu nehmen. Nachdem Duke, ebenfalls einen Schwall Flüche ausstoßend, nach seiner Waffe gehechtet war, sprang er wieder auf wie ein Turner nach einem Flickflack.
»Erschieß sie! Erschieß sie!«, brüllte er dem Totenkopfkerl zu.
»Mach ich! Mach ich!« Die Todesangst schärfte Sarahs Sinne, sodass sie alles intensiver wahrnahm. Der kalte Luftstrom aus der Klimaanlage kam ihr nun wie der eisige Hauch des Todes vor. Neben den Schreien und dem Brüllen und dem Trommeln ihres eigenen Herzens hörte sie jeden einzelnen Schritt der Räuber, jeden einzelnen ihrer Atemzüge, jedes metallische Klicken ihrer Waffen. Der ekelerregende, süßliche Gestank des Todes gewann an Stärke, breitete sich pilzartig aus und tränkte die ganze Luft. Die Umgebung verschwamm zu einem fließenden Kaleidoskop aus Farben, als Sarah um ihr Leben – und um das des Kindes – rannte. Die Wärme des zarten, zerbrechlichen Handgelenks des kleinen Mädchens wurde der einzige reale Punkt in diesem grauenhaften Albtraum. Ihre eigenen Bewegungen schienen wie in Zeitlupe abzulaufen, als würde sie sich durch brusthohes Wasser kämpfen. Ihr Arm fühlte sich schwer wie Blei an, als sie ihn in Richtung des Türgriffs ausstreckte, der jetzt nur noch wenige Zentimeter von ihren Fingerspitzen entfernt war. Die Räuber waren hinter ihr, sie konnte ihr Spiegelbild in dem schimmernd schwarzen Schaufenster sehen.
Der Totenkopfkerl zielte mit seiner Waffe. Als Sarah die Bewegung im Fenster sah, begann sie gellend zu schreien. Ihr Herz machte einen Sprung. Ihr Puls raste. Duke kam auf sie zugerannt. Die Hand, mit der er die Waffe hielt, fuhr nach oben und ging knapp über der Hüfte in Position.
Sarah gefror das Blut in den Adern. Gleich würde sie spüren, wie sich eine Kugel in ihren Rücken bohrte.
Sie fasste nach dem Türgriff und fühlte kühles Metall unter der flachen Hand, als sie die schwere Tür weit aufschob und dann hinausrannte und über den Gehsteig raste. Die schwüle, dampfende Augustluft umfing sie mit weichen Armen. Sterne funkelten am Himmel. Hoch oben hing ein fahler Halbmond. Hinter ihr war das schreiende Kind, das sich gewichtslos und unkörperlich wie ein in der Luft schwebender Drachen anfühlte.
Weiter, weiter, weiter ...
Ein Streifenwagen-Quartett mit schrillenden Sirenen und roten Lichtern, die wie Leuchtfeuer in der tintenschwarzen Nacht blitzten, kam aus allen vier Himmelsrichtungen auf den Parkplatz zugerast.
Danke, G–
Noch während sie ihr Dankgebet gen Himmel sandte, fühlte Sarah einen gewaltigen Schlag, als hätte ihr jemand einen Baseballschläger an die Seite des Kopfes geknallt. Der Schmerz explodierte in ihrem Schädel. Die Wucht des Einschlags zog ihr die Beine weg, brachte sie ins Taumeln. Gebannt beobachtete sie, wie sich nun eine ganze Armada aus Streifenwagen dem Geschehen näherte, während gleichzeitig ein Inferno aus Glassplittern auf sie niederprasselte.
Die Schaufensterscheibe hinter ihr war zerborsten.
Das Rat-tat-tat eines Schusswechsels explodierte wie eine Reihe Knallfrösche dicht über ihrem zu Boden fallenden Körper, und sie zog instinktiv den Kopf ein. Dann knallte sie auf das Pflaster, kam mit dem Kopf so hart auf, dass sie Sterne sah. Sie rollte über den unnachgiebigen Asphalt. Ihre Arme, ihre Knie und ihr Kinn waren aufgeschürft und brannten. Stöhnend blieb sie liegen und rollte sich dann instinktiv zu einer Kugel zusammen. Etwas Warmes und Feuchtes strömte über ihre rechte Wange. Blut, erkannte sie, als sie mit den Fingern darüber strich und dann ihre roten Fingerspitzen sah. Erst da dämmerte ihr die erschreckende Wahrheit: Es war ihr Blut.
Eine Welle von Panik erfasste sie. Oh, mein Gott, ich habe einen Schuss abbekommen ...
»Zwei Männer! Drüben, auf der linken Seite!« Die Stimme eines Mannes. Eines Cops. Nicht sehr nah.
»Die versuchen abzuhauen!«
»Halt! Stehen bleiben! Halt!«
»Achtung! Er hat eine Waffe! Scheiße!«
Ein einzelner Schuss. Dann eine ganze Salve. Ein Schrei.
»Maurice!« Dukes Ruf glich einem ängstlichen Wimmern.
»Lassen Sie die Waffe fallen! Waffe fallen lassen!«
»Okay, okay! Nicht schießen! Erschießen Sie mich nicht!« Es war Dukes Stimme, und sie war heiser vor Angst. Ein entferntes Klonk ertönte, als habe er die Waffe fallen gelassen. Von dem Totenkopfkerl war nicht ein Laut zu hören.
»Hände hoch!«
Bis auf ein Gewirr von schimmernd schwarzen Schuhen, die sich hektisch hin und her bewegten, konnte Sarah nichts von den Vorgängen erkennen. Starr vor Schreck und kaum in der Lage zu atmen, lag sie noch immer dort, wo sie hingefallen war.
Es tut weh. Es tut weh ...
Sekunden später blieb ein Paar dieser schimmernd schwarzen Schuhe wenige Zentimeter vor ihrer Nase stehen und gleich darauf ein zweites Paar.
»Alles klar, es ist Sarah Mason.« Ein Uniformierter kauerte sich neben sie. Die Dinge in ihrer Umgebung kamen in Wellen auf sie zu und wichen wieder zurück, sodass sie sich ihrer Wahrnehmung nicht sicher war, aber sie glaubte, Art Ficus zu erkennen, einen Streifenbeamten, den sie ganz gut, wenn auch nur oberflächlich kannte. Ihre kurzen Begegnungen waren immer herzlich gewesen. »Sieht aus, als sei sie angeschossen worden.«
»Tja, wird nicht viele geben, die darüber traurig sind«, brummte der andere Uniformierte und ging weiter. Die Stimme war Sarah vertraut: Es war die Stimme von Brian McIntyre. Natürlich. Zuletzt hatte sie diese Stimme heute nach dem Mittagessen gehört, als sie sich seine aufgezeichnete Aussage angehört hatte. Sie hatte die Stimme heute Mittag genauso wenig gemocht wie jetzt.
Art berührte ihre Schulter, hob dann ihr Handgelenk hoch und fühlte ihren Puls. Ihr Arm war schlaff. Erschreckend schlaff. Doch sie konnte seine Berührung fühlen.
»Sarah. Können Sie mich hören?«
Ja. Sarah versuchte zu antworten. Zu ihrer Überraschung entdeckte sie, dass ihr Mund nicht funktionierte. Er öffnete sich zwar, doch es drang kein Laut daraus hervor. Sie bewegte die Lippen, die Zunge, versuchte, den ekelhaften Geschmack nach rohem Fleisch zu ignorieren, der von ihrem eigenen warmen Blut, das ihr in den Mund lief, stammte.
Sterbe ich? Fühlt sich so Sterben an?
Alle Angst, alle Anspannung waren von ihr abgefallen. An ihre Stelle waren Neugier, Ungläubigkeit und ein Hauch von Traurigkeit getreten. Die ganze Situation erschien völlig unwirklich.
Ich will nicht sterben.
Der Gedanke war stark, kraftvoll, entschlossen. Ohne einen Funken von Zweifel. Trotz allem wollte sie nun, da es hart auf hart ging, definitiv noch weiterhin unter den Lebenden weilen. Aber hatte sie überhaupt eine Wahl?, kam ihr plötzlich in den Sinn. Hatte man überhaupt jemals eine Wahl?
Sarah hatte das Gefühl, es gäbe irgendetwas ungeheuer Wichtiges, woran sie sich erinnern und das sie Art mitteilen müsste, ehe es womöglich für immer in der Schwärze, die schleichend von ihr Besitz zu ergreifen drohte, verloren wäre. Doch so sehr sie sich anstrengte, es fiel ihr nicht ein, was es sein könnte.
»Wir brauchen hier dringend einen Notarzt!«, schrie Art und ließ ihr Handgelenk los. Gleich darauf spürte sie seine Finger an ihrem Hals, direkt unter dem Ohr. Ein winziger Teil ihres Verstandes, der nach wie vor funktionierte, sagte ihr, dass Art wahrscheinlich Probleme hatte, einen Puls bei ihr zu finden, weil er ständig danach suchte. Dann bemerkte sie, wie er wild den Arm in der Luft herumschwenkte, um Aufmerksamkeit zu erlangen, und sie hatte den Eindruck, dass er über das Ergebnis seiner Pulsuntersuchung nicht allzu glücklich war. »Ein Notarzt! Schnell!«
Sie hörte seine Stimme, hörte die Rufe im Hintergrund, die Sirenen und das hektische Durcheinander, doch alle Geräusche schienen zurückzuweichen, als würde sie sich immer weiter von ihnen entfernen.
Sah so Sterben aus? Schwebte man einfach ins All hinaus? Eigentlich gar nicht so übel ...
Plötzlich erinnerte sich Sarah, was an den Rändern ihres Bewusstseins gezupft und gezerrt hatte, und sie schnappte nach Luft. Das Erschrecken, das mit dieser Erinnerung einherging, rüttelte sie schlagartig aus ihrer Apathie.
»So ist es gut«, murmelte Art. »Atmen, los, atmen!«
»Das Mädchen«, brachte Sarah mit geradezu übermenschlicher Anstrengung hervor. Das Kind hatte gekreischt, als Sarah getroffen worden war. Sie konnte sich noch an die schrillen Laute erinnern und wie sich das zarte Handgelenk des kleinen Mädchens angefühlt hatte. Dann war der Schlag auf ihren Kopf erfolgt. Als sie zu Boden getaumelt war, war ihr das Handgelenk des Mädchens entglitten, und danach hatte sie von dem Kind nichts mehr gehört oder gesehen. Keine Schreie. Nichts.
Wo ist das Mädchen?
Die Teerdämpfe, die von dem noch aufgeheizten Straßenbelag aufstiegen, durchsetzt von den schwächeren Gerüchen nach Autoabgasen, Benzin, Schießpulver und ihrem eigenen Blut, stiegen ihr in die Nase, glitten ihr die Kehle hinunter und verursachten ihr Brechreiz. Sie musste all ihre Willenskraft aufbieten, um bei Bewusstsein zu bleiben. Sie war benommen, und ihr Verstand lief lediglich auf Sparflamme, doch sie war sich so gut wie sicher, dass das kleine Mädchen genau in dem Moment zu schreien aufgehört hatte, als Sarah von dem Schuss getroffen worden war. Danach war nichts mehr zu hören gewesen. Nicht ein Pieps. Ein eisiger Schauder strich ihr über den Rücken, als ihr klar wurde, welche Schlussfolgerungen das nach sich zog. Was war mit dem kleinen Mädchen geschehen?
Findet sie. Sarah spürte, wie sich ihr Mund bewegte, doch es kam kein Laut hervor.
»Nicht sprechen. Das strengt Sie zu sehr an.« Art nahm die Finger von ihrem Hals. Er stand auf und winkte ungeduldig. »Verdammt noch mal. Hierher!«
War das Kind ebenfalls angeschossen? Lag es hier irgendwo blutend und verletzt herum? Es war tiefe Nacht, der Parkplatz war voller dunkler Schatten, ringsum herrschte nur Lärm und Hektik – da könnte man ein kleines, zu einem Häufchen zusammengerolltes Kind leicht übersehen.
»Wo ist ... das Mädchen?« Ihrer Ansicht nach war die Frage laut und deutlich zu vernehmen.
Keine Reaktion. Hatte Art sie gehört? Hatte sie überhaupt gesprochen? Ihre Lippen hatten sich bewegt, aber vielleicht war wieder kein Laut hervorgedrungen.
Verzweifelt ließ sie den Blick schweifen, so gut ihr das im Liegen möglich war, doch viel konnte sie nicht erkennen. Der Supermarkt lag hinter ihr. Vor ihr befanden sich Arts Beine, ein Stück schwarzen Asphalts, die in Inseln aus Halogenlicht liegenden Zapfsäulen und die Kreuzung mit der Ampel, die im Moment gerade auf Grün schaltete. Auf der anderen Straßenseite befanden sich ein chinesisches Restaurant und ein Gelände mit Gebrauchtwagen, beide dunkel und bereits geschlossen. Ein Dutzend oder mehr Streifenwagen und zwei Ambulanzwagen, alle mit heulenden Sirenen und blinkenden Lichtern, blockierten den Parkplatz des Ladens und die beiden längs verlaufenden Straßen. Noch während Sarah die Szenerie beobachtete, kamen weitere Streifenwagen angerast. Ein Polizei-Van blieb mit quietschenden Reifen mitten auf dem Parkplatz stehen und spuckte eine Handvoll Uniformierter aus, die sofort loszurennen begannen. Helme, Schutzanzüge, Gewehre – war das ein SWAT- Team? Die Polizei legte sich ja mächtig ins Zeug. Weiter hinten, jenseits der blitzenden Lichter der Ambulanzwagen, war es unmöglich, etwas zu erkennen, doch Sarah hatte den Eindruck, dass sich auf der anderen Straßenseite vor der People’s Bank, die hier ihre Niederlassung hatte, eine Schar Gaffer versammelt hatte. Wohin sie auch blickte, überall war Chaos – aber von dem Kind keine Spur.
Sarah versuchte, den Kopf zu heben. Sofort jagte ein stechender Schmerz wie eine abgeschossene Flipperkugel durch ihren Schädel und vereitelte ihr Vorhaben. Heftiger Schwindel rollte wie eine sich brechende Woge über sie hinweg. Keuchend und gegen ihren aufsteigenden Brechreiz ankämpfend, blieb sie wieder reglos liegen. Ihr linkes Ohr war flach gegen den Asphalt gepresst. Ihr wurde bewusst, dass sie die Sirenen, die Rufe und die Schritte jetzt weniger als Geräusche, sondern eher als Vibrationen wahrnahm.
Und ihr wurde auch bewusst, dass ihr die Welt mit jeder Sekunde, die verstrich, immer mehr entglitt. Solange sie sich nicht bewegte, hatte sie vielleicht eine winzige Chance, wach zu bleiben, bei Bewusstsein. Wenn sie sich nicht bewegte, merkte sie, tat ihr auch der Kopf nicht mehr weh. Er kribbelte nur und fühlte sich irgendwie komisch an. Wie ihr ganzer Körper.
Womöglich kein gutes Zeichen.
Doch ehe sie loslassen und sich der Schwärze hingeben könnte, die wie eine anrollende Flut gegen den Rand ihres Bewusstseins schwappte, musste sie sicher sein, dass man sich um das Kind kümmerte. Bis man das Mädchen gefunden hätte, musste sie alle Kräfte mobilisieren, um durchzuhalten.
»Wir haben ein Opfer im Laden«, schrie jemand hinter ihr.
Natürlich, sie hatten Mary gefunden.
Eine Bahre auf Rädern ratterte vorbei, dann noch eine. Noch mehr Leute – Notärzte, Sanitäter – kamen an und kauerten sich neben sie. Jemand umfasste ihr Handgelenk. Finger strichen durch ihr Haar ...
Sarah versuchte es erneut, mobilisierte sämtliche Reserven.
»Das Mädchen ...«
»Was für ein Mädchen?« Die Notärztin presste eine Mullbinde fest an Sarahs Kopf, gleich hinter ihrem rechten Ohr. Es hätte wehtun sollen, tat es aber nicht. Komisch, dass sie sich Sorgen machen musste, weil sie keinen Schmerz fühlte.
»Legt ihr die Sauerstoffmaske über«, rief die Ärztin über die Schulter hinweg.
»Sie war bei mir.« Es erforderte Sarahs ganze Kraft, die Worte hervorzupressen. »Ein kleines Mädchen. Mit mir im Laden ...«
Eine Sauerstoffmaske schob sich über ihren Mund und ihre Nase, schnitt ihr das Wort ab. Der plötzliche Zufluss von wunderbar frischer, süßer Luft lenkte sie ab. Sie atmete tief ein, einmal, zweimal. Die bedrohliche Schwärze wich ein wenig zurück. Dafür nahm der Schmerz wieder zu.
»Hat jemand ein kleines Mädchen gesehen?«, schrie die Ärztin, während um Sarahs Hals eine Halskrause befestigt wurde.
Die Antworten, die Sarah hörte, waren alle negativ. Panik wallte in ihr auf, brachte ihren Herzschlag zum Rasen. Wo war das Kind? Es musste irgendwo in der Nähe sein. Wenn sie endlich nach dem Kind suchen würden, würden sie es sicherlich finden ...
Sie stieß drängende Laute unter der Maske aus.
»Fertig zum Abtransport?«, fragte ein Mann, während eine Trage neben ihr auf das Pflaster geknallt wurde.
»Ja«, erwiderte die Ärztin. Nein!, brüllte Sarah innerlich. Bevor sie nicht wusste, was mit dem Kind geschehen war, würde sie nirgendwohin gehen.
Sie versuchte, nach der Maske zu greifen, versuchte, den Kopf zu heben, versuchte, ihnen zu sagen, dass sie warten mussten, das Kind finden mussten. Ihre Bewegungen waren schnell, instinktiv – und ein riesiger Fehler. Der darauf einsetzende Schmerz war so intensiv, so qualvoll, dass ihr nur noch der Bruchteil einer Sekunde blieb, um ihren Fehler zu erkennen, bevor die wirbelnde Schwärze sie mit sich riss.
Zu ihrer Überraschung war das nächste kleine Mädchen, das Sarah sah, ihre eigene Tochter, Alexandra. Alexandra Rose Mason. Spitzname »Lexie«. Ihr stupsnasiges, sommersprossiges, pausbackiges Kind sah sie direkt an, die tiefblauen Augen weit und ernst, der erdbeerrote Mund ohne ein Lächeln. Sarah wurde von schmerzhafter Sehnsucht und purer Liebe durchflutet, als ihr Blick auf diesem süßen kleinen Gesicht ruhte. Begierig saugte sie jedes winzige Detail an Lexies Erscheinungsbild in sich auf. Ihr Gesicht war frisch gewaschen, und ihre langen, kupferroten Locken waren mit schmalen Satinbändern, die beinahe dasselbe Blau wie ihre Augen hatten, zu zwei ordentlichen Zöpfen gebunden. Sie stand vollkommen reglos da, absolut untypisch für ein fünfjähriges Mädchen, das der Inbegriff von Bewegung war, das durch die Welt rannte oder tanzte oder hüpfte (niemals normal ging), das Schlagball, Fußball, Schwimmen, Zelten, Reiten und einfach alles liebte, was mit Bewegung und Aufenthalt im Freien zu tun hatte. Normalerweise hatte Lexie Schmutzflecken im Gesicht, aufgeschrammte Knie und verfilzte Haare, doch jetzt sah sie in ihrem babyblauen Lieblings-T-Shirt und dem Jeansrock so aus, als sei sie gerade der Badewanne entstiegen.
Aus Erfahrung wusste Sarah, dass solch eine Perfektion nicht lange anhalten würde.
»Hallo, Mommy«, sagte Lexie lächelnd. Lexie lächelte genauso wie sie alles machte: aus vollem Herzen. Ihre Augen funkelten, ihre Wangen erglühten rosig, und ihre Lippen dehnten sich zu einem so breiten Grinsen, dass Sarah nahezu jeden einzelnen Zahn in ihrem Mund erkennen konnte – einschließlich des lockeren Schneidezahns, der jeden Tag herausfallen müsste.
Sarah lächelte zurück, wagte es aber nicht, auch nur ein Wort zu sagen.
»Emma hat Kuchen mitgebracht«, fuhr Lexie aufgeregt fort, und die warme Freude, die Sarah zunächst bei Lexies Anblick empfunden hatte, begann zu schwinden. »Heute ist ihr Geburtstag. Sie ist sechs geworden. Wann ist mein Geburtstag?«
Am siebenundzwanzigsten Oktober.
»Werde ich da sechs?«
Ja.
»Dann sind Emma und ich wieder gleich alt«, sagte Lexie. »Aber jetzt ist sie älter. Das hat sie mir gesagt.« Sie krauste die Stirn, als sei das neu erreichte Alter ihrer Freundin ein Ärgernis, doch gleich darauf klarten sich ihre Züge auf, und ihr sonniges Gemüt gewann wieder die Oberhand. »Meinst du, ich kriege heute einen Preis?«
Heute war der Tag, der das Ende der Schlagballsaison einleitete. Die Feier fand im Waterfront Park statt, mit einem Picknick und der Preisverleihung. Ohne dass die Kinder es wussten, hatten sich die Eltern bereits mit den ehrenamtlich arbeitenden Trainern in Verbindung gesetzt, um sicherzustellen, dass dieses Jahr jedes Kind mit einer kleinen, blau-goldenen Trophäe bedacht wurde. Bei dieser Erinnerung durchzuckte Sarah ein bittersüßer Stich. Lexie liebte Trophäen. Bisher hatte sie schon zwei Preise gewonnen, einen für den erfolgreichen Abschluss ihres Schwimmunterrichts und einen für ihre Fußballleistungen im letzten Frühjahr. Die Trophäen hatten einen Ehrenplatz auf ihrem Nachtkästchen, auf dem für eine dritte Trophäe eigentlich kein Platz mehr war, nicht einmal für den kleinen Preis, den sie heute bekommen würde. Vielleicht könnte man Lexie überreden, ihre Preise ins Bücherregal im Wohnzimmer zu stellen, doch Sarah bezweifelte das. Ihr einziges Kind hatte sehr genaue Vorstellungen davon, wie die Dinge zu sein hatten. Und sie hatte nun einmal entschieden, dass ihr Nachtkästchen der geeignete Ort für ihre Trophäen war.
Doch mit diesem Problem konnte man sich später befassen. Im Moment war Sarah nur bestrebt, ihrer Tochter die Freude über die kommende Überraschung nicht zu verderben.
Ich weiß es nicht, mein Schatz. Das wird sich zeigen.
»Darf ich mir jetzt ein Stück Kuchen holen?«
Kalte Angst jagte durch Sarahs Adern.
Nein. Warte auf mich.
»Es ist mein Lieblingskuchen. Schokoladenkuchen mit Schokoglasur. Mit rosafarbenen Rosen darauf. Bitte, Mommy, bitte!«
Nein, nein, nein, schrie Sarah innerlich, doch Lexie hatte eindeutig etwas anderes gehört, denn sie schenkte Sarah ein strahlendes Lächeln und hopste und tänzelte davon.
Außerstande sie am Fortgehen zu hindern, beobachtete Sarah mit ersticktem Keuchen, wie die hopsende Gestalt immer kleiner wurde. Nach ein paar Sekunden ging Lexie zum Hüpfen über, eine neue Fähigkeit, die sie erst seit einigen Tagen beherrschte. Alle anderen Kinder können hüpfen, hatte Lexie ihr traurig am Ende des Kindergartenjahres erzählt. Also hatte Sarah den größten Teil des Sommers damit verbracht, in der knappen Freizeit, die ihr nach der Arbeit blieb, mit ihrer Tochter auf den Gehsteig vor ihrem Wohnblock zu gehen und sie in die Kunst des Hüpfens einzuweihen. Nach wochenlanger Anstrengung hatte sich der Erfolg pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres und dem großen, mit Spannung erwarteten Tag von Lexies Einschulung eingestellt.
»Ich heb dir ein Stück auf, Mommy«, rief Lexie ihr über die Schulter hinweg zu und schenkte ihr ein letztes strahlendes Lächeln.
Sarah spürte, wie ihr Herz in zwei Teile zerriss.
Komm zurück, Liebling. Bitte, bitte, komm zurück.
Doch Lexie ging weiter, setzte in seliger Unwissenheit ihren Weg fort.
Während Sarah beobachtete, wie sich ihre Tochter immer weiter entfernte, empfand sie einen so gewaltigen Schmerz, dass selbst das Atmen wehtat. Mit ihren wippenden Zöpfen und den molligen kleinen Beinen, die sich mit diesen federnden Sprüngen, auf die sie so stolz war, vorwärtsbewegten, sah Lexie so glücklich aus, so süß, so unbeschwert ...
Nein, nein, nein, nein.
Tränen tropften aus Sarahs Augen. Klagende, wimmernde Laute entwichen ihrer plötzlich heiseren Kehle. Ihr Körper krümmte sich im erfolglosen Bemühen, der grauenhaften Angst, die jeden Moment über ihr zusammenschlagen würde, zu entfliehen.
Lexie. Lexie.
Doch wie Sarah gewusst hatte, drehte sich Lexie nicht mehr um. Die Vergangenheit ließ sich nicht neu gestalten. Sie war unabänderlich, in Stein gemeißelt, für immer vorbei.
Sarah wurde von ihrem eigenen harten Schluchzen wach. Sie atmete zitternd aus, öffnete blinzelnd die Augen, und Lexie war verschwunden. Wieder verschwunden.
Eine schreckliche Einsamkeit erfüllte sie, kälter, dunkler und öder als die Arktis um Mitternacht.
Ein Traum. Es war lediglich ein Traum gewesen. Natürlich.
Inzwischen solltest du dich eigentlich daran gewöhnt haben, sagte sie sich bitter, während sie nach Luft rang, da sie unter der zermalmenden Last, die sich auf ihre Brust gesenkt hatte, zu ersticken drohte. Doch sie hatte sich nicht daran gewöhnt, und wieder war der Schmerz beinahe nicht auszuhalten. Er hieb seine adlergleichen Klauen in ihr Herz und riss es blutig. Ihr Körper zitterte, ihr Atem kam keuchend und stoßweise, und ihre Wangen waren nass vor Tränen.
Lexie.
Sie stöhnte, hörte ihr Stöhnen und verstummte.
Okay, konzentrier dich. Lass den Schmerz weiterziehen. Das kannst du.
Doch trotz ihrer wilden Entschlossenheit wollte der Schmerz nicht von ihr weichen. In diesen ersten Sekunden nach dem Aufwachen konnte Sarah nicht die stählerne Willenskraft aufbringen, die notwendig war, um die Qualen aus ihrem Bewusstsein zu zwingen. Das einzig Gute daran war, dass der seelische Schmerz den körperlichen Schmerz, den sie verspürte, völlig bedeutungslos erscheinen ließ. Ihr Herz, eine zuckende Masse aus blanken Nervenenden, brüllte vor Höllenqualen. Was spielte es, im Vergleich dazu, noch für eine Rolle, dass praktisch jede Stelle ihres Körpers wehtat oder dass sich ihre rechte Kopfhälfte dick und geschwollen anfühlte oder dass sie rasende Kopfschmerzen hatte? Nichts davon hatte irgendeine Bedeutung angesichts der monströsen Qual, die tief in ihrer Seele einen dauerhaften Wohnsitz genommen hatte.
Wird je eine Zeit kommen, in der es nicht mehr so wehtut?
Sarah war sich ziemlich sicher, dass sie die Antwort bereits kannte: Nein, nicht in einer Million Leben.
Sie konnte nichts anderes tun, als die Zähne zusammenzubeißen und weiterzumachen.
Es erforderte einen enormen Kraftaufwand, um sich von den noch immer nachhallenden Traumbildern abzuwenden, doch es gelang ihr, indem sie sich fest auf die Gegenwart konzentrierte. Das war, wie sie aus Erfahrung wusste, der einzige Weg, um irgendwie zurechtzukommen, weiterzuleben.
Okay, eins nach dem anderen. Warum fühlte sie sich, als sei sie von einem Lastwagen überrollt worden? Das war im Moment die vorrangige Frage, und Sarah zwang sich, in den verschwommenen Tiefen ihrer Erinnerung nach einer Antwort zu forschen. Sie lag auf dem Rücken, den Kopf leicht erhöht, auf einer weichen, federnden Unterlage, bei der es sich, wie sie vermutete, um ihr Bett handelte. Eine Zeit lang starrte sie in die sie umgebende Schwärze und überlegte, warum das Zimmer so kalt war, woher der leichte Essiggeruch stammte und was die Ursache für das rhythmische Piepsen sein mochte, das von irgendwo hinter ihrem Bett zu kommen schien. Mit Erschrecken wurde ihr bewusst, dass die Schwärze ringsum nicht vertraut war. Das war nicht ihr Schlafzimmer, war nicht ihr Bett. Und während sich ihre Augen an ihre Umgebung anpassten, erkannte sie auch, dass die Dunkelheit keineswegs vollkommen war. Sie war von einem unheimlichen grünen Glühen durchsetzt, das gerade genug Licht erzeugte, um Schatten und Formen und Bewegungen erkennen zu lassen.
Als ihr die Konsequenz dessen bewusst wurde, setzte ihr Herzschlag einen Takt lang aus. Sie spannte sich an und wimmerte dann vor Schmerzen, während sie mit weit aufgerissenen Augen weiterhin in die Dunkelheit starrte. Denn ihr war klar geworden, dass sie nur deshalb Formen und Schatten und Bewegungen erkennen konnte, weil sich in dieser dunklen Zimmerecke etwas verdichtete, aufragte, sich bewegte. Den Blick auf die Gestalt geheftet, die plötzlich vor ihren Augen Substanz annahm, musste Sarah hilflos mit ansehen, wie die große, breite Gestalt eines Mannes plötzlich aus der Dunkelheit hervortrat und sich dem Bett näherte, auf dem sie lag.
Kapitel 3
»Bist du wach?«
Die grollende Stimme war ihr vertraut: Jake. Sarahs angespannte Muskeln entkrampften sich, und sie atmete mit einem leisen Seufzen aus. Im Verlauf der letzten sieben Jahre war Jake Hogan nach und nach zu einem engen Freund geworden, beinahe schon so etwas wie Familie. Er hatte sie durch die schlimmste Zeit ihres Lebens begleitet, hatte ihr mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Er war die starke Schulter gewesen, als sie geglaubt hatte, nicht mehr weiterleben zu können, und als sie sich mühsam wieder hochzurappeln begann. Und sie hatte ihn durch eine Scheidung und diverse andere Krisen begleitet, die er zum Großteil seiner extremen Halsstarrigkeit zu verdanken hatte. Sie kannten die meisten ihrer Geheimnisse, hatten Freude am Angeln, an den Hahnenrennen der Universität von South Carolina und an schwachsinnigen Horrorfilmen und hatten allgemein viel Spaß miteinander, obwohl sie sich aufgrund von Zeitmangel immer seltener sahen. Da Jakes Detektei zahlreiche Untersuchungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchführte und er sich dadurch mehr oder weniger in denselben Kreisen wie Sarah bewegte, konnten sie sich einander auch beruflich unterstützen. Für Sarah hatte die Beziehung auch den Vorteil, dass sie, wenn sie gelegentlich für eine Veranstaltung einen männlichen Begleiter brauchte, üblicherweise Jake zu dieser Gefälligkeit bewegen konnte. Von Nachteil war seine ausgeprägte Allergie gegen stundenlanges Quatschen am Telefon und gegen Einkaufszentren.
»Hey.« Ihre Stimme hörte sich matt an. Ihre Zunge war dick und pelzig, und sie hatte zweimal schlucken müssen, ehe sie diese Silbe herausbrachte. Außerdem war nicht ganz klar, ob sich das Zimmer oder ob sie sich bewegte. Oder ob irgendetwas in ihrem Kopf kaputt war – sehr kaputt.
Sie tendierte zu Letzterem.
»Du hast ganz schön laut gestöhnt. Hast du Schmerzen?« Jake knipste die Lampe über dem Bett an. Sarah blinzelte, zuckte bei der plötzlichen Helligkeit zusammen. Einen Moment lang konnte sie nur die leicht verschwommenen Umrisse von Jake sehen. Mit seinen einen Meter fünfundachtzig und den hundertzehn Kilo füllte er nahezu ihr gesamtes Gesichtsfeld aus. Seiner kräftigen Statur mit dem vorgewölbten Brustkorb und den breiten Schultern sah man noch den Footballstar der Highschool an, wenn er auch nicht mehr ganz so in Form war. Er war mit seinen neununddreißig Jahren vielleicht etwas füllig um die Mitte, doch das war der einzige Makel. Seine Gesichtszüge waren von ungehobelter Männlichkeit, sein Kiefer war breit und von bulldoggenartiger Aggressivität, und seine kakaobraunen Augen wie auch der schmallippige Mund waren selbst im entspannten Zustand hart. Er hatte einen Schuss Irokesenblut in sich, und das zeigte sich an seiner markanten Nase, der Rabenschwärze seiner kurz geschorenen Haare und dem dunklen Farbton seiner Haut.
»Ein wenig.« Die Worte, die sich ihrer schmirgelpapiertrockenen Kehle entrangen, waren kaum mehr als ein Krächzen. Ihr war übel, sie fühlte sich desorientiert und einfach nur miserabel, und ihre Denkprozesse gingen so langsam vonstatten, dass sie beinahe das Klicken der Schaltstellen in ihrem Gehirn zu hören vermeinte. Ihre Benommenheit rührte sicher auch daher, dass ihre Gedanken noch in den letzten Spinnweben des Traums verfangen waren. Lexie ... Nein. Sie würde nicht dorthin gehen. Nicht bewusst. Nicht, solange es nicht sein musste. Nicht schon wieder. »Ist auszuhalten.«
»Toughes Mädchen, hm?« Seine Stimme war gelassen. Seine Hand, groß und warm, umfasste die ihre. Sie hatte gar nicht gemerkt, wie kalt ihre Hand war, bis sie die wohltuende Wärme seiner Hand spürte.
Versuchsweise wackelte sie mit den Fingern und danach, um sicherzugehen, auch mit den Zehen. Zumindest schien noch alles zu funktionieren.
»Wenn du Schmerzen hast, solltest du es sagen. Aus diesem Grund wurden Ärzte erfunden. Und Schmerzmittel.«
Sarah gab keine Antwort. Dieses Thema war schon seit Langem ein Streitpunkt zwischen ihnen. Jake warf ihr vor, sie würde Hilfe aus purer Sturheit ablehnen, auch wenn sie diese, wie er meinte, dringend benötigte. Doch im Moment hatte sie einfach nicht die Kraft, sich mit Jake darüber zu streiten. Dazu fühlte sie sich zu schlecht. Ihr Sehvermögen war beeinträchtigt, stellte sie fest, als Jakes Gesicht vor ihren Augen verschwamm. Sie runzelte die Brauen, um ihren Blick zu fokussieren, doch das Brauenrunzeln verursachte ihr Schmerzen, und so versuchte sie es stattdessen mit einem vorsichtigen Zusammenkneifen der Augen, was tatsächlich einen gewissen Erfolg mit sich brachte. Mit einer Mischung aus Erschrecken und Überraschung stellte sie fest, dass sie sich in einem Krankenhauszimmer befand, lang ausgestreckt auf einem schmalen Krankenhausbett. Um ihren Kopf war irgendetwas geschnallt, das sich wie ein Footballhelm anfühlte. Der grünliche Schimmer, der ihr vorhin, bevor Jake das Licht angeknipst hatte, aufgefallen war, stammte von einem Monitor neben dem Kopfende des Bettes. Sie musste den Kopf ein wenig drehen, um ihn zu sehen. Ein Infusionsgestell mit einem zur Hälfte mit Flüssigkeit gefüllten Beutel stand zu ihrer Linken. Der lange, durchsichtige Infusionsschlauch schlängelte sich an ihrem Arm hinunter. Rechts, in der anderen Ecke des kleinen Raums, befand sich ein schwarzer Vinylsessel mit verstellbarer Rückenlehne, in dem Jake gesessen hatte, bis ihr Stöhnen ihn aufgeschreckt hatte. Außerdem gab es in dem Raum ein Fenster mit einem beigefarbenen Vorhang, ein kleines Nachtkästchen mit einem Telefon, einem Krug, Gläsern und einer Fernbedienung darauf, ein Fernsehgerät, das mit einem Metallarm an der Wand befestigt war, und das war es auch schon. Typisch Krankenhaus, aber wenigstens hatte sie das Glück gehabt, ein Einzelzimmer zu ergattern.
Allerdings wusste sie noch immer nicht, wie oder warum sie hierhergekommen war. »Was ist ... passiert?«
»Erinnerst du dich nicht?« Jakes dichte schwarze Augenbrauen zogen sich zusammen, während er sie prüfend betrachtete.
»N-nicht wirklich.« Das Einzige, woran sie sich lebhaft erinnerte, war Lexie, die neben ihrem Bett stand, Lexie, die davonhüpfte ...
Sarahs Herz krampfte sich vor Kummer zusammen, und sie zwang ihre Gedanken in die Gegenwart zurück. Zu ihrem Verdruss bemerkte sie nun, dass ihre Augen sich schwer und heiß anfühlten, dass ihre Nase verstopft und ihre Wangen noch immer feucht waren. Wahrscheinlich konnte er ihr ansehen, dass sie geweint hatte. Vor nicht allzu langer Zeit hatte sie ihm gelobt, sie werde fortan nicht mehr weinend aufwachen, und größtenteils war ihr dies auch gelungen. Wenn sie Glück hatte, würde er annehmen, die Tränen rührten von den Schmerzen in ihrem Kopf her.
Er ließ ihre Hand los, strich dann mit seinem rauen Zeigefinger über ihre Wange.
»Böser Traum, Kleines?« Seine Stimme war unendlich sanft.
Okay, sie hatte also kein Glück. Und er hatte offenbar gerade seinen scharfsichtigen Moment. Außerdem kannte er sie nun einmal verdammt gut.
»Ja.« Es klang wie ein Knurren.
»Lexie?«
»Ja.« Mit einem keuchenden Atemzug stieß sie dieses Geständnis hervor und hob dann, um von diesem Thema abzulenken, die Hand an die Schläfe, wo sich der schlimmste Schmerz zu zentrieren schien. Das war ein Fehler. Ihr Kopf begann wie rasend zu hämmern, das Zimmer drehte sich, und wenn sie nicht sofort die Hand gesenkt und die Augen geschlossen hätte, wäre sie vermutlich ohnmächtig geworden. »Ich fühle mich ... so komisch.«
»Das überrascht mich nicht.«