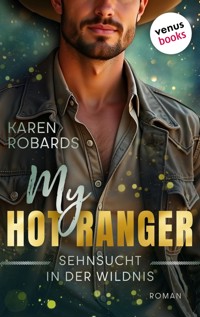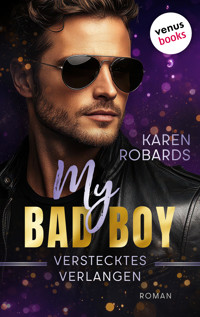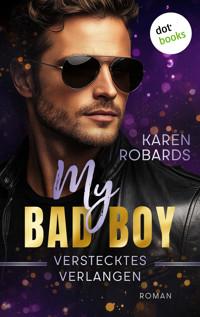Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie schwebt in tödlicher Gefahr, doch sie ahnt nichts davon … Wenn du dir selbst nicht mehr vertrauen kannst … Als Katherine nach einem Überfall mit Amnesie im Krankenhaus aufwacht, fühlt sie sich wie eine Fremde im eigenen Körper. Aus unerklärlichen Gründen hat sie plötzlich Angst vor ihrem Partner Ed Barnes – und fühlt sich stattdessen zu ihrem Nachbarn Dan hingezogen, den sie kaum kennt. Als sie erneut von zwei Männern angegriffen wird, kann sie nur mit Dans Hilfe entkommen. Aber warum lässt sie das Gefühl nicht los, seit dem Aufwachen im Krankenhaus eine andere zu sein – und kann sie Dan wirklich trauen? »Spannend!« Los Angeles TimesDieser fesselnde Psychothriller der amerikanischen Bestsellerautorin wird Fans von Joy Fielding und Karin Slaughter in seinen Bann ziehen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn du dir selbst nicht mehr vertrauen kannst … Als Katherine nach einem Überfall mit Amnesie im Krankenhaus aufwacht, fühlt sie sich wie eine Fremde im eigenen Körper. Aus unerklärlichen Gründen hat sie plötzlich Angst vor ihrem Partner Ed Barnes – und fühlt sich stattdessen zu ihrem Nachbarn Dan hingezogen, den sie kaum kennt. Als sie erneut von zwei Männern angegriffen wird, kann sie nur mit Dans Hilfe entkommen. Aber warum lässt sie das Gefühl nicht los, seit dem Aufwachen im Krankenhaus eine andere zu sein – und kann sie Dan wirklich trauen?
Über die Autorin:
Karen Robards ist die New York Times-, USA Today- und Publishers Weekly-Bestsellerautorin von mehr als fünfzig Büchern. Sie veröffentlichte ihren ersten Roman im Alter von 24 Jahren und wurde im Laufe ihrer Karriere mit zahlreichen Preisen bedacht, unter anderem mit sechs Silver Pens, die sie als beliebteste Autorin auszeichnen. Sie brilliert in der Spannung ebenso sehr wie im Liebesroman.
Die Website der Autorin: karenrobards.com/
Die Autorin bei Facebook: facebook.com/AuthorKarenRobards/
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin den Thriller »Und niemand hört dein Rufen«, die historischen Liebesromane »Die Rose von Irland«, »Die Liebe der englischen Rose«, »Die Gefangene des Piraten« und »Die Geliebte des Piraten« sowie die Exotikromane »Im Land der Zimtbäume« und »Unter der heißen Sonne Afrikas«.
***
eBook-Neuausgabe Januar 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2007 unter dem Originaltitel »Obsession« bei G.P.Putnam’s Sons, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2007 by Karen Robards
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2009 by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-640-2
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13, 4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Karen Robards
Keiner wird dir helfen
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Evelin Sudakowa-Blasberg
dotbooks.
Widmung
Peter, dieses Buch ist dir gewidmet zu Ehren
deines Studienabschlusses an der
Washington University in Saint Louis.
Christopher, dieses Buch ist dir gewidmet zu Ehren
deiner Qualifikation als Semifinalist
für das National Merit Scholarship Program.
Jack, dieses Buch ist dir gewidmet,
weil du einfach ein absolut umwerfender Bursche bist.
Glückwunsch, meine Herren, und weiter so.
Ihr macht eure Mutter sehr stolz.
Wie es begann ...
8. Juni 2005
»Nick. Nii-ckiee! Bist du da? Ich bin in Schwierigkeiten. Ernsten Schwierigkeiten.«
Special Agent Nick Houston, FBI, stand in der Küche seines kleinen Hauses in Alexandria, Virginia, und massierte sich den Nacken, während er mit gesenktem Kopf der Nachricht auf seinem Anrufbeantworter lauschte. Es war ein schwüler Mittwochabend kurz nach elf Uhr, und er war hundemüde. Er hatte einen höllisch anstrengenden Tag bei Gericht hinter sich, wo er als Zeuge für einen Mann ausgesagt hatte, der über ein Jahr als Informant für ihn gearbeitet hatte. Als der für seine Härte bekannte Richter den armen Kerl trotz Nicks Fürsprache und der Kooperation des Mannes zu zehn Jahren Haft verdonnerte, war dessen Tochter mitten im Gerichtssaal zusammengeklappt. Den Rest des Tages hatte Nick damit verbracht, sich Wortgefechte mit teuren Anwälten zu liefern, die versuchten, ihm ans Bein zu pinkeln. Sie setzten alles dran, seinen Job herunterzumachen, als er in einem verwandten Fall als Zeuge aussagte. Er hatte Aussagen zu Protokoll gegeben, die Berge von Papierkram bearbeitet, die dem Abschluss jeden Falls so unvermeidlich folgten wie der Schwanz einem Hund. Und zu guter Letzt war er auf dem Heimweg als Berater zu einer Geiselnahme gerufen worden, die mit dem Tod einer der Geiseln, einer Frau, geendet hatte.
Ein ganz normaler Arbeitstag im Leben eines überarbeiteten, unterbezahlten amerikanischen Bundesbeamten, keine Frage. Aber das Letzte, was er nach so einem Tag brauchte, war, beim Heimkommen die Stimme seiner Schwester auf dem Anrufbeantworter zu hören.
»Irgendein Mann hat mich angerufen und gesagt, dass Keith wegen mir seinen Job verlieren wird. Er meinte, wenn ich ihm nicht die Kopien aller Unterlagen verschaffe, die Keith über einen bestimmten Bundesrichter gesammelt hat, gegen den ihr Jungs ermittelt, wird er den Leuten, die für Sicherheitsfragen zuständig sind, stecken, dass ich« – an dieser Stelle brach die Stimme seiner Schwester ab – »auf Drogen bin.«
»Oh, Scheiße!« Nick nahm die Hand vom Nacken und starrte stirnrunzelnd auf das Telefon. Das war ihr kleines schmutziges Familiengeheimnis, das er, Allison und ihr Mann, Keith Clark – Leiter des FBI-Programms gegen White-Collar-Kriminalität und zufälligerweise auch Nicks Boss –, hüteten wie ein Kobold seinen Goldtopf. Wenn die Neigungen seiner Schwester – sie war Alkoholikerin, die auch bei keiner anderen Droge Nein sagte, wiewohl Kokain ihre erste Wahl war – herauskämen, würde Keith vermutlich gefeuert werden. Ein Beamter der Bundespolizei, der durch seine Frau erpressbar war, konnte unmöglich im Amt bleiben.
Und jetzt war es so weit. Jemand wollte sie erpressen.
»Kannst du kommen? Jetzt gleich? Ich brauche dich unbedingt. Ich weiß wirklich nicht weiter. Okay, ich sollte nicht so schwach sein bei ... bei so Sachen, aber ich ... ich kann nicht anders. Ich habe Angst, Nick. Schreckliche Angst.«
Der Piepston des Anrufbeantworters unterbrach das Geräusch ihres leisen Weinens.
»Verdammt, Allie!« Nick schlug mit der flachen Hand auf die Küchentheke. Sie war nicht so robust, wie sie aussah – er wollte die Küche schon seit fünf Jahren, seit er das Haus gekauft hatte, renovieren. Deshalb begann alles, was darauf stand, zu wackeln, einschließlich des Goldfischglases. Seine beiden Goldfische, Bill und Ted, bedachten ihn mit vorwurfsvollen Blicken. Der Vorwurf in ihren vorquellenden Augen könnte sich natürlich auch darauf beziehen, dass die Schachtel mit Fischfutter direkt vor seiner Nase stand und er bis jetzt noch keine Anstalten gemacht hatte, seiner Fütterpflicht nachzukommen. Bill und Ted waren sehr pedantisch. (Er war zu ihnen gekommen wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind, als er vor zwei Jahren in einem Anflug von Irrsinn eine Frau mit ihrem sechsjährigen Sohn zu einem kinderfreundlichen Rendezvous auf ein Volksfest eingeladen hatte. Auf Drängen des Jungen hin hatte er die beiden Fische für ihn gewonnen, indem er für ungefähr vierzig Dollar Pingpongbälle in Richtung des Goldfischglases warf. Leider nur mit dem Erfolg, dass die Frau, die er eigentlich hatte beeindrucken wollen, sagte, sie wolle keine stinkenden Fische in ihrem Haus haben.) Wie auch immer, die Fische bestanden auf ihren paar Kubikzentimetern Platz und einem sauberen Glas. Abgesehen davon waren sie traumhafte Wohngenossen. Sie waren ruhig, nie schlecht gelaunt und hatten immer ein offenes Ohr für ihn.
Als Belohnung für ihre Geduld nahm er eine Prise Fischfutter aus der Schachtel und streute es über die Wasseroberfläche. Während die Fische gierig nach den weißen Flocken schnappten, kehrten seine Gedanken wieder zu seiner Schwester zurück.
Zunächst versuchte er, sie auf ihrem Handy zu erreichen. Keine Antwort. Er überlegte, sie auf dem Festnetzanschluss anzurufen oder auf dem Handy seines Schwagers, doch falls Allie bisher noch nicht den Mut gehabt haben sollte, Keith einzuweihen, könnte das problematisch werden. Die Nachricht war knapp eine halbe Stunde alt, was zeitlich in etwa hinkam, weil ihm vor einer Stunde in dem Durcheinander des Geiselszenarios sein Handy aus der Tasche gefallen und kaputtgegangen war. Als echte Nachteule ging Allie nie vor ein Uhr ins Bett, was bedeutete, dass sie höchstwahrscheinlich noch wach war – irgendwo. Und gerade, wer weiß was, anstellte. Bei dem Gedanken sträubten sich ihm seine Nackenhaare.
Scheiße.
»Du verdammter Quälgeist!«, schimpfte er die abwesende Allie. Weiterhin leise vor sich hin fluchend, marschierte er aus dem Haus und stieg in seinen Wagen. Er würde zu ihr nach Arlington fahren, das nur etwa eine Viertelstunde entfernt war. Falls sie Keith die schlechten Nachrichten noch nicht gebeichtet haben sollte, würde er ihr zur Seite stehen, während sie das tat. Und wenn sie es ihm bereits gebeichtet hätte und Keith so fuchsteufelswild sein würde, wie Nick es erwartete, dann würde er ihr auch dabei zur Seite stehen.
Was soll’s. Sie war nun mal seine Schwester.
Blut ist dicker als Wasser. Diesen Spruch hatte seine Mutter gern von sich gegeben, wenn sie betrunken und schwankend in einem der Wohnwagen stand, in denen Allie und er groß geworden waren. Meist sagte sie das, bevor sie ihn losschickte, um Allie zu suchen, seine schöne, labile, vier Jahre ältere Schwester, deren Anfälligkeit für alle Arten von Drogen sich bereits im Alter von zwölf Jahren manifestiert hatte. Er war der stabile Teil des Trios gewesen, derjenige, der dieses beschissene Leben mit gnadenlosem Blick analysiert und sich geschworen hatte, es besser zu machen. Er entfloh der offenbar familiären Neigung zu Drogen und Alkohol, indem er nicht trank, sich nicht mit Rauschgift die Sinne vernebelte, sondern nichts anderes machte, als hart zu arbeiten, damit sie es alle irgendwann besser haben würden. Unglücklicherweise starb seine Mutter noch während er auf dem College war. Doch sobald er seinen Abschluss in der Tasche hatte, machte er seinen Schwur wahr: Er holte Allie, die bereits einen Ehemann verschlissen hatte, aus dem verwahrlosten Umfeld von Georgia heraus und brachte sie nach Virginia, wo er gerade eine Stelle beim FBI angetreten hatte.
Eine Weile lang war für sie beide alles bestens gelaufen. Beflügelt durch diese Chance auf einen Neubeginn, nahm Allie einen Job an und blieb clean – jedenfalls, soweit Nick es wusste. Im nüchternen Zustand war Allie ein bezauberndes Wesen mit einem fröhlichen, überschäumenden Naturell, das andere Menschen anzog wie ein Magnet. Zudem war sie auch schön, eine große, schlanke, blauäugige Blondine mit den feinen, erlesenen Zügen eines Models.
Durch Nick lernte Allie Keith kennen, Nicks Kollegen, der ihm in der FBI-Hierarchie ein paar Jahre voraus war. Nick hatte wirklich gehofft, diese Beziehung würde für Allie die Rettung bedeuten. Dass ihre Liebe zu Keith ihr die Kraft gäbe, ihre Sucht zu überwinden. Zu seiner Schande musste er gestehen, dass er Keith gegenüber nicht ein Sterbenswörtchen von Allies Problemen erwähnt hatte. Wie auch? Sie war seine Schwester.
Das war vor ungefähr fünfzehn Jahren gewesen. Inzwischen war Keith Teil der Familie, und es war ihm hoch anzurechnen, dass er nicht ein einziges Mal zu Nick gesagt hatte: »Warum hast du mir nichts davon erzählt?« Denn natürlich war Allie, die schöne, labile Allie im Lauf der Jahre rückfällig geworden. Sie hatte den Anforderungen des täglichen Lebens nicht ohne, wie sie es nannte, »kleine Helferchen« standhalten können. Manchmal dröhnte sie sich mit Alkohol zu, manchmal mit Drogen, manchmal mit beidem. Doch zwischen diesen Phasen war es Nick und Keith immer gelungen, sie in die Normalität zurückzuholen und ihre Eskapaden geheim zu halten.
So wie er hoffte – nein, betete –, dass ihnen das auch dieses Mal gelingen möge.
Als er in Arlington, dem teuren Vorort von Washington, D.C., ankam, war es kurz vor Mitternacht. Seine Schwester wohnte in einer ruhigen Straße mit großen Häusern und gepflegten Gärten, in denen hundertjährige Eichen Schatten spendeten. Als Allie und Keith das Haus gekauft hatten, planten sie, es mit Kindern zu füllen. Die Kinder waren bisher ausgeblieben, aber Allie hatte mit ihren einundvierzig Jahren die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Um diese späte Stunde sollte es in dieser Wohngegend ruhig und dunkel sein. Doch sobald Nick in Allies Straße einbog, wurde er von Lichtern und Lärm überrumpelt, einer geschäftigen Aktivität, die sich, wie er beim Näherkommen entdeckte, auf das Haus seiner Schwester konzentrierte.
»Oh, verdammt!«, keuchte er, als die Lichter sich als die blitzenden Stroboskoplichter von Einsatzfahrzeugen herauskristallisierten – Polizeiautos, ein Ambulanzwagen und sogar ein Feuerwehrauto, das seitlich auf dem Rasen parkte, was seiner Schwester sicher nicht recht wäre. Der Lärm entpuppte sich als Sirenengeheul und die Aktivität als herumrennende Einsatzkräfte, Nachbarn und Gott weiß welche Leute, die in und um das Haus herumschwirrten.
Das hell erleuchtet war.
Sein Mund wurde trocken. Sein Puls raste. Sein Herz hämmerte gegen die Brust.
Ohne sich einen Deut darum zu scheren, dass Allie stocksauer sein würde, parkte er auf dem Rasen, weil das der einzige freie Platz war, und rannte zur Haustür. Nur die innere Glastür, die zur Sturmsicherung diente, war geschlossen. Die wuchtige, mit Holzschnitzereien versehene Eingangstür stand weit offen, gewährte allen Zugang, die eintreten wollten.
Nick trat ein. Nach zwei raschen Schritten durch die Eingangsdiele ging er nach rechts in das geräumige, geschmackvoll eingerichtete Wohnzimmer. Dort fand er zwei uniformierte Cops vor, die untätig herumstanden, ein kleines Grüppchen von Leuten, womöglich Nachbarn, die die Köpfe zusammensteckten und sich leise unterhielten, und einige offiziell aussehende Typen in Mänteln und Krawatten, die Nick vor Aufregung nicht einordnen konnte. In einer Ecke des Raums entdeckte er Keith, der gerade mit einer uniformierten Polizistin redete. Während er sprach, machte sich die Polizistin Notizen auf ein Klemmbrett. Mit raschem Blick musterte Nick seinen fünfundvierzigjährigen Schwager und stellte fest, dass Keith noch dieselbe Hose und dasselbe weiße Hemd trug wie tagsüber im Büro, nur hatte er jetzt Mantel und Krawatte abgelegt. Sein schütteres mittelbraunes Haar war zerzaust.
Irgendetwas Schlimmes war passiert, so viel stand fest.
»Keith! Wo ist Allie?«, fragte Nick ohne Umschweife, sobald er sich Keith auf Hörweite genähert hatte. Seine Stimme war laut, scharf. Alle sahen ihn an – die Polizistin mit dem Klemmbrett, die offiziellen Typen, die Nachbarn, sein Schwager. Nick stellte fest, dass Keiths stumpfnasiges, kantiges und normalerweise gesund gerötetes Gesicht jede Farbe verloren hatte. Seine Augen waren geschwollen und rotgerändert. Seine Nasenspitze war gerötet.
»O mein Gott, Nick!«, stöhnte Keith und vergrub das Gesicht in den Händen. Seine Schultern bebten. Mit einem flauen Gefühl, als habe er gerade einen Schlag in die Magengrube erhalten, wurde Nick klar, dass Keith weinte.
»Wo ist Allie?«, herrschte er ihn an. Panik überfiel ihn. Unbewusst ballte er die Hände zu Fäusten.
Keith schluchzte. Die Polizistin mit dem Klemmbrett und ein offiziell aussehender Typ bewegten sich gleichzeitig auf Nick zu. Ihre Mienen kündeten von den schlechten Nachrichten, die sie zu übermitteln hatten.
Doch noch ehe sie bei ihm waren, hörte Nick etwas anderes. Das Quietschen einer Bahre auf Rädern. Nick drehte sich um und sah, wie die Bahre durch die Diele in Richtung Haustür gerollt wurde. An den Enden wurde das Gefährt von je einem Sanitäter gelenkt. Ein weißes Laken war darübergebreitet. Und unter dem Laken zeichnete sich deutlich ein Körper ab.
Ein langer, schlanker Körper.
Nick stockte der Atem. Er sprang auf die Bahre zu, ignorierte Keiths Ruf, es bleiben zu lassen, ignorierte die Stimmen und die Hände, die sich nach ihm ausstreckten. Noch ehe ihn jemand davon abhalten konnte, das zu tun, was er unbedingt tun musste, war er auch schon neben der Bahre und riss einen Zipfel des Lakens zurück.
Allie lag ausgestreckt da, ihr blondes Haar ergoss sich auf das weiße Laken unter ihr. Ihre Augen waren weit aufgerissen, glasig, starr und extrem blutunterlaufen. Ihre Haut war grau, ihre geöffneten Lippen purpurrot. An ihrem Hals befanden sich massive Blutergüsse ...
Kalter Schweiß brach ihm aus.
»Allie.« Seine Stimme war heiser. Er wusste natürlich, dass sie nicht antworten würde. Sie war unverkennbar tot. »Allie!«
»Sir!« Empört riss ihm einer der Sanitäter den Lakenzipfel aus seiner plötzlich kraftlosen Hand und drapierte ihn wieder über Allies Gesicht. Dann war Keith bei ihm, gefolgt von der Polizistin mit dem Klemmbrett, legte ihm die Hände auf die Schultern, auf die Arme, und hielt ihn fest, während die Bahre in Richtung Haustür weiterrollte. Nick rührte sich nicht. Er konnte nicht. Starr vor Erschütterung, stand er einfach nur da und sah zu, wie die Leiche seiner Schwester in die Nacht hinausgeschoben wurde.
Er konnte eine Minute dagestanden haben oder eine Stunde. Infolge des schweren Schocks hatte er jedes Zeitgefühl verloren. Aber schließlich gelang es ihm, sich der entsetzlichen Wahrheit zu stellen, wieder einen Gedanken zu fassen, sich wieder zu bewegen, und er wandte sich zu seinem weinenden Schwager um, dessen Hand nach wie vor auf seiner Schulter lag.
»Keith ...« Seine Stimme war ein Krächzen. »Was, zum Teufel ...«
»Sie hat sich erhängt.« Keith schluchzte heftig, fasste sich dann wieder. »Ich kam nach Hause und – oh, mein Gott, da war sie. Ich konnte nichts mehr tun. Sie war bereits t-tot.«
Nick hatte das Gefühl, als würde sich eine Riesenhand um seine Brust spannen und sein Herz zerquetschen. Es tat so weh. So verdammt weh. Er konnte kaum atmen. In seinen Ohren schrillte es. Sein Kopf dröhnte, als würde er jeden Moment bersten.
Allies Stimme hallte in seinem Kopf wider: Ich bin in Schwierigkeiten. Ernsten Schwierigkeiten ...
Das konnte er Keith nicht erzählen, wenn das Zimmer voller Fremder war.
»Komm mit«, sagte er zu Keith und nahm ihn beim Arm. Überall im Haus waren Leute, also zog er seinen Schwager durch die Hintertür auf die gepflasterte Terrasse hinaus, mit der eingebauten Partyküche, in der Allie so gern gefeiert hatte.
Bei der Erinnerung daran blutete ihm das Herz.
»Sie hat mich angerufen«, stieß er rau hervor, sobald sie allein waren, und wiederholte, was Allie gesagt hatte. Die weiche Schönheit der Nacht bot keinen Trost, im Gegenteil: Sie war wie ein Schlag ins Gesicht. Wie konnten die Sterne noch scheinen und die Blumen die Luft mit süßem Duft erfüllen, obwohl Allie tot war?
»Deshalb also.« Wie Nick schien auch Keith Probleme mit der Atmung zu haben. Seine Schultern waren nach vorne gekrümmt, sein Kopf gesenkt. Seine Stimme war keuchend und belegt. »Herrgott, Nick, deshalb hat sie es getan. Weil irgendein mieses Schwein gedroht hat, sie zu erpressen.« Er schnappte nach Luft. »Wer immer es ist, er wird nicht davonkommen. Wir werden ihn schnappen. Und wenn wir ihn geschnappt haben, werden wir seinen Arsch an die Wand nageln.«
Nick sah wieder Allies graues Gesicht auf der Bahre vor sich und merkte, wie sich seine Eingeweide zusammenzogen.
»O ja«, sagte er leise. »Ich werde ihn finden. Verlass dich drauf. Was immer es auch bedarf.«
Es war eher ein Versprechen an seine Schwester als an Keith.
Eine erste jähe Trauer überfiel ihn, bohrte sich mit greller Schärfe durch den Schock hindurch, und er stolperte in den dunklen Garten hinaus und erbrach sich auf dem Rasen.
Kapitel 1
29. Juli 2006
Ihre letzten Gedanken vor dem Sterben waren trivial, und das war Katharine Lawrence auch bewusst. Aber Fakt war nun mal: Ihr Küchenboden war dreckig.
Als sie bäuchlings auf dem harten, kalten Boden lag, die Hände auf dem Rücken mit Klebeband gefesselt, war sie mit ihren dreißig mal dreißig Zentimeter großen Terracotta-Fliesen in so engem, intimem Kontakt wie noch niemals zuvor. Und deshalb waren auch die Fettflecken nicht zu übersehen, die aussahen, als wäre irgendetwas Öliges ausgelaufen und nur schlampig aufgewischt worden. Ebenso die kleinen, schlammigen Pfotenabdrücke – das flache, runde Gesicht ihrer Perserkatze, Muffy, blitzte vor ihrem inneren Auge auf – sowie ein paar eingetrocknete schwärzliche Tropfen, die wie Barbecue-Soße rochen, und eine Reihe unidentifizierbarer Schrammen, Flecken und Schmutz.
Herrgott nochmal, besaß sie denn keinen Schrubber?
»Ich werde Sie noch ein einziges Mal fragen: Wo ist er?«
Die Frage wurde etwa einen Meter über ihrem Kopf von einem über sie gebeugten, großen, muskulösen Mann mit schwarzer Wollmaske in kaltem, drohendem Ton hervorgestoßen. Und durch eine kräftige Faust, die sie schmerzhaft an den Haaren zog, betont. Das Ziehen an ihrer Kopfhaut war jedoch nichts im Vergleich zu dem stechenden Schmerz, der ihren Nacken hinunterschoss, als er ihren Kopf brutal zurückriss, damit er ihr Gesicht sehen konnte, das trotz der leicht gebogenen Nase allgemein als schön galt, wenn es nicht gerade, so wie jetzt, vor Angst verzerrt war. Seine Waffe – eine große silberne Pistole – knallte gegen ihre Schläfe. Der Aufprall von Metall auf Knochen entrang ihr ein Wimmern. Die Mündung der Waffe war hart und kalt wie der Tod.
Seine Augen – haselnussbraun, eng zusammenstehend, mit dichten schwarzen Wimpern, die ihr verrieten, dass er unter der Maske mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit schwarzhaarig war – waren noch härter und kälter.
Als sie dem Blick dieser Augen begegnete, kroch ihr die Angst erneut über den Rücken. Ihr Atem wurde schneller. Ihr Herz, das ohnehin schon heftig schlug, begann wie rasend zu hämmern, bis das wilde Pochen das Summen des Kühlschranks und das leise Zischen der Klimaanlage übertönte – und die raschen Schritte des zweiten Mannes, der ihr Haus Zimmer für Zimmer durchsuchte.
»Ich habe es Ihnen doch bereits gesagt: Es gibt keinen. Er existiert nicht, okay? Sie sind offenbar einer Fehlinformation aufgesessen.«
Sie konnte nichts weiter sagen als das, obwohl sie bereits wusste, dass er ihr nicht glauben würde. Er hatte ihr vorher nicht geglaubt, er würde ihr auch jetzt nicht glauben. Sie drehten sich im Kreis.
Seine Augen verdunkelten sich. Sein Mund, der durch einen Schlitz in der Wollmaske sichtbar war, wurde schmaler. Ihr Magen verkrampfte sich vor Angst.
Würden die Männer sie töten, wenn sie das Gesuchte nicht bekamen?
Ja, lautete die deprimierende Antwort, zu der sie gelangte, als sie sich die bisherige Brutalität des Überfalls vor Augen führte. Die Kälte und Entschlossenheit, mit der die Männer vorgingen, sprachen für sich. Sie war sich so gut wie sicher, dass die beiden Eindringlinge – beide große athletische Typen, die sich in den schwarzen T-Shirts und Trainingshosen gespenstisch ähnelten – nicht die Absicht hatten, sie am Leben zu lassen.
Oder Lisa.
Lisa Abbott, ihre gute Freundin und früher auch Mitglied in derselben Studentinnenvereinigung, hatte, wie es der böse Zufall wollte, ausgerechnet dieses Wochenende gewählt, um Katharine zum ersten Mal seit sieben Jahren zu besuchen; genauer gesagt, seit Katharine mit ihrem funkelnagelneuen Abschlusszeugnis in Politikwissenschaften und dem Kopf voller Weltverbesserungsideale das College verlassen hatte. Katharine hatte Muffy das Wochenende über zu Freunden gebracht – Lisa war allergisch gegen Katzenhaare – und anschließend Lisa um kurz nach siebzehn Uhr vom Dulles Flughafen abgeholt. Sie waren beide aufgeregt gewesen und hatten nonstop gequasselt, um sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Auf dem Heimweg hatten sie auf einen Drink im Le Bar in Georgetown haltgemacht, waren dann um die Ecke zum Dinner zu Angelo’s gegangen und anschließend durch die Bars gezogen. Bei der Ankunft in Katharines elegantem, zweistöckigem Reihenhaus in der historischen Altstadt des D.C.- Bezirks Alexandria, Virginia, war es nach Mitternacht, und sie waren beide mehr als nur angesäuselt gewesen. Nachdem sie mit einem Glas Wein noch einmal auf ihr Wiedersehen angestoßen hatten, waren sie zu Bett gegangen, nicht unbedingt müde, aber komplett betrunken.
Das war vor einigen Stunden gewesen.
Jetzt war Katharine stocknüchtern, und Lisa lag etwa einen Meter von ihr entfernt mit dem Gesicht nach unten auf dem peinlich schmutzigen Boden, die Hände und Füße wie bei Katharine mit Klebeband gefesselt. Ein weiterer Klebestreifen bedeckte Lisas Mund. Das ornamentierte, schmiedeeiserne Unterteil der mit einer Granitplatte ausgestatteten Kücheninsel trennte sie zwar, doch dank der Struktur des offenen Designs konnten sie sich immer noch sehen. Lisas schulterlanges kastanienbraunes Haar lag über ihrem Gesicht, aber dennoch war das entsetzte Flackern in ihren braunen Augen erkennbar. Ihr gelbes, bodenlanges Seidennachthemd war bis zu den Knien hochgerutscht und enthüllte das zarte Trio aus miteinander verbundenen Schmetterlingen, das über ihrem linken Fußgelenk tätowiert war. Der gerüschte Saum breitete sich fächerförmig um ihre gebräunten Beine aus wie die Blütenblätter irgendeiner exotischen Blume. Aber wenigstens bot das lange Nachthemd mehr Schutz als Katharines winzige pinkfarbene Boxershorts und das dazu passende Strickhemdchen. Lisa war mit ihren eins siebzig zwei Zentimeter größer als Katharine. Katharine war die dünnere von beiden, aber Lisa war mit ihrer durchtrainierten Figur mindestens genauso sexy. Selbst als Katharine voller Angst in die kalten, haselnussbraunen Augen über ihr starrte, nahm sie Lisas panisches Hecheln wahr.
Vier Jahre lang haben wir praktisch alles zusammen gemacht, und jetzt, wo wir uns endlich wiedersehen, werden wir vermutlich zusammen sterben, schoss Katharine durch den Kopf. Oh, Gott, ich will nicht sterben. Nicht auf diese Weise. Wir sind noch so jung. Lisa ist gerade dreißig geworden, und ich bin erst neunundzwanzig ...
Sie hatten alles, wofür es sich zu leben lohnte. Alles. »Eine letzte Chance: Wo ist der verdammte Safe?« Verzweifelt räusperte sie sich. »Verstehen Sie doch, hier gibt es wirklich keinen Safe. Der Schmuck ist nicht hier. Er gehört mir nicht. Er war geliehen –«
Die Worte erstarben ihr in der Kehle, als der Mann ihr Haar losließ, einen Schritt zurücktrat, die Waffe in den Hosenbund schob und ihr einen Tritt in die Rippen versetzte. Die Stärke war genau dosiert: hart genug, um wehzutun, aber nicht zu fest, um ihr einen echten Schaden zuzufügen.
Dennoch explodierte der Schmerz, breitete sich von der Stelle, wo die Spitze des schwarzen Turnschuhs ihre Rippen getroffen hatte, blitzartig nach allen Seiten aus. Hätte der Schmerz es zugelassen, hätte Katharine geschrien. Stattdessen krümmte sie sich keuchend. Tränen brannten in ihren Augen, liefen über ihre Wangen. Sie konnte die heißen, feuchten Spuren auf ihrer Haut fühlen.
Es tat so schrecklich weh – so schlimm, dass ihr der Atem stockte und ihr der kalte Schweiß auf die Stirn trat. Gezackte Schmerzsplitter schossen wie glühende Pfeile in ihre Organe, ihre Muskeln, ihre Knochen.
»Na, kommen wir jetzt endlich zur Vernunft?« Sein Ton war eher locker als drohend, als er dunkel über ihr aufragte. Gleichwohl war es der entsetzlichste Klang, den sie je vernommen hatte. Nach einem kurzen, angsterfüllten Blick zu ihm hoch kniff sie die Augen fest zusammen und erstarrte zu völliger Reglosigkeit. »Wo ist der Safe?«
Aus Angst vor der Antwort, bemühte sich Katharine nach Kräften, den Mann auszublenden. Zitternd vor Schmerz und Todesangst, zog sie sich in sich selbst zurück. Auf der Haut spürte sie das Kribbeln ihres Schweißes, der ihr aus allen Poren brach. Der Schmerz in ihrer Seite erschwerte ihr nach wie vor das Atmen. In kleinen, vorsichtigen Zügen holte sie Luft und versuchte, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Sie fror nun, spürte eine eisige Kälte, die nichts mit den ungemütlichen Fliesen unter ihr zu tun hatte oder mit der Klimaanlage, die über ihre schweißnasse Haut blies.
Es war die Kälte der Todesangst.
Sie war sich ziemlich sicher, dass sie nichts sagen oder tun könnte, um das drohende Ende abzuwenden. Dennoch dachte sie fieberhaft nach, ob es nicht etwas gäbe, irgendetwas, das vielleicht die Rettung bringen würde ...
»Antworten Sie!«
Er griff wieder in ihr Haar, und sie öffnete die Augen und schrie auf. Ihre Kopfhaut brannte, als er ihren Kopf nach hinten riss. Ihr Hals fühlte sich an, als würde er abbrechen.
»Wo ist der verdammte Safe?«
Er war nah, furchterregend nah, und beugte sich über sie, während er ihren Kopf zu sich drehte und sie anfunkelte.
Ihre Blicke begegneten sich. Die unmissverständliche Drohung in seinen Augen erfüllte sie mit neuer Panik.
Ihre Lippen zitterten. »Hier ist kein Safe.«
Seine Augen wurden schmal, hart, bis sie diesen brutalen Blick keine Sekunde länger ertragen konnte. Sie presste die Lippen zusammen, schluckte heftig und schloss die Augen wieder. Während sie sich bemühte, wieder zu Atem zu kommen und den Schmerz hinter sich zu lassen, hing sie für einen Moment schlaff an der Hand, die sie noch immer an den Haaren in der Luft hielt. Ihre Kopfhaut prickelte und brannte von seinem groben Griff. Ihr Hals tat weh. Doch auch der schlimmste körperliche Schmerz war nichts im Vergleich zu der wachsenden Panik, die ihren Mund austrocknete, ihren Puls hochjagte und ihren Atem in Keuchlaute verwandelte.
Bitte, lieber Gott, bitte, schick Hilfe ...
Sogar mit geschlossenen Augen konnte sie seinen unablässigen Blick auf ihrem Gesicht spüren.
»Also, allmählich habe ich dieses Spiel satt. Wenn Sie mir nicht sofort sagen, was ich wissen will, könnte ich gute Lust kriegen, Ihre Freundin ein wenig mit dem Messer zu kitzeln. Ihr zum Beispiel einen Finger abschneiden oder ein Ohr.«
Katharine riss die Augen auf und blickte zu Lisa hinüber, die plötzlich erstarrte. Sie schien nicht einmal mehr zu atmen, und wäre da nicht das angstvolle Flackern ihrer Augen gewesen, hätte Katharine geglaubt, ihre Freundin sei ohnmächtig geworden.
»Wollen Sie zuschauen? Wollen Sie sie bluten sehen? Bringt Sie das in Redelaune?«
Katharine holte tief Luft und fand endlich ihre Stimme wieder. Oder wenigstens etwas, das ihrer Stimme ähnelte. Was aus ihrem Mund kam, war leise und zittrig, klang ganz und gar nicht wie ihr normaler flotter Ton, der ihre Herkunft aus Midwest verriet.
»Nein«, flüsterte sie gequält, den Blick weiterhin auf Lisa gerichtet. »Bitte. Sie müssen mir glauben, hier ist kein Safe ...« Ihre Stimme brach ab, als sie sah, wie Lisa zu zittern begann. Tränen stiegen ihr in die Augen. Sie musste sich anstrengen, um trotz des Kloßes in ihrem Hals zu sprechen. »Wenn es hier einen Safe gäbe oder Schmuck oder irgendetwas anderes von Wert, das ich Ihnen geben könnte, damit Sie Weggehen, dann hätte ich Ihnen das gesagt. Das schwöre ich.«
Seine Augen glitzerten unheilvoll. Er spitzte die Lippen. Sein Blick glitt langsam und betont über ihren Körper.
Katharine erschauerte.
»Hm, Sie sind ein wirklich hübsches Mädchen. Vielleicht sollte ich Ihre Freundin in Ruhe lassen und stattdessen Ihnen meine Initialen ins Gesicht ritzen.«
Ihr Magen krampfte sich zusammen, als würde sich eine eiserne Faust darum schließen.
»Nein.« Ihr Flehen klang selbst in ihren Ohren mitleiderregend. »Nein.«
Seine Drohung war vor allem deswegen so verstörend, weil er sie in einem leisen, unbeteiligten Ton ausgesprochen hatte. Alles, was passiert war, hatte sich in albtraumhafter Stille zugetragen. Bevor er sie überwältigte, hatte sie die Augen eine Nanosekunde vorher geöffnet und gesehen, wie in dem dunklen Schlafzimmer ein Mann auf ihr Bett zuschlich. Der Angstschrei, der sich ihrer Kehle entrang, war das einzige laute Geräusch gewesen. Leider nicht laut genug, um darauf zu hoffen, dass ihn außerhalb dieser vier Wände jemand gehört und die Polizei gerufen hatte.
Lisa, die im Gästezimmer geschlafen hatte, und sie waren nach unten in die Küche geschleift, auf den Boden geworfen und brutal gefesselt worden. Vergewaltigung war Katharines erster Gedanke gewesen, doch das war nicht geschehen. Ein sexueller Übergriff schien das Letzte zu sein, was diese Männer im Sinn hatten.
Vielmehr hatten sie es, wie sie mehr als deutlich zu verstehen gaben, auf den Inhalt eines Safes abgesehen, der angeblich irgendwo im Haus versteckt war. In dem Safe schienen sie Schmuck im Wert von Hunderttausenden von Dollar zu erwarten. Normale Einbrecherbeute wie das Fernsehgerät mit Plasmabildschirm im Wohnzimmer und der Laptop im Arbeitszimmer interessierte die beiden offenbar nicht. Entsprechend rührten sie auch den Schmuck nicht an, den die beiden Frauen trugen. Sie hatten Lisas bescheidenen Diamantanhänger genauso ignoriert wie Katharines weitaus wertvollere Diamantohrstecker und den großen, oval geschliffenen Saphirring, den sie sich selbst zum letzten Geburtstag geschenkt hatte.
Seit Lisa und sie in der Küche lagen, hatten die Männer Lisa mehr oder weniger sich selbst überlassen. Es war Katharine, die sie terrorisiert, ausgefragt und bedroht hatten, um ihr das Versteck des nicht existierenden (jedenfalls, soweit sie das wusste) Safes zu entlocken.
Komisch war, dass sie ihren Namen von Anfang an gekannt hatten. Das war ihr voller Schrecken bewusst geworden, nachdem sich der erste Nebel blinder Panik weit genug gelichtet hatte, um nachdenken zu können. Dies war kein zufälliger Einbruch; er hatte ganz gezielt sie im Visier und war sorgfältig geplant, obwohl sie den Eindruck hatte, dass Lisas Anwesenheit für die Männer eine Überraschung gewesen war. Offenbar hatten sie damit gerechnet, sie allein anzutreffen.
Aus einigen Bemerkungen der Einbrecher schloss sie, dass sie das Foto von ihr gesehen hatten, das letzte Woche in der Washington Post abgebildet gewesen war und das ihr bereits vor diesem Albtraum eine Menge Scherereien eingebracht hatte. Sie hatte von dem Foto gar nichts geahnt, bis sie es dann in der Zeitung entdeckte. Auf dem Bild war sie gerade zur Dinnerparty bei einem von Washingtons Top-Lobbyisten unterwegs und trug ein verführerisches weißes Dior-Abendkleid sowie atemberaubenden Schmuck, der ein Vermögen wert war. Vermutlich ging nun in Einbrecherkreisen das Gerücht um, dass diese unbezahlbar teuren Juwelen und andere vergleichbar wertvolle Dinge bei ihr zu Hause in diesem ominösen Safe aufbewahrt wurden.
Von wegen.
Der Schmuck, den sie auf dem Foto trug, gehörte ihr gar nicht. Er war ihr eigens für diesen Anlass geliehen worden. Neben dem Ring und den Ohrringen, die sie gerade trug, besaß sie nur die wenigen wertlosen Schmuckstücke in dem ledernen Schmuckkästchen auf ihrer Kommode. Bis Ende letzten Herbstes hatte sie ausschließlich von dem Gehalt einer Regierungsangestellten gelebt, welches, sofern das überhaupt erwähnt werden musste, nicht gerade üppig war. Jedenfalls nicht annähernd so hoch, um sich solche Klunker leisten zu können, wie sie die Einbrecher bei ihr vermuteten.
Und genau das hatte sie versucht, ihnen klarzumachen. Leider wollten sie ihr nicht glauben, obwohl es die reine Wahrheit war.
Während der Einbrecher, der ihren Kopf gerade an den Haaren nach oben riss, sich nach Kräften bemüht hatte, ihr eine Information, die sie nicht besaß, zu entlocken, hatte der andere ihr Haus verwüstet. Unter gedämpftem Gepolter und Geklapper hatte er das Haus auseinandergenommen, Bücher von den Regalen gefegt, Bilder von den Wänden gerissen, Möbel umgeworfen und die teuren Orientteppiche weggeschoben, die das glänzend polierte Parkett bedeckten. Wäre ihr Nachbar, ein Arzt, dessen Name Katharine im Moment nicht einfiel, zu Hause gewesen, hätte er womöglich etwas gehört. Doch als Lisa und sie nachts zurückgekommen waren, waren die Fenster seines Hauses dunkel gewesen, und Katharine wusste, dass er an den Wochenenden häufig verreist war. Ihre Nachbarin zur anderen Seite hin wiederum, eine junge Abgeordnete, weilte definitiv bis Ende August bei ihren Eltern in Minnesota. Möglicherweise war das Anwaltspärchen, das im letzten der vier Reihenhäuser wohnte, zu Hause – jedenfalls hatten die beiden nicht erzählt, dass sie irgendwohin fahren wollten. Aber warum hätten sie das auch tun sollen? Andererseits schien es völlig egal zu sein, ob die Leute da waren oder nicht: Bisher hatte noch kein neugieriger Nachbar angerufen, um sich zu erkundigen, was es mit dem Tumult mitten in der Nacht auf sich hatte. Es waren auch keine Sirenen zu hören gewesen, kein Hämmern an der Haustür, keine gebrüllten Befehle, die Tür zu öffnen. Was nachbarliche Einmischung betraf, so war diese, kurz gesagt, gleich null. Sollten der Arzt oder die Anwälte tatsächlich zu Hause sein, so bekamen sie von den Vorgängen anscheinend genauso wenig mit wie der nachtschwarze Potomac, der verschlafen jenseits der kopfsteingepflasterten Straße entlangfloss.
Laut der Uhr an der schwarzen Vorderseite des Mikrowellenherds, der in einer der freigelegten, unverputzten Ziegelwände der erst vor Kurzem renovierten Küche eingebaut war, war es ein Uhr sieben. Es war Samstag, der neunundzwanzigste Juli. Washington – zumindest das offizielle Washington – war in den Sommerferien. Das bedeutete, dass sich in Old Town gegenwärtig kaum Menschen befanden. Katharines Straße, in der einige der weniger bedeutenden Regierungsangestellten wohnten, war jedenfalls halb leer. Ihr Reihenhaus – das hübsche, alte Haus – war komplett saniert und mit einem hochmodernen Sicherheitssystem ausgestattet worden. Deswegen hatte Katharine es auch bis vor zwanzig Minuten für völlig sicher gehalten. Doch nun wirkte es so abgeschieden wie eine Blockhütte im tiefen Wald.
Mit anderen Worten, Lisa – die arme, unschuldige Lisa, die einfach nur das falsche Wochenende für ihren Besuch gewählt hatte – und sie waren ganz auf sich gestellt.
»Katharine. Ich will weder Ihnen noch Ihrer Freundin wehtun.« Sein Ton war beinahe sanft. Seine Augen nicht.
Sie nahm einen zitternden Atemzug. Als sie sprach, war ihre Stimme kräftiger als vorher. »Dann lassen Sie es doch.«
Er blinzelte langsam wie eine träge Schildkröte. Dann griff er mit einer bedächtigen Bewegung in seine Tasche und zog ein Messer hervor. Ein silbernes Messer, schmal und harmlos aussehend, etwa fünfzehn Zentimeter lang. Es war keine scharfe Klinge zu sehen, aber Katharine erkannte mit einem Blick, worum es sich handelte: ein Schnappmesser.
Entsetzen erfasste sie. Ihre Kehle schnürte sich zusammen, während ihr Blick wie gebannt auf dem Messer haften blieb. Er brauchte nur auf den Knopf zu drücken ...
»Sie lassen mir keine Wahl, Katharine, deshalb werden Sie Ihren Kopf hinhalten müssen. Wenn Sie mir nicht sagen, wo der Safe ist, werde ich Ihr hübsches Gesicht wie eine Kürbislaterne zurechtschnitzen.«
Trotz dieser grausamen Drohung konnte sie ihm nur eine Antwort geben – dieselbe, die sie ihm schon die ganze Zeit über gegeben hatte.
Verzweifelt schüttelte sie den Kopf, deutete ohne Worte an, was sie gleich darauf laut aussprach: »Hier ... gibt ... es ... keinen ... Safe. Bitte, glauben Sie mir. Wie ich bereits sagte, sind Sie einem Irrtum erlegen.«
Eine tödliche Stille trat ein.
»Dummes Miststück«, sagte er, und das Fehlen jeglicher Emotion in seiner Stimme, ließ die Worte noch brutaler klingen.
»Es ist die Wahrheit.« Ihre Stimme bebte vor Hilflosigkeit. »Wirklich. Das ist ein ganz normales, gemietetes Reihenhaus. Warum sollte hier ein Safe versteckt sein?«
Sie vernahm das helle Klicken des Messers einen Sekundenbruchteil, bevor sie die Klinge aus dem Gehäuse springen sah. Das Licht aus den in die Decke versenkten Lichtquellen ließ die geschliffene Klinge bösartig aufglitzern. Das Messer war, wie sie sehen konnte, skalpellscharf. Den Blick darauf geheftet, nahm sie einen tiefen, zitternden Atemzug.
»Das wird Ihnen auch nicht weiterhelfen«, sagte sie. »Ich kann Ihnen nichts verraten, was ich nicht weiß.«
Er beugte sich näher zu ihr hinunter. Sein Gesicht war nur Zentimeter von ihrem entfernt, nah genug, um die geplatzten Äderchen in seinen blutunterlaufenen Augen zu sehen und den schwachen Knoblauchgeruch in seinem Atem zu riechen. Plötzlich lächelte er. Ein kleines, böses Lächeln. Von einem jähen Schwindel erfasst, nahm sie ein seltsames Rauschen wahr und erkannte erst nach einigen Sekunden, dass es ihr eigenes Blut war, das wie ein Wasserfall in ihren Ohren dröhnte.
»Hier gibt es sehr wohl einen Safe, weil Ihr Freund ihn hier versteckt hat«, sagte er.
Kapitel 2
Ihr Freund. Edward Barnes. Ein fitter, attraktiver, bald geschiedener Mann von siebenundvierzig Jahren, der bis Dienstag in Amsterdam war. Sie waren seit dreizehn Monaten zusammen. In den vergangenen vier Jahren war er ihr Boss gewesen. Und – ach ja, richtig! – davor war er zwei Jahre lang Deputy Director of Operationes in der CIA gewesen, stellvertretender Direktor für Operationen, kurz DDO. Er hatte sie, seine Chefassistentin, auf der Karriereleiter mit nach oben geschleift, sodass sie, das ehemals berüchtigte Partygirl Katharine Marie Lawrence, inzwischen zu den mächtigsten Leuten in der CIA gehörte.
Weil sie Eds Vertrauen hatte. Und nun, da seine Ehefrau seit zwanzig Jahren, Sharon, als Folge dieses verfluchten Washington-Post-Fotos aus der gemeinsamen Villa im vornehmen Botschaftsviertel Embassy Row ausgezogen war, hatte sie nicht nur sein Vertrauen, sondern auch noch so gut wie alles andere von ihm.
In Anbetracht der Tatsache, dass Ed das Reihenhaus gehörte, in dem sie wohnte – mietfrei, ein Vorteil ihrer Beziehung –, schien ein geheimer Safe plötzlich nicht mehr komplett abwegig zu sein.
Bei dem Gedanken gefror Katharine das Blut in den Adern.
»Davon weiß ich nichts. Ich wohne hier nur.«
»Klar doch.« Die beiden Silben trieften vor Sarkasmus.
Beinahe zärtlich legte er die Klinge an ihre Wange. Als Katharine das kalte Metall auf der Haut fühlte, stockte ihr der Atem. Eine endlose Sekunde lang war sie vor Angst wie gelähmt. Verwundert stellte sie dann fest, dass sie lediglich einen leichten Druck auf der Wange spürte, kein Brennen, keinen Schmerz, und ihr wurde klar: nur die stumpfe Seite der Klinge berührte ihre Haut. Er schnitt sie nicht – noch nicht.
»Bitte«, stieß sie hervor. Ihre Kehle war so eng, dass ihr selbst dieses eine Wort Mühe bereitete. Sie spürte Lisas Blick, sah das angstvolle Glitzern in ihren weit aufgerissenen Augen. Der Horror ihrer Freundin war nahezu greifbar. Verzagt, weil sie um die Sinnlosigkeit ihrer Worte wusste, fügte sie hinzu: »Tun Sie das nicht. Bitte.«
»Wo ist der Safe?«
Warum glaubte er ihr nicht? Was könnte sie denn noch sagen? Wenn sie weiterhin bei der Wahrheit bliebe – dass es hier ihres Wissens nach keinen Safe gab –, würde er ihr wehtun. Panik breitete sich wie tödliches Schlangengift in ihr aus. Sollte sie lügen? Aber wenn sie lügen würde – wenn sie beispielsweise vortäuschte, ihr sei das Versteck des angeblichen Safes bekannt, und einfach aus dem Stegreif einen Ort erfände, wo der Safe versteckt war –, würde er das sofort nachprüfen und die Lüge binnen weniger Minuten aufdecken. Bei der Vorstellung, was er dann mit ihr anstellen würde, packte sie das kalte Grauen.
Aber konnte ihr noch Schlimmeres drohen als das, was er bereits jetzt mit ihr vorhatte?
»Katharine?« Seine Stimme war sanft, kaum mehr als ein Wispern. Ein seidiges, beinahe kosendes Wispern. Er drehte das Messer um, legte die scharfe Klingenseite in die Mulde unter ihrem Wangenkochen. Ihr Atem beschleunigte sich. Ein Schrei stieg ihr in die Kehle.
Sie unterdrückte ihn, wollte den Mann nicht provozieren. Die Angst schmeckte sauer wie Essig in ihrem Mund, doch sie bemühte sich um einen ruhigen Ton.
»Wenn es einen Safe gäbe und ich davon wüsste, meinen Sie nicht, dass ich Ihnen das schon längst verraten hätte?«
»Kommt darauf an, wie schlau Sie sind. Meiner Einschätzung nach sind Sie nicht sonderlich schlau. Immerhin ficken Sie mit Ed Barnes.«
Die Panik machte es schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Was immer sie sagen, was immer sie tun würde, das Ergebnis wäre das Gleiche. Die Männer würden nicht einfach wieder verschwinden. Sie würden Lisa und sie weiterquälen, bis sie gefunden hätten, wonach sie suchten. Oder bis sie endlich überzeugt wären, dass der Safe nicht existierte. Aber bis dahin wären Lisa und sie vermutlich tot. Da heute Samstag war, würde man sie wohl erst am Montag, wenn Katharines Arbeitswoche wieder begann, vermissen. Wenn am Montag niemand ans Telefon ginge, würde jemand vom FBI vorbeikommen, um bei ihr nach dem Rechten zu sehen. Dieser Jemand würde an der Tür klingeln, aber keinen Einlass erhalten. Früher oder später würde er die Polizei benachrichtigen, und dann würde man Lisas und ihre Leiche genau hier, auf dem dreckigen Küchenboden finden.
Nein. Das werde ich nicht zulassen.
Der Entschluss erfüllte sie mit neuer Energie. Sie hatte keine Lust, tatenlos darauf zu warten, dass er sie abmurkste.
Es musste einen Ausweg geben. Sie musste es versuchen.
Bitte, lieber Gott, bitte ...
Sie befeuchtete ihre Lippen und blickte zu ihm hinauf. »Schauen Sie, ich habe Geld auf der Bank. Sehr viel Geld.« Seine Augen verdunkelten sich. Er runzelte die Stirn. O nein. Obwohl sie bereits wusste, dass er ablehnen würde, redete sie fieberhaft weiter. »Über hunderttausend Dollar. Die könnte ich Ihnen geben. Meine ATM-Karte ist in meiner Handtasche. Wir können –«
»Bingo!« Der freudige Ausruf unterbrach sie mitten in ihrem Verhandlungsgeschwafel. Er kam, wie sie schätzte, aus dem kleinen Arbeitszimmer, das zusammen mit dem Wohn-Essbereich, der Küche, der Eingangsdiele und dem Bad das Erdgeschoss des Reihenhauses bildete. Und dieses triumphierende Bingo des zweiten Mannes konnte sich nur auf eines beziehen: den verborgenen Safe.
Offenbar existierte er also doch, denn sonst hätte man ihn ja wohl kaum gefunden.
Wer hätte das gedacht?, war ihr erster Gedanke, gefolgt von einem inbrünstigen Gott sei Dank.
Noch während sich die Gedanken in ihrem Kopf bildeten, entfernte sich das Messer von ihrem Gesicht. Sie stieß einen tiefen, erleichterten Atemzug aus.
»Schwein gehabt, Katharine.«
Schwein hin oder her, Katharine wusste, dass dies nicht die Rettung war. Es war bestenfalls eine kleine Gnadenfrist. Ihr Herz hämmerte gegen die Rippen, als ihre Blicke sich für einen quälend langen Moment trafen. Sein Blick war eisig kalt; in diesen trüben haselnussbraunen Tiefen lag kein Mitleid für sie. Die Hand, die sich immer noch in ihr Haar krallte, veränderte ihren Griff.
Der Mann lächelte sie an.
Dann schlug er ihren Kopf ohne jede Vorwarnung nach unten. Ihre Nase und Stirn knallten mit voller Wucht auf die Fliesen. Der Aufprall war so heftig, dass sie Sterne sah.
»Aah!« Der Schrei kam aus ihrer eigenen Kehle, realisierte sie benommen. Blut schoss aus ihrer Nase; sie spürte den warmen, nassen Schwall trotz des rasenden Schwindels, der sie in seine wirbelnden Tiefen zog.
Der Mann ließ ihr Haar los und richtete sich zu voller Größe auf.
»Bin gleich zurück«, sagte er und verließ die Küche mit wenigen raschen Schritten, die leise nachhallten, als er über das Parkett ging. Sobald er auf dem Esszimmerteppich angelangt war, wurden seine Schritte von der dicken Wolle verschluckt und waren nicht mehr zu hören.
Katharine registrierte das nur am Rande. Durch den Nebel aus Schock und Schmerz hindurch nahm sie sein Verschwinden kaum wahr. Die Augen geschlossen und hart atmend, lag sie wie erstarrt da, während ihr das Blut weiterhin aus der Nase strömte. Vielleicht verlor sie das Bewusstsein, vielleicht nicht, aber für einen kurzen Zeitraum nahm sie kaum etwas anderes wahr als die graue Wolke, die ihre Sinne umnebelte, und ihre Schwierigkeiten, durch das viele Blut hindurch zu atmen.
»Katharine.« Es war kaum mehr als ein Hauch. Etwas berührte sie, etwas Warmes, das an ihre linke Schulter und ihr linkes Bein stupste. Als sie nicht reagierte, kam die Berührung erneut, diesmal fester. Sie hatte etwas Dringendes an sich.
Mit einiger Anstrengung öffnete Katharine die Augen. Blut füllte ihren Mund, salzig, dickflüssig und warm, und der Geschmack ließ sie vor Ekel erschauern. Sie hob den Kopf und spuckte aus. Die Küche verschwamm vor ihren Augen, doch vor ihr auf dem Boden, wo ihr Gesicht gelegen hatte, erspähte sie eine tiefrote Lache. Ihre Nase ... war sie gebrochen? Sie blutete noch, aber nicht mehr so heftig wie zuvor.
Dafür tat sie weh. O Gott, entsetzlich weh.
»Katharine.«
Vor ihren Augen begann wieder alles zu verschwimmen. Instinktiv drehte sie den Kopf in Richtung des heiseren Flüsterns. Etwas Gelbes blitzte auf, stahl sich in ihr peripheres Gesichtsfeld, drängte sie, sich weiter anzustrengen. Noch während der Schwindel in einer neuen Woge über sie hinwegrollte und die Küche wieder hinter einem Nebel verschwand, gelang es ihr, mit dem Kopf die schwierige Vierteldrehung zu bewerkstelligen, und ihre Augen weiteten sich vor Erstaunen. Lisa war unmöglich zu übersehen. Ihre Freundin lag nun neben ihr, auf die Seite gedreht, das Gesicht abgewandt und ihr mit gelbem Nylon bedeckter Rücken nur Zentimeter von Katharines blutigem Gesicht entfernt. Es dauerte eine Sekunde, bis Katharine schließlich dämmerte, dass Lisa sich über den Boden gerollt, geschoben, geschlängelt oder sonst wie bewegt haben musste, um zu ihr zu gelangen.
Ihre Blicke begegneten sich über Lisas Schulter hinweg.
»Lös mir die Fessel von den Händen.«
Lisas schlanke, gebräunte Hände, die an den Fingerspitzen unnatürlich bleich waren, wackelten ungeduldig unter dem breiten grauen Klebeband, das fest um beide Handgelenke gewickelt war. Während Katharine verständnislos die Stirn runzelte, rutschte Lisa ein kleines Stück zurück und stieß ihre gefesselten Hände kraftvoll in die Richtung von Katharines Gesicht.
»Meine Hände«, zischte Lisa.
Plötzlich fiel es Katharine wie Schuppen von den Augen: Lisa sprach. Nicht mühelos, nicht gut, aber sie sprach. Das Klebeband über ihrem Mund hatte sich etwas gelockert, sodass sie die Unterlippe ausreichend bewegen konnte, um verständliche Wörter zu bilden.
»Nimm die Zähne.« Es war ein drängendes Wispern.
Katharine blinzelte.
»Die Zähne?«, wiederholte sie verwirrt.
»Sch! Ja.«
Katharine hatte vergessen zu flüstern. Es fiel ihr auf, noch während sie redete und noch bevor Lisas Gesicht sich entsetzt verzerrte und sie die Fersen warnend in Katharines Oberschenkel rammte.
»Nimm die Zähne, um das Klebeband abzukriegen.«
Diesmal dachte Katharine daran zu flüstern. »Oh. Okay.«
Aber nach wie vor hatte Katharine Mühe zu begreifen, was sie tun sollte. Ihre Nase tat fürchterlich weh. Ihr Schädel pochte, ihre Ohren klingelten, und jedes Mal, wenn sie den Kopf auch nur ein klein wenig bewegte, überfiel sie eine neue Woge von Schwindel. Lisa wollte, dass sie das Klebeband mit den Zähnen abmachte? Das ergab keinen rechten Sinn, aber dennoch neigte Katharine den Kopf folgsam in Richtung von Lisas Händen. Der Schmerz explodierte hinter ihren Augen. Die Umgebung begann erneut zurückzuweichen. Das Klingeln in ihren Ohren verwandelte sich zu einem beinahe beruhigenden Summen. Die Küche schien plötzlich zu schimmern und zu flirren wie eine Fata Morgana. Die ganze Welt löste sich auf ...
»Katharine.«
Außer Lisa. Deren gefesselte Hände zappelten im unteren Teil ihres Rückens wild herum, während sie mit ihren gefesselten Füßen erneut gegen Katharines Oberschenkel trat. Lisa, die sie mit einem Killerblick anfunkelte.
Lisa, die sich nach Kräften bemühte, Katharine vor dem gähnenden Abgrund der Ohnmacht zurückzureißen, obwohl Katharine sich danach sehnte, in die Leere einzutauchen.
»Katharine. Du musst das jetzt tun, kapiert? Reiß das Klebeband an meinen Händen mit den Zähnen ab.«
Die Intensität der geflüsterten Worte durchdrang den Nebel, der Katharines Bewusstsein umwölkte, ihre Muskeln schwächte, ihre Glieder schwer wie Blei machte. Lisas Worte kamen endlich an, und Katharine riss bewusst die Augen auf, holte tief Luft und zwang sich, in die Gegenwart zurückzukehren. Doch noch ehe sie sich bewegen oder antworten oder sonst wie reagieren konnte, ertönte aus dem Arbeitszimmer ein lautes Poltern, gefolgt von einer Reihe gemeiner Flüche, bei denen Katharine der Atem stockte.
»Du hast ihn fallen lassen!« Das anklagende Gebrüll übertönte die Flüche.
»Scheiße, ja, das Teil ist schwer!«
Lisa, die gerade zu einem neuen Tritt ansetzte, erstarrte in der Bewegung, die Fersen nur Millimeter von Katharines Oberschenkel entfernt.
Katharine erstarrte ebenfalls.
Die Angst vertrieb die letzten Nebelfetzen, und wie eine Bombe schlug die Erkenntnis bei ihr ein: Sie hatten nicht viel Zeit. Die Männer waren noch immer da, nur ein Zimmer weiter. Sie konnten jeden Moment zurückkommen.
Und das war wahrlich keine beruhigende Aussicht.
»Los, mach endlich!« Lisa führte den Tritt zu Ende aus.
Katharine hatte zwar das Gefühl, als habe sich die Hälfte ihres Gehirns in Watte verwandelt, aber da sie sich nun wieder an die Geschehnisse erinnerte und wusste, dass ihrer beider Leben auf dem Spiel standen, war der Teil in ihr, der noch funktionierte, definitiv gefordert.
Wenn Lisa und sie nicht bald von hier wegkämen, würden sie sterben. So einfach war das.
»Ja, okay«, flüsterte Katharine.
Das Vorhaben erforderte eine enorme Anstrengung, doch Katharine gab nicht auf. Mit den Zähnen attackierte sie das Klebeband um Lisas Handgelenke, ignorierte das rasende Stechen, das durch ihre entsetzlich empfindliche Nase schoss, als sie damit aus Versehen gegen Lisas Oberarm stieß. Der Schmerz war so grauenhaft, so schlimm, dass Katharine nur noch den Wunsch hatte, sich zurückzuziehen und eine Weile ganz still zu liegen, bis der Schmerz abgeklungen wäre. Doch der Gedanke an den Tod war schlimmer. Also machte sie weiter und bearbeitete das Klebeband mit einer Wildheit, die aus Verzweiflung geboren war. Lisa hielt ihre Arme so still und steif wie sie konnte, streckte sie nach hinten und zerrte immer wieder mit aller Kraft an dem Klebeband, um auch den winzigsten Riss auszunutzen.
Es gab keinen. Trotz Katharines Bemühungen blieb das Klebeband intakt. Das Band war gummiert und hatte einen widerlichen, säuerlichen Geschmack. Es war schwierig, es mit den Zähnen zu fassen. Ständig stieß sie mit der Nase gegen Lisas Arm. Unter weniger dramatischen Umständen hätte sie der Schmerz schachmatt gesetzt. Ihre Nase war so empfindlich wie ein frei liegender Nerv und so demoliert – wahrscheinlich war sie gebrochen –, dass Katharine durch den Mund nach Luft schnappen musste.
Wiewohl der Zustand ihrer Nase im Moment das geringste Problem war. Sie hatten nur dieses winzige Zeitfenster ...
»Beeil dich«, keuchte Lisa.
Katharine kam es vor, als seien Stunden verstrichen. Tage. Wochen. Monate. Aber ein kurzer Blick auf die Uhr am Mikrowellenherd verriet ihr, dass sie irrte.
Es war erst vierzehn Minuten nach eins. Sie konnte kaum glauben, dass erst sieben Minuten vergangen waren, seit sie das letzte Mal auf diese rotglühenden Zahlen geblickt hatte.
Folglich konnte sie nicht länger als ein, zwei Minuten auf dem Klebeband herumgekaut haben.
»Doch nicht so!«, ertönte es in ungehaltenem Ton aus dem Arbeitszimmer. Katharine zuckte zusammen, als wäre sie unerwartet mit einem elektrischen Zaun in Berührung gekommen.
»Hast du eine bessere Idee?«, kam die geknurrte Antwort.
Mit klopfendem Herzen warf Katharine über die Schulter hinweg einen nervösen Blick zur Tür. Die Stimmen klangen so nah – beängstigend nah. Doch sie sah nichts weiter als den kleinen Ausschnitt des Esszimmers: eine Ecke des Glasesstisches, den Teil eines hochkant gestellten, grau gepolsterten Chromstuhls, das Bild der in einer Vase steckenden Lilie, das auf den Teppich geworfen worden war. Von den Männern war, Gott sei Dank, nichts zu sehen. Offenbar waren sie noch im Arbeitszimmer und hatten zum Glück keine Ahnung, was in der Küche vor sich ging.
Oh, Gott, wie lange würde es dauern, bis einer der beiden auf die Idee käme, nach ihnen zu schauend
Die Panik schoss wie eisiges Gletscherwasser durch ihre Adern, als sie zu dem unausweichlichen Schluss gelangte: vermutlich nicht mehr lange.
»Schnell!«, keuchte Lisa.
Ja, ja. Sich verzweifelt zur Eile mahnend, stürzte sich Katharine wieder auf das Klebeband. Ihr Herz hämmerte. Ihr Puls raste. Ihr Magen verknäulte sich. Jeden Moment – jede Sekunde – konnte einer der Männer in die Küche zurückkommen.
Und sie hatte nicht den geringsten Zweifel daran, dass Lisa und sie dann sterben würden. Schließlich hatten die Kerle den Safe gefunden. Sie brauchten die Frauen nicht mehr.
Schnell. Schnell. Schnell. Das Wort schwoll in ihrem Kopf zu einem anfeuernden Chor.
»Wo gehst du hin?« Die laute Stimme gehörte dem Typen, der Katharine mit dem Gesicht auf die Fliesen geknallt hatte. Dessen war sie sich absolut sicher. Die Frage galt eindeutig seinem Partner, der anscheinend das Arbeitszimmer verlassen hatte.
O Gott, wo war er? Ihr Herz pochte in ihrer Brust, als sie angestrengt die Ohren spitzte. Sie hörte nichts, keine Schritte, keine anderen Geräusche, die ihr geholfen hätten, den Mann zu lokalisieren.
Bitte, lieber Gott, lass ihn nicht in die Küche gehen.
Die Panik verlieh ihr neue Kräfte. Sie fand Halt mit den Eckzähnen, zerrte an dem Band. Und Wunder über Wunder, das Klebeband riss. Ja. Es war ein elektrisierender Moment, und Lisa spürte es auch. Das verrieten ihre sich triumphierend zur Faust krümmenden Finger. Es war nur ein winziger Riss, doch er schenkte ihnen Hoffnung, ließ den Erfolg ihres Tuns nicht mehr gänzlich unmöglich erscheinen. Katharine zerrte wie ein Terrier an dem Klebeband, schmeckte den metallischen Geschmack. Oder vielleicht war der metallische Geschmack auch Blut. Sie wusste es nicht, scherte sich nicht darum.
Er konnte jeden Moment in die Küche kommen ...
Mit ruckartigen Bewegungen versuchte Lisa, die Hände auseinanderzuziehen, während Katharine weiterhin fieberhaft an dem Band nagte. Langsam, entsetzlich langsam begann es zu reißen ...
Lisa spannte die Armmuskeln an, und plötzlich waren ihre Hände frei. Als Katharine den Kopf keuchend auf den Küchenboden fallen ließ, begegneten sich für einen Moment lang ihre Blicke. Dann hievte sich Lisa, an deren einem Handgelenk lose Klebebandstreifen herunterbaumelten, in eine sitzende Position, riss sich das Klebeband vom Mund und zerrte dann mit den Fingernägeln erfolglos an ihren Fußfesseln.
Das Geräusch der Toilettenspülung beantwortete zumindest eine wichtige Frage: den Standort des zweiten Typen. Er befand sich in der Toilette, die von der Diele abging. Das Wissen darum, wo er sich aufhielt, ließ Katharine kurzzeitig aufatmen.
Bis ihr bewusst wurde, dass die Küche seine nächste Station sein könnte. Er brauchte sich nur nach links zu drehen und zehn, zwölf Schritte durch den Flur zu machen. Der Bogengang, der von der Diele in die Küche führte, hatte nicht einmal eine Tür. Das bedeutete, der Mann würde sie sehen, noch bevor er die Küche betreten hätte.
Lisa setzte sich in Bewegung, indem sie mit dem Hintern über den Küchenboden rutschte. Verdattert beobachtete Katharine ihr Tun. Erst als Lisa nach der Schublade mit dem Besteck griff und sie vorsichtig aufzuziehen begann, wurde Katharine klar, was sie beabsichtigte. Das weiche Herausgleiten der Schublade dröhnte wie Donner in Katharines Ohren, und ihr Herz reagierte mit einem Trommelwirbel, während sie nervös zur Tür hinüberlinste. Das Klirren des Bestecks, als Lisa hineingriff, ließ Katharine zusammenzucken. Starr vor Anspannung beobachtete sie dann, wie Lisas Hand aus der Schublade auftauchte und triumphierend ein Steakmesser mit Sägezahnung umklammerte. Sie hielt es nach unten und sägte mit wilder Entschlossenheit durch das Klebeband an ihren Fußknöcheln.
»Kannst du mir mal eben helfen?«, rief der erste Mann. Einen Aufschrei unterdrückend, blickte sich Katharine erneut zur Tür um: Nichts.
»Ich wollte mich jetzt eigentlich um die Mädels kümmern«, antwortete der andere Mann. Katharine stockte der Atem. Entsetzt drehte sie sich zu Lisa um, die gerade das Klebeband von ihren Füßen zog. »Dann wäre das schon mal erledigt.«
Oh, mein Gott. Gleich ist er da und wird uns töten.
Dem Klang seiner Stimme zufolge war er ganz in der Nähe. Nur wenige Schritte entfernt.
Die Panik schlug wie eine eisige Welle über Katharine zusammen. Sie war plötzlich in kalten Schweiß gebadet. Ihr Herz galoppierte. Ihr Magen sackte in freiem Fall nach unten. Ihr Blick heftete sich auf Lisa, und ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen, als Lisa aufstand und Katharine schlagartig bewusst wurde, dass Lisa frei war – und sie nicht.
Sie hörte seine Schritte, hörte ihn näher kommen ...
Das Messer in der Hand sprang Lisa mit einem Satz auf Katharine zu, beugte sich über sie und sägte wild an dem Klebeband um ihre Fußknöchel.
»Dafür haben wir noch genügend Zeit.« Der erste Mann hörte sich ungeduldig an. »Komm jetzt lieber her und hilf mir.«
Die Schritte hielten eine endlos währende Zeit inne und wechselten dann die Richtung.
Puh! Vor Erleichterung brach Katharine beinahe zusammen.
Das Messer fuhr durch das Klebeband an ihren Füßen als wäre es Seidenpapier.
Mit einem Ruck riss Katharine die Füße auseinander und war ebenfalls frei.
»Lass uns abhauen«, flüsterte Lisa. Sie packte Katharine am Oberarm, zog sie hoch und schnitt gleichzeitig ihre Handfessel auf. Rasch befreite Katharine ihre Handgelenke von den klebrigen Streifen. Das schnelle Aufstehen verursachte ihr Schwindel, und sie hatte das Gefühl, als würde ihr der Kopf platzen. Ein messerscharfer Schmerz durchfuhr sie an der Stelle, wo der Mann sie getreten hatte. Sie befürchtete, mindestens eine gebrochene Rippe zu haben. Ihre tauben Arme kribbelten, als sie sie bewegte. Tief Luft holend, versuchte sie zu laufen, und bemerkte zu ihrem Entsetzen, dass ihr die Beine nicht gehorchten. Benommen, geschwächt und von einer jähen Übelkeit erfasst, gelang es Katharine dennoch, sich fortzubewegen. Schwerfällig taumelte sie hinter Lisa her, die bereits auf die andere Seite der Küche zuschoss. Dort befand sich eine kleine Waschküche, und in dieser Waschküche befand sich die Hintertür.