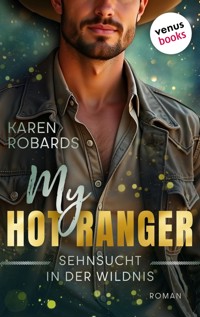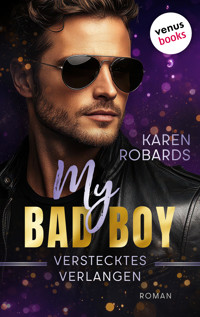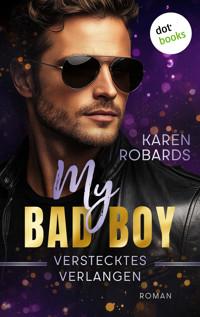Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reporterin in Gefahr – ein geheimnisvoller Mann, der sie beschützt Simbabwe, im Süden Afrikas: Um den tragischen Erinnerungen an den Tod ihrer Tochter zu entgehen, hat die junge amerikanische Journalistin Lisa Collins einen Auftrag übernommen, der sie auf den Schwarzen Kontinent führt. Doch schon bald wird ihr schmerzlich bewusst, wie sehr sie das Risiko unterschätzt hat, dem sie sich als Reporterin in einem vom Bürgerkrieg umtobten Land aussetzt. Als die Farm, von der sie berichtet, angegriffen und niedergebrannt wird, kann Lisa nur mit der Hilfe des attraktiven Söldners Sam Eastmann entkommen. Aber der Weg in die Sicherheit ist noch weit und gefährlich – kann sie ihm wirklich trauen? Dieses Romantik-Highlight voller Abenteuer wird Fans von Stefanie Gercke und Nora Roberts begeistern!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Simbabwe, im Süden Afrikas: Um den tragischen Erinnerungen an den Tod ihrer Tochter zu entgehen, hat die junge amerikanische Journalistin Lisa Collins einen Auftrag übernommen, der sie auf den Schwarzen Kontinent führt. Doch schon bald wird ihr schmerzlich bewusst, wie sehr sie das Risiko unterschätzt hat, dem sie sich als Reporterin in einem vom Bürgerkrieg umtobten Land aussetzt. Als die Farm, von der sie berichtet, angegriffen und niedergebrannt wird, kann Lisa nur mit der Hilfe des attraktiven Söldners Sam Eastmann entkommen. Aber der Weg in die Sicherheit ist noch weit und gefährlich – kann sie ihm wirklich trauen?
Über die Autorin:
Karen Robards ist die New York Times-, USA Today- und Publishers Weekly-Bestsellerautorin von mehr als fünfzig Büchern. Sie veröffentlichte ihren ersten Roman im Alter von 24 Jahren und wurde im Laufe ihrer Karriere mit zahlreichen Preisen bedacht, unter anderem mit sechs Silver Pens. Sie brilliert in der Spannung ebenso sehr wie im Genre Liebesroman.
Die Website der Autorin: karenrobards.com/
Die Autorin bei Facebook: facebook.com/AuthorKarenRobards/
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin die Thriller »Keiner wird dir helfen«, »Und niemand hört dein Rufen«, die historischen Liebesromane »Die Rose von Irland«, »Die Liebe der englischen Rose«, »Die Gefangene des Piraten« und »Die Geliebte des Piraten« sowie die Exotikromane »Im Land der Zimtbäume« und »Unter der heißen Sonne Afrikas«.
***
eBook-Neuausgabe März 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1985 unter dem Originaltitel »To Love a Man« bei Warner Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1991 unter dem Titel »Sklavin der Liebe« bei Heyne
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1985 by Karen Robards
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1991 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung zweier Motive von visoot / Daniela / Adobe Stock sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-650-1
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Karen Robards
Unter der heißen Sonne Afrikas
Roman
Aus dem Amerikanischen von Uschi Gnade
dotbooks.
Kapitel 1
Lisa Collins’ schlanker Körper war zu einer Kugel zusammengerollt, und ihr Gesicht war nur wenige Zentimeter über dem Lehmboden, als sie ihre Nase und ihren Mund fest gegen ihren nackten, rußigen Arm preßte. Um sie herum stieg auf allen Seiten Rauch auf, dichter schwarzer Rauch, der hochzüngelte und sich in Schwaden voranwälzte und ölig in ihre Nase und ihre Kehle drang. Sie hustete erstickt und bemühte sich verzweifelt, den Laut zu dämpfen. Gott sei Dank war niemand in der Nähe, der sie hören konnte. Wenn sie sie hörten ... ein Schauer lief über ihren Rücken. Sie machte sich keine Illusionen darüber, was dann ihr Los sein würde.
Wenigstens hatten die Schreie aufgehört. Obwohl sie wußte, daß sie es nicht sein durfte, und auch wußte, was die Stille bedeutete, war Lisa bei allem Schuldbewußtsein dankbar dafür. Sie hatte geglaubt, verrückt zu werden, als sie den gequälten Schreien von Ian und Mary Blass und ihren drei Kindern gelauscht hatte, während sie in dem flammenden Inferno, das einst ihr Haus gewesen war, verbrannten. Wenn sie nicht draußen gewesen wäre, als die Soldaten kamen, wenn sie nicht vor dem Schlafengehen der Hütte einen kurzen Besuch abgestattet hätte, in der die sanitären Einrichtungen des Bauernhofes untergebracht waren, wäre sie jetzt auch tot. Sie wußte aber auch, daß sie bis jetzt noch nicht davongekommen war. Die Mörder waren noch da, umgaben sie auf allen Seiten und steckten alles in Brand, und sie schlachteten nicht nur Menschen, sondern auch Tiere ab. Die Schreie der Schweine und Kühe hatten sich mit denen der Blass’ vermengt ...
Natürlich waren es Guerillas. Lisa war nicht sicher, für welche Seite sie kämpften. Sie hatte gewußt, daß in Rhodesien Bürgerkrieg herrschte, als sie sich für den Auftrag beworben hatte, aber es war ihr so sehr als eine Fluchtmöglichkeit erschienen, die ihr der Himmel gesandt hatte, daß sie die Möglichkeit einer Gefahr kaum in Betracht gezogen hatte. Außerdem hatte sie in ihrer Naivität geglaubt, ihr Status als amerikanische Journalistin würde sie vor Gefahren schützen. Wie in so vielen anderen Dingen ihres Lebens hatte sie sich geirrt. Vielleicht würde sie diesen Irrtum mit dem Tod bezahlen müssen.
Der Rauch wurde mit jeder Sekunde dichter. Sie drohte zu ersticken. Lisa wußte, daß sie etwas unternehmen mußte, daß sie davonlaufen mußte, solange sie noch dazu in der Lage war, doch die Vorstellung, ihr Versteck zu verlassen und ohne Deckung über den Platz zu laufen, lähmte sie.
Auf der anderen Seite der dünnen Mauer trampelten Füße dicht neben ihrem Kopf. Lisa hielt den Atem an, als ein Mann in einer unverständlichen Sprache etwas schrie. Irgendwo über ihrem Kopf hörte sie einen dumpfen Laut. Dann aber entfernten sich die Schritte wieder zu ihrer großen Erleichterung.
Kaum hatte Lisa sich ein bißchen beruhigt, wurde ihr ein unheilvolles knisterndes Geräusch bewußt. Sie hob den Kopf, sah sich um und stellte fest, daß das gesamte hintere Ende der Hütte in einen glutroten Schein gehüllt war. Feuer! Winzige Flammen züngelten am Dach und rasten an den Wänden hinauf. Jetzt hatte sie keine Wahl mehr. Sie mußte davonlaufen. Panik stieg in ihr auf, als müsse sie sich übergeben. Sie fürchtete sich – fürchtete sich zu Tode. Sie hatte das Gefühl, sich nicht mehr rühren zu können. Aber das Grauen wurde ihr Verbündeter und zwang ihre verkrampften Glieder, langsam zur Tür zu kriechen. Ihr Atem stockte. Tränen hinterließen glühende Spuren auf ihrem Gesicht. Sie würde sterben, das wußte sie, hier auf dieser abgelegenen Farm im Süden von Rhodesien. Und sie war doch erst fünfundzwanzig! Es war eine Ungerechtigkeit! O Gott, es war so ungerecht!
Der Meter bis zur Tür kam ihr wie fünf Kilometer vor. Lisa fühlte sich vom Rauch benommen, und ihre Rückenmuskeln spannten sich in vergeblicher Abwehr gegen das Feuer an, das jetzt direkt über ihr tobte. Um sie herum fielen kleine brennende Holzsplitter auf den Boden. Lisa wußte, daß es nur noch eine Frage von Minuten war, bis das Dach einstürzte – und sie sterben würde. Ob Sterben wehtat? fragte sie sich. Natürlich tat es weh. Denk nur daran, wie die Blass’ geschrien haben ...
Ihre Nägel gruben sich tief in den Lehmboden, um sich vorwärtszuschleppen. Wenn sie doch nur ins Freie käme, dann würde sie überleben – zumindest für eine Weile. Doch als sie die Tür endlich erreicht hatte, hielt sie inne und japste nach kostbarer Luft, während sie auf dem Bauch liegenblieb und ihre Gedanken sich im Kreis drehten. Das, was sie vor dieser Tür erwartete, flößte ihr fast mehr Grauen ein als das Krematorium, in dem sie sterben würde, wenn sie im Hause bliebe.
»In deine Hände, Gott«, flüsterte sie schließlich und stieß mühelos die Tür auf. Sie öffnete sie gerade so weit, um hinausschauen zu können. Die Nachtluft, die durch den Spalt hereinwehte, war eine kühlende Erquickung für ihr Gesicht und ihre rauhe Kehle. Lisa sog sie gierig ein und empfand sie in diesem Augenblick als etwas Wunderbares und Kostbares. Ihre Augen glitten furchtsam über die Kulisse, die vor ihr lag.
Es war Nacht, aber es war nicht ganz dunkel. Flammen schossen aus dem Haus, aus der Scheune und aus etlichen Nebengebäuden und warfen ihre Strahlen auf den Platz, der fast taghell erschien. Überall sah Lisa Männer in Khakiuniformen. Manche standen selbstzufrieden vor der Zerstörung, die sie angerichtet hatten, andere rannten über den Hof und schwangen brennende Fackeln, und wieder andere luden Gegenstände, sie sie offensichtlich geplündert hatten, auf Lastwagen. Keiner von ihnen schien sich besonders für den brennenden Abort zu interessieren. Lisa holte tief Atem. Sie hatte also eine Chance. Nur eine geringe Chance.
So schnell wie eine Schlange wand sie sich durch die Tür und kroch durch das kurze, zähe Gras zu den Bäumen, die den Rand der gerodeten Lichtung markierten. Wenn es ihr erst gelungen sein sollte, den Dschungel zu erreichen, konnte sie sich verstecken ... sie könnte weiterleben! Der Gedanke, der ihr vorher so undenkbar erschien, war berauschend. Lisa glitt so schnell über den Boden, wie sie im Traum nicht geglaubt hätte, sich bewegen zu können. Sie fürchtete sich, sich umzusehen. Steine und spitze Stücke zerrissen ihre Jeans und ihr kurzärmeliges T-Shirt und zerkratzten ihre Haut, doch Lisa spürte den Schmerz kaum. Ihr Bewußtsein war darauf ausgerichtet, den dürren Streifen Erde hinter sich zu legen, der sie von der Sicherheit trennte.
Weniger als fünf Meter lagen vor ihr. Lisa sah nach links und erstarrte. Wenige Zentimeter neben ihr lag die Leiche eines Mannes, eines Mannes, den sie gekannt hatte. Cholly – so hieß er. Ian Blass hatte ihn geschickt, damit er sie von dem kleinen Flugplatz abholte und sie die sechzehn Meilen zur Farm herausfuhr. Auf dem ganzen Weg hatte er übersprudelnd auf sie eingeredet. War es erst gestern? Sie konnte es nicht glauben. Jetzt war er tot. Brutal ermordet worden. Lisas Magen zog sich zusammen, und sie übergab sich, bis sie keinen Tropfen Flüssigkeit mehr in sich hatte. Bei diesem Anblick des Grauens vergaß sie für kurze Zeit ihre Angst. Sie sprang auf die Füße und lief wankend auf die Bäume zu.
Durch ein Wunder schaffte sie es. Doch selbst dann blieb sie nicht stehen und verlangsamte ihre überstürzte Flucht. Sie konnte nicht innehalten. Die Panik trieb sie weiter. Sie bahnte sich einen Weg durch das Unterholz, das ihr bis zur Taille reichte. Zweimal stolperte sie und fiel der Länge nach hin, doch sie sprang wieder auf und lief weiter. Der einzige Gedanke, den sie noch hatte, war, daß sie entkommen mußte ... entkommen mußte ... entkommen mußte ...
»Gütiger Herr im Himmel, was zum Teufel soll das?« Bei diesem barbarischen Ausruf wirbelte sie herum.
Soldaten! Mehr als ein Dutzend, und sie standen keine drei Armlängen von ihr entfernt als zwangloses Grüppchen zusammen. Die pechschwarze Nacht des Dschungels und ihr eigenes Entsetzen hatten dazu geführt, daß sie sie bis jetzt nicht bemerkt hatte. Es war grausam, sie bis hierher und nicht weiter kommen zu lassen ...
Sie versuchte es dennoch. Sie lief verzweifelt weiter durch das dichte Laub. Hinter sich hörte sie malmende Schritte, die ihr nachjagten, und dann das heftige Keuchen eines Mannes. Schließlich brachte sie ein Seil, das nach ihr geworfen wurde, zu Fall. Ihr Körper grub sich tief in das dornige Unterholz, und das schwere Gewicht eines Mannes preßte sie noch tiefer hinein. Zu ihrer Verteidigung schlug sie wüst um sich. Sie sah den Khakiärmel einer Uniform und schrie. Und schrie. Und schrie. Bis etwas heftig in ihr Gesicht schlug und die Welt schwarz wurde.
Lisa träumte, sie sei wieder zu Hause, ein gründlich verzogener Teenager in der Sicherheit des riesigen Hauses ihres Großvaters an der Chesapeake Bay. Sie war sein Liebling, den er verhätschelte, seine einzige Verwandte, die noch am Leben war, und nichts auf Erden war zu gut für sie. Die besten Kleider, die besten Schulen, ein Wagen – sie bekam alles. Aber mit neunzehn wollte sie all das nicht mehr haben. Oder zumindest war ihr anderes wichtiger. Nämlich Jeff – Jeff Collins, der traumhaft gutaussehende Fußballspieler, Sohn eines Senators. Sie war nur zweimal mit ihm ausgegangen, aber sie wollte ihn für immer haben. Und was Lisa haben wollte, das bekam sie auch.
»Was Lisa haben wollte, das bekam sie auch.« Sogar im Traum lächelte Lisa verschmitzt darüber. Mit der zielstrebigen Hartnäckigkeit, die sie von ihrem Großvater, einem der einflußreichsten Verleger, geerbt hatte, hatte sie sich um Jeff bemüht und ihm innerhalb von sechs Monaten einen Heiratsantrag entlockt. Ihre Verlobung wurde von beiden Familien mit großer Begeisterung aufgenommen. Alle sprachen von ›einem idealen Paar‹. Ihr eigenes Glück war etwas, was Lisa als selbstverständlich voraussetzte. Für Leute wie sie, die ›richtigen‹ Leute, sah das Leben nun einmal so aus. Alles klappte immer so, wie es geplant war, und sie erwartete nicht weniger als ›glücklich bis an ihr Lebensende‹ zu sein.
Das bekam sie auch. Fast ein Jahr lang. Vielleicht war ihre Ehe nicht die Romanze, die in populären Romanen geschildert wird, aber es war eine gute und stabile Ehe, die auf gegenseitigem Vertrauen und auf Zuneigung begründet war. Oder zumindest erzählte sie das ihren Freundinnen. Insgeheim begann sie aber, sich Fragen zu stellen. Sie war behütet aufgewachsen und wußte daher sehr wenig über Sex. Sie war als Jungfrau in die Ehe gegangen, wenn auch eher aus Mangel an Gelegenheit (die besten Schulen waren immer reine Mädchenschulen) und weniger aufgrund von echten moralischen Überzeugungen. Das Wenige, was sie an Petting kannte, hatte ihr gezeigt, daß körperliche Kontakte mit einem Mann genüßlich sein konnten. Bei Jeff war es nicht so. Er hatte keinen Spaß daran, auch wenn er bemüht war, seine mangelnde Begeisterung zu verbergen. Als sich der Zustand im Laufe der Zeit nicht besserte, fing Lisa an, sich zu fragen, ob das Problem an ihr lag, ob ihr vielleicht das fehlte, was die Männer reizte, was auch immer das sein mochte. Es gelang ihr nicht, Jeff zu entflammen, obwohl sie ein außergewöhnlich hübsches Mädchen war. Sie war groß und schlank und hatte eine gute und wohl proportionierte Figur. Sie hatte ein gut geschnittenes und makelloses Gesicht. Das glänzende aschblonde Haar fiel locker auf die Schultern. Sie schminkte sich so gut wie gar nicht, sondern betonte nur ein wenig ihre grünen Augen. Sie roch gut, sie kleidete sich gut – was also stimmte nicht mit ihr?
Zwei Tage vor ihrem zwanzigsten Geburtstag fand sie es heraus – am selben Tag, an dem sie erfuhr, daß sie schwanger war. Sie hatte schon seit Wochen den Verdacht gehabt, aber Jeff nichts sagen wollen, solange sie nicht absolut sicher war. Als der Arzt ihr an diesem Vormittag bestätigt hatte, daß sie tatsächlich ein Kind erwartete, hatte Lisa das geplante Mittagessen abgesagt und war mit den Neuigkeiten nach Hause geeilt. So glücklich war sie seit langem nicht mehr gewesen. Mit freudigem Erstaunen stellte sie fest, daß Jeff zu Hause war. Sein Hut und Mantel hingen unten, und Lisa lächelte fröhlich und malte sich seine Aufregung aus, wenn sie ihm erzählte, daß er Vater wurde. Sie lief die Stufen zum Schlafzimmer hinauf und entdeckte Jeff nackt in ihrem riesigen Bett liegen, neben ihm ein fremder Mann.
Sie hätte sich damals von ihm scheiden lassen, wenn das Baby nicht unterwegs gewesen wäre, obwohl Jeff weinte und ihr versicherte, daß es wirklich das erste Mal gewesen wäre, Männer wirklich nicht sein Fall wären, und es nie wieder vorkommen würde. Er hatte sie angefleht, niemandem davon zu erzählen und ihm noch eine Chance zu geben. Schließlich hatte sie eingewilligt wegen des Babys.
Das war der zweitgrößte Fehler ihres Lebens. Sie hätte ihn auf der Stelle verlassen sollen. Mit der Zeit wurde es immer schwieriger, weil er wirklich großen Anteil an ihrer Schwangerschaft nahm und nach Jennifers Geburt ein hingebungsvoller Vater war. Die süße, kleine Jennifer betete ihn seit ihrem ersten Atemzug an, und Lisa brachte es beim besten Willen nicht über sich, mit dem Kind fortzugehen. Wie erklärt man einem Wickelkind, daß Papa andere Männer mehr liebt, als er Mama liebt, denn so war es natürlich.
Lisa war an den Punkt gekommen, ihn trotz seiner Bemühungen zu verlassen, als das schrecklichste Kapitel des Alptraums, zu dem ihr Leben geworden war, anbrach. Jennifer bekam Leukämie. Weder die vielen hunderttausend Dollar ihres Treuhandvermögens, noch die zahllosen Millionen ihres Großvaters oder dessen endloses Beziehungsnetz konnten das Kostbarste retten, was es für Lisa gab. Ihr blieb nichts anderes übrig, als betäubt zuzusehen, wie ihr Kind hinweggerafft wurde, und nur Jeffs Qualen konnten es mit ihren aufnehmen. Gemeinsam starben sie zu dritt Stück für Stück, bis es schließlich vorbei war und Jennifer in einem kalten, dunklen Grab lag. Danach brach Lisa zusammen. Es dauerte Monate, bis sie den ersten Tag ohne Tränen verbrachte, Monate, bis sie mit der Situation umgehen konnte, daß ihr Kind nicht mehr lebte.
Nach einem Jahr wurde ihr klar, daß sie sich aus allem lösen mußte. Ihr Rettungsanker war eine Stelle beim Annapolis Daily Star, einer der zahlreichen Zeitungen, die ihrem Großvater gehörten. Sie hatte ihn nicht um diese Arbeit gebeten, und eigentlich wollte sie die Stellung auch gar nicht annehmen, doch ihr Großvater beharrte darauf. Es sei an der Zeit, daß sie zur Abwechslung endlich einmal etwas arbeitete, sagte er, und die Sorge, die in seinen Augen stand, strafte seinen mürrischen Tonfall Lügen, als er ihre nunmehr zu schlanke Gestalt und ihr eingefallenes Gesicht betrachtete. Als Lisa Einwände erhob, wollte er nichts davon hören. Er brauchte jemanden, der über die gesellschaftlichen Ereignisse berichtete, sagte er ihr, und wer hätte das besser gekonnt als seine eigene Enkelin, die von Geburt an mit den richtigen Leuten Kontakt und als Gleichgestellte Zugang zu den besten Familien hatte? Lisa hatte die Achseln gezuckt und sich gefügt. Die Apathie, in die sie sich über Monate gehüllt hatte, machte es ihr unmöglich, sich dem eisernen Willen ihres Großvaters zu widersetzen. Daher hatte sie widerstrebend begonnen, alle Diners, Wohltätigkeitsbazare und Jagdbälle zu besuchen, die sie vor Jennifers Geburt soviel Zeit gekostet hatten. Der einzige Unterschied bestand darin, daß sie jetzt darüber berichtete, wer was trug, wer was sagte und wer mit wem gekommen war. Zu ihrem Erstaunen stellte Lisa fest, daß sie recht begabt im Schreiben war. Bald freute sie sich tatsächlich jeden Tag auf ihre Arbeit. Sie frischte alte Bekanntschaften wieder auf, die sie in ihrer Trauer um Jennifer vernachlässigt hatte, und unter den Mitarbeitern des Star fand sie neue Freunde. Schließlich erreichte sie einen Punkt, an dem sie wieder ins Auge fassen konnte, Jeff zu verlassen. Nur wenn sie sich von ihm freimachte, bestand für sie die Hoffnung, ein gewisses Maß an wahrem Glück zu erfahren. Soviel war ihr klar. Dennoch schob sie es vor sich her, weil sie die Reaktion ihres Großvaters, die von Jeffs Eltern und die ihrer Freunde fürchtete.
Als Grace Ballard, die die Leitartikel für den Star schrieb, eines Tages beim Mittagessen beiläufig erwähnte, daß eine alte Schulfreundin von ihr einen rhodesischen Farmer geheiratet hatte und im Moment die abenteuerlichen Erfahrungen machte, was es bedeutete, in einem Land zu leben, in dem Bürgerkrieg herrschte, hatte das kaum einen Funken Interesse in Lisa wachgerufen. Als Grace jedoch darüber klagte, nicht genügend Material für einen Artikel zu bekommen, sah die Sache plötzlich ganz anders aus. Lisa wußte, was sie wollte.
Man schlug es ihr glatt aus, denn selbst, wenn die Farm der Blass’ noch so weit vom Kampfgebiet entfernt lag, erschien dieser Auftrag zu gefährlich. Zum ersten Mal in ihrem Leben nutzte Lisa ihre familiären Beziehungen aus, um sich durchzusetzen. Sie suchte ihren Großvater auf und legte ihm ihren Wunsch vor. Er sah sie anscheinend eine Ewigkeit lang stumm an und nahm den Feuereifer in den grünen Augen wahr, die noch vor wenigen Wochen matt und leblos gewesen waren. Er gab ihr seine Erlaubnis.
Sie zog keinen Moment lang in Erwägung, daß sie ernstlichen Gefahren ausgesetzt sein könnte. Ihr kam es vor, als seien ihre Gebete erhört worden. Perfekter hätte sie nicht mit ihrem bisherigen Leben brechen können, ohne daß jemand etwas davon erfuhr, ehe alles vorbei war. Als sie die Reisevorbereitungen traf, erzählte sie natürlich niemandem, daß sie nicht vorhatte, je zurückzukommen – oder zumindest nicht zu Jeff oder in das Haus, das sie gemeinsam bewohnten.
Alles tat Lisa weh. Wimmernd vor Schmerz kam sie wieder zu Bewußtsein. Ihre Haut kam ihr vor, als stünde sie in Flammen. Feuer ... sie konnte sich an ein Feuer erinnern. Stand sie etwa in Flammen? War sie ohnmächtig geworden und hatte sich nur vorgestellt, es sei ihr gelungen, aus dem Schuppen zu fliehen? Hatte ... Etwas Scharfes piekste sie, und sie zuckte zusammen.
»Aua!« hörte sie sich zu ihrem eigenen Erstaunen sagen und schlug die Augen auf. Sie sah in das Gesicht eines Mannes, ein kantiges, sonnengebräuntes Gesicht, das ungewöhnlich geschnitten war. Über die rechte Backe zog sich eine Narbe. Es war kein schönes Gesicht – bis sie in die unglaublich blauen Augen sah.
»Du bist also doch endlich aufgewacht, Dornröschen.« Die Stimme paßte zu dem Gesicht. Sie war sehr schroff und männlich, und doch hörte sie einen melodisch gedehnten Klang heraus. Lisa blinzelte, ohne den Mann aus den Augen zu verlieren. Er lächelte, und eine braune Hand mit langen, schmalen Fingern strich ihr sehr sanft das Haar aus der Stirn.
»Kannst du mich hören?« fragte er. Lisa nickte matt und starrte ihn weiterhin an. Ihr fiel auf, daß seine Zähne etwas schief waren, doch sie blitzten leuchtend weiß in seinem dunklen Gesicht.
»Wo bin ich?« flüsterte sie. Ihre Stimme war so matt, daß sie selbst erschrak.
»Du bist in Sicherheit«, sagte er. Auch wenn es keine wirkliche Antwort war, war es doch genau das, was sie hören wollte.
»Wer sind Sie?«
»Ich heiße Sam. Sam Eastmann. Und wer sind Sie?«
»Lisa Collins.« Ihre Stimme klang, als käme sie aus weiter Ferne. Lisa fing an, sich zu fragen, ob sie sich dieses ganze Gespräch, ihre Arbeit für die Zeitung, das Feuer und alles, was geschehen war, nur eingebildet hatte. Ob sie vielleicht in ihrem Kummer über Jennifers Tod den Verstand verloren hatte ...
»Bist du echt? Bist du wirklich da?« Die argwöhnische Frage brachte ihn wieder dazu, zu lächeln.
»Ich kann mir vorstellen, daß ich mehr da bin als du, Schätzchen. Fühlst du dich schon in der Lage zu reden? Kannst du mir sagen, ob du hier in der Nähe Verwandte hast, jemanden, zu dem wir dich bringen können?« Es klang freundlich und besorgt. Gerührt von seiner bewußten Zartheit, stiegen Lisa heiße Tränen in die Augen.
»Ich komme aus Maryland«, flüsterte sie hilflos.
»Schon gut. Deshalb brauchst du nicht zu weinen. Du hast Schlimmes mitgemacht, aber es wird alles wieder gut. Und jetzt brauchst du Ruhe. Ich werde dir etwas geben, damit du schlafen kannst. Einverstanden?«
»Einverstanden«, wiederholte Lisa und versuchte zaghaft zu lächeln. Sie war so verwirrt, daß sie allem, was er vorschlug, zugestimmt hätte. Er hatte eine seltsame Wirkung auf sie. Sie fühlte sich sicher bei ihm, sicher und geborgen ...
Sie blickte ihm nach, und als er zurückkam, stach sie wieder etwas in den Arm. Benommen erkannte sie, was sie aus ihren Träumen gerissen hatte. Es war der Einstich einer Nadel gewesen. Sie starrte ihn weiterhin an, bis das Mittel wirkte und sie einschlief.
Als Lisa wieder erwachte, war es Nacht geworden. Sie lag in einem großen Zelt, nur mit einem riesigen Männerhemd bekleidet, unter einer Decke auf einer Feldpritsche. Trotz großer Schmerzen versuchte sie sich aufzurichten. Jede Bewegung tat weh, aber das Stillliegen auch. Daher versuchte sie krampfhaft, sich doch hinzusetzen.
»Verflucht noch mal«, sagte sie und ließ sich wieder zurücksinken, nachdem sie die Hand auf eine der vielen häßlichen roten Striemen auf ihrem Unterarm gelegt hatte.
»Drückt sich so eine Dame aus?« schalt sie eine zarte, spöttische Stimme. Lisa blickte eilig auf, als eine Zeltplane hochgehoben wurde und eine große, breitschultrige Gestalt gebeugt durch die Öffnung trat, die viel zu niedrig für ihren Wuchs war. Beim Anblick seiner Khaki- uniform fürchtete sie sich instinktiv, doch als sie in die blauen Augen sah, entspannte sie sich sofort wieder.
»Hallo«, sagte sie und empfand eine alberne Scheu.
»Worauf hat sich dieses ungehörige Wort bezogen?« fragte er lächelnd.
»Oh.« Lisa fielen erst jetzt wieder die Kratzer und Striemen auf ihren Armen ein. »Ich bin auf die Pritsche zurückgefallen, als ich mir meine Arme ansah. Sie sehen schrecklich aus – als hätte jemand mich ausgepeitscht. Was ist passiert?«
»Erinnern Sie sich daran, wie Sie durch den Dschungel gelaufen sind?«
Lisa nickte.
»Ich vermute, daß Sie sich dort an den Dornen die Arme aufgerissen haben. Sie haben aber auch ziemlich schlimme Verletzungen am Rücken – Verbrennungen, nehme ich an. Und überall blaue Flecken.«
»Das Feuer – die Blass’ – wie lange ist das alles her?« fragte sie, und ihr Hals schnürte sich plötzlich zusammen.
»Vier Tage.« Sam sah ihr fest in die Augen. »Wir haben Sie im Dschungel gefunden und nahmen Sie ins Lager mit. Wir ... äh ... sind an der Farm vorbeigekommen, nachdem wir Sie gefunden hatten. Wenn das Ihre Familie war, tut es mir furchtbar leid für Sie.«
»Nein, es war nicht meine Familie.« Lisa schloß einen Moment lang die Augen und schluckte schwer. »Ich kannte sie noch nicht lange, noch keine zwei Tage. Aber sie waren so nett ...«
»Das ist hart.« Seine Stimme drückte ein barsches Mitleid aus. Lisa schlug die Augen auf. Sie wollte nicht an die Blass’ denken.
»Sind Sie Arzt?«
Sam schnitt eine Grimasse. »Nein, wahrhaftig nicht.
Ich kenne die Grundlagen der ersten Hilfe. So etwas lernt man bei meiner Arbeit automatisch.«
»Und was für eine Arbeit ist das?« fragte Lisa matt, obwohl sie fürchtete, es längst zu wissen.
»Ich bin Soldat«, antwortete er, wie sie es geahnt hatte.
»Für ... für welche Seite?« Es war ihr verhaßt, sich vorzustellen, er könne auf derselben Seite kämpfen wie diese Tiere, die die Farm überfallen hatten.
»Im Moment für die Seite der Regierung. Aber ich bin flexibel. Meine Männer und ich sind für jeden zu haben, der unseren Preis zahlen kann.«
»Ihren ... Preis?« wiederholte Lisa verständnislos. Ohne es zu wollen, fügte sie hastig hinzu: »Sie sind doch auch Amerikaner, oder nicht?«
»Ja, das ist richtig.« Seine Stimme war ausdruckslos. Abrupt kauerte er sich neben sie, und seine Stirn legte sich in Falten, als er einen ihrer Arme in seine Hände nahm.
»Ein paar Ihrer Wunden sind aufgegangen, weil Sie sich bewegt haben. Haben Sie sich selbst noch mehr Schaden zugefügt?«
Er legte ihren Arm behutsam neben sie und wollte ihr die Decke wegziehen. Lisa zuckte zurück. Seine Augen wandten sich ihrem Gesicht zu und wirkten nachdenklich.
»Es ist alles in Ordnung. Ich werde Ihnen nicht weh tun«, sagte er und wippte auf den Fersen. »Aber ich muß mir die Verbrennungen auf Ihrem Rücken ansehen. Sie wollen doch nicht, daß sie sich entzünden, oder?«
»N-nein.« Lisa sah ihm fest in die Augen und kam sich dumm vor. Schließlich hatte der Mann ihre Verletzungen während ihrer Bewußtlosigkeit behandelt. Es wäre lachhaft gewesen, jetzt noch einen großen Wirbel zu veranstalten. Außerdem hatte sie instinktiv das Gefühl, ihm vertrauen zu können ...
»Es tut mir leid«, murmelte sie zerknirscht. »Ich weiß, daß Sie mir nicht weh tun wollen. Es ist nur ...«
»Nur was?« half er ihr weiter, als er merkte, daß sie ihren Satz von allein nicht beenden würde.
»Ihre Uniform«, antwortete Lisa. Während die Worte aus ihr heraussprudelten, wandte sie den Kopf ab. »Die Soldaten auf der Farm ... sie haben auch solche Uniformen getragen. Entschuldigen Sie, ich weiß ja, daß Sie nicht einer von ihnen waren, aber ich kann nichts dagegen tun, daß mir davon fast ... übel wird.«
Verständnis trat auf sein Gesicht. Er legte seine Hand unter ihr Kinn, zog ihr Gesicht zu sich hin und musterte es eingehend.
»Das war mir nicht klar ...« sagte er nachdenklich. »Deshalb sind Sie wie ein verängstigtes kleines Tier davongelaufen, als Sie uns gesehen haben. Und Sie haben geschrien, als würden Sie den Verstand verlieren. Ich mußte Sie niederschlagen, damit Sie endlich still waren.«
»Sie – Sie haben mich geschlagen?« fragte Lisa matt und spürte ein plötzliches Unbehagen. Was wußte sie denn schon über diesen Mann? Er war Soldat, was ihrer Meinung nach nur eine beschönigende Ausdrucksweise für einen bezahlten Mörder war, und er schlug Frauen.
»Ich mußte es tun. Sie haben lauter als eine Sirene geschrien. Noch ein paar Minuten, und das gesamte Rebellenheer hätte gewußt, wo wir sind.« Seine Stimme war sachlich. »Würden Sie sich jetzt bitte umdrehen? Ich habe noch mehr zu tun, als nur die Krankenschwester für Sie zu spielen.«
Lisa errötete, als sie sich auf den Bauch gelegt hatte und das Hemd bis zu ihrem Hals hinaufzog. Er begann eine kühlende Salbe auf die Verbrennungen aufzutragen. Seine Berührungen waren unpersönlich und doch wohltuend. Allmählich entspannte sie sich ein wenig. Soldat oder nicht – zu ihr war er ausnahmslos freundlich gewesen.
»So«, sagte er schließlich und zog ihr Hemd behutsam wieder herunter. Dann deckte er sie zu. Lisa drehte sich zu ihm um, doch ihre Wangen waren immer noch leicht gerötet. Er bemerkte es und grinste spöttisch.
»Sind Sie hungrig?«
Lisa nickte. Sie war restlos ausgehungert.
»Das dachte ich mir doch fast«, antwortete er und grinste noch breiter. »Wir hatten zum Abendessen Schweinefleisch mit Bohnen aus der Dose. Kann Sie das reizen?«
»Ich ... ich denke schon.« Wenn Lisas Stimme Zweifel ausdrückte, dann nur, weil sie noch nie in ihrem Leben Schweinefleisch mit Bohnen aus der Dose gegessen hatte und keine Ahnung hatte, ob ihr Magen mitspielen würde. Aber ihr Hunger war so groß, daß sie alles probiert hätte.
Sekunden später kam Sam mit einem Blechteller zurück, der mit dampfendem Essen vollgetürmt war. Lisa sah den Teller an, atmete den würzigen Duft ein und bekam ihre Zweifel. Sam bemerkte ihre Unsicherheit, hielt sich aber von jeder Bemerkung zurück. Dafür war ihm Lisa dankbar.
»Warten Sie, ich helfe Ihnen«, sagte er, als sie sich damit abmühte, sich aufzurichten. Ehe ihr klar wurde, was er vorhatte, hatte er den Teller auf die Kiste neben ihrem Bett gestellt und saß mit gespreizten Beinen hinter ihr auf der Pritsche. Er zog ihre Schultern an sich und lehnte sie an seinen Körper, damit sie eine Rückenstütze hatte. Vertrauensselig wie ein Kind lehnte sie sich an seine Brust. Seine Arme waren um ihre Taille geschlungen, und er stellte den Teller auf ihren Schoß.
»Schaffen Sie es allein?« fragte er, als sie nicht sofort zu essen begann.
»Danke, ja«, murmelte sie und bemerkte ihre Atemlosigkeit.
Als sie alles aufgegessen hatte, lehnte sie sich zufrieden zurück und fühlte sich gesättigt. Es schien ihr das Natürlichste auf Erden zu sein, so von ihm festgehalten zu werden. Sie fühlte sich jetzt schon viel besser, spürte die Kraft in ihre Glieder strömen, und sogar ihr Kopf wurde klarer. Sie fühlte sich behaglich und sicher.
Ihr Kopf lag auf seiner muskulösen Schulter, und sie drehte sich um, um ihn anzusehen.
»Sie sind sehr nett zu mir«, murmelte sie, und ihre Blicke wanderten neugierig über sein Gesicht. Auf die Nähe konnte sie seine ledrige, von Wind und Sonne gegerbte Haut mit der weißen Narbe und den Fältchen um die Mund- und Augenwinkel erkennen. Er hatte dichtes, schwarz gelocktes Haar. Sein Nasenrücken war schief, als sei seine Nase einmal gebrochen und nicht ordentlich geschient worden, sein Mund war groß und schmal, doch seine Unterlippe wirkte sinnlich, und auf seinem Kinn wuchsen schwarze Stoppeln, als hätte er sich seit Tagen nicht mehr rasiert. Er machte einen durch und durch männlichen und dabei unerhört verrufenen Eindruck, und Lisa wunderte sich darüber, wie geborgen und sicher sie sich bei ihm fühlte.
»Bestandsaufnahme?« fragte er belustigt. Lisa lächelte verträumt und gestattete sich den Luxus, sich noch dichter in seine Arme zu schmiegen. Es war wunderbar, von einem so starken Mann festgehalten zu werden, von jemandem, der sie mit Leichtigkeit beschützen und für sie sorgen konnte.
»Sam?« murmelte sie und fühlte sich plötzlich schläfrig. Nachdem sie es gesagt hatte, sah sie ihn schuldbewußt an. Sie hatte seinen Namen nicht laut aussprechen wollen.
»Lisa«, sagte er mit einem Anflug von Spott, obwohl seine Arme sich noch fester um sie schlangen.
»Ich muß furchtbar aussehen.« Sie fühlte sich so benommen, als triebe sie auf einer Wolke. Ihre Lider wurden schwer ... Sie fielen zu, und sie schlug sie wieder auf.
»Du siehst ... gut aus.« Seine Stimme war plötzlich belegt. »Und jetzt sollte ich dich lieber schlafen lassen. Du bist völlig fertig.«
»Laß mich nicht allein«, protestierte sie und umklammerte die Hand, die noch auf ihrer Taille lag, doch er stand unbeirrbar auf und ließ sie sachte wieder auf die Pritsche sinken.
»Ich bin in der Nähe, wenn du etwas brauchst«, sagte er, und seine Stimme klang schon ganz fern. Er hatte das Zelt noch nicht verlassen, als Lisa bereits eingeschlafen war.
Sie träumte erfreuliche Dinge aus ihrer Kindheit, doch dann wurden plötzlich Alpträume daraus ... von einem Ungeheuer mit Fängen, das sie fressen wollte. Es spuckte Feuer – rote Flammen, die nach ihr griffen und ihren Körper verbrannten.
Lisa schrie laut auf. Ihr eigenes ohrenbetäubendes Geschrei ließ sie zitternd aus dem Alptraum aufschrecken. Im ersten Moment wußte sie nicht, wo sie war.
»Lisa?« Die Stimme war leise und vertraut. Lisa schlug die Augen auf und sah eine dunkle Silhouette über sich aufragen.
»Sam?« Sie streckte ihre Arme nach ihm aus, und es kam ihr vor, als sei sie nur in Sicherheit, wenn er sie in seine Arme nahm. Er beugte sich zu ihr herunter, und ihre Hände berührten nackte, muskulöse Schultern, schlangen sich um seinen Hals und hielten ihn fest. Sie zog ihn mit einer Kraft zu sich herunter, von der sie gar nicht gewußt hatte, daß sie sie besaß. »Halt mich fest, Sam, bitte«, flüsterte sie mit gebrochener Stimme.
»Was ist los, Schätzchen?« Es war seltsam, wie vertraut ihr diese Stimme in der kurzen Zeit geworden war. Es war, als sei er ihr bester Freund, jemand, den sie kannte und dem sie traute und auf den sie sich verlassen konnte, sie zu beschützen.
»O Sam, es war so schrecklich!« Bebend murmelte sie die Worte, und ihre Hände umklammerten ihn, als wolle sie ihn nie mehr loslassen. Er ließ sich von ihr auf die Pritsche ziehen, zog ihre Decke zur Seite und schmiegte sich ganz fest an sie. Seine Arme schlangen sich um sie, und er preßte sie an seinen langen, festen Körper. Lisa löste sich nicht aus seinen Armen.
»Erzähl es mir«, flüsterte er, und seine Hände streichelten beschwichtigend ihr zerzaustes Haar. Während sie ihm den gräßlichen Alptraum erzählte, vergrub Lisa ihr Gesicht an seiner Brust. Sie holte tief Atem und schloß die Augen. Er sagte nichts, sondern hielt sie nur fest, und seine Hände setzten ihre zarten Liebkosungen fort. Sie spürte seine warme Haut.
Ohne jede Überlegung gab sie sich ihren Instinkten hin und ließ ihre Zunge über seinen Hals gleiten. Der laute Herzschlag an ihrem Ohr erregte sie. Lisa öffnete die Lippen und küßte seinen Hals, spürte aber, daß sein Körper sich anspannte.
»Lisa«, sagte er barsch. Es klang wie eine Warnung. Sie küßte seine Lippen, diesmal leidenschaftlich, und sie wollte in diesem Moment an nichts denken, als daran, wie richtig ihr das alles vorkam.
»Lieb mich«, flüsterte sie. »Bitte, lieb mich, Sam.«
Lisa nahm voller Zufriedenheit wahr, wie tief er Atem holte. Es war berauschend zu wissen, daß auch er sie begehrte.
»Lisa.« Er schien immer noch zu Diskussionen zu neigen, und daher tat Lisa das, wozu alle ihre Sinne sie aufriefen. Ihre Hand glitt über seine Brust, blieb kurz auf seinem Hosenbund liegen und glitt dann hinein. Sie schlängelte sich über seinen festen Bauch zu dem gewaltigen, granitenen Monolithen, der unter ihrer Berührung glühte und pulsierte.
Als ihre Finger sich um ihn schlossen, stöhnte er voller Wollust. Seine Hände legten sich auf ihre Schultern und drehten sie so heftig auf den Rücken, daß es ihr im ersten Moment den Atem verschlug. Keuchend legte er sich auf sie, und sein Mund heftete sich mit einer so leidenschaftlichen Gier auf ihre Lippen, als wolle er sie verschlingen. Lisa erwiderte seinen Kuß voller Glut und wollte ihn inbrünstiger, als sie je in ihrem Leben etwas hatte besitzen wollen. Genau das war es, was sie brauchte, das, wonach sie seit Jahren lechzte, die zügellose, unbändige Sexualität eines Mannes.
Mit unsicheren Händen zog er sie aus, und die Knöpfe sprangen von ihrem Hemd ab. Lisa stöhnte, als sich seine Hände zu ihren Brüsten tasteten und sie so fest drückten, daß es hätte schmerzen sollen, doch es tat nicht weh. Als er auch nackt war, stieß er sie zurück, und sie ließ es bereitwillig zu. Ihre Schenkel spreizten sich, und ihre Hände wiesen ihm eifrig den Weg. Er stieß zu, und Lisa schnappte vor Wonne nach Luft und glaubte, sie würde vor Glück sterben. Sein Stöhnen entflammte sie. Sie bewegte sich mit ihm, als er in sie eindrang, sich zurückzog und in einem erbarmungslosen Rhythmus, der sich steigerte, wieder in sie eindrang. Sie warf den Kopf zurück und riß den Mund weit auf, als er sie nahm, und ihre Nägel gruben sich ohne ihr Wissen in seinen muskulösen Rücken. Er hob sie höher, um noch tiefer in sie vorzustoßen. Lisa konnte es nicht länger ertragen. Eine Lust, die jahrelang unterdrückt war, kam in ihr zum Ausbruch, und sie schrie laut auf. Er spürte ihren Genuß und stieß ein letztes Mal heftig zu und blieb pochend in ihr. Dann war es vorbei.
Als Lisa seinen schweren Körper schweißnaß auf sich spürte, gab sie ihrer Erschöpfung nach, doch kurz bevor sie einschlief, glaubte sie, ihn fluchen zu hören.
Kapitel 2
Sam war wütend auf sich, als er das Zelt verließ, ohne sich auch nur noch einmal umzusehen. Er schlug auf die Insektenschwärme ein, die sich auf seine Schultern und seinen Rücken setzten, und als er sich eine Zigarette anzünden wollte, stellte er verärgert fest, daß seine Hand immer noch nicht ruhig war. Verdammt und zum Teufel! Er war in dieser flachen Steppe, um eine Arbeit zu erledigen und nicht, um für ein mannstolles kleines Mädchen den Deckhengst zu spielen. Wenn er es zuließ, konnte sie alle möglichen Komplikationen auslösen. Die einzig vernünftige Lösung bestand darin, sie so schnell wie möglich wieder loszuwerden, ehe sie ihm die Konzentration raubte oder, was noch schlimmer gewesen wäre, Streitigkeiten unter seinen Männern auslöste.
Die Frage war nur, wie? Wenn er auch nur halb so gefühllos gewesen wäre, wie er es sich gern einredete, dann hätte er sich jetzt schlicht umgedreht, wäre ins Zelt zurückgegangen und hätte ihr die Kehle aufgeschlitzt. Damit wäre das Problem gelöst. Er verfluchte sich zwar für seine Weichheit, aber er wußte nur zu gut, daß er das nicht über sich brachte. Kaltblütig eine hübsche junge Frau zu ermorden, die sich ihm gerade hingegeben hatte, lag ihm nicht.
Natürlich konnte er sie einfach wegschicken. Aber wohin, und wie? Salisbury mit seinem modernen Flughafen und den Düsenflugzeugen, die sie ruckzuck aus dem Land brachten, bot sich natürlich an, aber das stellte ihn vor neue Probleme. Wenn sie anfing, ihr Abenteuer auszuplaudern, was sie zweifellos tun würde, konnte sie ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Und selbst, wenn er bereit war, es darauf ankommen zu lassen, sie aber zu bitten, daß sie den Mund hielt, wie hätte er sie dann nach Salisbury bringen wollen? Den kleinen Flugplatz in der Nähe hatten die Guerillas an sich gebracht, und das hieß, daß er sie mit dem Jeep nach Salisbury schicken mußte. Aber auch das war unmöglich. Er brauchte jeden einzelnen seiner Männer. Sie waren eine kleine Gruppe, die er speziell für die bevorstehende Aufgabe ausgesucht hatte, und jeder Mann war entscheidend für eine erfolgreiche Ausführung des Auftrags. Er konnte es sich nicht leisten, einer jungen Frau, die ziellos durch die Gegend streunte, einen von ihnen als Chauffeur und Leibwächter abzutreten. Außerdem hätte ein solcher Schritt ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit erregt, und das wäre fatal gewesen. Nein, verdammt noch mal, sie mußte bleiben, bis sie ihre Arbeit erledigt hatten, aber er fand diese Lösung fast so untragbar wie jede andere.
Ein wirklich anständiger Mann hätte zweifellos lieber das ganze Geschäft platzen lassen, als auch nur ein Haar dieses silberblonden Schopfes in Gefahr zu bringen, aber er wußte schon seit Jahren, daß Anstand nicht gerade seine stärkste Seite war. Er brauchte das Geld – so standen die Dinge. Hunderttausend Dollar waren schließlich keine Kleinigkeit, die man bedenkenlos aus dem Fenster warf. Mit dem Geld konnten er und Jay ein Leben beginnen, wie er es sich immer gewünscht hatte. Davon konnten sie eine Ranch anzahlen und mit Rindern bestücken. Er dachte im Traum nicht daran, sich und seinem Sohn die Chance auf ein schönes Leben zu vermasseln, und schon gar nicht, weil es irgendeiner attraktiven Puppe gelungen war, sich in eine Situation zu bringen, die ihr Tod sein konnte. Er hatte mehr für sie getan, als man von ihm erwarten konnte, als er sie ins Lager mitgenommen hatte, obwohl ihm sein gesunder Menschenverstand gesagt hatte, sie bewußtlos im Dschungel liegen zu lassen. Irgendein längst begrabener Kavaliersinstinkt hatte jedoch die Oberhand gewonnen, und zum Erstaunen seiner Männer hatte er sie aufgehoben und auf die Ladefläche des Jeeps geworfen. Und wie jede impulsive Handlung erwies sich auch diese als eine Katastrophe von erheblichem Ausmaß.
Von dem Moment an, als er sie ins Zelt getragen und den Schein seiner Taschenlampe auf sie gerichtet hatte, war ihm klar gewesen, daß Probleme auf ihn zukommen würden. Die nässenden roten Kratzer und Striemen konnten ihre langgliedrige Schönheit nicht verbergen, und er fühlte eine erste unerwünschte Regung der Begierde, als er ihr die zerfetzten Kleider ausgezogen hatte. Außerdem schwärmte er schon immer für Blondinen. Nach der Rettung aus dem Dschungel war es jetzt seine Aufgabe, für das verletzte und hilflose Mädchen, wenn auch gegen seinen Willen, die Verantwortung für ihr Wohlergehen zu übernehmen. Folglich hatte auch nur er ihre Wunden behandelt und sich gesagt, er könne sich viel Ärger unter den Männern ersparen, der einzige zu sein, der in ihre Nähe kam. Bisher war er überzeugt davon, seine Triebe absolut unter Kontrolle zu haben, aber natürlich hatte er beim besten Willen nicht ahnen können, daß die kleine Hexe ihn unter dem Vorwand eines Alptraums in ihr Bett locken und dann auf eine Art und Weise mit ihm umgehen würde, der kein Mann aus Fleisch und Blut hätte widerstehen können. Die rasende Lust, die sie in ihm wachgerufen hatte, hatte eine augenblickliche Befriedigung verlangt. Und es war aufregender als alles, was er seit Jahren an Sex erlebt hatte. Allein die Erinnerung an diesen zarten, seidigen Körper reichte aus, um seinen Mund trocken werden zu lassen. Es wäre sein Untergang gewesen, wenn er sich ihren Körper nicht aus dem Kopf geschlagen hätte. Von jetzt an würde er sich von ihr fernhalten. In weniger als drei Wochen würde er seine Aufgabe hinter sich gebracht haben und dann wieder in den guten alten Vereinigten Staaten sitzen und genug Geld haben, um sich jede Frau auf Erden zu kaufen.
Entscheidend war im Moment seine Arbeit, nicht die Frau, sagte sich Sam, und es war eine Arbeit, die nur eine Elitetruppe durchführen konnte. Es hatte ihn drei Monate gewissenhafter Bemühungen gekostet, seine Truppe zusammenzustellen, fünfzehn Mann außer ihm. Weitere drei Monate hatte er damit verbracht, sie auszubilden. Soldaten, die für Geld kämpfen, gedungene Killer, wenn man es so wollte, waren die absoluten Profis überhaupt. Das mußten sie sein, weil ihr Leben davon abhing, was sie konnten. Aber der Erfolg hing davon ab, wie gut die Gruppe aufeinander eingespielt war, wie gut sie als Team funktionierte.
Sam als ihr Anführer wurde für seine Bemühungen gut entlohnt, die Hälfte im Voraus – fünfzigtausend erwarteten ihn bereits in einer amerikanischen Bank – und die andere Hälfte bei Erledigung. Plus Spesen, verstand sich, und die waren bereits ganz beträchtlich gewesen. Die Männer bekamen weniger, Beträge zwischen zehn- und fünfzigtausend, je nachdem, wie hoch Sam ihren Beitrag einschätzte. Bisher war alles wie am Schnürchen gelaufen. Es war ihnen gelungen, in das Land einzureisen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, und sie hatten ihr Basislager aufgeschlagen und die Räder allmählich in Bewegung gesetzt. Bald würde alles vorbei sein. Der einzige Haken an diesem blendend eingefädelten Plan war die Frau.
Meuchelmord war nicht direkt sein Bier, aber das Angebot war ihm zu einem Zeitpunkt gemacht worden, zu dem er dringend Geld gebraucht hatte. Er gestattete sich keine Reue. Eine Gruppe von ungenannten Geldgebern war bereit, dafür zu zahlen, und zwar gut zu zahlen, daß Thomas Kimo, einer der herausragendsten Anführer der rhodesischen Rebellen, auf eine Art und Weise getötet wurde, die den Anschein erweckte, als hätten Anhänger eines rivalisierenden Rebellenführers die Tat begangen. Das Warum und Wozu war nicht näher erklärt worden, aber Sam konnte sich denken, daß der Mord dazu dienen sollte, einen Ausbruch von Kämpfen unter den Revolutionären auszulösen. Während sie damit beschäftigt waren, sich gegenseitig umzubringen, vermutete Sam, würde die herrschende Partei ihren Einfluß auf die Regierung festigen. Wenn er es richtig erraten hatte, war das ein guter und erfolgversprechender Plan. Nicht, daß es ihn näher interessiert hätte. Politische Überzeugungen waren der Todeskuß für einen Berufssoldaten.
»Sam?« Frank Leads, sein stellvertretender Kommandeur und ein guter Freund, seit sie 1964 und ‘65 zusammen in Vietnam gekämpft hatten, war neben ihm aufgetaucht, ohne daß er auch nur einen Laut vernommen hatte. Verdammt noch mal, anscheinend wurde er alt! Zu alt, um solche Spiele noch lange zu spielen. Im vergangenen Monat war er neununddreißig geworden, und er begann es zu spüren ...
»Alles in Ordnung?« fragte Frank behutsam.
Sam brummte bejahend. Frank, der neben ihn trat, verhielt sich merkwürdig. Er konnte doch beim besten Willen nicht wissen, was sich gerade abgespielt hatte, oder? Zum Teufel, er wollte es nicht hoffen. Frank wußte, wie er zu Frauen im Allgemeinen stand, und er hatte oft seine Ansichten darüber gehört, was für ein Irrsinn es war, Sex und Geschäft miteinander zu verwechseln. Der Mann hätte sich totgelacht ...
»Und was hast du jetzt mit ihr vor?«
Sam verzog den Mund. Frank wußte es also.
»Wie bist du dahintergekommen? Über Radar?« fragte er trocken.
Frank schnaubte und lief naben Sam her, der sich weiter vom Lager entfernte. »Wozu? Ihr Wimmern war im ganzen Lager zu hören – wie eine Katze, die sich verbrannt hat. Du mußtest sie entweder umbringen oder bumsen, und irgendwie dachte ich nicht, daß du sie umbringst.«
»Hm.« Sam dachte wieder daran, wie lustvoll sie am Schluß aufgeschrien hatte. Ihr Schrei hatte ihm den Rest gegeben, aber wenn er jetzt daran zurückdachte, mußte es wirklich verdammt laut gewesen sein. Verblüfft stellte er fest, daß die Röte in seine Wangen stieg. Himmel, er wurde wahrhaftig rot! Gott sei Dank, daß es dunkel war. Wenn Frank gesehen hätte, daß er errötete, hätte er sich das für den Rest seines Lebens anhören müssen.
»Und was hast du jetzt mit ihr vor?« wiederholte Frank geduldig seine Frage.
Sam schnitt eine Grimasse. »Zum Teufel, was könnte ich schon tun? Nichts.«
»Was soll das heißen – nichts?« explodierte Frank, nachdem er im ersten Moment bestürzt geschwiegen hatte. »Du kannst doch nicht einfach gar nichts unternehmen. Sie könnte die ganze Sache vermasseln!«
»Was schlägst du denn vor?« Sam hatte das Thema satt. Er hätte sich am liebsten einen Tritt dafür verpaßt, daß er sie überhaupt mit ins Lager genommen hatte, ganz zu schweigen davon, was inzwischen passiert war ...
»Wir müssen sie uns vom Hals schaffen. So oder so. Wenn du zu zimperlich bist, mache ich es – und zwar jetzt gleich.«
»Nein!« Sams Ablehnung kam in einem scharfen Ton heraus. »Verdammt noch mal, ich habe mir all das gerade selbst überlegt. Sie hat nichts getan, was ihren Tod rechtfertigen würde, und wenn wir sie laufen lassen, können wir uns nicht absichern, daß sie auch wirklich den Mund hält. Also bleibt sie.«
Frank seufzte tief. »Ich hatte von Anfang an das Gefühl, daß du das sagen würdest. Meinetwegen, du bist für sie verantwortlich. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Aber dir muß klar sein, daß es ihretwegen Ärger mit den anderen Kerlen gibt. Manche von ihnen können keine Frau auf der Straße sehen, ohne sofort außer sich zu geraten.«
»Ich weiß«, antwortete Sam nachdenklich. »Sie darf ihnen nicht über den Weg laufen – vielleicht muß sie einfach in ihrem Zelt bleiben. Riley könnte sie sozusagen bewachen – ihm kann das nichts anhaben.«
Frank lachte schallend. Riley Bates und sein mangelndes Interesse am anderen Geschlecht waren schon in all den Jahren, seit sie ihn kannten, Grund zur allgemeinen Belustigung. Gerüchteweise hieß es, er sei in Korea auf eine Mine getreten und hätte dabei seine entscheidenden Körperteile verloren. Vielleicht stimmte das, aber wahrscheinlich nicht. So oder so war der Mann ein höllisch guter Soldat, und in einer Situation wie dieser war das das Einzige, was zählte.
»Eine gute Idee. Aber ab und zu wird sie das Zelt verlassen müssen, du weißt schon, der Ruf der Natur und so.« Frank senkte die Stimme ein wenig und wirkte plötzlich verlegen.
Sam grinste, und seine Zähne blitzten in der Dunkelheit auf. Es tat ihm gut zu wissen, daß er nicht der einzige war, den die Anwesenheit einer Frau in ihrer Mitte jugendlich erröten ließ. »Dann kann sie das Zelt verlassen – mit Riley als Begleiter«, sagte er. »Das wird ihm guttun.«
Beide Männer lachten über das unwiderstehliche Bild, das diese Vorstellung heraufbeschwor, und sie grinsten immer noch, als sie das Lager erreicht hatten. In den Zelten war es still. Frank gähnte, klopfte Sam auf die Schulter und machte sich auf den Weg ins Bett. Sam drehte noch eine schnelle Runde um das Lager, um sich zu vergewissern, daß die Männer, die Wache halten sollten, auch wach und auf der Hut waren. Dann legte auch er sich hin.
Die Sonne schien, als Lisa am nächsten Morgen aufwachte, sich streckte und gähnend die Augen aufschlug. Trotz ihrer Schmerzen fühlte sie sich so entspannt und zufrieden wie eine Katze auf der Ofenbank. So gut hatte sie sich seit Jahren nicht mehr gefühlt, dachte sie verwundert, seit ihrer Heirat nicht mehr. Worin mochte bloß der Grund für dieses köstliche Gefühl von Wohlbefinden liegen? Was ...
Plötzlich stellte Lisa fest, daß sie unter der Decke vollständig nackt war. Ihre Hand glitt ungläubig unter die Zudecke, und auf ihrem Bauch und ihren Schenkeln spürte ihre Hand eine klebrige Nässe. Sie erbleichte. Dunkle Erinnerungen an einen starken, rücksichtslosen Männerkörper durchzuckten sie. Lieber Gott, was hatte sie bloß getan? Sie hatte doch nicht etwa – nein, das durfte einfach nicht wahr sein – einen vollkommen fremden Mann mehr oder weniger vergewaltigt? Bruchstücke dessen, was sie in der vergangenen Nacht getan hatte, liefen vor ihren Augen ab wie ein unfertiger Film. Ihr blasses Gesicht lief knallrot an. Wie hatte sie nur so ... so vollkommen schamlos sein können? Ihn anzuflehen, sie zu lieben, ihn so zu berühren, wie sie ihn berührt hatte!
Lisa schloß die Augen und stöhnte. Wovon war sie bloß besessen gewesen? Wie konnte es sein, daß sie, die gewöhnlich so kühl und zurückhaltend war, sich derart ungenierlich benommen hatte? Und dann auch noch mit einem solchen Mann! Einem gewöhnlichen Soldaten, um Himmels willen! Aber sie wußte, daß es die Wahrheit war.
Lisa zog sich stöhnend die Decke über den Kopf, sie wollte am liebsten nichts mehr von dieser Welt wissen. Was mußte er sich bloß gedacht haben? Und wie dachte er jetzt über sie?
Ganz allmählich braute sich Wut in ihr zusammen. Vielleicht war Sam nicht ganz so unschuldig an alledem, wie sie im ersten Moment geglaubt hatte. Schließlich wußte sie von zwei Spritzen, die er ihr gegeben hatte, und sie konnte nicht sagen, wie viele es vorher schon gewesen waren. Wer hätte sagen können, was er ihr injiziert hatte? Vielleicht hatte er sie absichtlich dahin gebracht und auf eine solche Reaktion gehofft? Jedenfalls war sie gestern nacht nicht klar bei Verstand gewesen, soviel stand fest, und das mußte auch er gewußt haben. Sie derart auszunutzen war schlechtweg eine Abscheulichkeit.
Als sie Schritte auf dem weichen Boden direkt vor dem Zelt hörte, steckte sie den Kopf aus der Decke heraus. Trotz aller vernunftgemäßen Auslegungen wurde sie scharlachrot, und die Hände, die die Decke umklammerten, zitterten. Sie rechnete jetzt jeden Moment damit, die allzu vertraute Gestalt in ihr Zelt treten zu sehen. Stattdessen wurde nur ein Kopf durch die Öffnung gesteckt, und es war keineswegs der arrogante, schwarzhaarige Kopf, den sie erwartet hatte. Ihr Blick fiel stattdessen auf eine Halbglatze, die von einem grauwerdenden Haarkranz umgeben war, und die Augen, die sie ansahen, waren braun. Es war nicht das Kobaltblau, das ihre Haut prickeln ließ, wenn sie nur daran dachte.
»Wer ... wer sind Sie?« fragte sie mit matter Stimme und war plötzlich besorgt. So peinlich ihr Sams Erscheinen auch gewesen wäre, zumindest wäre er ihr nicht fremd gewesen. Dieser Mann dagegen war ein Unbekannter, und nach ihren allerletzten Erfahrungen setzte sie kein allzu großes Vertrauen in Fremde.
»Riley Bates heiße ich.« Er trat beim Antworten ein. Seinen Tonfall konnte man unter keinen Umständen als freundlich auslegen, doch Lisa wurde ruhiger, als sie den Namen hörte. Sam hatte ihn gestern gerufen, ehe ...
»Was wollen Sie?« Sie richtete sich behutsam auf. Ihre Augen musterten Riley Bates. Er war hager und gebeugt und sah aus, als sei er mindestens fünfzig. Er trug eine Khakiuniform wie Sam.
»Hunger?« fragte er barsch. Lisa dachte kurz darüber nach und nickte dann. »Ich bringe Ihnen etwas zu essen.«
Während er fort war, rätselte Lisa an seiner Haltung herum. Er behandelte sie entschieden feindselig – aber warum nur? Ihres Wissens hatte sie nichts getan, was er als Beleidigung hätte auffassen können. Vielleicht ärgerte es ihn, daß er sie bedienen mußte. Aber vielleicht mochte er auch einfach Frauen nicht.
Ehe sie sich diese Frage beantwortet hatte, kam Riley zurück und hielt ihr einen Blechnapf hin. Lisa war in der Klemme. Wenn sie ihm den Teller abgenommen hätte, hätte sie ihre Decke loslassen müssen, und das war absolut unmöglich. Sie biß sich auf die Lippen. Riley erkannte ihr Problem, schnaubte und stellte den Teller auf die Kiste neben dem Bett. Er hatte eine Gabel und einen Becher mitgebracht, von dem sie hoffte, daß er Kaffee enthielt. Dann wandte er sich wortlos ab und ging.
Diesmal machte sich Lisa keine Gedanken über seine Motive. Schon beim Anblick des Essens hatte ihr Magen zu knurren begonnen, und sie spürte, daß ihr das Wasser im Mund zusammenlief. Eilig stand sie auf, schlang sich die Decke wie einen Sarong um den Körper und setzte sich dann auf die Pritsche, um zu essen.
Ein weniger gieriger Magen hätte sich von dem einschüchtern lassen, was auf dem Teller lag. Es war ein gummiartiger weißlicher Haufen, den sie eilig probierte – vielleicht Rühreier? Wenn ja, dann waren es zweifellos die schlechtesten, die sie je gegessen hatte, und die Würste – sie hoffte zumindest, daß es welche waren – schmeckten genauso schlecht. Wenn sie nicht absolut ausgehungert gewesen wäre, hätte sie noch nicht einmal versucht, dieses Essen herunterzuwürgen. Sie hatte allerdings den Verdacht, daß sie ohnehin nichts anderes bekommen hätte. Daher kämpfte sie gegen ihre Übelkeit an und aß. Der Kaffee war halbwegs passabel, heiß und stark und großzügig gezuckert.
»Das ist für Sie.«
Riley kam mit ein paar Kleidungsstücken zurück. Er war, wenn das überhaupt möglich war, noch brummiger als vorher. Lisa sah ihn zweifelnd an, als er die Kleider neben sie auf das Bett warf.
»Danke.«
»Bei mir brauchen Sie sich nicht zu bedanken, Fräulein«, schnaubte Riley. »Das hier ist ein Militärlager, und Sie können nicht unbekleidet rumlaufen, ganz gleich, was Sie sonst gewohnt sind. Sie können sogar, wenn Sie es genau wissen wollen, überhaupt nicht rumlaufen. Sie bleiben hier in diesem Zelt, und einmal am Tag gehe ich zusammen mit Ihnen raus. Ansonsten setzen Sie keinen Fuß ins Freie. Kapiert?«
Lisa starrte ihn an. Sie sollte im Zelt bleiben – das mußte ein schlechter Witz sein. Es war jetzt schon stickig hier, und sie hatte das sichere Gefühl, daß es im Lauf des Tages unerträglich heiß werden würde. Das konnte doch nicht sein Ernst sein! Und überhaupt, wer zum Teufel war denn dieser Riley Bates? Sie konnte nicht glauben, daß er hier die Befehle erteilte.
»Wo ist Sam?« fragte sie kühl und reckte ihr Kinn in die Luft. Es war ihr zwar peinlich, ihn wiedersehen zu müssen, aber er war wenigstens freundlich, und er hatte bestimmt mehr zu sagen als dieser seltsame Zwerg.
»Sam hat zu tun. Er hat keine Zeit mehr für Sie. Und außerdem kommt der Befehl von ihm. Er ist kein Mann, dessen Urteil sich durch ein bißchen Fummeln trüben läßt.«