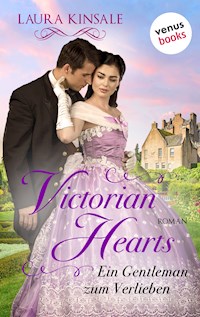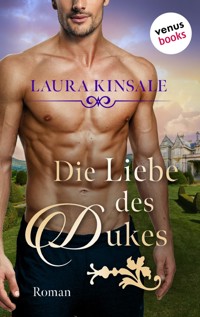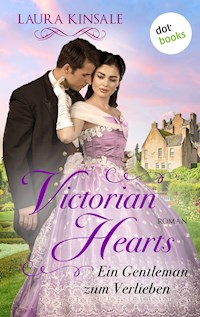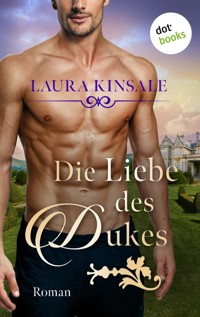
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist ein Frauenheld – wird ihre Liebe ihn bekehren? Der historische Liebesroman »Die Liebe des Dukes« von Laura Kinsale als eBook bei dotbooks. England zur Regency-Zeit. Niemals würde sie sich in so einen Mann verlieben! Die junge Maddy Timms hat für den stadtbekannten Schürzenjäger Christian Langland, den Duke von Jervaulx, nur Verachtung übrig. Die Nachricht von seinem angeblichen Tod erschüttert sie dennoch – und wandelt sich schon bald in große Verwunderung, als sie dem Totgeglaubten im nahegelegenen Sanatorium begegnet. Er scheint sein Gedächtnis verloren zu haben und wirkt wie ausgewechselt. Maddy spürt, dass sie ihm helfen muss. Durch ihre liebevolle Zuwendung kommt der Duke bald wieder zu Kräften und ein zartes Band erwächst zwischen den beiden, dass sich alsbald in flammende Leidenschaft verwandelt … Aber kann Maddy sich auf den Treueschwur eines Herzensbrechers wie Christian wirklich verlassen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Romantik-Roman »Die Liebe des Dukes« von Laura Kinsale. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
England zur Regency-Zeit. Niemals würde sie sich in so einen Mann verlieben! Die junge Maddy Timms hat für den stadtbekannten Schürzenjäger Christian Langland, den Duke von Jervaulx, nur Verachtung übrig. Die Nachricht von seinem angeblichen Tod erschüttert sie dennoch – und wandelt sich schon bald in große Verwunderung, als sie dem Totgeglaubten im nahegelegenen Sanatorium begegnet. Er scheint sein Gedächtnis verloren zu haben und wirkt wie ausgewechselt. Maddy spürt, dass sie ihm helfen muss. Durch ihre liebevolle Zuwendung kommt der Duke bald wieder zu Kräften und ein zartes Band erwächst zwischen den beiden, dass sich alsbald in flammende Leidenschaft verwandelt … Aber kann Maddy sich auf den Treueschwur eines Herzensbrechers wie Christian wirklich verlassen?
Über die Autorin:
Nach ihrem Masterabschluss an der University of Texas war Laura Kinsale als Geologin tätig, bis sie begann, Romane zu schreiben. Ihre Bücher standen mehrfach auf der Auswahlliste für den besten amerikanischen Liebesroman des Jahres und stürmten immer wieder die Bestsellerlisten der New York Times. Die Autorin lebt mit ihrem Mann David abwechselnd in Santa Fé/New Mexico und Texas.
Bei dotbooks erscheinen von Laura Kinsale auch die Romane:
»Eine eigensinnige Lady«
»Victorian Hearts – Der Kuss des Marquess«
»Victorian Hearts – Ein Gentleman zum Verlieben«
»In den Fängen des Piraten«
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2021
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1992 unter dem Originaltitel »Flowers from the Storm« bei Avon Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2004 unter dem Titel »Triumph der Herzen« bei Goldmann.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1992 by Amanda Moor Jay
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2004 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Dragosh Co / Dean Drobot / Nina Lishchuk / Stefano_Valeri / Martin Charles Hatch / Vector Tradition
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-673-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Liebe des Dukes« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Laura Kinsale
Die Liebe des Dukes
Roman
Aus dem Amerikanischen von Gertrud Wittich
dotbooks.
Prolog
Er hatte eine Vorliebe für radikale Politik und eine Schwäche für heiße Schokolade. Vor fünf Jahren war die ehrenwerte Miss Lacy-Grey auf der Stelle in Ohnmacht gefallen, nur weil er sie zum Tanz aufgefordert hatte – ein Vorfall, den seine Freunde noch heute bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit ad nauseam, bis zum Erbrechen, zum Besten gaben. Meistens hieß es dann auch noch, ein von ihm vorgebrachter Heiratsantrag würde das gute Fräulein fürs Leben zeichnen und ein frivoles Angebot sie gar auf der Stelle töten.
Da Christian jedoch soeben das Haupt in die köstliche Kuhle oberhalb ihrer entzückenden Kehrseite gebettet hatte und schamlos das Stückchen nackter Haut zwischen Strumpf und Straps befingerte, durfte er wohl davon ausgehen, dass seine Freunde mit ihren Prognosen ein wenig daneben gelegen hatten. Nein, das Fräulein erschien ihm überaus lebendig. Ihre anmutig gekreuzten Fußknöchel wippten leicht auf und ab.
Er umfasste sanft eine Pobacke, drückte einen Schmatz auf das darüber liegende Grübchen und stützte sich auf den Ellbogen. »Wann kommt Sutherland wieder nach Hause?«
»In zwei Wochen. Frühestens.« Die ehemalige Miss Lacy-Grey rollte sich lächelnd auf den Rücken und zeigte ihm ihre voller gewordenen Brüste und den sanft gerundeten Bauch. Sie waren jetzt schon seit fast drei Monaten ein Paar. Christian ließ die Augen müßig über diese subtilen Veränderungen schweifen und bedachte sie mit einem langen Blick, sagte aber nichts.
»Ich wünschte, er würde nie mehr heimkommen«, seufzte sie und streckte sich. »Es ist so schön mit dir.«
»Besser als Schokolade«, meinte er.
»Wirklich?«
Apropos Schokolade. Suchend schaute er sich um. Da stand er ja, der große Topf, und harrte der Dinge. Der Wasserkessel dampfte leise vor sich hin. »Du entschuldigst mich.« Er stemmte sich aus dem Bett.
»Abscheulicher Mann.«
Mit einer anmutigen Verbeugung und einem frechen Zwinkern wandte er sich von ihr ab, ergriff den Kessel und goss heißes Wasser in die kalte Milch, genau halb und halb, fügte dann die Schokoladenspäne hinzu und setzte den Quirl an. Der Teppich unter seinen nackten Füßen fühlte sich seidig kühl an. Er rieb den schlanken Griff des Quirls energisch zwischen den Handflächen – eigentlich hätte das über dem offenen Feuer getan werden müssen, aber die Bedingungen nachts, im Schlafzimmer eines anderen, waren nun mal nicht die besten – und goss das schäumende Gebräu in eine Tasse.
»Wie du es fertig bringst, das Zeug ohne einen Hauch von Zucker zu trinken, übersteigt mein Begriffsvermögen«, verkündete sie.
»Aber der Zucker, das bist doch du, meine Süße«, erwiderte er prompt. Nackt neben dem Bett stehend nahm er einen kleinen Schluck. »Was sonst?«
Sie versuchte ein entzückendes Schnütchen zu ziehen, konnte dann aber nicht anders, als abermals zu lächeln. Genüsslich seufzend streckte sie sich auf eine ausgesprochen provozierende Art und strich mit einem bestrumpften Fuß über das Bettlaken. »Oh ja, ich wünschte wirklich, Sutherland käme nie wieder.«
»Nun, so wie die Dinge liegen, solltest du zusehen, dass du dich so schnell wie möglich von ihm begatten lässt, meine Süße.«
Sie starrte zu ihren Händen hinauf, dann ließ sie sie sinken. Ihr Mund verzog sich diesmal zu einem verlockenden Schnütchen. »Ihm ist das doch vollkommen egal.«
»Also, das glaube ich dir aufs Wort«, meinte Christian trocken.
Sie spreizte die Hände auf ihrem schwellenden Leib und warf ihm einen Seitenblick zu.
Er stellte seine Schokolade ab, beugte sich über sie, küsste ihre Brüste, vergrub die Hände in ihrem Haar und küsste ihren Hals. »Und – war es das wert?«, murmelte er ihr ins Ohr.
Sie schlang die Arme um seine Schultern und drückte ihn ganz fest. Ihr weiches Fleisch entfachte seine Lust. Er vergrub die Nase in ihrer Haut, und während sie sich an ihn klammerte, als wolle sie ihn nie wieder loslassen, ergriff er beherzt die Gelegenheit, ihren guten Ruf ein weiteres Mal zu beflecken. Ihr schien es zu gefallen. Ihm, weiß Gott, sowieso.
Ein einzelne Kerze flackerte am Fuß der Treppe und beschien den linken Arm und den Faltenwurf einer Marmorstatue der Ceres, die mit übertrieben sentimentaler Miene auf eine Weizengarbe hinabblickte. Christians Schritte waren zwar diskret, aber keineswegs verstohlen, hatte er sich doch schon vor Wochen mit dem Butler arrangiert, indem er beim Hinausgehen jedes Mal drei goldene Jungs, einen hübschen kleinen Stapel, neben der Kerze zurückließ. Schon tastete er in seiner Jackentasche nach den Münzen, als ihn ein schlurfendes Geräusch im Foyer innehalten ließ, die Hand am Geländer.
»Eydie?« Eine Männerstimme schwebte leicht hallend aus der Eingangsdiele zu ihm herauf.
Teufel aber auch.
Christian verharrte vollkommen reglos. Lesley Sutherland kam, sich den Mantel aufknöpfend, unter der Treppe hervor. »Eydie?«, wiederholte er und strich sich über die roten Koteletten, als er nach oben sah.
Unten im Foyer tickte eine Standuhr. Christian war sie bisher noch nie aufgefallen, doch nun schien seine Zeit mit jedem dröhnenden Ticken abzulaufen. Eins … zwei … drei … vier …
Es passierte bei vier. Das leichte Lächeln auf Sutherlands Gesicht erlosch. Seine Lippen öffneten sich. Christian erwartete nicht, dass ein Ton herauskam, und es kam auch keiner: Nur Stille und Sutherlands Gesicht, das von Sekunde zu Sekunde weißer wurde, bis er den Mund jäh zuklappte und sein Gesicht, abgesehen von den Linien um Nase und Mund, die Farbe einer reifen Tomate annahm.
Sechs … sieben … acht …
Christian schossen mehrere Bemerkungen durch den Kopf, alle scherzhaft und alle zielten auf ihn selbst ab, einmal abgesehen von dem Klassiker: So früh schon zu Hause?
Er behielt sie alle für sich. Sutherland schien sich immer noch nicht von dem Schock erholt zu haben. Ein unangenehmes Kribbeln in der behandschuhten rechten Hand wies Christian darauf hin, dass er das Geländer viel zu fest umkrallte. Er ließ los, aber das heftige Prickeln hörte nicht auf, im Gegenteil, es wurde schlimmer und er hatte auf einmal ein ganz seltsames Gefühl, als bewegte sich die Treppe unter ihm, obwohl er sich nicht vom Fleck gerührt hatte.
Er öffnete die rechte Hand und schloss sie wieder.
Diese Bewegung schien Sutherland aus der Erstarrung zu reißen. Er starrte Christians Hand an. »Jervaulx«, sagte er mit geradezu absurd sanfter Stimme. »Dafür bringe ich Sie um.«
Er brachte nicht einmal die richtige Aussprache zustande, der aufgeblasene Kleiderständer. In der unheimlichen, knisternden Stille des Moments drehten sich Christians Gedanken absurderweise um die korrekte Aussprache seines Namens: Scherwoh – Scherwoh – Scherwoh …
Er sagte nichts, spreizte nur abermals die Finger und ballte sie zur Faust, was ihm eigenartig schwierig vorkam. Sein Arm fühlte sich seltsam schwer, irgendwie tot an, und in seinen Fingern kribbelte es höllisch.
»Ihre Sekundanten«, herrschte ihn Sutherland an, nun schon merklich aggressiver. »Nennen Sie mir die Namen Ihrer Sekundanten.«
»Durham. Und Colonel Fane.« Es war unvermeidlich. Aber es überraschte ihn, dass es sich so seltsam anfühlte.
Die Uhr tickte weitere zehn Sekunden lang, während sie einander anstarrten.
»Dreckiger Lump! Raus hier, verlassen Sie sofort mein Haus!«
Der Ausruf brach halb erstickt hervor. Sutherland war mittlerweile dunkelrot angelaufen und Christian befürchtete schon, er könnte jeden Moment einen Schlaganfall bekommen und umkippen.
»Schon gut«, sagte Christian ruhig. Mit bemüht abgemessenen, ja langsamen Bewegungen schritt er die Treppe hinunter und an dem anderen vorbei. Sutherland mochte ja den Wunsch haben, ihn zu töten, was sein gutes Recht war, aber Christian hatte keine Lust, sich vorwerfen zu müssen, er wäre der Grund dafür, dass der Mann in seiner eigenen Diele tot umgekippt war.
Davon abgesehen brauchte er dringend frische Luft. Er fühlte sich, als wäre er betrunken. Seine rechte Hand, mit der er den Türknauf ergriff und die Tür aufzog, fühlte sich noch immer taub und ungeschickt an. Mit der Linken zog er die Tür hinter sich zu und stolperte prompt gegen das Eisengeländer der Eingangsstufen.
Der Vollmond stand am Himmel und beschien einen Fleck Nebel unten auf dem Trottoir: Ein zarter, blauer Schleier, der sich langsam hob und über die schwarze Häuserreihe legte. Christian klammerte sich ans Geländer und starrte den Hügel hinab. Irgendetwas stimmte nicht mit ihm. Ihm war übel und schwindlig und … irgendwie seltsam. Der wilde Gedanke, er könne vergiftet worden sein, schoss ihm durch den Kopf.
Eydie? Die Schokolade. Würde Eydie ihn vergiften? Aber wieso, zum Teufel noch mal?
Sein Herz begann heftig zu hämmern; er schluckte, versuchte sich zu beruhigen, zu überlegen.
Ein paar Augenblicke später ließ er das Geländer los. Die kühle Luft war belebend. Er sog sie in tiefen Zügen ein und fühlte sich schon wieder mehr wie er selbst. Etwas Dunkles lag am Fuß der Stufen und er spähte es mit zusammengekniffenen Augen an. Da merkte er, dass es sein eigener Zylinder war.
Er ging die Stufen hinunter und daran vorbei und dachte noch einmal, dass es sein Zylinder war. Die Kutsche wartete zwei Straßen weiter auf ihn. Er starrte unsicher auf den Hut und ging dann weiter. Er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, warum Eydie ihn vergiften sollte. Der Gedanke bekümmerte ihn. Aber er fühlte sich schon besser, jetzt, beim Gehen. Die Dinge normalisierten sich. Als er seinen Brougham erreichte, stieg der Kutscher sofort herunter und hielt ihm den Schlag auf.
Cass und Devil kamen fröhlich mit wedelnden Schwänzen herausgesprungen. Christian lehnte sich an die Kutsche und erlaubte es jedem der beiden, einmal an ihm hochzuspringen. Er kraulte sie mit einer Hand hinter den Ohren, rief Devil von den Kohlenlöchern am Rand des Gehsteigs zurück und stieg ein. Cass legte sich ihm brav zu Füßen, doch Devil schob seine gescheckte Nase unter seine behandschuhte Hand und machte es sich auf dem Sitz gemütlich.
Christian tätschelte den Kopf des Setters. Als die Kutsche losfuhr, griff er sich an die Stirn, um den Hut abzunehmen, nur um festzustellen, dass er gar keinen aufhatte.
Er lehnte den Kopf zurück. Sutherland. Sutherland wollte Satisfaktion.
Christian wollte nur schlafen. Seine rechte Hand war immer noch bleischwer und taub und er öffnete und schloss sie abermals. Dösig dachte er noch, dass es ausnahmsweise einmal gut war, dass er Linkshänder war, denn sonst wäre er wohl kaum imstande eine Pistole zu heben.
Kapitel 1
»Ich begreif’s nicht. Und werde es wohl auch nie begreifen. Wie könnt Ihr Rücksichtnahme von … von so einem« – Archimedea Timms unterbrach sich und fuhr dann, sichtlich um die passenden Worte ringend, fort –, »von Leuten wie ihm erwarten, Papa?«
»Dürfte ich dich um eine Tasse Tee bemühen, Maddy?«, bat ihr Vater in diesem freundlich-entwaffnenden Ton, der es einem unmöglich machte, einen ordentlichen Streit vom Zaun zu brechen.
»Erstens einmal ist er ein Herzog«, warf sie ihm noch über die Schulter zu, während sie durch das hintere Wohnzimmer ging, um Geraldine zu suchen, weil die Klingelschnur defekt war. Die Zeit, die sie brauchte, bis sie das Dienstmädchen gefunden und dafür gesorgt hatte, dass Wasser gezapft und aufgesetzt wurde, reichte nicht, um ihren Gedankengang zu vergessen. »Von einem Herzog kann man wohl kaum erwarten, dass er sich ernsthaft mit solchen Dingen befasst«, verkündete sie bei ihrer Rückkehr ins Wohnzimmer. »Wie Ihr inzwischen eigentlich selbst gemerkt haben müsstet – das Quadrat ist oberhalb Eurer rechten Hand – immerhin liegt die Integralrechnung jetzt schon seit einer Woche unerledigt bei ihm.«
»Du solltest nicht so ungeduldig sein, Maddy. Diese Dinge brauchen viel Zeit und Sorgfalt. Und er lässt sich eben die nötige Zeit. Dafür kann ich ihn nur loben.« Die tastenden Finger ihres Vaters fanden die Zahl Zwei und legten sie als Exponent oberhalb des Holzbuchstabens S.
»Ach, von wegen Zeit und Sorgfalt. Alles, was ihn interessiert, sind ausgelassene Geselligkeiten. Er hat nicht die geringste Achtung vor Euch und auch nicht vor sich selbst.«
Ihr Vater lächelte und blickte starr geradeaus, während seine tastenden Finger das Multiplikationszeichen suchten und fanden und der Serie von Holzbuchstaben und Zahlen, die er auf dem roten Wolltuch vor sich aufgereiht hatte, hinzufügten. Erneut ließ er die Finger über die Lettern gleiten, um ihre Korrektheit zu überprüfen. »Bist du dir denn sicher, was die ausgelassenen Geselligkeiten betrifft, meine Maddy?«
»Da braucht Ihr doch nur in die Zeitung zu schauen«, sie sprach mit ihrem Vater in der bei Quäkern üblichen altertümlichen Redeweise, die allen Respektspersonen, einschließlich der Eltern galt. »Es gab in diesem Frühling noch keine einzige weltliche Zusammenkunft, die er nicht mit seiner Anwesenheit beehrt hätte. Und euer gemeinsames Thesenpapier soll doch schon beim nächsten Treffen der Mathematischen Gesellschaft vorgestellt werden! Es wird wieder einmal an mir hängen bleiben, den Auftritt abzusagen, das weiß ich genau, denn er wird gewiss nicht daran denken. Präsident Milner wird zutiefst enttäuscht sein und mit Recht, denn wer sollte Jervaulx’ Platz auf dem Podium einnehmen?«
»Du wirst die Gleichungen auf die Tafel schreiben und ich werde für Fragen zur Verfügung stehen.«
»Vorausgesetzt Freund Milner gestattet es«, meinte sie nachdenklich. »Er wird es für höchst ungehörig halten.«
»Niemand wird etwas dagegen haben. Wir haben dich bei den monatlichen Treffen immer sehr gern bei uns, Maddy. Du warst immer willkommen. Freund Milner hat mir selbst einmal gesagt, dass die Anwesenheit einer Dame eine Bereicherung für jedes Treffen sei.«
»Natürlich werde ich mitkommen. Oder soll ich Euch etwa alleine gehen lassen?« Sie blickte auf, als das Dienstmädchen das Tablett hereinbrachte. Geraldine stellte den Tee ab und Maddy schenkte ihrem Vater eine Tasse ein. Dann führte sie seine Hand sanft zu Tasse und Henkel. Er besaß die weißen, glatten Hände eines Menschen, der noch nie schwere körperliche Arbeit verrichtet hat und sein Gesicht war trotz seines Alters noch faltenlos. Er war schon immer ein wenig der zerstreute Professor gewesen, selbst als er noch nicht erblindet war. Um die Wahrheit zu sagen, hatten sich seine Gewohnheiten kaum geändert, seit er vor Jahren durch eine Krankheit das Augenlicht verlor, nur dass er sich nun auf Maddys Arm verließ, wenn er seine täglichen Spaziergänge machte oder die monatlichen Treffen der Mathematischen Gesellschaft besuchte und Holzbuchstaben und -zahlen für seine Berechnungen benutzte und deren Ergebnisse diktierte, anstatt sie selbst niederzuschreiben.
»Du wirst doch den Herzog heute noch einmal aufsuchen und nach den Differenzialgleichungen fragen?«, bat er hoffnungsvoll.
Maddy schnitt eine Grimasse, was sie gefahrlos tun konnte, den Geraldine war längst wieder verschwunden. »Ja, Papa«, sagte sie, bemüht, sich ihre Gereiztheit nicht anmerken zu lassen. »Ich werde heute noch einmal beim Herzog vorbeischauen.«
Das Erste, woran Christian beim Erwachen dachte, war die unfertige Integralrechnung. Er schlug die Bettdecke zurück und trieb Cass und Devil von seinem Bett herunter. Dann schüttelte er kräftig die Hand aus, auf der er geschlafen hatte, um das Prickeln darin loszuwerden. Die Hunde standen winselnd an der Tür und er ließ sie hinaus. Das unangenehme Taubheitsgefühl in seiner Rechten wollte so gar nicht weichen. Während er sich mit der Linken eine Tasse Schokolade einschenkte, machte er mehrmals eine Faust. Anschließend setzte er sich im Morgenrock an den Schreibtisch, um seine und Timms’ Berechnungen durchzugehen.
Der Unterschied zwischen beiden war kaum zu übersehen: Timms hatte eine kleine, äußerst regelmäßige Handschrift, die etwa zwei Drittel kleiner war als sein unausgewogenes, riesiges Gekrakel. Christian hatte vom ersten Schultag an gegen das Gebot des rechtshändigen Schreibens rebelliert und die Linke benutzt. Die regelmäßigen Züchtigungen seiner Schreibhand mit dem Rohrstock hatte er mit stoischer Dickköpfigkeit erduldet. Dennoch war es ihm immer noch peinlich, wenn ihm jemand beim Schreiben zusah. An diesem Morgen erschien ihm Timms’ Schrift geradezu winzig, kaum entzifferbar; sie verschwamm ihm vor den Augen und er bekam Kopfschmerzen bei dem Versuch, sich darauf zu konzentrieren.
Offenbar hatte er gestern Abend ein paar Brandys zu viel gehabt. Er nahm den Federkiel zur Hand, der von seinem Sekretär bereits so zurechtgestutzt worden war, dass Christian damit auf seine typische, unbeholfene Art von oben her schreiben konnte und machte sich an die Arbeit, wobei er die bisherigen Berechnungen kurzerhand außer Acht ließ. Es fiel ihm nicht schwer, sich in der klaren, nüchternen Welt der Analysis zu verlieren. Die Symbole auf dem Papier mochten sich verzerren und verschwimmen, aber die Gleichungen in seinem Kopf waren so klar und deutlich wie Musik. Er blinzelte und kniff das rechte Auge zusammen, hinter dem sich ein hartnäckiger Kopfschmerz breit gemacht zu haben schien; dann schrieb er weiter.
Als endlich auch die letzte Gleichung fertig war und es ihm einfiel, nach Calvin zu läuten, damit man ihm sein Frühstück heraufbrachte, war ihm, als würde er aus einer Trance erwachen und sich ganz unversehens in seinem Schlafzimmer wiederfinden, mit seinen palladianischen Säulen, die das Bett flankierten, den Stuckfriesen und den Holzvertäfelungen sowie der blau gemusterten Tapete, die eine Dame für ihn ausgesucht hatte, deren Namen ihm im Augenblick nicht einfallen wollte. Der Gedanke an Damen brachte ihm unwillkürlich seine süße Eydie in Erinnerung und er beauftragte Calvin, ihr noch vor dem Tee eine einzelne Orchidee zukommen zu lassen.
»Wie Sie wünschen, Euer Gnaden.« Der Butler verbeugte sich. »Mr. Durham und Colonel Fane sind hier. Sie warten schon geraume Zeit darauf, empfangen zu werden. Soll ich ihnen mitteilen, dass Exzellenz heute Nachmittag nicht zu Hause sind?«
»Sehe ich so aus, als wäre ich nicht zu Hause?« Er streckte die Beine aus, lehnte sich zurück und legte die Fußgelenke übereinander, während er gleichzeitig einen Blick auf die Uhr warf. »Bei Gott, schon fast halb zwei! Wie lange sitzen sie denn schon da unten? Schicken Sie sie rauf, Mann. Schicken Sie sie rauf.«
Er machte sich nicht die Mühe, sich für Durham und Fane präsentabel zu machen; zwei ältere und engere Freunde gab es nicht. Er rieb sich den immer noch seltsam schmerzenden Kopf, lehnte sich zurück und schloss einen Moment lang die Augen.
»Gottchen, was haben wir denn da? Schon wieder bei diesem Gekritzel?« Durhams träge Stimme klang milde überrascht. »Und ausgerechnet jetzt? Bist ja der reinste Eisblock, Mann!«
Christian öffnete kurz die Augen und schloss sie dann wieder. »Gott steh mir bei, es ist der Pfaffe.«
»Und gerade noch zur rechten Zeit, wie’s scheint. Siehst aus, als brauchtest du die letzte Ölung, alter Knabe.«
»Ach, und die kennst du?« Christian hob ein Augenlid.
»Nein. Könnte sie aber nachschlagen. Alles nur für dich, Shev.« Durham imitierte noch immer Brummels Stil, was Sprechweise und Kleidung betraf, obwohl es schon etliche Jahre her war, seit sich der Beau wegen seiner Gläubiger nach Frankreich abgesetzt hatte. Und obwohl er, im Gegensatz zu Brummel, blond war und sich sehr präzise bewegte, als Kontrapunkt zu seinem betont lässigen Gehabe. Die schwarze Robe war sein einziges Zugeständnis an seine priesterliche Berufung und Christian deren einziger Förderer – die Herzöge von Jervaulx besaßen nämlich, neben neunundzwanzig weiteren Pfarreien, das Patronat für St. Matthews-upon-Glade, einer wohlhabenden Pfarrgemeinde, die Christian großzügigerweise seinem Freund überantwortet hatte, ein, genau genommen, besonders nobles Geschenk, wenn man bedachte, wie wenig Durham dem herkömmlichen Bild eines Geistlichen entsprach und wie sehr es ihm an den nötigen Charaktereigenschaften mangelte.
Fane und die Hunde folgten ihm auf dem Fuße, wobei Devil sich am Bein des in prächtigem Scharlachrot und mit Goldlitze herausgeputzten Regimentssoldaten vorbeidrängelte, der einen Zylinder auf seinem Finger herumwirbeln ließ. Er warf den Hut Christian zu, der ihn auffing.
»Mit den besten Grüßen von Sutherland.«
Christian stieß Devils Vorderpfoten von seinem Schoß. »Donnerwetter. Sutherland, sagst du?«
»Sie behaupten, du hättest ihn gestern Abend vor seinem Haus liegen lassen.«
»Wer behauptet das?«
»Na, wer schon?« Fane ließ sich mit finsterer Miene in einen Sessel plumpsen. »Seine verdammten Sekundanten, wer sonst?«
Christian musste trotz seiner Kopfschmerzen grinsen. »Aber hallo! Ist er denn schon zurück? Und hat mich schon gefordert?«
»Der Teufel soll dich holen, Shev, das ist nicht witzig«, warf Durham ein. »Sutherland ist ein verflucht guter Schütze.«
Fane streichelte Cass’ Kopf und pickte dann ein schwarzes Hundehaar von seiner roten Uniformjacke. »Es soll schon morgen früh stattfinden. Bleibt natürlich ganz dir überlassen. Wir schätzen, Pistolen – obwohl du in Sutherlands Fall vielleicht doch besser Säbel wählen solltest.«
Christian schloss die Augen und öffnete sie wieder. Die Kopfschmerzen brachten ihn fast um; er konnte kaum noch einen klaren Gedanken fassen.
»Verdammtes Pech aber auch, ihm so in seinem eigenen Foyer über den Weg zu laufen«, fügte Fane grimmig hinzu. »Ich schwör dir, der hatte nicht die geringste Ahnung von dir und der la Sutherland. War einfach nur verfluchtes Pech, ist alles. Man sollte glauben, der törichte Bastard würde es schön unter der Decke halten wollen, oder nicht? Was glaubt er wohl, was er erreicht, indem er dich umbringt? Falls er’s schafft. Ein langer Europaurlaub oder der Galgen, wenn er nicht schnell genug ist. Bei Gott, Shev – ich knöpf ihn mir selbst vor, wenn er dich umbringen sollte.«
Christian sah Fane mit einem unbehaglichen Stirnrunzeln an. Hier musste es sich um einen besonders schlechten Scherz handeln, und dazu war er im Moment weiß Gott nicht in Stimmung. Aber niemand grinste und Fane biss die Zähne aufeinander, als wolle er etwas zermalmen.
»Sutherlands Sekundanten haben euch heute früh aufgesucht?«, erkundigte sich Christian zögernd.
»Visitenkarten sind mir um acht ins Haus geschneit.« Durham machte eine wegwerfende Handbewegung. »Die beiden dazugehörigen Gentlemen tauchten um neun bei mir in Albany auf. Der zerrt schäumend an der Kandare, Jervaulx. Der will Blut sehen.«
»Sie sagen – ich war in seinem Haus?«
»Etwa nicht?«
Christian starrte auf seine Zehen. Wenn er’s recht bedachte, konnte er sich an den gestrigen Abend kaum noch erinnern.
»Herrgott, ich muss vielleicht einen in der Krone gehabt haben.«
Durham stieß prustend die Luft aus. »Jesses, Jervaulx – willst du damit sagen, du weißt es nicht mehr?«
Christian schüttelte andeutungsweise den Kopf. Er fühlte sich aber nicht so, als hätte er einen Mordskater. Er konnte sich nicht mehr erinnern, überhaupt etwas getrunken zu haben. Aber diese höllischen Kopfschmerzen … und seine Hand – er fühlte sich irgendwie seltsam.
»Teufel«, sagte Durham und setzte sich. »Was für ein Schlamassel.«
»Spielt keine Rolle.« Christian drückte seine Nasenwurzel zwischen Zeigefinger und Daumen. »Er will also schon morgen? Nein, morgen ist zu früh.«
»Also wann?«
»Ich muss morgen Abend einen Vortrag halten. Es geht also erst Mittwoch in der Früh.«
»Ein Vortrag?«, fragte Fane verblüfft.
»Ja, über ein mathematisches Thesenpapier.«
Der Colonel schaute ihn nur weiterhin ratlos an.
»Ein Referat, Fane«, erklärte Christian geduldig. »Mit Worten, mittels derer man eine wichtige Botschaft unter die Leute bringt. Lest ihr denn in der Armee nie irgendwas?«
»Doch, manchmal«, sagte Fane ungerührt.
»Shev ist ein richtiger Isaac Newton, weißt du.« Durham lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander. »Obwohl man sich’s, wenn man ihn so ansieht, kaum vorstellen kann. Siehst zum Kotzen aus, Jervaulx.«
»Fühl mich auch so«, gestand Christian. Er kraulte mit der Linken Devil an der Kehle und seufzte. »Teufel aber auch. Und ich habe ihr gerade eine verdammte Orchidee geschickt.«
Der schneeweiße, elegante Neubau am Belgrave Square war ein Affront für Maddy. Alles, was den Herzog betraf, war ein Affront für Maddy. Sie war als Mitglied der »Religiösen Gesellschaft der Freunde« geboren und aufgewachsen und nahm daher an, dass ihr sein verderbter Lebenswandel ein Anliegen hätte sein müssen. Aber um die Wahrheit zu sagen schien ihr vom göttlichen Licht erleuchtetes Wesen nicht besonders an seiner spirituellen Verfassung interessiert zu sein. Im Gegenteil, sie empfand einen nur allzu weltlichen Widerwillen diesem Menschen gegenüber. Unter normalen Umständen hätte sie keinen Gedanken an den Mann verschwendet. Tatsächlich hatte Maddy noch nie zuvor vom Herzog von Jervaulx gehört und das wäre auch so geblieben, hätte er nicht plötzlich begonnen, aus ihm eigenen perversen Gründen Leserbriefe an das Journal der Londoner Mathematischen Gesellschaft zu schreiben und von da an einen immer größer werdenden Raum im bescheidenen Chelseaer Heim der Timms’ einzunehmen.
Sie hatte ihrem Vater immer jedes Wort aus diesem Journal vorgelesen und natürlich war auch sie es gewesen, die, nach Diktat ihres Papas, die Antwort auf den Leserbrief des Herzogs schrieb, in dem er sich nach der Person hinter den Initialen desjenigen erkundigte, der für die Lösungen der Gleichungen fünften Grades verantwortlich zeichnete – was natürlich ihr Vater gewesen war. Das hatte sich im Ersten Monat ereignet. Jetzt war schon beinahe der Sechste Monat angebrochen, die Blumentöpfe am Fenster quollen über in scharlachroter Pracht – Gartenwicken und späte Tulpen, die einen herrlichen Kontrast zu den bleichen Mauern bildeten – und Maddy war längst zu einem regelmäßigen Gast im Herrenhaus am Belgrave Square geworden.
Nicht, dass sie Jervaulx je persönlich begegnet wäre. Sie hatte den Menschen noch kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Selbstverständlich war es unter der Würde eines Herzogs, ein schlichtes Quäkermädchen wie sie zu empfangen oder gar in persona bei einem Treffen der Mathematischen Gesellschaft zu erscheinen; er verbrachte seine Zeit mit weit herzoglicheren und fragwürdigeren Dingen. Nein, sie, Archimedea Timms, war es, die gewöhnlich mit der neuesten, von ihr aufs Sorgfältigste niedergeschriebenen Arbeit ihres Vaters an der Tür des noblen Hauses vorstellig wurde. Der Butler nahm diese dann höflich entgegen und verfrachtete sie anschließend in eine gemütliche Nische unweit des Frühstückszimmers, bot ihr heiße Schokolade an und ließ sie dort manchmal bis zu dreieinhalb Stunden schmoren, bevor er endlich mit einem knappen Schreiben sowie mehreren, mit lässiger Hand hingeworfenen Blättern zurückkehrte, die eher einer unter dem Gesichtspunkt der Ästhetik verfassten Zeichnung glichen als einer mathematischen Formelsammlung.
Doch in den meisten Fällen kehrte Calvin lediglich mit dem Versprechen des Herzogs zurück, sie könne seinen Beitrag am morgigen Tage erwarten. Und wenn sie dann am nächsten Tag erneut kam, erhielt sie die Auskunft, sich noch einen weiteren Tag gedulden zu müssen und noch einen und noch einen, bis sie schließlich jede Langmut mit diesem Menschen verlor. Hinzu kam die stille, aber wachsende Begeisterung ihres Vaters über das, worauf er und Jervaulx hinarbeiteten. Die Mathematik war der ganze Lebensinhalt ihres Vaters, er wollte den unwiderlegbaren Beweis für ein Theorem finden, das war das einzige Ziel seiner Existenz – nicht etwa um des persönlichen Ruhmes willen, sondern aus reiner Liebe zur Wissenschaft an sich. In seinen Augen war der Herzog ein wahres Wunder, ein Gottesgeschenk für sein Leben, die Geometrie und die Welt im Allgemeinen und er erwartete die sporadischen Beiträge dieses Menschen mit nie erlahmender Geduld.
Um die Wahrheit zu sagen, Maddy fürchtete, dass sie ein klein wenig eifersüchtig war. Wie ihr Vater immer strahlte, wenn sie schließlich mit einer neuen Serie von Gleichungen und Axiomen aus Jervaulx’ unzuverlässiger Hand auftauchte, sein Verblüffen, ja Schock, wenn sie sie ihm zum ersten Mal vorlas, dann sein freudiges Nicken, wenn er ein paar besonders innovative oder raffinierte Berechnungen entdeckte … nun, es gehörte sich nicht, ihm diese Freude zu missgönnen, nur weil für sie das Ganze nichts weiter war als eine endlose Serie von Symbolen, eine fremde Sprache, die sie zwar lesen und aussprechen, aber nie wirklich verstehen konnte. Es gab Menschen, denen dieses Talent einfach angeboren war und Maddy gehörte, trotz des Namens, den ihr Vater ihr nach dem großen Archimedes gegeben hatte, nicht dazu.
Der Herzog von Jervaulx dagegen schon.
Abgesehen davon war er zügellos und leichtsinnig, extravagant und eitel, eine Spielernatur, ein Schürzenjäger und ein Förderer der Künste – von Malern und Musikern und Schriftstellern –, in den Skandalblättern nur der »H von J« genannt, Blättern, in denen seine fragwürdigen Großtaten mit schöner Regelmäßigkeit breitgetreten wurden.
Sie hatte es sich zur Aufgabe gemacht, alles über ihn herauszufinden. Um genau zu sein, er war ein Lebemann übelster Sorte.
Für ihren Vater dagegen hätte es keinen Unterschied gemacht, ob der Mensch ein Kuhhirte gewesen wäre; alles, was für ihn zählte, war seine Begabung. Aber Jervaulx war ein Herzog, eine Tatsache, an die Maddy weit öfter erinnert wurde als ihr Papa – nämlich jedes Mal, wenn sie im Frühstücksalkoven saß und darauf wartete, dass er den Arbeiten ihres Vaters sein nobles Augenmerk zu schenken geruhte. Und nun, nachdem er sich vor zwei Monaten bereiterklärt hatte, dieses Thesenpapier zusammen mit ihrem Papa zu verfassen, ja sich gar zu dem Angebot herabgelassen hatte, dessen Einführung bei einem der monatlichen Treffen der Mathematischen Gesellschaft höchstpersönlich zu übernehmen, nun schien es, als hätte Jervaulx das alles vollkommen vergessen und sich nicht einmal die Mühe gemacht, die letzten und wichtigsten Berechnungen zur Beendigung ihrer Arbeit vorzunehmen.
Nun, zumindest hoffte sie, dass er es lediglich vergessen hatte, denn insgeheim fürchtete sie, er könne einen schlechten Scherz mit ihrem Vater treiben. Ihr schlimmster Alptraum war, Jervaulx könne mit einigen seiner entsetzlichen Freunde bei dem Treffen auftauchen, möglicherweise sogar unter dem Einfluss von Alkohol, einige liederliche Weibsbilder im Schlepptau und ihren Vater und sämtliche Mitglieder der Gesellschaft dem öffentlichen Spott preisgeben.
Eigentlich gab es keinen Grund zu dieser Annahme, aber ihr Vater wäre schon allein sehr enttäuscht, wenn der Herzog nicht käme und ihn damit vor all seinen Fachkollegen blamierte. Und das alles nur wegen eines Aristokraten, der zu kindisch war, um seine Verpflichtungen ernst zu nehmen. Für Jervaulx war dies alles lediglich ein amüsanter Zeitvertreib. Für ihren Vater war es der eigentliche Lebensinhalt.
Sie marschierte die Stufen unterhalb des Säulengangs hinauf, der den Eingang des weißen Herrenhauses überschattete, und war dabei fast versucht, der höflichen, ja zaghaften Anfrage ihres Vaters eine Notiz hinzuzufügen, die ihren Gefühlen in dieser Sache mehr Ausdruck verlieh. Obwohl sie noch nie den Mut, ja die Kühnheit gehabt hatte, in der Stille der Andachten aufzustehen und ihre Gedanken laut auszusprechen, war sie sich ziemlich sicher, dass der gesellschaftliche Stand des Herzogs sie kaum einschüchtern würde. Nein, es würde ihr überhaupt nichts ausmachen, ihm gegenüberzutreten – was, wie sie fand, an sich schon ein deutlicher Beweis dafür war, dass das, was sie bewegte, die vollständige Billigung des Herrn fand. Schließlich stand in der Bibel, dass alle Menschen vor dem Herrn gleich waren. Es konnte dem Herzog nur gut tun, wenn man ihm seine Fehler und Unzulänglichkeiten ruhig und überzeugend vortrug.
Aber Calvin winkte sie lächelnd herein und nahm eine flache Ledermappe von der Anrichte im Foyer, die er ihr hinhielt. »Für Mr. Timms, zu übergeben von Miss Archimedea Timms, mit den besten Empfehlungen Seiner Exzellenz, des Herzogs«, erklärte er strahlend. »Der Herzog hat mich gebeten, Mr. Timms auszurichten, dass Exzellenz das morgige Treffen der Mathematischen Gesellschaft in Begleitung von Sir Charles Milner aufsuchen wird und dem Referat mit großer Vorfreude entgegensieht.«
Maddy nahm ihm die Aktenmappe ab. »Oh«, sagte sie. »Er ist fertig geworden.«
Calvin ließ sich nicht anmerken, ob er den überraschten Ton in ihrer Stimme gehört hatte, sondern stand lediglich mit erwartungsvoll in Richtung des Frühstücksalkoven geneigtem Haupte da. »Dürfte ich Ihnen eine Schokolade anbieten, Miss?«
»Eine Schokolade?« Maddy riss sich aus ihren Gedanken. »Nein, nein, keineswegs. Ich kann nicht bleiben. Ich muss dies hier sofort meinem Vater aushändigen.«
»Wie Sie wünschen, Miss.«
Dass der ansonsten so achtlose Herzog auf einmal ein Versprechen einhielt, warf Maddy vollkommen aus der Bahn. Begeistert war sie jedenfalls nicht, eher beunruhigt und ärgerlich. Abscheulicher Mann, erst stürzte er jedermann in helle Aufregung und Sorge, nur um dann zu glauben, er könne alles wieder gutmachen, indem er sich mit Präsident Milner zusammentat und die Differenziale im allerletzten Moment fertig stellte.
»Ich muss Euch ganz offen sagen, mein Freund«, erklärte sie in jenem strengen Ton, den sie sich eigentlich für den Herzog vorbehalten hatte, »ich hoffe, dass Jervaulx sich ausreichend auf seinen Vortrag vorbereitet hat, denn jetzt ist es, fürchte ich, zu spät, um meinen Vater noch um irgendwelche Hilfe zu bitten.«
Calvin maß sie mit einem kühlen Blick. »Seine Exzellenz erwähnte nicht, dass er Hilfestellung von Mr. Timms benötige.« Er betonte wie immer den Ehrentitel, was, wie Maddy sehr wohl verstand, sein Missfallen darüber kundtat, dass sie, wie bei der Gemeinschaft der Freunde üblich, niemanden mit seinem Titel ansprach. Maddy scherte sich nicht einen Deut darum. Sie wäre sogar noch weiter gegangen und hätte den Herzog bei seinem Vornamen genannt, wie es jeder aufrichtige Quäker täte, doch leider kannte sie ihn nicht.
Sie stand einen Moment lang vollkommen still und tippte ungeduldig mit der Fußspitze auf den Boden. »Dürfte ich mit ihm sprechen?«
»Ich bedaure, aber Exzellenz sind derzeit außer Haus.«
Das Tempo von Maddys Fußtippen erhöhte sich. »Aha. Wie bedauerlich. Nun, in diesem Fall überbringt ihm bitte den Dank meines Vaters.« Sie klemmte sich die Mappe unter den Arm, machte auf dem Absatz kehrt und stapfte davon.
Christian lag ausgestreckt auf dem Bett, über den Augen ein Tuch, das mit irgendeiner scharf riechenden Kampfertinktur getränkt war. Er grunzte, als er hörte, dass Calvin an die Tür pochte.
»Miss Archimedea Timms war gerade hier, Euer Gnaden. Sie hat die Papiere mitgenommen.«
»Gut.«
Es folgte ein Moment der Stille. »Der Arzt könnte in höchstens einer Viertelstunde da sein«, meinte Calvin zögernd, »Sie müssten mir nur gestatten, nach ihm zu schicken«.
»Ich brauche keinen verdammten Quacksalber. Es geht mir gleich wieder besser.« Christian schluckte schwer.
Der Butler murmelte etwas Zustimmendes. Dann ging die Tür mit einem Klicken wieder zu. Christian zog sich das muffige Tuch von den Augen und warf es zu Boden. Er presste den Arm über die Augen und legte den Kopf in den Nacken. Dabei fragte er sich, ob er wohl an diesen verdammten Kopfschmerzen krepieren würde, bevor Sutherland auch nur die Chance hatte, einen Finger gegen ihn zu erheben.
Kapitel 2
Das Treffen der Mathematischen Gesellschaft wurde ein rauschender Erfolg. Für die Timms’ begann es schon am frühen Nachmittag, als unversehens ein Lakai in Livree und mit gepudertem Haar auf der Türschwelle ihres bescheidenen Häuschens in der Upper Cheyne Row auftauchte, in der behandschuhten Hand eine in der markanten Handschrift des Herzogs abgefasste Botschaft. Er wolle, falls genehm, um halb neun Uhr ein Fahrzeug vorbeischicken, das Mr. Timms zu den Vortragsräumen bringen werde. Und es wäre ihm eine Ehre, wenn er nach dem Ende der Versammlung Mr. Timms und seine Tochter sowie Sir Charles Milner zu einem späten Souper in sein Heim am Belgrave Square einladen dürfe. Für ihren sicheren Heimtransport würde er anschließend mit seiner persönlichen Kutsche sorgen.
»Papa!«, zischte Maddy in entsetztem Flüsterton, um nicht von dem Lakaien gehört zu werden. »Das geht doch nicht!«
»Wirklich nicht?«, meinte ihr Papa fragend. »Dann dürfte es aber auch unmöglich für uns sein, das Treffen überhaupt zu besuchen, denn welche Entschuldigung hätten wir, die anschließende Einladung zum Essen bei Jervaulx abzulehnen?«
Maddy wurde rot. »Uns erwartet dort doch nichts als eitler Müßiggang und oberflächliche Gespräche. Er ist ein schlechter Mensch. Ich weiß, Ihr bewundert seine Wissenschaft, aber seine Moral ist … ist abgrundtief schlecht.«
»Mag sein«, gestand er zögerlich. »Aber sollen wir diejenigen sein, die den ersten Stein werfen?«
»Ich bezweifle sehr, dass es der erste wäre.« Mit einer flinken Bewegung des Handgelenks beförderte Maddy die Nachricht des Herzogs in Richtung Kamin. Das feine, schwere Papier flog jedoch nicht weit genug und prallte lediglich mit einem zarten Klirren am Messinggitter ab. »Ich werfe keinen Stein, ich will nur nichts mit diesem Menschen zu tun haben!«
Ihr Vater wandte den Kopf in die Richtung des leisen Geräuschs, dass der Brief beim Aufprallen auf das Kamingitter gemacht hatte und konzentrierte seine Aufmerksamkeit dann wieder auf ihre Stimme. »Es ist doch nur ein Abend.«
»Dann geht Ihr. Ich werde nach der Versammlung direkt nach Hause fahren.«
»Maddy?«, erkundigte sich ihr Vater mit einem leichten Stirnrunzeln. »Fürchtest du ihn?«
»Selbstverständlich nicht! Wieso sollte ich?«
»Ich dachte vielleicht… vielleicht ist er dir in irgendeiner Weise zu nahe getreten?«
Maddy schnaubte empört. »Allerdings! Er hat mich stundenlang in seiner albernen Frühstücksnische warten lassen. Ich kann dir die Tapete dort bis ins kleinste Detail beschreiben: grünes Gitter auf weißem Grund, in jedem zweiten Quadrat eine Margerite, bestehend aus sechzehn Blütenblättern und drei grünen Blättern, in der Mitte ein gelber Punkt.«
Die Stirn ihres Vaters glättete sich. »Ich fürchtete schon, er hätte etwas Unschickliches zu dir gesagt.«
»Er hat überhaupt noch nie etwas zu mir gesagt, aus dem einfachen Grund, weil er mich überhaupt noch nie gesehen hat. Aber Ihr könnt mir glauben, Papa, wenn ich sage, dass er all das verkörpert, was wir an der Aristokratie für verdammenswert halten. Er ist zügellos, verworfen und gottlos. Wir sind einfache, gottesfürchtige Menschen. Mit Leuten wie ihm haben wir nichts zu schaffen.«
Ihr Vater saß eine ganze Weile stumm da. Dann hob er die Brauen und meinte bekümmert: »Aber ich würde doch so gerne mit ihm speisen, Maddy.«
Seine Finger drehten rastlos ein hölzernes Y herum, das er von der roten Tischdecke genommen hatte. Die Öllampe neben seinem Ellbogen brannte trotz des düsteren Nachmittags nicht, da es für ihren Vater ohnehin keine Rolle spielte.
Sie ballte die Hände zu Fäusten und stützte ihr Kinn darauf. »Ach, Papa!«
»Würde es dir sehr viel ausmachen, Maddyschatz?«
Sie seufzte und ging dann ohne ein weiteres Wort zur Tür, öffnete sie und teilte dem Lakaien mit, dass sie die Einladung des Herzogs annähmen.
Um sich ihren Unmut vor ihrem Vater nicht anmerken zu lassen, ging sie nach oben und legte Gehrock und Hemd für ihn heraus. Danach richtete sie alles für seine Rasur her. Anschließend trat sie vor ihren eigenen Schrank. Bevor die Botschaft von Jervaulx gekommen war, hatte sie vorgehabt, dem Anlass entsprechend, ihr gutes graues Seidenkleid anzuziehen. Nun fand sie sich unversehens zwischen dem korrupten Wunsch hin und her gerissen, ihm durch ihre Erscheinung zu beweisen, dass sie und ihr Vater jeden Tag mit Herzögen und dergleichen speisten und dem Drang, sich besonders bescheiden zu kleiden, um sich den Anschein zu geben, als bedeute ihr das Souper im Belgrave Square nicht mehr als ein Besuch beim örtlichen Krämer.
Zusätzlich zu der Verworfenheit des Wunsches, sich zu kleiden, als würde man gewohnheitsmäßig mit adeligen Lebemännern verkehren, machten sich, bei näherer Nachforschung in den dunklen Tiefen des Kleiderschranks, gewisse materielle Beschränkungen bemerkbar. Ihre Familie gehörte nicht zu den unbekümmerteren unter den Glaubensfreunden, sie hatte sich immer streng an das Gebot der Schlichtheit in Kleidung und Rede gehalten. Das stahlgraue Seidenkleid mit seinem breiten, gestärkten weißen Baumwollkragen stellte den modischen Höhepunkt ihrer Garderobe dar. Das schicklich hochgeschlossene Gewand mit der altmodisch hohen Taille war nun einmal das, was es war – das beste, vier Jahre alte Morgenkleid einer schlichten Quäkerin, und es als etwas anderes verkaufen zu wollen war ein hoffnungsloses Unterfangen.
Sie begutachtete ihr schwarzes Kleid, das sie für solche Aufgaben wie Kranken- und Marktbesuche reserviert hatte. Es war schlicht und adrett, an den Ellbogen jedoch sichtlich abgestoßen. Nein, sie würde die Kollegen ihres Vaters nur vor den Kopf stoßen, wenn sie sich den Anschein gäbe, als hätte sie keinerlei Respekt vor der Bedeutung des Anlasses.
Am Ende entschied sie sich für ihr Grauseidenes. Und um zu betonen, was sie persönlich von dem ausschweifenden Charakter des Herzogs hielt, entfernte sie den weißen Kragen, sodass dem Kleid nun jeglicher Schmuck fehlte. Obwohl es im Hause keine Spiegel gab, war sie, als sie sich das so geänderte Gewand an den Körper hielt, überzeugt, hiermit die nötige Strenge und Schlichtheit zu vermitteln.
Ihr Haar jedoch stellte sie vor ein neuerliches Dilemma. Die gestärkte Quäkerhaube, die sie sonst immer trug, erschien ihr für den Anlass zu ordinär. Ihre Mutter, die bei ihrer Heirat zum Glauben der »Freunde« übergetreten war und fortan jeden Kontakt zu ihrer Verwandtschaft gemieden hatte, hatte ihrer Tochter dennoch ein wenig gesellschaftlichen Schliff beigebracht. Maddy fand es angebracht, den besonderen Anlass dieses Treffens durch eine kleine Geste ihrerseits zu würdigen.
Sie beschloss ihr Haar ganz neu zu flechten. Es nur auszukämmen war schon keine leichte Angelegenheit, weil es noch nie geschnitten worden war und ihr nun bis über die Kniekehlen reichte – die einzige weltliche Eitelkeit, die ihre Mutter – und nun sie – sich je gestatteten. Nachdem sie ihr Haar geflochten und in Kränzen um ihren Oberkopf gewunden hatte, kramte sie spontan eine kleine Schachtel aus der untersten Schublade ihrer Kommode. Die Perlen ihrer Mutter.
Aber so kühn, die Perlen offen um ihren Hals zu tragen, war sie nun doch nicht. Nach ein wenig Überlegen und Herumexperimentieren stellte sie fest, dass sie genau um den obersten Haarkranz passten. Sie war der Ansicht, man könne die Perlen ohnehin kaum sehen, was, wie ihr schien, einen durchaus erträglichen Kompromiss zwischen Heidentum und Glaubenseifer darstellte.
Aber als sie gegen Viertel nach acht und nachdem sie dafür gesorgt hatte, dass ihr Vater dem Anlass entsprechend gekleidet und hergerichtet war, die Treppe herunterkam, wurde sie ganz plötzlich von Nervosität übermannt. Sie fürchtete, die Perlen könnten albern aussehen – und es gab niemanden, außer ihren Vater und Geraldine, den sie um seine Meinung hätte fragen können. Und die Urteilsfähigkeit ihres Vaters und Geraldines schien ihr in diesem Falle höchst zweifelhaft. Maddy hielt kurzerhand den silbernen Teekessel hoch und versuchte so ihr Aussehen zu prüfen – ohne Erfolg. Und da kam auch schon ihr Vater zögernden Schrittes die Treppe herunter.
Gleichzeitig ertönte an der Tür ein beherztes Klopfen und sie musste zur Küchentreppe laufen, um Geraldine zu rufen, da die Klingelschnur, trotz des Versprechens des Hauswirts, sie ganz bestimmt noch an diesem Nachmittag wieder instand zu setzen, immer noch defekt war. Dann, nachdem sie darauf geachtet hatte, dass ihr Vater sicher die Treppe herunterging und der Lakai ihm auch vorsichtig genug in die schwarze Droschke half – auf deren Türen ein blauer Halbmond prangte, darinnen ein weißer Phönix, umgeben mit einem Kranz goldener fleurs-de-lis, Lilien – fand sie sich unversehens mit der Verbeugung und der dargebotenen Hand des Lakaien konfrontiert. Es blieb ihr nichts weiter übrig, als beides zu akzeptieren.
Der Hörsaal der Royal Institution in der Albermarle Street, ein weites Halbrund mit aufsteigenden, gepolsterten Sitzbänken, auf denen bis zu neunhundert Zuhörer Platz fanden, war zu den Treffen der Mathematischen Gesellschaft gewöhnlich nur spärlich gefüllt. Alle, die sich für die Philosophie reiner Mathematik interessierten, wie sie von der Gesellschaft propagiert wurde – und die in der Lage waren, sie zu begreifen – bildeten nur ein Häuflein passionierter Individualisten, das sich gewöhnlich ganz vorne, in den vordersten vier Reihen vor dem Podium zusammendrängte, während der Rest des Saales leer und dunkel blieb.
Als die Droschke jedoch in der Albermarle Street vorfuhr, drängelten sich auf dem Gehsteig bereits zahlreiche Herren, die in das Gebäude strömten. Maddy befürchtete einen schrecklichen Moment lang, sie könnten sich im Tag geirrt haben – aber nein, da war President Milner höchstpersönlich, ein rundlicher, fröhlicher Mann, der herantrat und ihrem Vater aus der Droschke half. Maddy folgte und die Herren auf dem Gehsteig und der Eingangstreppe wichen nickend und den Hut lüftend vor ihr zurück.
»Ergebenster Diener, Miss Timms! Kommen Sie, wir schauen nur rasch noch auf einen Sprung in den Lesesaal«, erklärte Freund Milner mit einem Blick über die Schulter, während er auch schon ihren Vater in die Eingangshalle geleitete. »Der Herzog ist bereits eingetroffen und erwartet uns dort. Er freut sich schon sehr, Sie beide kennen zu lernen.« Maddy unterdrückte ein Schnauben, bezweifelte sie doch sehr, dass der Herzog etwas Derartiges empfand. Vor der dicht umdrängten Garderobe fiel sie, einen Moment lang etwas desorientiert, ein wenig zurück, bis ein höflicher Gentleman, ein reguläres Mitglied der Gesellschaft, vortrat und ihr ihren Umhang abnahm.
»Wer sind bloß all diese Leute?«, erkundigte sie sich flüsternd bei ihm.
»Ich nehme an, sie sind gekommen, um den mathematischen Herzog kennen zu lernen.«
Maddy zog eine Grimasse. »Ist das so etwas wie das dressierte Ferkel?«
Er gluckste vergnügt und ergriff ihre Hand. »Richten Sie Mr. Timms meine besten Wünsche aus. Ich freue mich schon sehr auf die heutige Vorlesung.«
Maddy nickte und wandte sich ab. Das wäre doch typisch Jervaulx, dachte sie, das ganze in einen Zirkus zu verwandeln. Sie hätte es eigentlich erwarten sollen. Ihr armer Papa würde zum Gespött werden.
Vor der Tür des Lesesaals hielt sie kurz inne und dachte einen Moment lang zerstreut an die Perlen in ihrem Haar. Sie schienen, soweit sie es beurteilen konnte, niemandem sonderlich aufgefallen zu sein. Sie hob die Hand an den Zopf, um zu überprüfen, ob sie noch richtig saßen.
Alles perfekt. Dennoch hatte sie das dumpfe Gefühl, dass sie damit wie eine närrische, überkandidelte alte Jungfer aussah, was sie, wie sie annahm, ja auch war – eine Quäkerin, eine vom »merkwürdigen Volk«, noch merkwürdiger sogar mit diesem eitlen Perlenschmuck im streng geflochtenen Haar. Dieser Gedanke belustigte sie allerdings mehr als dass er sie bekümmerte: Wie musste sie dem lasterhaften Lord vorkommen!
Nun – dann sollte es eben so sein. Sie würde ihm einen gehörigen Schock versetzen. Wahrscheinlich hatte er es noch nie mit jemandem wie Archimedea Timms zu tun bekommen. Mit einem leisen Lächeln auf den Lippen stieß sie die Tür auf.
Ihr Vater, mit seinem flachen, breitrandigen Quäkerhut, saß am anderen Ende des großen Raums, an einem der Tische, auf dem die Zeitungen beiseite geschoben worden waren, um ein wenig Platz zu schaffen. President Milner war nirgends zu sehen. Der andere Mann saß, mit einer Konzentration, die Maddy zuletzt bei den Schülern der Ersttagsschule erlebt hatte, in der sie gelegentlich unterrichtete, im Licht der Kerzen über einen Papierstapel gebeugt. Er hatte die Ellbogen gespreizt, wobei sich der Stoff seines feinen, mitternachtsblauen Abendrocks über breite Schultern spannte, und als sie näher kam, sah sie, wie er sich mit einer ungehaltenen Geste das dunkle Haar aus der Stirn strich – ganz der wilde Poet, der sein neuestes Werk in Agonien gebärt.
Doch plötzlich, noch bevor sie die beiden ganz erreicht hatte, warf er den Stift beiseite und erhob sich in einer einzigen, fließenden Bewegung, als wolle er verbergen, was er gerade tat.
Er sah sie einen Moment lang an, dann lächelte er.
Der eifrige Studiosus, der leidenschaftliche Poet, das alles verpuffte vor dieser erfahrenen Galanterie. »Miss Timms«, sagte er, genau so, wie man es von einem Herzog erwartete – ruhig, mit einer leichten Verbeugung. Er hatte dunkelblaue Augen, eine gerade, kräftige Nase, sein Anzug war selbstverständlich maßgeschneidert, die Haltung kultiviert; und dennoch schaffte er es trotz dieser polierten Außenhaut irgendwie wie ein ausgesprochener Pirat auszusehen.
Genau wie es zu erwarten gewesen war, eben – obwohl, trotz des Lebenswandels, nicht ganz so verfallen – im physischen Sinne –, wie man es angenommen hätte. Er vermittelte den Anschein einer streng in Schach gehaltenen Energie, es gab nichts Verwässertes oder Degeneriertes an ihm – er war groß, hart und beeindruckend. Ihr Vater wirkte daneben geradezu leichenblass, so, als würde er sich jeden Moment in Dunst auflösen und zerstreuen.
»Meine Tochter Archimedea«, erklärte Papa. »Maddy – das ist der Herzog von Jervaulx.«
Er sprach den Namen ganz anders aus als sie es bisher immer getan hatten – als würde er mit einem »sch« beginnen und auf ein langes »oh« enden, keineswegs mit »aux«. Als ihr klar wurde, dass ihr gewöhnliches »Jerwaux« nicht annähernd korrekt gewesen war, kam sie sich vor wie ein Trampel. Mit peinlichem Entsetzen fielen ihr die zahlreichen Gelegenheiten ein, bei denen sie den Namen auf diese falsche Weise vor seinem Butler ausgesprochen hatte. Sie konnte nur hoffen, dass sie diese Information Freund Milner zu verdanken hatten und nicht etwa Jervaulx selbst.
Sie reichte ihm ihre Hand, einen Knicks, selbst ein leichtes Neigen des Kopfes, verweigerte sie, wie es einer schlichten Person und einem Mitglied der Gesellschaft der Freunde zukam. Man hatte sie ihr Leben lang gelehrt, solch gemurmelte Gemeinplätze wie »guten Tag« zu vermeiden, war es doch gotteslästerlich und entsprach nicht der Wahrheit, einem Menschen einen guten Tag zu wünschen, wenn er einen schlechten hatte. Und dass es ihr eine Freude war, den Herzog kennen zu lernen, konnte sie ebenso wenig sagen, weil dies eine weitere Unwahrheit gewesen wäre. Also begnügte sie sich mit der allgemeinsten aller Anreden: »Freund«.
Seine Begrüßung fiel weit weniger spärlich aus: »Es ist mir ein ausgesprochenes Vergnügen, Ihnen zu Diensten zu sein, Mademoiselle.« Er ergriff ihre Hand, hob sie kurz an und senkte die Lider, dann gab er sie frei. »Ich muss mich bei Miss Archimedea für all die Stunden entschuldigen, die sie, wie ich hörte, in meinem Frühstücksalkoven schmachtete. Ich litt in den letzten beiden Tagen unter schlimmen Kopfschmerzen.«
Maddy fragte sich, womit er sich für all die anderen Wartestunden herausreden wollte, doch ihr Vater sagte lediglich, mit einem Ausdruck echter Besorgnis in der Stimme: »Ich hoffe, Ihr seid wieder genesen.« Ihr Vater sagte immer die Wahrheit und nahm daher natürlich an, dass es sein Gegenüber ebenfalls tat. Armer, naiver Papa.
»Vollständig.« Der Herzog grinste und zwinkerte Maddy zu, als wären sie zwei Verschwörer. »Obwohl Miss Archimedea ihre Zweifel hatte, wie ich weiß.«
Ihr Vater lächelte. »Ja, sie befürchtete allenthalben, Ihr könntet mich derart blamieren, dass ich mich nie wieder in der Mathematischen Gesellschaft sehen lassen könnte.«
»Papa!«
In diesem Moment klopfte Präsident Milner an die Tür und kam auch sogleich herein. Er wedelte mit den Händen, als wäre er ein besonders begeisterter Hühnerscheucher. »Miss Timms, Mr. Timms – es wird Zeit. Kommen Sie und nehmen Sie Ihre Plätze ein, dann werden der Herzog und ich uns aufs Podium begeben.«
»Ich werde Miss Timms Hilfe brauchen«, verkündete der Herzog und ergriff ihren Arm, als sie Anstalten machte, zu ihrem Vater zu gehen. »Wenn Sie so liebenswürdig wären …« Er sah ihr tief in die Augen.
Das war, Maddy wusste es sofort, die Art von Blick, mit der er all die Frauen dazu brachte, sich willig in seine Arme sinken zu lassen. Selbst sie, die mit ihren achtundzwanzig Lenzen erst einmal umworben worden war, von einem äußerst konventionellen Doktor, der ihre abschlägige Antwort mit schmerzlichem Bedauern entgegengenommen hatte, um sich dann innerhalb eines halben Jahres mit einer gewissen Jane Hutton zu verloben und sich nie wieder bei einer Quäkerversammlung blicken zu lassen, selbst sie konnte weder die Bedeutung noch die Wirkung dieses intensiven, leicht fragenden Blickes missdeuten.
Als er ihr daher einfach nur den Papierstapel in die Hand drückte und sie bat, die Gleichungen während seines Vortrags auf die Tafel zu schreiben, empfand sie dies, ja es ließ sich nicht leugnen, als deutliche Enttäuschung. Sie warf einen Blick auf die Papiere in ihrer Hand. »Ihr wollt das nicht selbst machen? Aber die Tafel steht doch gleich hinter dem Vortragspult. Die meisten Redner …«
»Ich nicht«, erklärte er entschieden.
»Kommen Sie, kommen Sie.« Mr. Milner hielt bereits die Tür auf und aus dem Hörsaal drang ein dumpfes Brausen zu ihnen herein. »Dann gehen wir eben alle gemeinsam. Mr. Timms?«
Jervaulx selbst war es, der den Arm ihres Vaters ergriff und ihn in den Saal und die Stufen hinunter zur ersten Reihe geleitete. Der Präsident winkte Maddy aufs Podium, wo eine Reihe hoher Stühle mit geraden Lehnen für sie bereitstand; der Herzog folgte ihr, und ihre Schritte hallten laut und hohl auf dem Holzpodium. Er rückte ihr galant den Stuhl zurecht und nahm dann entspannt neben ihr Platz, wobei er ganz selbstverständlich seine Rockschöße zurückwarf.
Im Saal wurde es ruhig, als Präsident Milner ans Rednerpult trat, den Schirm der kleinen Gaslampe ein wenig höher drehte und sich räusperte. Maddy ließ den Blick über die Menge weißer Hemdkragen schweifen, die in einem Meer aus Schwarz zu schwimmen schienen. Sie hatte schon viele Versammlungen besucht, sowohl der Mathematischen Gesellschaft wie der »Freunde«, meist allerdings hatte sie auf einem der hinteren Plätze gesessen, neben ihrem Vater. Noch nie hatte sie vor einem Publikum gesessen, geschweige denn vor so vielen Menschen. Sie versuchte sich einzureden, dass alle Aufmerksamkeit dem Präsidenten galt, der den Saal zur Ruhe aufgefordert hatte und nun gerade dabei war, das Thema des Vortrags vorzustellen und ihren Vater als dessen Co-Autor. Aber es war nur zu leicht sich auszumalen, wie die Aufmerksamkeit und das Auge des Zuschauers abschweiften. Einige Herren in den vorderen Reihen blickten definitiv an Präsident Milner vorbei und auf sie oder den Herzog, das ließ sich nicht genau sagen, aber sie fühlte sich in ihrem Grauseidenen und den Perlen im Haar schrecklich exponiert.
Überdeutlich bewusst war ihr auch die solide Präsenz und beeindruckende Größe von Jervaulx, der neben ihr saß, gewandet in Mitternachtsblau, die Hände in den weißen Handschuhen gelassen übereinander gelegt, vollkommen bewegungslos, was Maddy wiederum dazu veranlasste, sich zu zwingen, ihrerseits das nervöse Händekneten einzustellen. Er wirkte ungeheuer selbstsicher, schien das Gewicht der allgemeinen Aufmerksamkeit, das auf ihm lastete, überhaupt nicht wahrzunehmen, selbst dann nicht, als Präsident Milner überschwänglich erklärte, welch große Ehre es doch sei, eine solch illustre Persönlichkeit wie Christian Richard Nicholas Francis Langland, Seine Exzellenz, den Herzog von Jervaulx, Graf von Langland und Vicomte Glade in der Mathematischen Gesellschaft als Gastredner begrüßen zu dürfen.
Der Herzog erhob sich unter dem Applaus der Zuhörer. Er verfügte über nichts Schriftliches als Gedächtnisstütze, hatte er doch die Papiere Maddy ausgehändigt. Sie hätte sich denken können, dass er eine Begabung dafür hatte, entspannt und gelöst in der Öffentlichkeit zu sprechen und das mit einer Stimme, die nichtsdestotrotz bis in den letzten Winkel drang. Gerade erklärte er mit Grabesstimme, er wolle diesen Vortrag seinem lieben verblichenen Tutor, Mr. Peebles, widmen, einem hoch geschätzten, hoch gebildeten Mann, einer wahren Bereicherung seines Berufsstandes, der lebenslangen Respekt und Ehrerbietung von Seiten seines Schülers verdiene; und der Herzog bedaure zutiefst, sein Lehrbuch damals mit Leichengeruch präpariert zu haben.
Alle lachten, sogar ihr Vater.
Noch heute schmerze ihn, so Jervaulx, die Erinnerung an diesen Streich, und irgendwie führte das zu der Seite, die er mit dem Geruch präpariert hatte und von da zum Parallelenaxiom von Euklid und der Differenzialrechnung. Und dann, unter dem nachhallenden Gegacker des Publikums über einen fragwürdigen Scherz in Bezug auf seine Leidenschaft für die Erforschung gewisser unwiderstehlicher Kurven, wandte er sich mit einem erwartungsvollen Nicken zu ihr um.
Maddy sprang erschrocken auf, griff sich die Kreide und begann die große Tafel voll zu schreiben. Sie hatte sich mittlerweile an die Handschrift des Herzogs gewöhnt, doch war diese selbst im günstigsten Falle noch schwer zu entziffern. Sie wagte nicht, jetzt irgendwelche Fehler zu machen und richtete daher ihre ganze Aufmerksamkeit auf die korrekte Duplizierung der Gleichungsserien sowie die genaue Wiedergabe der Kreise und Linien, die diese unterteilten. Aufgrund der endlosen Arbeitsstunden mit ihrem Vater hatte sie ein Geschick dafür entwickelt, der jeweiligen Sequenz zu folgen; mit halbem Ohr auf das lauschend, was Jervaulx sagte, entschied sie, wann sie die nächste Formel niederschreiben und die vorherigen wegwischen sollte, um Platz zu gewinnen. Das funktionierte gut, bis auf ein Mal, als sie sich zu lange mit einer Seite aufhielt. Jervaulx’ Pause, als er fragend den Kopf zu ihr umwandte, machte sie auf ihren Irrtum aufmerksam; hastig wischte sie fünf Gleichungen weg und kritzelte schnell das, was auf der oberen Hälfte des nächsten Blattes stand, auf die Tafel.
Als sie bei den letzten Berechnungen des Herzogs angelangt war, war sie ihm ein Stück voraus, denn er referierte noch über die Beweisführung von Formeln, die einige Stufen zurücklagen. Aber als Maddy die letzte Gleichung fertig schrieb, wobei sie dem Integral zwischen null und r aus reiner Erleichterung einen schwungvollen Schnörkel hinzufügte, begann es im Publikum zu rumoren. Jervaulx ließ sich davon nicht stören. Langsam, erst einzeln, dann in Gruppen von drei bis fünf, begannen die Herren sich von ihren Bänken zu erheben und die Hälse in Richtung der Tafel zu recken.
Irgendjemand begann zu klatschen. Andere folgten. Das Rumoren steigerte sich zu einem Brausen, während sich mehr und mehr Zuhörer erhoben. Das vereinzelte Klatschen wurde zu Applaus, der Applaus steigerte sich zum Tumult, in dem jedes Wort unterging.
Der Herzog hatte aufgehört zu sprechen. Inmitten des stürmischen Beifalls wandte er sich breit grinsend zu Maddy um und machte eine versteckte Bewegung in Richtung ihres Vaters – aber Mr. Milner war bereits dabei, ihn aufs Podium zu führen.
Die Begeisterung und der Applaus verdoppelten sich; die Herren begannen mit den Füßen zu stampfen, sodass der Saal vibrierte. Maddy erhob sich und drückte entzückt die Hand ihres Vaters. Mit einem Ausdruck derart überwältigender Freude, wie Maddy ihn nicht mehr gesehen hatte, seit ihre Mutter vor über sechs Jahren gestorben war, tätschelte er ihr den Handrücken.
Der Saal wollte förmlich bersten vor Energie. Jervaulx schüttelte ihrem Vater die Hand und als ihr Vater sich weigerte, sie wieder loszulassen, überließ er sie ihm. Der Herzog hatte den Kopf ein wenig zur Seite gelegt, auf den Lippen eine Art Halblächeln. Er sah, zu Maddys ausgesprochenem Unglauben, fast schüchtern aus. Man konnte ihn sich einen Moment lang beinahe als eifrigen, linkischen Jungen vorstellen, voller unschuldigem Enthusiasmus – und dann wandte er sich ihr zu, hob ihre Hand und beugte sich darüber, aber nicht ohne ihr mit einem Blick in die Augen gesehen zu haben, der den erfahrenen Lebemann auf fünfzig Schritte entlarvte.
Er hielt ihre Hand fest, sodass sie nicht zurückweichen konnte, beugte sich vor, so dicht, dass sie seine Körperwärme spüren und seinen schwachen Duft nach Sandelholz riechen konnte und sagte ihr ins Ohr, gerade so laut, dass sie es verstehen konnte: »Na, was halten Sie davon, Miss Archimedea?«
Maddy wich zurück und entzog ihm ihre Hand. »Was haben wir denn gemacht?«
»Was ihr gemacht habt?«, bellte Präsident Milner. »Was ihr gemacht habt? Den Beweis für eine neue Geometrie außerhalb von Euklid gefunden, Mädel! Das Parallelenaxiom gesprengt! Ein völlig neues Universum! Mein Gott, wenn das wirklich so fehlerlos ist, wie es aussieht …« Er schlug ihrem Vater und dem Herzog auf den Rücken und brüllte inmitten der Begeisterungsstürme: »Ihr seid Zauberer, Männer! Die reinsten Zauberer!«
»Die Ehre gebührt ausschließlich Euch, Freund«, wiederholte Papa. Sechsmal schon hatte er es gesagt, glaubte Maddy zu wissen; dies war das siebte Mal. »Wahrhaftig, das tut sie.«
Jervaulx schüttelte den Kopf und nippte an seinem Wein. »Unsinn, Mr. Timms.« Ein schalkhaftes Lächeln umspielte seine Lippen. »Der schwierigste Teil bleibt schließlich an Ihnen hängen. Sie müssen das Thesenpapier verfassen.«