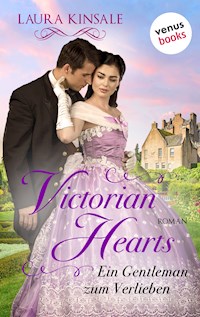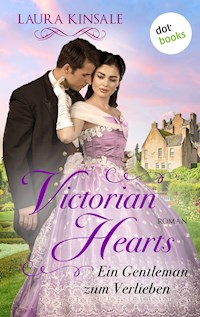5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ist sie seine Beute – oder sind sie füreinander bestimmt? Laura Kinsales historischer Liebesroman »In den Fängen des Piraten« als eBook bei dotbooks. Sein Herz ist von Hass zerfressen – kann ihre Liebe es heilen? Der berühmt-berüchtigte Piratenkapitän Allegreto hat nur eines im Sinn: Rache am Fürsten von Monteverde, der einst das Leben des Freibeuters zerstörte. Als Allegretos Mannschaft das Schiff der jungen Prinzessin Elayne kapert, der Verlobten des Fürsten, scheint ihm der denkbar beste Fang ins Netz gegangen zu sein. Doch die temperamentvolle Gefangene verzaubert ihn schon bald mit ihrer Schönheit und Anmut. So sehr sie sich gegen diese Gefühle auch wehren, zwischen den beiden entbrennt ein unaufhaltsames Feuer der Leidenschaft … Aber lodern die Flammen auch heiß genug, um Allegretos Rachegelüste zu Asche zerfallen zu lassen? »Laura Kinsale hat uns einen wunderbaren Liebesroman geschenkt, prickelnd vor Leidenschaft, Spannung und unwiderstehlichen Helden … Erstklassig!« Amanda Quick Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die historische Romanze »In den Fängen des Piraten« von Laura Kinsale. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 883
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sein Herz ist von Hass zerfressen – kann ihre Liebe es heilen? Der berühmt-berüchtigte Piratenkapitän Allegreto hat nur eines im Sinn: Rache am Fürsten von Monteverde, der einst das Leben des Freibeuters zerstörte. Als Allegretos Mannschaft das Schiff der jungen Prinzessin Elayne kapert, der Verlobten des Fürsten, scheint ihm der denkbar beste Fang ins Netz gegangen zu sein. Doch die temperamentvolle Gefangene verzaubert ihn schon bald mit ihrer Schönheit und Anmut. So sehr sie sich gegen diese Gefühle auch wehren, zwischen den beiden entbrennt ein unaufhaltsames Feuer der Leidenschaft … Aber lodern die Flammen auch heiß genug, um Allegretos Rachegelüste zu Asche zerfallen zu lassen?
»Laura Kinsale hat uns einen wunderbaren Liebesroman geschenkt, prickelnd vor Leidenschaft, Spannung und unwiderstehlichen Helden … Erstklassig!« Amanda Quick
Über die Autorin:
Nach ihrem Masterabschluss an der University of Texas war Laura Kinsale als Geologin tätig, bis sie begann, Romane zu schreiben. Ihre Bücher standen mehrfach auf der Auswahlliste für den besten amerikanischen Liebesroman des Jahres und stürmten immer wieder die Bestsellerlisten der New York Times. Die Autorin lebt mit ihrem Mann David abwechselnd in Santa Fé/New Mexico und Texas.
Bei dotbooks erscheinen von Laura Kinsale:
»Eine eigensinnige Lady«
»Victorian Hearts – Der Kuss des Marquess«
»Victorian Hearts – Ein Gentleman zum Verlieben«
»Die Leidenschaft des Dukes«
Die Website der Autorin: www.laurakinsale.com
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2021
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2004 unter dem Originaltitel »Shadowheart« bei Avon Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Küsse in der Nacht« bei Blanvalet.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2004 by Amanda Moor Jay
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2005 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-677-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »In den Fängen des Piraten« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Laura Kinsale
In den Fängen des Piraten
Roman
Aus dem Amerikanischen von Gertrud Wittich
dotbooks.
Für Sage und Keeper und Folly,
für Hunde, für Musen und einen
Grund zum Lachen
Kapitel 1
Forsten von Savernake,
im fünften Jahr der Regierung von
König Richard II.
Am Pflugmontag ging das ganze Federvieh ein.
Es war wohl doch keine so gute Idee gewesen, anstelle der zauberkräftigen Wiedehopffeder eine ordinäre schwarze Hühnerfeder zu nehmen, wie Elayne mit einem flauen Gefühl klar wurde. Aber was hätte sie tun sollen? Sie wusste ja nicht einmal, was ein Wiedehopf war, geschweige denn, wie ein solcher Vogel aussehen sollte. Sie hatte den Namen überhaupt zum ersten Mal in ihrem Buch der Zaubersprüche gelesen.
Nun, ihrer Ansicht nach war es alles andere als sicher, dass ihr kleiner Versuch eines Liebeszaubers das komplette Ableben des dörflichen Federviehs verursacht hatte. Aber Cara würde natürlich sie, Elayne, verdächtigen. Cara verdächtigte grundsätzlich Elayne. Es bestand wenig Hoffnung, dass ihr Schlachtross von älterer Schwester die jähe Auslöschung der Hühnerpopulation von Savernake kommentarlos hinnehmen, geschweige denn übersehen würde. In einer großen Stadt, wie zum Beispiel London oder, ja, Paris, wäre der Verlust von ein paar Dutzend Hühnern keine große Sache gewesen. In einem Kaff wie Savernake aber schon.
Elayne wickelte sich fester in ihren Winterumhang und hastete über den gefrorenen Boden, das Dorf hinter sich lassend. Gut geschützt unter ihrer Chemise, ihrem knielangen leinenen Leibhemd verborgen, baumelte das kleine selbst gebastelte Amulett, eine Wachsfigur mit einer schwarzen Feder, und kitzelte sie wie ihr schlechtes Gewissen. Sie war überhaupt erst auf die Idee mit der schwarzen Hühnerfeder gekommen, weil diese in einer anderen Formel – allerdings zur Förderung des männlichen Bartwuchses – genannt wurde. Nun, vielleicht war es ja wirklich eine ausgesprochen blöde Idee gewesen. Vielleicht haute sich diese Bartwuchsformel ja mit ihrem Liebeszauber und hatte so zum Ableben des gesamten Federviehs in einem Umkreis von zehn Wegstunden geführt.
Alles, was ihr jetzt noch zu hoffen blieb, war, dass Raymond de Clare, dessen Abbild sie aus Wachs nachzuahmen versucht hatte, nun nicht plötzlich ausgesprochen buschig ums Kinn wurde.
Als sie sich der verfallenen Mühle näherte, hob eine Herde Rehe, die an den frostverharschten Resten eines kahlen Dickichts knabberte, die Köpfe. In diesem Augenblick tauchte Raymond hinter dem riesigen Mühlrad auf, und sie stoben davon. Er streckte ihr seine behandschuhten Hände entgegen, doch Elayne, in einem plötzlichen Anfall von Schüchternheit, wandte das Gesicht ab. Sie hielt ihn für den schönsten Mann auf Gottes Erdboden, konnte ihm aber, von plötzlicher Nervosität (und schlechtem Gewissen) geplagt, nicht in die Augen sehen.
»Wollt Ihr mich denn nicht wenigstens begrüßen?«, erkundigte er sich mit einem amüsierten Unterton in der sonoren Stimme.
»Doch«, quiekte Elayne. Sie gab sich einen Ruck, blickte auf und reckte in einem nicht ganz überzeugenden Versuch, welterfahren und abgeklärt zu wirken, das Kinn. Ein kleiner Knicks rundete die Vorstellung ab. »Bel-accoil! Seid gegrüßt, edler Ritter.«
»Ah! Heute mal ganz förmlich«, grinste er und machte seinerseits eine – allerdings formvollendete – Verbeugung, eine Verbeugung, die selbst dem Hof des Königs würdig gewesen wäre – nicht dass Elayne je auch nur in Sichtweite von London, geschweige denn des Königspalastes, gekommen war. Dennoch hegte sie das sichere Gefühl, dass der elegante Schwung seines Armes, mit dem er sein scharlachrotes Cape flattern und das rote Futter seines schwarzen Schlitzwamses aufblitzen ließ, eines solch erlauchten Ortes durchaus würdig gewesen wäre.
Als er sich wieder aufrichtete, mied sie weiterhin seinen Blick, denn sie war der Überzeugung, wenn sie nicht wenigstens sein Gesicht berühren, nur berühren könnte oder eine Locke seines dichten kastanienbraunen Haars sich würde um den Finger wickeln können – dann, ja dann würde sie vor unerwiderter Liebe sterben, noch bevor die Nacht um war. Stattdessen setzte sie den Fuß auf das vereiste Mühlgerinne und, seiner dargebotenen Hand ausweichend, übersprang sie den Mühlbach und versuchte an ihm vorbeizuschlüpfen. Doch er wandte sich um und schritt so dicht neben ihr her, dass sein Ärmel ihre Schulter streifte. Elayne machte einen kleinen Satz, um ihm ein wenig vorauszukommen, und schob einen kahlen Ast beiseite, der über dem Eingang zur alten Mühle hing.
Lachend gab er ihr einen Stups an die Wange. »Ihr weicht mir aus, Kätzchen.«
Sie warf einen unauffälligen Seitenblick auf sein Kinn. Alles schön glatt – noch keine Stoppeln in Sicht. Ihr fiel ein Stein vom Herzen. Gleich viel vergnügter, verkündete sie: »Aber damit tue ich Euch doch nur einen Gefallen, edler Ritter. Ihr wollt Euch doch nicht ernsthaft mit einer Landpomeranze wie mir abgeben!«
Da nahm er sie bei der Schulter und drehte sie zu sich herum. Für einen Moment blickte er ihr tief in die Augen, und sie spürte seine Hände, seine Finger, die sich durch den dicken grauen Wollstoff ihrer Cotte, ihres Kittels, in ihre Schultern gruben. »Aber wie könnte ich nicht?«, fragte er leise und intensiv. »Ein funkelnder Diamant, ganz unerwartet im Staub am Wegesrand – wie könnte ich mich nicht bücken, ihn aufzuheben?«
Elayne starrte seinen Mund an, als wäre sie diejenige, die unter einem Zauberbann stand und nicht er. Mit einem sanften Druck seiner Handfläche schob er sie rückwärts an die Wand. Ihre Schulterblätter schabten gegen kalten Stein. Elayne warf einen wilden Blick um sich. Auf einmal hatte sie panische Angst vor Entdeckung. Kahle Äste warfen zitternde Schatten über die Türschwelle, doch die alte Mühle lag verlassen und still da. Sie drückte mit den Handflächen gegen seine Brust, als wolle sie ihn abwehren, doch insgeheim zitterte sie vor Erwartungsfreude und Hoffnung, dass es nun endlich geschehen, dass er sie nun endlich, nach Wochen des scherzhaften, knisternden Geplänkels, küssen würde. Ihr erster Kuss. Sie war siebzehn und war noch nie verliebt gewesen, ja, noch nicht einmal hofiert worden. Nie hätte sie sich vorstellen können, dass es einen Mann wie Raymond, der ihr nicht nur den Schlaf, sondern auch noch sämtliche Hemmungen raubte, überhaupt geben könnte.
»Ich bin nur eine schlichte Maid wie jede andere«, flüsterte sie, und ihr Herz pochte heftig unterhalb der Männerhand, die auf ihrer Schulter lag. »Vielleicht ein wenig kühner als die meisten.«
»Du, mein Lieb, bist etwas ganz Besonderes.« Sein Gesicht näherte sich dem ihren. Elayne schnappte erschrocken nach Luft. Dann küsste er sie; warm und weich waren seine Lippen in der frostigen Luft, weicher, als sie es erwartet hätte. Es war ein nasser Kuss, und er schmeckte stark nach Met – nicht ganz nach ihrem Geschmack. Erregt keuchend schob er seine Zunge in ihren Mund. Elayne, entsetzt und angeekelt, stieß ihn in ihrer Panik heftiger von sich als beabsichtigt. Er musste sich unwillkürlich mit dem Arm an der Wand festhalten, um nicht ins Stolpern zu geraten und hinzufallen.
Er hob arrogant die Augenbrauen. Richtete sich zu seiner vollen Größe auf. »Missfalle ich Euch etwa, Mylady?«
»O nein!«, beeilte sie sich zu versichern und tätschelte beschwichtigend seinen Ärmel. Sie schämte sich bereits für ihre Feigheit. »Es ist nur – wenn uns jemand sieht – das wäre nicht auszudenken ... o Raymond!« Sie biss sich auf die Lippe. »Ihr bringt mich ja so durcheinander!«
Seine Miene besänftigte sich etwas, wofür Elayne von Herzen dankbar war. Raymond de Clare nahm jede, auch die kleinste Kränkung, bitter übel. Doch jetzt lächelte er sie an, schob ihre wollene Kapuze ein wenig zurück und zog sie neckend am Ohrläppchen. »Ich werde nicht zulassen, dass uns jemand erwischt.«
»Kommt, gehen wir zum Haus zurück. Wir können ja im Garten spazieren gehen und reden.«
»Unter den wachsamen Augen von ich weiß nicht wem«, kommentierte er trocken. »Und worüber wollt Ihr Euch unterhalten, Mylady?«
»Na, Ihr müsst doch ein Gedicht auf meine Augen und auf mein Haar verfassen, was sonst? Ich könnte Euch helfen.«
Er lachte laut auf. »In der Tat.« Dann blickte er lächelnd und mit einem hingerissenen Ausdruck auf sie herab, als wäre er mit den Gedanken schon beim Dichten. Seine Augen ließen ihre Lippen dabei keine Sekunde lang los. »Glaubt Ihr denn, dass ich dazu Hilfe brauche?«
»Nun, ich denke, dass jeder Ritter vom feinen Gespür einer Dame in diesen Dingen profitieren könnte.«
»Immer müsst Ihr Euer Näschen in irgendwelche Bücher stecken. Am Ende wollt Ihr mir noch meinen Heiratsantrag vorformulieren.«
»Nun, wenn Ihr mich darum bitten würdet, warum nicht?«, entgegnete sie hochmütig. »Nennt mir die Braut Eurer Wahl, und ich werde sie studieren, um herauszufinden, mit welchen Worten Ihr ganz gewiss ihre Hand erringen könntet.«
»Aha. Aber alles, was mich interessiert, sind die Worte, die es braucht, um Eure Hand zu erringen.«
»Ach was, ich werde nie heiraten!«, erklärte Elayne im Brustton der Überzeugung, konnte jedoch ein verräterisches Zucken der Mundwinkel nicht ganz verhindern. Um dies vor ihm zu verbergen, neigte sie den Kopf, sodass ihr die Kapuze über die Wangen fiel. Dann warf sie ihm von unten herauf einen koketten Blick zu.
Er stieß ein ungläubiges Schnauben aus. »Wollt Ihr etwa eine vertrocknete alte Jungfer werden, die die Nase andauernd in Bücher steckt und irgendwelche hirnlosen Zaubertränke braut?«
»Hirnlos!«, rief sie empört. »Diese Dinge sind nicht so harmlos, wie Ihr zu glauben scheint, mein Herr!«
Er nickte auf eine derart ernste Art, dass ihr rasch klar wurde, dass er sie nur aufzog.
»Also gut«, meinte sie mit einem Achselzucken. »Ihr könnt mir glauben oder nicht. Ich wüsste jedoch nicht, wieso ich mit meinen Studien aufhören sollte, bloß weil ich verheiratet bin.«
Er schüttelte lächelnd den Kopf. »Kommt, jetzt einmal ernsthaft – auch wenn Euch das schwer zu fallen scheint.«
Elayne reckte sich empört. »Ich scherze nicht, was das betrifft, das versichere ich Euch, Raymond! Verheiratet oder nicht, ich werde meine Studien fortsetzen. Lady Melanthe tut es ja auch.«
»Nun, sie ist nicht gerade ein nachahmenswertes Vorbild –« Als Elayne daraufhin jäh zu ihm aufblickte, brach er ab und versuchte etwas lahm abzuwiegeln. »Natürlich ist Eure Patin eine bewundernswerte Person, Gott segne sie, aber Lady Melanthe ist immerhin die Herzogin von Bowland und muss sich nicht an die Gepflogenheiten der Gattinnen von einfachen Rittern halten.«
»Dann sollte ich wohl lieber keinen einfachen Ritter heiraten!«, rief Elayne. »Vielleicht finde ich ja irgendeinen König in einem fernen Land, der gerade nach einer Königin sucht.«
»Dann erbarme sich Gott seiner, sollte sein Augenmerk auf Euch fallen, habt Ihr doch gerade noch erklärt, Ihr wolltet niemals heiraten.«
»Nein –« Sie quittierte seine akkurate Beobachtung mit einer Grimasse. »Dann gehe ich eben ins Kloster.«
»Ihr? Keusch und gehorsam?« Er zog sich einen Handschuh aus, stützte sich mit dem Ellbogen auf der Türklinke ab und streichelte mit dem weichen Leder über ihre vollen Lippen. »Unvorstellbar.«
Die Gewissheit, mit der er dies sagte, ärgerte sie. »Ach? Tatsächlich?«, entgegnete sie schnippisch. »Nun, ich würde lieber Gott anbeten als einen Ehemann.«
»Hmmm ...« Er strich mit dem Finger über ihren Mund. »Glaubt Ihr wirklich, die Kirche würde Euch eher Eure Tränkchen panschen lassen als ein Ehegatte?«
Elaynes Atem beschleunigte sich, und sie blies kleine Frostwölkchen auf seine streichelnden Finger. »Und wie, bitte schön, soll mich dieser mystische Ehemann davon abhalten?«
»Dummes, süßes Mädchen, glaubt Ihr etwa, ich würde Euch schlagen? Nein, ich würde Euch so mit meiner Liebe in Atem halten, dass Ihr überhaupt keine Zeit mehr für Bücher hättet.«
Elaynes Körpertemperatur erreichte allmählich kritische Ausmaße; beinahe fürchtete sie vor seinen Augen zu verdampfen. Aber ihre Erregung besaß einen Anstrich von Panik. Sie hatte keine Angst vor ihm, o nein – und dennoch fürchtete sie sich zu Tode.
»Trotzdem!«, rief sie mit einem nervösen Lachen aus. »Ich werde nicht heiraten! Es gefällt mir nicht, mich von einem ganz gewöhnlichen Mann herumkommandieren zu lassen. Nein, ich werde Visionen haben und sogar dem Papst befehlen, was er zu tun hat.«
»Komisches Kätzchen«, murmelte er. »Du willst deinem Mann nicht gehorchen? Was soll der Unsinn?«
»Bloß eine von meinen ausgefallenen Ideen.« Sie streckte ihm die Zunge heraus, drückte sich an ihm vorbei und nahm ihn bei der Hand. »Kommt, gehen wir zurück. Dann werde ich Euch mehr darüber erzählen.«
Aber so leicht ließ er sich nicht übertölpeln. »Nein. Da sitzt uns bloß wieder Eure Schwester im Genick – und wenn Blicke töten könnten, dann wäre ich längst kalt.« Er packte sie um die Taille und zog sie an sich. Seine Hände verirrten sich in höhere Gefilde. »Ich habe eine bessere Idee, Elayne.«
Er begann sie rückwärts ins düstere Innere der verlassenen Mühle zu schieben. Lachend, um ihre Verwirrung zu überspielen, ließ sie sich Schritt für Schritt in den Raum hinein bugsieren, in dem vereinzelt Fassdauben und alte Bastkörbe herumlagen.
Er raffte ihre Röcke und warf dabei auch gleich den zweiten Handschuh ab. Sie versuchte ihm tänzelnd zu entwischen, doch er drängte sie in eine Ecke und klemmte sie sich zwischen die Beine. Seine Lippen stürzten sich hungrig auf die ihren. Mit den bloßen Händen wühlte er sich suchend unter ihre Chemise.
Jetzt wurde es brenzlig; so hatte sie sich dieses Rendezvous nicht vorgestellt. Alles, was sie gewollt hatte, war, ihn dazu zu bringen, sich in sie zu verlieben und ihr einen Heiratsantrag zu machen. Sie stieß ein entsetztes Keuchen aus, das er jedoch gar nicht wahrzunehmen schien, denn seine Finger waren unbeirrt dabei, ihre Cotte aufzuknöpfen. Dann packte er den Saum ihres nun offenen Gewandes und schob es ihr bis über die Oberschenkel hoch, sodass der kalte Wind um ihre nackten Beine strich.
»Raymond«, quiekte sie erschrocken, als seine Hände über ihre bloße Haut krabbelten.
Er wog das straffe Gewicht ihrer Brüste in seinen Händen. »Ich will dich«, flüsterte er ihr heiser ins Ohr. »Du Hexe, du treibst mich noch in den Wahnsinn!«
»Bitte. Nicht hier.« Durch den Stoff ihres Kleides umklammerte sie seine Handgelenke und schob sie weg. Doch er schüttelte sie mit einer flinken Drehung der Hände ab.
»Wo dann? Elayne – du überwältigst mich! Großer Gott, du bist so warm.« Seine Hände kannten nun kein Halten mehr, strichen über ihren Oberkörper, die Hüften, den Rücken und wieder zurück zu ihren Brüsten. Er drückte die beiden Halbkugeln zusammen. Sie wimmerte entsetzt und erregt zugleich.
Er war bei Hofe gewesen; er bewegte sich in den feinsten Kreisen, sie dagegen kannte nichts anderes als das Landschloss in Savernake. Sie hatte bisher noch keinen einzigen Verehrer gehabt, ganz zu schweigen von einem so welterfahrenen Ritter wie Raymond. Bis zu diesem Moment war er ein zuvorkommender, galanter Bewunderer gewesen; hatte ihr höchstens einmal die Hand geküsst, hatte sie geneckt und ihr entzückende Kosenamen gegeben.
Wie es schien, war durch ihr Hühnerfederamulett ein ganz anderer aus ihm geworden. Kein Gentleman mehr. Kein galanter Bewunderer. Die Küsse dieses Mannes waren roh und ungezügelt; jetzt schob er gar sein Knie zwischen ihre Schenkel. Sie rang mit ihm, duckte sich und versuchte ihn von sich zu stoßen. Er packte ihr Leibhemd, um sie festzuhalten, und dabei riss der dünne Faden ihres Amuletts, und es fiel herunter. Stolpernd kam sie von ihm frei und wischte panisch an ihren Röcken, um sich wieder zu bedecken.
»Raymond!«, rief sie keuchend aus.
Er trat mit flammend roten Wangen zurück. »Ihr begehrt mich also nicht«, sagte er eisig, seinerseits schwer atmend.
»Aber doch!«, rief sie, die Arme schützend um den Oberkörper geschlungen. »Nur nicht so.«
»Ich bitte um Verzeihung, Mylady.« Er richtete sich stolz auf. »Ich wollte Euch keinesfalls zu nahe treten.«
»Das ist es nicht, ich ...« Sie blinzelte, ihr versagte die Stimme. Es war so düster und schmutzig hier drin. Sie hätte sich nie mit ihm an diesem Ort treffen dürfen. Er hatte es als Einladung aufgefasst, eine Einladung, die nie in ihrer Absicht gelegen hatte.
»Geht es ums Heiraten?« Er bückte sich, um seine Handschuhe wieder aufzuheben, und eine Ratte verschwand im Schatten der nächsten Ecke. »Ich hatte das von Anfang an vor. Oder zweifelt Ihr an mir?«
Natürlich tat sie das. Er war aus heiterem Himmel hier in Savernake aufgetaucht, in seinem feinen höfischen Putz, um Pferde für seinen Herrn, den Lord John Lancaster, zu erwerben. Und jetzt hielt er sich schon seit Wochen hier auf, wo es für einen wie ihn keinerlei Zerstreuungen gab. Und sein Gerede von Heirat hatte sie nie ernst genommen; immer sprach er in einem scherzhaften Ton davon, hatte ihr aber bisher weder einen richtigen Antrag gemacht noch irgendwelche offiziellen Verhandlungen mit ihrer Familie eingeleitet, obwohl Cara sich natürlich sorgfältig über seine Herkunft informiert hatte. Ihre Schwester war alles andere als beeindruckt, was Letzteres betraf. Er stammte zwar aus gutem Hause, war jedoch ein landloser jüngerer Sohn. Elayne dagegen würde eine beträchtliche Mitgift in die Ehe bringen, dazu die Aussicht auf eine generöse Landschenkung durch ihre vermögende Taufpatin, Lady Melanthe. Cara fand, ihr stände eine bessere Partie zu. Aber Elayne war das vollkommen egal. Sie hatte vom ersten Moment an, als er sie beim Abendessen quer über die Tafel hinweg angelächelt hatte, gewusst, dass es er oder keiner sein musste.
»Ich zweifle nicht an Euch«, versicherte sie ihm daher. »Ich liebe Euch doch.«
Der grimmige Zug um seinen Mund glättete sich ein wenig. »Kätzchen. Du treibst mich in den Wahnsinn!« Er lächelte sie liebevoll an. »Vergebt mir. Ich hätte Euch nicht so roh behandeln dürfen. Ich verstehe gar nicht, wie ich derart meinen Kopf verlieren konnte.«
Sie versuchte angestrengt, nicht die Wachsfigur mit der schwarzen Feder anzusehen, die heruntergefallen war und die er nun unbemerkt zusammen mit seinen Handschuhen aufgehoben hatte. »Ach, schon vergessen«, sagte sie gespielt fröhlich, insgeheim aber inständig hoffend, das Amulett möge unbemerkt zu Boden fallen. »Ihr habt mich einfach erschreckt. Ich habe noch nie – ich hätte nie – Cara würde mich umbringen, wenn sie wüsste, dass ich mich hier mit Euch getroffen habe.«
»Das stimmt«, pflichtete er ihr bei. »Es war unklug von Euch. Jeder andere hätte Euch nicht so glimpflich davonkommen lassen.«
Sie machte einen Knicks. »Ihr seid die Güte in Person, edler Ritter, mir eine Schändung zu ersparen!«
Er runzelte die Stirn. »Elayne, es ist mir ernst. Ihr müsst mir versprechen, dass Ihr in Zukunft umsichtiger seid.«
Elayne errötete. »Umsichtiger?«
»Genau. Wenn Ihr meine Frau werden wollt, dürft Ihr Euch nicht länger wie ein Kind benehmen. Ein junges Mädel mag ja wie ein Wildfang in der Gegend herumtollen und sich an albernen Zaubersprüchen und -tränken versuchen, so wie Ihr, aber bei meiner zukünftigen Braut kann ich so ein Benehmen nicht dulden.«
Sie musste an die toten Hühner denken und senkte den Kopf. Wahrlich, sie war immer schon viel zu impulsiv gewesen. Cara und Sir Guy hatten dies oft beklagt. Kannst du denn nicht einmal überlegen, bevor du irgendwas Dummes anstellst, Ellie? Du musst lernen, dein freches Mundwerk im Zaum zu halten, junge Dame. Eine Lady sagt so etwas nicht. Ich hoffe inständig, dass du bald zur Ruhe kommst, Ellie, hör auf zu lachen und mich andauernd mit Fragen zu löchern.
»Ich will mich bemühen, mich zu bessern«, sagte sie und starrte dabei wie hypnotisiert das Liebesamulett an, das immer noch an seinem Handschuh baumelte. Jeden Moment würde er es sehen!
»Ich will, dass Ihr mir dies schwört«, verlangte er. »Schwört mir, die Finger von irgendwelchen Hexentricks zu lassen. Ich weiß, Ihr meint es nicht böse, aber diese Dinge sind sündig.«
Sie nickte. Er wollte sie heiraten. Das Amulett hatte gewirkt. Was wollte sie mehr? Sie brauchte nie mehr zu zaubern.
»Schwört es«, wiederholte er streng. »Schwört beim Allmächtigen, nie wieder etwas mit Hexenkunst zu tun zu haben.«
»Aber, Raymond –«
Er zog ein finsteres Gesicht.
»Einen so wichtigen Eid sollte man doch wohl in der Kirche ablegen, vor einem Priester, nicht wahr? Ich mache es bei der Beichte, gleich nach der nächsten Sonntagsmesse. Und ich bitte den Pfarrer, mir eine möglichst schwere und schmerzhafte Buße aufzuerlegen, damit ich es ja nicht vergesse«, fügte sie hinzu.
»Na ja –« Sein Mund zuckte, dann schüttelte er den Kopf. »Heilige Maria, ich will Euch doch nicht wehtun! Schwört es einfach still für Euch, in der heiligen Messe, im Angesicht der Hostie, das sollte genügen.«
Sie nickte, den Blick züchtig gesenkt.
»Gut.« Er streckte den Arm aus und hob ihr Kinn. »Schaut nicht so trübe, Kätzchen. Ich liebe Euch doch.«
Sie blickte zu ihm auf und befeuchtete ihre Lippen. Er liebte sie. Ohne die Augen von ihm abzuwenden, griff sie nach seiner Hand und entzog ihm die Handschuhe mitsamt dem verflixten Amulett. »Darf ich die behalten? Als Liebespfand?«
»Von Herzen gern«, meinte er. »Gleich morgen reite ich nach Windsor, um die Zustimmung meines Herrn, des Lord Lancaster, und der Lady Melanthe einzuholen.«
Cara sagte immer, dass Elayne wohl einen besonders guten Schutzengel haben müsse, und sie sagte es hauptsächlich dann, wenn Elayne wieder einmal unbeschadet aus irgendeinem Schlamassel herausgekommen war. Aber es stimmte. Nicht, dass sie es je Cara gegenüber zugegeben hätte, aber Elayne sah ihn hin und wieder, ihren Schutzengel – in ihren Träumen oder in einem halb wachen Zustand. Meist erinnerte sie sich kaum oder nur schemenhaft daran; aber es waren keine freundlichen Träume, sondern dunkle und vage bedrohliche. Sie sprach nie zu irgendjemandem darüber, denn für jeden Außenstehenden mochte es so aussehen, als sei ihr Schutzengel eher ein Abgesandter der Hölle. Aber das war er nicht, dessen war sie sich ebenso sicher wie der Tatsache, dass ihre Heiltinkturen und Zaubersprüche nicht des Teufels waren. Er war einfach nur ... ihr Engel. Und wenn er eher düster als hell wirkte, dann nur deshalb, weil er gegen so viel Böses antreten musste.
Heute Nachmittag hatte sie ganz gewiss unter seinem Schutz gestanden. Keiner hatte gesehen, wie Raymond sie geküsst hatte – schon beim bloßen Gedanken an diesen Kuss schoss Elayne das Blut in die Wangen. Nicht auszudenken, wenn man sie bei ihrem liederlichen Treiben erwischt hätte! Aber die Tatsache, dass sie ungeschoren davongekommen war, machte das Ganze nur umso aufregender und wunderbarer. Ein Schauder überlief sie. Ihr Blick huschte durch ihre leere Kammer, als könne ihre Schwester jeden Moment aus einer Truhe oder hinter einem Vorhang hervorspringen. Sie legte ihr Buch in den Schoß und überzeugte sich noch einmal davon, dass ihre Cotte auch ja wieder ordentlich zugeknöpft war. Ihr seid etwas ganz Besonderes, hatte er gesagt, ein funkelnder Diamant. Und dann hatte er sie geküsst.
So etwas hätte sie sich nicht einmal in ihren kühnsten Träumen vorstellen können. An dem Tag, als Raymond eintraf, hatte sie erst gar nicht zum Abendbrot herunterkommen wollen, denn die Gäste, die sie sonst immer hatten, waren entweder sterbenslangweilig oder unerträglich korrekt. Oder beides. Wer konnte es schon sein? Ein Forstaufseher oder ein Laienbruder aus der nahe gelegenen Abtei. Eine willkommene Gelegenheit für Cara, sie, Elayne, wegen ihrer schlechten Manieren zurechtzuweisen.
Elayne fühlte sich zunehmend fremd unter den Menschen, mit denen sie, seit sie zurückdenken konnte, unter einem Dach lebte. Sie liebte die riesigen Forsten von Savernake, mit ihren altehrwürdigen Eichen, den mächtigen, weit ausladenden Buchen, jenen wilden, einsamen Orten, wo es Wild und Fasan im Überfluss gab. Sie liebte die hervorragenden Pferde, die Sir Guy auf Koppeln am Rande der königlichen Wälder für die Herzogin Melanthe züchtete, liebte es, auf ihnen auszureiten. Sie liebte ihre Neffen und Nichten, liebte es, mit einem Haufen Hunde und Kinder herumzustreunen, eine Neigung, die ihre Schwester und der Pfarrer nie müde wurden zu kritisieren.
Ja, sie liebte selbst Cara, auch wenn sie beide sich unterschieden wie Feuer und Wasser. Aber der wohl organisierte Haushalt, der geordnete, stille Alltag, der Caras größte Freude war, erschien Elayne einfach nur erstickend. Alles war so vorhersehbar wie das tägliche Wiederkäuen der Kühe auf der Weide.
Aber mit Raymond de Clares Auftauchen war alles anders geworden. Er war nicht irgendein königlicher Beamter, der gekommen war, die pannage für das Schweinefutter – Eicheln aus den royalen Forsten – einzutreiben. Er war einer von Lord Lancasters Männern, war Ritter am Hofe dieses bedeutenden Herzogs; er war klug und elegant, und er amüsierte sich über Elaynes natürliches, ungehemmtes Wesen. Als Cara sich wegen ihres ungezügelten Lachens aufregte, hatte er ihr grinsend zugezwinkert – und Elayne hatte sich Hals über Kopf verliebt. Er schlug sich immer auf ihre Seite, stachelte sie zu noch mehr Späßen auf und verteidigte sie, wenn ihre Schwester sie ausschelten wollte. In seiner Gegenwart war sie wie in einem wilden Rausch – erst danach, wenn sie allein war, wallte die Liebe in ihr auf, die Liebe zu diesem gütigen, zuvorkommenden Edelmann mit den weit ausgreifenden, energischen Schritten.
Cara meinte, er würde nur mit ihr spielen; dass sie sich besser in Acht nahm vor diesem Mann mit seiner ausgedehnten höfischen Erfahrung. Sogar Sir Guy hatte Elayne zur Vorsicht geraten. Er meinte, ein Mann mochte zwar über eine wilde junge Stute in Wallung geraten, aber kaufen würde er am Ende doch nur die sanfte, gut zugerittene Mähre.
Elayne schnaubte beim Gedanken an diese zweifelhafte Weisheit. Sie legte Buch und Feder beiseite, raffte vorsichtig ihre Röcke und beugte sich zum Kaminfeuer hinunter, um eine Talgkerze zu entzünden. Die würden schon sehen, wenn Raymond mit dem Segen ihres Vormunds zurückkäme!
Sie setzte sich wieder auf die Truhe, in der sie ihre Bücher aufbewahrte, und hielt sich Raymonds Handschuhe an die Lippen. Sehnsüchtig schnuppernd nahm sie seinen Duft in sich auf und ließ dann das Liebespfand, in dessen einem Handschuh noch immer ihr selbst gebasteltes Amulett steckte, in den Schoß sinken. Sie wärmte einen Moment lang die Hände zwischen den Knien, dann zog sie ihr Schreibpult heran. Elayne hatte schon vor langem aufgehört, über ihre tiefsten Wünsche, Träume und Sehnsüchte zu sprechen; nein, sie behielt sie ebenso für sich wie das Geheimnis ihres schwarzen Engels. Aber es gab einen Ort, an dem sie diesen geheimsten Gedanken Ausdruck geben konnte – in einem Büchlein, einem Geschenk von jener Person, die sie als Einzige zu verstehen schien, ihre großartige, rätselhafte Patin, die Lady Melanthe.
Elayne hatte die Frau, die sowohl ihre Patin als auch ihr Vormund war, bisher nur wenige Male in ihrem Leben gesehen, doch diese Gelegenheiten hafteten in ihrem Gedächtnis. Lady Melanthe – rabenschwarzes Haar, genau wie Elayne, stolz und königlich wie eine Löwin und ebenso gefährlich. Beim Gedanken an sie hob Elayne den Kopf und starrte wie in weite Fernen. Keiner konnte sich mit ihr, mit Lady Melanthe, vergleichen, keine Beschreibung wurde ihr je gerecht. Cara fürchtete sich vor ihr, wollte aber nicht sagen, warum. Sir Guy verehrte sie geradezu. Beide taten alles, um ihre Lehnsherrin zufrieden zu stellen. Wenn sie ihren Namen nannten, dann immer mit Dankbarkeit und Hochachtung, doch hörte man unter der gewiss vorhandenen Zuneigung immer auch Furcht heraus. Als wäre die Lady Melanthe eher eine Art mystische Göttin als eine Frau aus Fleisch und Blut.
Wenn Lady Melanthe Raymonds Antrag stattgab, hätten die beiden nichts mehr zu melden.
Elayne rührte nachdenklich im Tintenfass. Sie wollte ein Gedicht verfassen, ein Gedicht über den Moment, als Raymond ihr seine Liebe gestand. Cara rümpfte immer die Nase über ihre dichterischen Anwandlungen und mahnte sie dann, sich lieber mit Nadel und Faden zu befassen, das hätte sie weit nötiger. Elayne warf einen beschämten Blick auf ihren Nähkorb. Es stimmte schon – verglichen mit Caras exquisiten Stickereien wirkte ihre Klöppelei immer, als hätte sich ein Fisch mit Flossen daran versucht.
Aber die Art ihrer Ausbildung war von Lady Melanthe höchstpersönlich festgelegt worden. Sie solle jedes Dokument, das ihre Patin ihr schickte, sowohl lesen als auch begreifen können, egal ob es auf Englisch, Französisch, Italienisch oder Latein abgefasst war und egal, um welches Thema es sich handelte. Seitdem trafen in schöner Regelmäßigkeit gleichermaßen interessante wie ermüdende Dokumente ein, gewissenhafte Abschriften von Briefen aller möglichen Personen des öffentlichen Lebens, von Erzbischöfen bis hin zu fahrenden Schneidern.
Elayne riss den Boten diese Pakete buchstäblich aus den Händen und hatte sie bereits geöffnet, noch bevor deren Reittiere im Stall untergebracht waren. Und dann suchte sie sogleich ihr eigenes, stilles Eckchen im großen Gemeinschaftsraum auf. Es spielte keine Rolle, was ihr ihre Patin zu lesen gab. Selbst der ödeste lateinische Text konnte sie dazu veranlassen, über Dinge nachzudenken, auf die sie sonst nie gekommen wäre, beispielsweise ob ein Eid auch unter Androhung eines glühenden Eisens Gültigkeit hatte. Mit großer Spannung folgte sie dem Urteilsgang des Richters, und mit ebenso großer Erleichterung las sie, dass sich die fragliche Ehefrau nicht dem von ihrem Ehemann geforderten Martyrium zur Prüfung ihrer Tugend unterziehen hatte müssen.
Am besten aber waren Bücher wie Die Beschreibung der Welt. Cara behauptete, sie hätte schon früher, in Italien, davon gehört. Man nenne es dort nur Il Milione – »die millionenfache Lüge« –, da es allgemein bekannt war, dass diese Geschichten nur von einem venezianischen Witzbold erfunden worden waren. Aber Elayne verschlang jedes Wort von Signor Polos Erzählungen über seine Reisen in so ferne Länder wie China, und sie fragte sich, ob es wirklich Vögel gab, die so groß wie Elefanten waren, oder Geld aus Papier. Doch obwohl Cara mit manchem, was Elaynes Patin schickte, nicht einverstanden war, hinderte sie sie nie daran, die Sachen zu studieren. Die Tatsache, dass Lady Melanthe Elayne ihre persönlichen Bücher und Briefe anvertraute, war unleugbar eine große Ehre.
Lady Melanthe schickte Elayne darüber hinaus jedes Jahr Geschenke. Zu ihrem zwölften Geburtstag war es beispielsweise ein Tagebuch gewesen, ein wundervolles, in herrliches blau gefärbtes Leder gebundenes Buch mit vielen leeren Seiten und einem kleinen vergoldeten Schloss samt Schlüsselchen. Es hatte keinerlei Anweisungen dazu gegeben, aber Elayne hatte ganz von selbst angefangen, darin zu schreiben, sorgfältige Abschriften der interessantesten Dokumente, bevor sie sie zurückgeben musste. Nicht lange und sie begann eigene Texte zu verfassen, so stümperhaft ihr die Versuche auch vorkommen mochten. Gebete und wichtigere Gedanken notierte sie auf Latein, an kleinen Balladen und Gedichten versuchte sie sich in der anmutigen französischen Zunge. Aber je älter sie wurde, desto mehr Spaß fand sie daran, alles niederzuschreiben, was ihr in den Sinn kam, und zwar in einer Sprache, die nur sie selbst verstand.
Lady Melanthe hatte nämlich vor Jahren die weise alte Libusche aus Böhmen zu ihr geschickt, um sie in Heilkräuterkunde und der Versorgung von Wunden zu unterrichten – natürlich nur so weit dies einer Dame edler Abstammung zukam. So war es jedenfalls in dem Brief gestanden. Oft jedoch schien mehr hinter Lady Melanthes Geschenken zu stecken, als einem zunächst ins Auge fiel, denn Elayne lernte weit mehr von Libusche als Kräuterkunde und einfache Wundbehandlung. Sie lernte auch die eigenartige Mundart der Böhmin, die so ganz anders war als das vornehme Französisch, Latein, Toskanisch oder Englisch, das Elayne bisher gesprochen hatte. Und daher benutzte Elayne nun diese Sprache, um ihre geheimsten Gedanken und Wünsche in ihr Tagebuch zu schreiben.
Cara dagegen hatte die Alte auf den ersten Blick missfallen. Sie vergaß wie zufällig, Feuerholz für Libusches Kamin zu ordern, beschwerte sich darüber, dass die Alte Elayne eine wertlose, barbarische Sprache beibringe und dass es einfach ungehörig sei, sommers wie winters barfuß herumzulaufen, wie Libusche es tat, wo sie sich von dem Gehalt, das ihr Lady Melanthe zahlte, doch sehr wohl anständiges Schuhwerk kaufen könne. Aber alles, was Libusche dazu sagte, war, sie wolle keine Schuhe, sie müsse die Erde unter ihren Sohlen spüren. Nein, Cara war machtlos; das Einzige, was sie tun konnte, war meckern und es dem unerwünschten Gast in kleinen Gemeinheiten heimzuzahlen. Sie hinauszuwerfen war unmöglich: Herzogin Melanthe hatte Libusche zu ihnen geschickt, also blieb Libusche.
Elayne tippte sich seufzend mit dem Federkiel an die Unterlippe. Sie traute sich nicht, ihr Liebesgedicht anders als auf Böhmisch zu verfassen, doch beherrschte sie Libusches Sprache leider nicht so gut – nicht gut genug jedenfalls, um den Gefühlssturm, der in ihr tobte, adäquat wiedergeben zu können. Wie gerne hätte sie jetzt Libusche zum Reden gehabt, wie früher immer, auf ihren weiten Spaziergängen. Libusche verstand sich darauf, Ordnung ins Chaos, Sinn ins Durcheinander zu bringen. Aber als Elayne sechzehn geworden war, war die weise Alte auf eigenen Wunsch gegangen, und seitdem fühlte sich Elayne einsam. Bis jetzt. Bis Raymond.
Noch einmal schnupperte sie inbrünstig an seinen Handschuhen und machte sich dann hingebungsvoll ans Dichten, ihre Lieblingsbeschäftigung. Sorgfältig über dem ersten Vers brütend – sie wollte nichts von dem kostbaren Papier verschwenden –, wurde sie durch die schrille Stimme ihrer Schwester aus ihren Träumen von Liebe und Seligkeit gerissen.
»Elayne!«, keifte Cara. Das klang nicht gut. Ohne sich die Zeit zu nehmen, die noch feuchte Tinte mit Löschpapier zu trocknen, klappte Elayne ihr Tagebuch mit einem Knall zu. Während ihre Schwester sich noch schnaufend die Treppe hocharbeitete, sprang Elayne hastig auf und stopfte Tagebuch und Handschuhe samt Liebesamulett in die wuchtige Holztruhe. Sie schloss den Deckel und setzte sich obendrauf.
»Elayne!« Caras rundliche Gestalt tauchte im reich mit Schnitzereien verzierten Türstock des großen Gemeinschaftsraums auf. In ihrem Schlepptau befand sich ein durch Kleidung und Ausdünstung leicht als Bauer identifizierbarer Mann. Elayne kannte ihn. Er war der Ehemann der Frau, der sie, im Austausch für eine Winzigkeit von Caras eifersüchtig gehütetem Ingwerpulver, die schwarze Hühnerfeder abgeschwatzt hatte.
Elayne erhob sich, nickte dem Mann hoheitsvoll zu und begrüßte ihre Schwester mit einem wohlerzogenen Knicks. »Sei mir gegrüßt, Schwester!«, sagte sie ein wenig zu überschwänglich.
Cara, die sich so leicht nichts vormachen ließ, quittierte diese Demonstration der Wohlerzogenheit denn auch mit einem verächtlichen Schnauben. »Spiel hier nicht das Unschuldslamm, Elayne«, fauchte sie. »Was hast du mit Willems Hahn angestellt?«
»Das war ’n ganz besonderer Hahn, Lady«, warf Willem zornig dazwischen. Sein Blick war funkelnd auf Elayne gerichtet; er knetete seine Kappe in den schmutzigen Pranken. »Das war mein bester Kampfhahn! Der beste, den ich je hatte! Hab ihn extra für den Kampf in Shrovetide aufgespart! Und die Hühner meiner Frau sind auch alle krepiert! Allesamt mausetot!«
»O nein! Ich hörte davon, wollte es aber nicht glauben!«, rief Elayne in gespieltem Entsetzen aus. »Sir Guy meint, dass sämtliche Hühner des Dorfes tot sind.«
»Allerdings! Sind alle letzte Nacht krepiert«, bestätigte er hitzig. »Lagen heute früh überall tot rum.«
»Das sind ja ganz schlimme Neuigkeiten«, sagte Elayne. Ihr zitterten die Knie, und sie hätte nichts lieber getan, als sich auf den nächsten Stuhl sinken zu lassen, doch sie blieb stehen, denn sie wusste, was jetzt gleich kommen würde.
»Und wie schlimm! Da war der Teufel am Werk!«, stieß er zornig hervor und schaute ihr dabei frech ins Gesicht.
Elayne bekreuzigte sich hastig und mimte die tief Betroffene. »Hat das der Pfarrer gesagt?«, meinte sie und sah dem Mann dabei direkt in die Augen.
Dieser senkte sofort den Blick und bekreuzigte sich ebenfalls. Dann versuchte er es bei Cara. »Gott steh uns bei, aber Eure Schwester hat den bösen Blick, Lady«, brummte er.
Cara stieg die Zornesröte in die Wangen. »Was fällt dir ein! Wie kannst du so etwas sagen?«, fauchte sie den Mann an. Elayne wurde es ein wenig leichter ums Herz, denn nun hatte die Wut ihrer Schwester eine neue Zielscheibe gefunden. »Ich warne dich, ich erlaube es nicht, dass so in diesem Haus gesprochen wird!«
»Es liegt an der Farbe«, brummte der Bauer, der sich so schnell nicht einschüchtern ließ. »Es ist kein richtiges Blau.«
»Was nur mal wieder beweist, dass du keinen Verstand hast«, erklärte Cara. »Lady Elayne ist von edlem Blut. Dieser Lavendelton gilt in ihrem Geschlecht seit jeher als Merkmal ihrer hohen Geburt.«
»Ausländer!«, brummte Willem voller Missgunst.
Cara schürzte die Lippen, bei ihr immer ein Alarmzeichen. Sie selbst, mit ihrem dunklen Hautton und den dunkelbraunen Augen, war nämlich unschwer als eine solche zu erkennen. Auch unterhielt sie sich mit Elayne am liebsten in ihrer melodiösen italienischen Muttersprache. Aber sobald jemand auch nur andeutete, sie sei nicht genauso englisch wie der Mann, den sie geheiratet hatte, geriet sie in Harnisch. »Fort mit dir! Beklage dich bei meinem Mann, wenn du es nicht lassen kannst!«
»Das werde ich auch, Lady«, meinte Willem. »Ich will zehn Kronen für meinen besten Kampfhahn und zwanzig Shilling für die Hühner!«
»Zehn Kronen!«, rief Cara empört. »So viel Geld hast du doch deiner Lebtage noch nicht gesehen! Wieso sollte Sir Guy dir überhaupt was für deinen toten Hahn geben? Ist doch nicht seine Schuld, dass er eingegangen ist!«
Willems Augen verengten sich zornig. »Er ist Euer Mann und obendrein für Eure Schwester verantwortlich, oder etwa nicht? Meine Frau sagt, sie hat ihr feine Sachen dafür gegeben, dass sie sie zu den Hühnern lässt, und am nächsten Tag sind sie alle hin ... Dabei ist Hexerei im Spiel, das ist doch sonnenklar. Ihr habt doch diese fremdländische Hexe bei euch beherbergt, und die hat dem Mädel ihre ketzerischen Künste beigebracht. Und seht, was dabei rauskommt: mein bester Hahn, der in Shrovetide kämpfen sollte, ist im Eimer!«
»Libusche hat mir keine ketzerischen Künste beigebracht«, widersprach Elayne fest. »Sie wurde von der Herzogin Melanthe – gesegnet sei sie – selbst hergeschickt, um mich in Kräuterkunde und Medizin zu unterrichten.«
»Na klar, und was sonst noch? Hat sie Euch auch beigebracht, Euch mit Männern in der alten Mühle rumzutreiben? Hab Euch heute da gesehn!«
Als sie den Blick sah, den Cara ihr bei diesen Worten zuwarf, verließ Elayne fast der Mut. Sie wich dem Blick ihrer Schwester aus. »Ich habe nichts getan, um deinem Federvieh zu schaden, Will«, sagte sie. »Libusche hat mich gelehrt, wie man kranke Tiere gesund pflegt, nicht wie man sie tötet!«
»Mit Männern in der alten Mühle rumtreiben?!«, fragte Cara bedrohlich auf Italienisch. »Mit Männern in der alten Mühle rumtreiben?!«
»Ich habe mich dort nur rasch von Sir Raymond verabschiedet«, beeilte sich Elayne in derselben Sprache zu versichern. »Wir haben nur ein paar Worte gewechselt, ehrlich.«
»Elena, du bist wirklich das dümmste Gör, das mir je untergekommen ist«, zischte Cara. »Allmächtiger, du wirst noch mal auf der Straße landen, wenn du so weitermachst!«
Elayne ließ den Kopf sinken. Dazu gab es nichts mehr zu sagen.
»Ausländer«, grummelte Willem erneut und musterte sie mit aggressiv vorgerecktem Kinn.
Cara nahm ihn sich sogleich zur Brust. »Das war ganz sicher nicht Elayne dort in der Mühle«, fauchte sie. »Sie hat den ganzen Tag lang Arbeiten für mich erledigt, hier im Haus. Du – du mit deinem Geschwätz vom bösen Blick und deinen unverschämten Forderungen. Verschwinde! Aus meinen Augen.«
»Ich gehe zu Sir Guy«, drohte er.
»Raus! Oder ich lass dich von der Torwache rauswerfen!«
»Ausländer!«, fauchte Willem, fuhr herum und verschwand, ohne sich noch einmal vor den Damen des Hauses zu verbeugen, wie es die Höflichkeit gebot. »Ketzerpack! Na wartet, das werde ich dem Pfarrer erzählen!«
Kapitel 2
Elayne saß auf einer Bank in Lady Melanthes Sonnenzimmer und hatte die Hände so fest ineinander verwoben, dass ihre Fingerknöchel weiß hervortraten. Die Sonne schien hart und blendend durch die hohen Bleiglasfenster herein und brach sich funkelnd in einem ihrer Ringe, einem Rubin, der rosige Streifen über ihre Haut warf. Wie aus einem düsteren Traum drang die trompetende Stimme von Lady Beatrice, einer formidablen älteren Dame, selbst durch die dicken Steinwände zu ihr. Aber das Einzige, woran Elayne denken konnte, war Raymonds Brief, in dem er ihr in scharfen, verächtlichen Worten den Laufpass gegeben hatte.
Selbst nach all diesen Wochen konnte sie sich an jedes verletzende Wort erinnern, das Cara ihr beim Sticken vorgelesen hatte. Es war das Erste, woran Elayne beim Aufwachen dachte, und das Letzte, bevor sie nachts in einen unruhigen Schlaf fiel.
Dabei spielte es keine Rolle, dass, wie Sir Guy ihr hatte mitteilen lassen, der Antrag auf Anklage wegen Ketzerei vom Geistlichen Gericht in Salisbury abgewiesen worden war. Es spielte keine Rolle, dass den Dörflern die Hühner, zusammen mit einem ihre Erwartungen bei weitem übersteigenden Schmerzensgeld, ersetzt worden waren. Alles, woran sie denken konnte, war das, was noch in Sir Guys Brief gestanden hatte. Vor einer Woche, hieß es da, sei das Aufgebot für seine baldige Verehelichung mit einer gewissen Katherine Rienne, Witwe eines böhmischen Ritters, am Dom zu Westminster ausgehängt worden.
»Mylady.« Elayne zuckte beim Klang der leisen Männerstimme zusammen. Vor ihr stand in einer rotweißen Livree der Haushofmeister. Er machte eine höfliche Verbeugung und sagte: »Ihre Gnaden wünscht Euch in ihrem Schlafgemach zu empfangen.«
Draußen tobte trotz der Sonne ein heftiger Wind, der Eiskristalle an die hohen Fenster von Windsor Castle fegte und die Luft mit einem funkelnden Glitzern erfüllte. Elayne sah, dass die Herzogin Beatrice von Ludford, die nie ohne ihren fiesen kleinen Cockerspaniel zu sehen war, aus Lady Melanthes Empfangszimmer geleitet wurde. Die Herzogin schien, trotz ihrer vorherigen cholerischen Ausbrüche, keineswegs unerfreut über das Ergebnis ihres Gesprächs mit Lady Melanthe zu sein. Elayne, die höflich knickste, als die ältere Dame, einem Schlachtschiff gleich, mit prächtigem Wimpel, in steifer Brokatrobe an ihr vorbeisegelte, wurde mit einem hoheitsvollen Nicken und einem aggressiven Japsen bedacht.
Elaynes Blick klebte am Boden. Sicher wusste jeder hier, dass sie in Schimpf und Schande vor ihre Patin zitiert worden war. Im Schlafgemach der hohen Dame empfangen zu werden hätte an sich eine hohe Auszeichnung sein müssen – selbst die Herzogin Beatrice hatte es nur bis zum Empfangszimmer geschafft –, doch Elayne war sich sicher, dass sie diese Ehre nur der Tatsache zu verdanken hatte, dass die Lady ihre skandalöse Patentochter zwecks Standpauke in strikter Privatsphäre zu empfangen wünschte. Elayne folgte dem Butler durchs Empfangszimmer, dessen Wände mit kostbaren Seidenstoffen tapeziert worden waren, vorbei am überdachten Audienzsessel und den mannshohen silbernen Kerzenhaltern. Als sie das Schlafgemach betrat, sah sie, dass Lady Melanthe soeben dabei war, ihre mit einem Hermelinkragen verbrämte Robe abzulegen, während ihr die Kammerzofe den aufwändigen Kopfputz abnahm – ein hohes, mit kostbaren Smaragden und silbernen Knöpfen besticktes, zuckerhutförmiges Gebilde.
Mit einer Bewegung, bei der sich ihr schwarzes Haar wie ein Wasserfall in schimmernder Fülle über ihren Rücken ergoss, wandte Lady Melanthe sich zu ihr um. Mit einem Blick, so wachsam wie der einer Katze, die Augen ein seltsames sattes Veilchenblau, beobachtete sie, wie Elayne einen ehrerbietigen Hofknicks machte.
»Gottes Segen, werte Patin«, sagte Elayne, den Blick gesenkt, den Rock gespreizt. So verharrte sie, die Augen unverwandt auf ein indigoblaues Kreuz auf dem türkischen Teppich geheftet.
Stille. »Du siehst gar nicht gut aus, Ellie«, sagte Lady Melanthe leise.
Elayne biss sich, verzweifelt die jäh aufsteigenden Tränen zurückhaltend, auf die Lippen. Sie wagte nicht aufzublicken, schüttelte nur den Kopf. Caras heftige Vorwürfe, die Blicke der Dienerschaft, die Verachtung des Pfarrers und der Dorfbewohner, das alles hatte sie ertragen, ohne sich etwas anmerken zu lassen.
»Deine Hände zittern ja. Mary, räum den Hocker fort und rück einen Sessel vor den Kamin. Bring uns zwei Paar Hausschuhe, die warmen mit dem Winterfell. Und mir reichst du bitte die grüne Abendrobe. Dann bringst du uns bitte zwei Gläser Glühwein, schön warm und süß. Setz dich, Elena.«
Elayne ließ sich dankbar in einen Sessel sinken. Trotz aller Mühe gelang es ihr nicht zu verhindern, dass ihr die Tränen nun ungehindert über die Wangen kullerten. Verzweifelt starrte sie ins Feuer. Lady Melanthe löste ihren goldenen Gürtel und schlüpfte in ihren grünseidenen Abendmantel. Als die Zofe gegangen war, setzte sie sich ebenfalls ans Feuer und schob mit dem Feuerhaken ein Stück Kohle zurück, das aus dem Kamin zu kullern drohte.
»Wenn du wieder sprechen kannst, Kind, erzähle mir bitte, was los ist«, sagte sie und reichte Elayne dabei ein Leinentuch.
Nun, da der Damm einmal gebrochen war, schien es kein Halten mehr zu geben. Elayne schlug das Tuch vors Gesicht. Draußen heulte der Wind um die Mauern und trieb Eiskristalle in Kaskaden gegen die Bleiglasscheiben in ihrem Rücken.
»Deine Hände sind ganz dünn«, bemerkte Lady Melanthe.
»Es ist Fastenzeit. Nichts schmeckt, Mylady.«
»Bist du krank?«
»Nein. Das heißt –« Sie hob den Kopf, die Hand an der Kehle. »Nein.« Weil sie nicht wollte, dass man ihre neuerlich aufsteigenden Tränen sah, wandte sie ihr Gesicht wieder dem Feuer zu.
Sie spürte, wie Lady Melanthe sie beobachtete. Elayne hatte nicht vorgehabt, überhaupt darüber zu sprechen oder zuzugeben, wie verzweifelt sie war. Doch nun fiel ihr nichts ein, womit sich ihr absurdes Benehmen vor ihrer Patin hätte rechtfertigen lassen. Sie biss sich fest auf die Lippen und zwang die Tränen nieder.
»Könnte es sein, dass du verliebt bist, mein Kind?«, erkundigte sich Lady Melanthe sanft.
»Nein!« Elayne krallte die Hände zusammen und vergrub abermals das Gesicht im Leinentuch. »Nicht mehr. Nicht mehr.«
Vor- und zurückschaukelnd saß sie über ihren Schoß gebeugt. Lady Melanthe sagte nichts. Kummer, seit Wochen aufgestaut, brach sich nun Bahn, und Elayne schluchzte sich förmlich das Herz aus dem Leib. Sie schluchzte, bis sie kaum mehr atmen konnte.
»Vorsicht, da kommt meine Zofe«, warnte Lady Melanthe leise.
Elayne rang keuchend nach Luft und setzte sich auf, das Gesicht dem Feuer zugewandt, den Kopf gesenkt, damit die Zofe, die zwei kostbar verzierte Silberkelche auf einem kleinen Tisch zwischen ihnen platzierte, ihre Tränen nicht sah. Danach stellte sie jeder der beiden ein Paar warme Hausschuhe hin und zog sich zurück.
»Hier.« Lady Melanthe hielt Elayne einen Becher Wein hin. »Trink das aus, das wird dich stärken.«
Elayne setzte den Kelch an die Lippen und nahm einen kräftigen Schluck von dem süßen, heißen Gebräu. Anschließend wärmte sie die eisigen Finger an dem Silberbecher, der mit Drachen verziert war und mit Rittern, die todesmutig mit ihnen kämpften. »Es ist alles meine Schuld!«, platzte es aus ihr heraus. »Ich habe alles ruiniert. Er nannte mich einen funkelnden Diamanten, etwas ganz Besonderes. Und dann sagte er, ich sei arrogant und würde ihn anwidern. Und es stimmt! Es stimmt!«
»Was du nicht sagst!« Lady Melanthe nippte an ihrem Glühwein und beobachtete Elayne dabei über den Becherrand hinweg. »Und wer, bitte schön, ist dieser Ausbund an Höflichkeit?«
Elayne holte tief Luft, nahm noch einen Schluck und hob den Kopf. »Bitte ergebenst um Verzeihung, liebe Patin. Ich dachte, er hätte sich vielleicht an Euch gewandt?«
Die Herzogin hob erstaunt die Brauen. »Nein – was dich betrifft, sind in letzter Zeit nur deine Schwester Cara und Sir Guy an mich herangetreten.«
Elayne errötete. Sie wagte sich kaum vorzustellen, was Cara wohl über sie gesagt haben musste, dass Lady Melanthe sie auf ihr Anwesen bei Windsor bestellt hatte. »Es tut mir Leid, Mylady! Ich wollte Euch nicht beschämen!«
»Mich beschämt man nicht so leicht, das versichere ich dir. Um ehrlich zu sein, ich habe mich über Caras Geschichte von der Ausrottung des Savernaker Federviehs köstlich amüsiert. Und der Bischof von Salisbury ist ein vernünftiger Mann. Eine kleine Spende und er hat rasch eingesehen, wie lächerlich es wäre, jemanden wegen ein paar Hühnern der Ketzerei zu bezichtigen.«
Elayne holte zitternd Luft und mühte sich, ruhig zu sprechen. »Besten Dank, Madam, dass Ihr Euch so für mich eingesetzt habt.«
»Um noch einmal auf diesen Burschen zurückzukommen«, sagte Lady Melanthe. »Er hatte also vor, um eine Audienz bei mir zu ersuchen? Kann mir denken, worüber er mit mir sprechen wollte, angesichts des ›funkelnden Diamanten‹ und dergleichen.«
»Nun, er ist offenbar anderen Sinnes geworden«, bekannte Elayne bitter. »Er sagte, ich sei sündig und eine Lügnerin und ich solle mir auf ihn nichts mehr einbilden und er betrachte unsere Vereinbarung für null und nichtig.« Sie nahm einen kräftigen Schluck Malmsey. Dann überkam sie abermals die Reue. »Aber es war tatsächlich meine Schuld! Ich versuchte ihn mit einem Liebeszauber an mich zu binden!«
Lady Melanthe schüttelte den Kopf. »Wie abscheulich. Nun, ich nehme an, dass dies der Grund für das Hühnersterben war.«
Elaynes Augen füllten sich wieder mit Tränen. »Ich wollte ja sagen, wie Leid es mir tut! Ich habe ihm einen Entschuldigungsbrief, nein, sogar drei geschickt! Ich konnte nichts essen, ich war jedes Mal ganz krank vor Angst, was er wohl sagen würde, wenn er sie liest.«
Lady Melanthe strich mit einem langen, beringten Finger über den anderen. »Und was hat er gesagt?«
Elayne starrte in die dunkelroten Tiefen ihres Weins. »Nichts«, murmelte sie. »Er hat nicht geantwortet. Vergangenen Sonntag wurde das Aufgebot für seine Eheschließung mit einer anderen in der Kirche verlesen.«
Auf eine Schelte gefasst, senkte sie den Kopf. Sie fühlte sich zutiefst beschämt und gedemütigt.
»Avoi – wer ist denn dieser liebeskranke Trottel?«
»Kein Mann von hohem Stand, Mylady, nur ein einfacher Ritter.« Sie zögerte, voller Scham darüber, ihr Herz einem derart wankelmütigen Mann geschenkt zu haben. »Im Übrigen wäre es unpassend, seinen Namen zu nennen.«
Lady Melanthe lehnte sich zurück und stellte ihr Glas auf der breiten Lehne ihres Sessels ab. Selbst mit offenem Haar und im informellen Abendmantel wirkte sie äußerst einschüchternd. Sie besaß eine gefährliche, katzenhafte Grazie. »Nun, da hast du wohl Recht.« Sie lächelte. »Denn ich könnte der Versuchung vielleicht nicht widerstehen.«
Elayne blickte auf. »Ma’am?«
Ihre Patin trommelte kurz mit den Fingern auf die Sessellehne. »Ich könnte ihn wegen irgendeines lächerlichen Delikts verhaften und zur Strafe in kochendes Wasser tauchen lassen«, murmelte sie.
»Ich hätte nichts dagegen, ihn ein wenig kochen zu lassen«, entgegnete Elayne böse.
Aber Lady Melanthe sagte lediglich: »Nein, nenne mir nicht seinen Namen, Elena. Ich traue mir selbst nicht über den Weg, weißt du.«
Elayne holte tief Luft, die Augen unverwandt auf die halbmondförmige Reflexion auf der Oberfläche ihres Weins geheftet. Es stimmte – sie war bis jetzt noch gar nicht auf diesen Gedanken gekommen, aber ein Wort von Lady Melanthe genügte, um Raymond für immer zu ruinieren. Rache war in Reichweite, wie bei einer zum Sprung geduckten Tigerin.
Sie erlaubte sich einen kurzen Moment des Träumens. Immerhin hatte er sie arrogant, ja abstoßend genannt. Sie stellte sich vor, wie es wäre, wenn er und seine feine Frau, ihres Vermögens beraubt, zum Frondienst bei irgendeiner reichen Schachtel verurteilt wären – Lady Beatrice zum Beispiel –, wo er in Kellerküchen herumsitzen und sich wehmütig der Tage erinnern würde, als noch Elayne, der funkelnde Diamant, ihm zu Füßen gelegen hatte. Während sie selbst sich inzwischen gar nicht mehr vor Verehrern – natürlich weit nobleren Herren als Raymond de Clare – retten könnte: Herzöge, ja Prinzen, aus so weit entfernten Ländern wie Italien oder Frankreich.
»Wir könnten dir einen Prinzen suchen«, sagte Lady Melanthe wie nebenbei, was Elayne einen solchen Schock versetzte, dass sie beinahe ihren Becher umgestoßen hätte. Ihre Patin musterte sie amüsiert, als wüsste sie ganz genau, dass sie Elaynes Gedanken erraten hatte.
Elayne stieß ein ersticktes Lachen aus und begann dann prompt wieder zu weinen. Das Gesicht im Leinen vergraben, schüttelte sie den Kopf. »Ich will keinen Prinzen«, jaulte sie, »ich will ihn wiederhaben!«
»Hmm!«, meinte Lady Melanthe gedehnt. »Ich denke, es wird höchste Zeit, dass du aus Savernake herauskommst und bei Hofe eingeführt wirst, Elena. Eine solch weltliche Umgebung wird dir äußerst gut tun.« Sie machte eine wegwerfende Bewegung in Richtung der mit Banner behängten Wälle draußen, als wäre Windsor Castle kaum mehr als eine schäbige Hütte. »Du wirst die Herzogin von Ludford begleiten. Vorhin erst hat sie mich angefleht, sie mit Empfehlungen für ihre Pilgerreise nach Rom zu versorgen. Sie wird über Brüssel und Prag reisen. Bis Rom wirst du wohl kaum mitfahren wollen, dort gibt es bis auf Schutt und Ruinen nicht viel zu sehen, aber du könntest Lady Beatrice in Prag, am kaiserlichen Hof, erwarten und dann in sechs bis acht Monaten mit weit mehr weltmännischem Schliff zurückkehren, als du jetzt hast. Es gibt keinen geeigneteren Ort, um deine Ausbildung zu verfeinern und dich in jeder nur möglichen Hinsicht weiterzubilden. Prag ist eine herrliche Stadt! Wie gut ist dein Latein?«
Elayne blinzelte wie vom Donner gerührt. »Es geht.«
»Nun, wir werden ein wenig üben, nur wir beide. Die Herzogin wird nicht vor Mittsommer aufbrechen – wir haben also den ganzen Frühling Zeit, um dich vorzubereiten. Ich werde sehen, dass du eine Audienz bei Königin Anne bekommst. Sie ist erst kürzlich aus Prag eingetroffen und scheint mir für ihr zartes Alter ungewöhnlich verständig und stilsicher zu sein.« Lady Melanthe schnitt eine Grimasse. »London muss ihr reichlich rückständig vorkommen, aber mit dem König scheint sie sich ja prächtig zu verstehen, und er selbst, Gott segne ihn, ist vollkommen vernarrt in sie.« Sie hielt inne, nachdenklich mit ihren langen Fingern trommelnd. »Wir werden morgen mal in meiner Garderobe nachsehen, ob wir nicht was Schönes für dich finden, das du bei Hofe tragen kannst.«
Elayne rührte sich nicht. Sie war fassungslos. Sie konnte nur verblüfft zusehen, mit welch beiläufiger Selbstverständlichkeit ihre Patin über ihre Zukunft entschied. Sie hörte kaum, wie sich der Türriegel hob, doch als gleich darauf ein großer, in schlichtes Schwarz gekleideter Ritter, der sich unter dem für ihn zu niedrigen Türsturz ducken musste, mit einem dunkelhaarigen Jungen auf dem Arm eintrat, erhob sie sich hastig und sank in einen tiefen Hofknicks. »Seid gegrüßt, Mylord!«
»Bitte erhebt Euch, Mylady«, bat Lord Ruadrik sogleich und streckte Elayne seine riesige Schwerthand hin. Den Jungen, der inzwischen ungeduldig zappelte, deponierte er kurzerhand auf dem Schoß von Lady Melanthe. Er besaß ein offenes, ehrliches Grinsen, auch war die Mundart des Nordens unverkennbar in seiner Rede. »Nehmt mir bloß diesen Kobold ab, verehrte Gattin, bevor er mich noch erschlägt!«
Der Junge rutschte jedoch sogleich vom Schoß seiner Mutter herunter, rannte zu seinem Vater zurück und klammerte sich an dessen Bein. Von dieser sicheren Warte aus starrte er Elayne an. Sie spreizte die Röcke und knickste vor dem Kind. »Höchst ehrenwerter Lord Richard, ich grüße Euch.«
Der Junge nickte, den ehrerbietigen Gruß wie selbstverständlich hinnehmend, dann verbarg er sein Gesicht am schwarzen Strumpf von Lord Ruadrik.
»Dies ist deine Base, die Lady Elena. Sie wohnt auf unserem Gut in Savernake«, erklärte Lord Ruadrik dem Kind. »Es wäre artig, wenn auch du sie ebenso herzlich begrüßen würdest.«
Der Junge warf einen verstohlenen Blick auf Elayne. Eine herzliche Begrüßung schien ihm nicht über die Lippen zu wollen, doch stieß er mit gesenktem Blick hervor: »Ihr seht aus wie meine Mama.«
»Und Ihr seid Eurem werten Papa wie aus dem Gesicht geschnitten«, erwiderte Elayne brav.
Der Junge lächelte scheu und klammerte sich an das muskulöse Bein seines Vaters. »Ihr habt Blumenaugen wie Mama.«
»Besten Dank, Sir. Und Ihr seht furchtbar stark aus wie Lord Ruadrik.«
»Best’ Dank, Lady«, sagte er ernst. Offenbar glaubte er, der Pflicht damit Genüge getan zu haben, denn er gab seiner Mutter noch rasch einen Gutenachtkuss und rannte dann, schnell wie der Wind, durch die gleiche Tür aus dem Zimmer, durch die er hereingekommen war.
Lady Melanthe wollte sich schon besorgt erheben, doch Lord Ruadrik schüttelte den Kopf. »Jane versteckt sich hinter der Tür – so war es abgemacht: wenn er mit hereinkommt, um seine Base Elayne zu begrüßen, dann würde ich ihm versprechen, einen Fluchtweg offen zu lassen.«
Elayne stellte beschämt fest, dass sie sich noch nicht einmal nach der Tochter und dem Sohn von Lady Melanthe erkundigt hatte, so sehr war sie mit ihrem eigenen Kummer beschäftigt gewesen. Den Kopf gesenkt, um ihr sicherlich ganz verweintes Gesicht zu verbergen, erkundigte sie sich nach der jungen Lady Celestine.
»Sie lernt gerade das Tanzen«, entgegnete Lady Melanthe. »Ich glaube kaum, dass wir sie vor Mariä Verkündigung noch einmal zu sehen bekommen. Mylord, was haltet Ihr von der Idee, Elena an den Kaiserhof nach Prag zu schicken?«
Lord Ruadrik musterte seine Gattin mit scharfem Blick und leicht gerunzelten Brauen. »Zu welchem Zweck?«
»Um ihren Horizont zu erweitern und ihre Weisheit zu vertiefen. Offenbar scheint jeder dahergelaufene Ritter zu glauben, sich ihr aufdrängen zu können, aber ich bin nicht der Meinung, dass eine Lady Elena di Monteverde die geeignete Gattin für einen Bauerntrampel wäre.«
»Kommt wohl zu sehr nach Euch, meine Liebe«, sagte Lord Ruadrik trocken.
»Du Schuft!«, lachte Lady Melanthe. »Du weißt, wie sehr ich Landpomeranzen liebe.«
Auch er musste lachen. »Was mir zum Verhängnis wurde! Nun, wenn es Euer Wunsch ist, dass Lady Elena lernt, wie man einfache Ritter vom Lande in die Knie zwingt, ebenso herzlos, wie Ihr dies gemacht habt, Madame, dann meinetwegen.«
Lady Melanthe lächelte. Mit einem frechen Funkeln in ihren großen, sinnlichen Augen blickte sie Elayne an. »Nun, was hältst du davon, meine Liebe?«
Elayne presste die Lippen zusammen. »Ach, Madam«, murmelte sie. »Ach, Madam!« Sie konnte sich nicht vorstellen, einmal auch nur annähernd die Eleganz und Haltung, das Selbstbewusstsein von Lady Melanthe zu besitzen. Einfachen Rittern wie Raymond Ehrfurcht einzujagen! Dafür würde sie alles tun, selbst eine Reise mit der Herzogin Beatrice auf sich nehmen. Sie sank auf die Knie und ergriff die Hand ihrer Patin. »Gott segne Euch, Madame, Ihr seid zu gütig.«
»Und wenn du wieder da bist, werden wir dir einen Ehemann suchen, der deine Überlegenheit zu schätzen weiß«, bestimmte Lady Melanthe.
»Der arme Bursche tut mir jetzt schon Leid«, bemerkte Lord Ruadrik.
Selbst nach zwei Wochen hatte sich Elayne noch nicht an den höfischen Kopfputz, die hohe Haube, gewöhnt. Sie besaß die Form eines mittelmäßig hohen Spitzhutes, der in zwei Hörnern auslief. Dennoch hatte sie das Gefühl, ihr müsse unter dem Gewicht des aufwändigen Gebildes schier das Genick brechen. Nun zahlten sich Caras ständige Mahnungen bezüglich einer aufrechten Haltung endlich aus – denn sobald Elayne vergaß, den Kopf gerade zu halten und sich mit langsamer Grazie zu bewegen, wie ihr das ihre Schwester eingetrichtert hatte, begann ihr Spitzhut zu schwanken wie ein Schiff im Sturm.