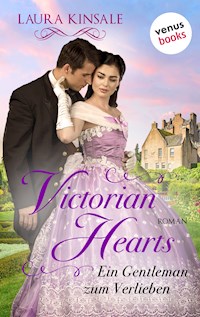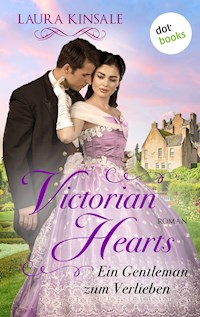
4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Victorian Hearts
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Hat ihre Liebe eine Chance? Der historische Liebesroman »Victorian Hearts – Ein Gentleman zum Verlieben« von Laura Kinsale als eBook bei dotbooks. London, 1887. Als die junge Leda in eine schier ausweglose Situation gerät, eilt ihr ein charmanter Gentleman zur Seite. Kein Wunder, dass sich die Verkäuferin Hals über Kopf verliebt! Doch der attraktive Samuel ist im Haus des Marquess of Ashford aufgewachsen – und steht damit leider gesellschaftlich mehr als nur eine Stufe über ihr. Noch dazu ist er bereits seit langem seiner vermögenden Kindheitsfreundin Catherine Ashford versprochen. Es scheint also undenkbar, dass sich ein Mann wie Samuel je in eine einfache Frau wie Leda verlieben könnte. Und doch hat sie das Gefühl, dass seine Blicke immer wieder länger auf ihr ruhen, als es die Etikette erlaubt … Muss sie wirklich ihre zarten Träume für immer aufgeben – oder kann ihre Hoffnung sich erfüllen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die viktorianische Romanze »Victorian Hearts – Ein Gentleman zum Verlieben« von Laura Kinsale. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 778
Ähnliche
Über dieses Buch:
London, 1887. Als die junge Leda in eine schier ausweglose Situation gerät, eilt ihr ein charmanter Gentleman zur Seite. Kein Wunder, dass sich die Verkäuferin Hals über Kopf verliebt! Doch der attraktive Samuel ist im Haus des Marquess of Ashford aufgewachsen – und steht damit leider gesellschaftlich mehr als nur eine Stufe über ihr. Noch dazu ist er bereits seit langem seiner vermögenden Kindheitsfreundin Catherine Ashford versprochen. Es scheint also undenkbar, dass sich ein Mann wie Samuel je in eine einfache Frau wie Leda verlieben könnte. Und doch hat sie das Gefühl, dass seine Blicke immer wieder länger auf ihr ruhen, als es die Etikette erlaubt … Muss sie wirklich ihre zarten Träume für immer aufgeben – oder kann ihre Hoffnung sich erfüllen?
Über die Autorin:
Nach ihrem Masterabschluss an der University of Texas war Laura Kinsale als Geologin tätig, bis sie begann, Romane zu schreiben. Ihre Bücher standen mehrfach auf der Auswahlliste für den besten amerikanischen Liebesroman des Jahres und stürmten immer wieder die Bestsellerlisten der New York Times. Die Autorin lebt mit ihrem Mann David abwechselnd in Santa Fé/New Mexico und Texas.
Bei dotbooks erscheinen von Laura Kinsale:
»Eine eigensinnige Lady«
»Victorian Hearts – Der Kuss des Marquess«
»Die Liebe des Dukes«
»In den Fängen des Piraten«
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2021
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1991 unter dem Originaltitel »The Shadow and the Star« bei HarperCollins, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Sterne der Nacht« bei Heyne.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1991 by Amanda Moor Jay
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © Period Images, © shutterstock / Checco2 / Martin Charles Hatch / PixieMe / SSY.11
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-676-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Ein Gentleman zum Verlieben« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Laura Kinsale
Victorian Hearts Ein Gentleman zum Verlieben
Roman
Aus dem Amerikanischen von Michaela Link
dotbooks.
Für Mutter, Papa, Cindy, Ubba, Großmutter, Großvater, Elva, Tootsie, Bud, Frances, Sue, Georgia, Tante, Christine …
Okage sama de: Was ich bin, bin ich durch eure Güte.
Kein anderes fernes Land der Welt übt jenen tiefen, starken Reiz auf mich aus, kein anderes Land hat mich so freundlich und dringlich verfolgt, im Schlafen und im Wachen, durch ein halbes Leben hindurch, wie es dieses getan hat. Andere haben mich im Stich gelassen, aber dieses Land blieb mir treu; andere Dinge ändern sich, aber dieses Land bleibt sich gleich. Für mich werden seine linden Lüfte ewig wehen, wird seine sommerliche See auf immer in der Sonne glänzen; das Dröhnen seiner Brandung klingt mir im Ohr; ich sehe seine blumenumkränzten Klippen, seine rauschenden Wasserfälle, seine grazilen Palmen am Strand und seine fernen Gipfel, die wie Inseln über einer Wolkenschicht treiben … Ich rieche noch den Duft der Blumen, der doch schon vor zwanzig Jahren verflogen ist.
Mark Twain
E lei kau, e lei ho’oilo i ke aloha: Liebe trägt man wie einen Blumenkranz, im Sommer und auch im Winter.
Der Schattenkrieger
1887
An jenem fernen Ort wo Dunkelheit und Stille herrschten, schüttelte er alles Denken ab. Er ließ das lärmende Treiben der Menschenwelt hinter sich; nur dem leisen Lufthauch in den Vorhängen gestattete er, seinen Geist zu berühren. Dann betrachtete er sein mattes Bild im Spiegel, bis sich das Gesicht, das ihm entgegenblickte, in einen Fremden verwandelte, Züge ohne Ausdruck in den silbernen Augen und dem unbewegten Mund …
Und dann war dieses Gesicht plötzlich nicht einmal mehr ein Fremder, nur noch eine starre Maske … und schließlich auch das nicht mehr, nichts Menschliches mehr, nur noch elementare Form. Ein Spektrum aus Dunkel und Licht, sichtbarer und unsichtbarer Substanz.
Jetzt, da die Wirklichkeit vor ihm lag, machte er sich daran, sie seinen eigenen Zwecken zu unterwerfen. Um den Goldton seines Haars zu verbergen, borgte er sich ein Utensil aus dem Kabuki-Theater, die schwarze Kapuze, die die kuroko trugen, wenn sie sich heimlich in den Gang der Handlung einschlichen, um sie zu verändern. Um sein Gesicht unsichtbar zu machen, hatte er Farbe oder Ruß schon seit langem als unzureichend verworfen: beides ließ sich nicht schnell genug entfernen und verstieß zu offen gegen das Gesetz, falls man ihn entlarvte. Statt dessen band er eine Maske aus tiefschwarzem Tuch vor das Gesicht und verbarg dahinter alles bis auf seine Augen. Aus ebenso weichem, eng anliegendem Stoff war der lose, mitternachtsgraue Umhang, den er mit einem Gürtel um die Taille zusammengebunden hatte. In seinen dunklen Gewändern trug er alles bei sich, was er brauchte, um eine Wand zu erklimmen oder tödlichem Stahl zu schleudern, um zu entkommen, zu verwunden – oder zu töten. Statt für Schuhe entschied er sich für die biegsamen tabi, um leisen Schrittes und doch fest verwurzelt mit der Erde sein Werk zu beginnen.
Erde … Wasser … Wind … Feuer … und die Leere. Er saß auf dem Fußboden, die Beine übereinandergeschlagen, und lauschte dem sanften Wind, dem Einhalt zu gebieten kein Mensch die Macht hatte. In den Knochen spürte er die allgewaltige Kraft der Erde unter sich. Mit dem Geist nahm er die Leere an. Völlig reglos verschmolz er mit der Nacht: vom Spiegel ungesehen, von der Brise ungehört.
Mit ineinander verschlungenen Fingern rief er die Macht herbei, mit deren Hilfe er die Welt, so wie sie bisher existierte, seinem Plan zufolge verändern wollte.
Er stand auf und verschwand.
Kapitel 1
London 1887
Mitten in der Nacht schreckte Leda plötzlich aus dem Schlaf hoch. Sie hatte von Kirschen geträumt. Ihr Körper vollzog den jähen Schritt vom Schlafen zum Wachen – ein unerfreulicher Schock, der ihre Lungen zum Bersten mit Luft füllte, ihre Muskeln zucken und ihr Herz hämmern ließ. Sie starrte in die Dunkelheit und versuchte, ihren Atem unter Kontrolle zu bringen – und den Unterschied zwischen Schlaf und Wirklichkeit zu begreifen.
Kirschen … und Pflaumen, nicht wahr? Fruchtpastete? Pudding? Ein Likörrezept? Nein … ah, nein … die Haube. Sie schloß die Augen. Ihre Gedanken umkreisten träumerisch die Frage, ob sie wohl Kirschen oder Pflaumen wählen sollte, um das hübsche, spitz zulaufende Olivia-Häubchen herauszuputzen. Gleich Ende der Woche, sobald Madame Elise sie für ihr Tagewerk entlohnt hatte, wollte sie es kaufen.
Instinktiv hatte sie das Gefühl, daß das Häubchen ein viel ungefährlicheres und erfreulicheres Thema war als das, mit dem sie sich im Augenblick eigentlich hätte beschäftigen müssen – nämlich ihr dunkles Zimmer, seine verschiedenen noch dunkleren Ecken und die Frage, was sie wohl aus ihrem tiefen und so dringend benötigten Schlaf gerissen hatte.
Es herrschte die fast vollkommene Stille der Nacht. Nur das Ticken ihrer Uhr war zu hören und die sanfte Brise, die durch das Fenster in ihre Dachstube hereinwehte. Ausnahmsweise war ihr Zimmer vom Duft der Themse erfüllt statt von den gewohnten Gerüchen nach Essig und Branntwein. Königinnenwetter nannten die Leute diesen Frühsommer. Leda spürte ihn wie eine sanfte Liebkosung auf ihrer Wange. Wegen der Feiern zum Jubiläum Ihrer Majestät herrschte auf den Straßen noch größere Betriebsamkeit als sonst. Ungeheure Menschenmengen waren unterwegs, und aus jedem Winkel von Gottes Erde strömten die exotischsten Fremden herbei; sie trugen Turbane und Juwelen und sahen so aus, als seien sie gerade erst von ihren Elefanten gestiegen.
Aber jetzt war die Nacht völlig still. Durch das offene Flügelfenster drang genügend Licht herein, so daß Leda die Umrisse ihrer Geranie sehen konnte und auf dem Tisch daneben das duftige Gebilde aus rosa-farbener Seide, mit dem sie erst um zwei Uhr morgens fertiggeworden war. Das Ballkleid sollte um acht geliefert werden, und vorher mußte man es noch raffen und rüschen und die Stickerei in der Schleppe fertigstellen. Leda selbst mußte bis halb sieben angekleidet sein und an Madame Elises Hintertür stehen. Sie sollte das Gewand in einen Weidenkorb packen und in die Werkstatt bringen, damit die Mädchen dort es anprobieren und auf Mängel untersuchen konnten. Erst dann würde der Laufbursche es an seinen Bestimmungsort bringen.
Sie versuchte, noch ein wenig kostbaren Schlaf zu ergattern. Aber ihr Körper lag stocksteif da, und ihr Herz raste. War das ein Geräusch? Sie war sich nicht sicher, ob sie wirklich etwas gehört hatte oder ob es nur der schwere Schlag ihres eigenen Herzens war. Sofort schlug ihr Herz um so schneller, und der Gedanke, daß noch jemand in dem kleinen Raum sein könne, wurde plötzlich übermächtig.
Das Gefühl des Entsetzens, das Leda angesichts dieser Möglichkeit empfand, hätte Miss Myrtle nur ein verächtliches Schnauben entlockt. Miss Myrtle war eine beherzte Natur gewesen. Miss Myrtle hätte stocksteif und nicht mit hämmerndem Herzen in ihrem Bett gelegen. Miss Myrtle wäre aufgesprungen und hätte nach dem Schürhaken gegriffen. Der hatte bei ihr immer direkt in Reichweite neben dem Kissen gelegen, denn Miss Myrtle hatte natürlich für einen Notfall wie einen unerwünschten Besucher, der sich des Nachts in ihr Zimmer schlich, vorausgeplant.
Leda jedoch war aus anderem Holz geschnitzt. In dieser Hinsicht war sie wohl eine Enttäuschung für Miss Myrtle gewesen. Zwar besaß sie einen Schürhaken, hatte aber vergessen, ihn griffbereit zurechtzulegen, bevor sie ins Bett ging. Sie war einfach zu müde gewesen – und außerdem eben die Tochter einer frivolen Französin.
Unbewaffnet, wie sie nun einmal war, blieb ihr keine andere Wahl, als sich an die Logik zu klammern und sich klarzumachen, daß sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit niemand außer ihr in ihrem Zimmer befand. Ganz bestimmt nicht sogar. Sie konnte den größten Teil des Raumes vom Bett aus übersehen, und der Schatten an der Wand war nichts Unheimlicheres als ihr Mantel und ihr Schirm. Die Sachen hingen an dem gleichen Haken, an den sie selbst sie vor einem Monat, nach dem letzten kühlen Maitag, gehängt hatte. Neben ihrer gemieteten Nähmaschine besaß sie noch einen Tisch und einen Stuhl sowie einen Waschständer mitsamt Schüssel und Krug. Die Umrisse der Schneiderpuppe neben dem Kaminsims jagten ihr einen flüchtigen Schrekken ein, aber als sie die Augen zusammenkniff und näher hinsah, konnte sie direkt durch das grobe Korbgeflecht des Torsos hindurchschauen und die quadratische Form des Kamingitters erkennen. All diese Dinge waren sogar im Dunkeln zu sehen; ihr Bett stand an der Wand ihrer kleinen Dachstube, so daß sie wirklich allein sein mußte, es sei denn, der Eindringling hinge wie eine Fledermaus vom Dachbalken.
Sie schloß die Augen.
Und öffnete sie wieder. Hatte dieser Schatten da drüben sich bewegt? War er nicht etwas zu lang für ihren Mantel, wie er da dicht überm Boden mit dem dunklen Holz zu verschmelzen schien? Hatte dieser finstere Fleck da nicht genau die Umrisse eines Männerfußes?
Unfug. Ihre Augen schmerzten vor Erschöpfung. Sie schloß sie wieder und holte tief Luft.
Dann riß sie die Augen wieder auf, starrte den Schatten ihres Mantels an, warf die Decke zurück, setzte sich hastig auf und rief: »Wer ist da?«
Nichts als tiefe Stille antwortete auf ihre Frage. Sie stand mit nackten Füßen auf dem kühlen, rauhen Holz und kam sich sehr töricht vor.
Mit einer kreisenden Bewegung ihrer Zehenspitzen suchte sie den dunklen Schatten unter ihrem Mantel ab. Dann machte sie vier Schritte zurück in Richtung Kamin und tastete nach dem Schürhaken. Mit diesem schweren Eisengerät in der Hand kam sie sich schon eher als Herrin der Lage vor. Sie ging auf ihren Mantel zu und stocherte mit dem Schürhaken in dem Stoff herum, bevor sie in jeder dunklen Ecke des Raumes – und schließlich sogar unterm Bett – damit herumfuhrwerkte.
Die Schatten waren absolut harmlos. Kein verborgener Eindringling. Überhaupt nichts außer Dunkelheit und Stille.
Ihre Muskeln erschlafften vor Erleichterung. Sie legte eine Hand auf die Brust, sprach ein kleines Dankgebet und prüfte noch einmal nach, ob die Tür verschlossen war, bevor sie ins Bett zurückkehrte. Von dem offenen Fenster drohte ihr keine Gefahr, denn darunter lag der schlammige Kanal, so daß man es nur über das steile Dach erreichen konnte. Trotzdem legte sie den Schürhaken dicht neben sich auf den Fußboden.
Nachdem sie sich die schon so oft geflickte Decke bis zur Nase hochgezogen hatte, versank sie wieder in einen erfreulichen Traum, in dem ein ausgestopfter Fink eine wesentliche Rolle spielte; so hübsch und elegant war das kleine Tierchen, daß es als schmucker Putz für ein Olivia-Häubchen beinahe geeigneter schien als Pflaumen und Kirschen.
Das Jubiläum trieb Hinz und Kunz in aller Herrgottsfrühe aus den Federn. Es war gerade erst hell geworden, als Leda die Hintertreppe in der Regent Street hinauftrottete, doch die Mädchen aus der Werkstatt saßen bereits alle unter den Gaslampen über ihre Nadelarbeit gebeugt. Die meisten von ihnen sahen aus, als hätten sie die ganze Nacht dort zugebracht – was wahrscheinlich auch der Fall war. Jedes Jahr um diese Zeit herrschte Hochbetrieb, das brachte die ›Saison‹ so mit sich, aber in diesem Jahr war es noch schlimmer als sonst: All die hübschen Mädchen und eleganten Matronen versanken in einer Flut von Theatervorstellungen und Einladungen zu Bällen, Partys und Picknicks anläßlich des Jubiläums. Leda blinzelte mit müden Augen, als sie und die erste Näherin die üppige Woge rosafarbenen Stoffs aus dem Korb zogen. Sie war erschöpft – alle waren sie erschöpft –, aber die Aufregung und die freudige Erwartung rissen sie mit sich. Oh, so etwas tragen zu dürfen, ein so wunderschönes Kleid! Noch einmal schloß sie die Augen und trat einen Schritt von dem Ballkleid zurück, ein wenig schwindlig vor Hunger und Erregung.
»Geh und hol dir ein Brötchen«, meinte die erste Näherin. »Ich möchte wetten, du hast dieses Kleid allerfrühestens um zwei Uhr morgens fertigbekommen, hm? Laß dir auch Tee geben, wenn du möchtest, aber mach schnell. Wir haben einen frühen Termin. Für Punkt acht hat sich eine ausländische Delegation angesagt – du sollst die bunten Seidenstoffe bereithalten.«
»Ausländer?«
»Ostasiaten, glaube ich. Mit schwarzem Haar. Also denke dran, daß du auf keinen Fall die Blässe ihres Teints betonen darfst.«
Leda eilte ins Nebenzimmer, spülte ihr Brötchen schnell mit einer süßen Tasse Tee hinunter und lief dann hinauf ins nächste Stockwerk. Die dort beschäftigten Arbeiterinnen bedachte sie nur mit einem hastigen Grußwort, dann war sie schon an ihnen vorbeigehuscht. Im dritten Stock schlüpfte sie in ein kleines Zimmer, streifte ihren schlichten marineblauen Rock und ihre Baumwollbluse ab, wusch sich mit dem lauwarmen Wasser aus einem Zinneimer und einer Porzellanschale und lief schließlich, nur mit Mieder und Unterhose bekleidet, durch den Flur.
Eins der Lehrlingsmädchen kam ihr auf halbem Weg entgegen. »Sie haben sich für die maßgeschneiderten Kleider entschieden«, sagte das Mädchen. »Die schottisch karierte Seide – weil Ihre Majestät Balmoral doch so sehr mag.«
Leda stieß einen leisen Seufzer des Verdrusses aus. »Oh! Aber ich …« Sie konnte gerade noch rechtzeitig verhindern, daß ihr ein überaus vulgäres Geständnis entschlüpfte: Sie konnte sich das neue Kleid nämlich unmöglich leisten. Aber da die Mädchen im Verkaufsraum es während der Dauer des Jubiläums als eine Art Uniform tragen sollten, würde ihr nichts anderes übrigbleiben, als sich die Kosten von ihrem Lohn abziehen zu lassen.
Jetzt, da Miss Myrtle nicht mehr da war, hatte sich alles für sie geändert. Aber Leda wollte ihren Tod nicht länger beweinen. Nein, wirklich nicht, sie würde keine Träne mehr vergießen, wie demütigend ihre Situation auch sein mochte. Es lag nur daran, daß sie so wenig und so schlecht geschlafen hatte und so spät und übelgelaunt aufgewacht war. Sie hätte eher schreien als weinen mögen bei dem Gedanken, was geschehen war. Miss Myrtle hatte so sorgfältige Vorkehrungen für ihre, Ledas Zukunft getroffen und ein korrektes Testament hinterlassen. Demnach war ihr kleines Haus in Mayfair, in dem Leda aufgewachsen war, an einen Neffen gefallen, einen Witwer von bald achtzig Jahren. Miss Myrtle hatte zur Bedingung gemacht, daß Leda bei ihm bleiben und das Haus für ihn verwalten dürfe. Und wenn sie es so wünschte, sollte sie auch ihr eigenes Schlafzimmer behalten, ein Angebot, das Leda mit Freuden angenommen hatte.
Der Witwer war mit allem einverstanden gewesen und hatte im Büro des Anwalts sogar gesagt, daß es ihm eine Ehre sein werde, sich von »Miss Myrtles junger Dame« das Haus führen zu lassen. Und gerade als alles zu ihrer beidseitigen Zufriedenheit geklärt war, hatte er das schreckliche Pech, einem Omnibus in den Weg zu laufen, und das, ohne ein Testament oder einen Erben oder auch nur eine ausdrückliche Meinung zu diesem Thema hinterlassen zu haben.
Das war mal wieder typisch Mann! Alles in allem ein ziemlich törichtes Geschlecht.
Das Haus in Mayfair war an eine entfernte Cousine Miss Myrtles gefallen, die nicht die leiseste Absicht hatte, selbst dort zu wohnen. Oder Leda den neuen Mietern zuzumuten. Leda war zu jung, um eine akzeptable Haushälterin abzugeben; so etwas kam einfach nicht in Frage. Nein, auch nicht unter dem Gesichtspunkt, daß Cousine Myrtle, eine Balfour immerhin, Leda tatsächlich in der South Street großgezogen hatte. Was eine ganz dumme Idee gewesen war. Ein Mädchen aus der Gosse zu holen und sie über ihren natürlichen Platz zu erheben! Darüber mußte die Erbin sich doch sehr wundern. Aber andererseits hatte sich Cousine Myrtle schon immer etwas seltsam benommen, – das wußte jeder in der Familie –, auch wenn sie einmal mit einem Viscount verlobt gewesen war. Statt ihn jedoch zu heiraten, war sie mit jenem unsäglichen Mann auf und davon gegangen und hatte sich absolut unmöglich gemacht. Und was hatte ihr das alles eingetragen? Nicht einmal einen Ehering!
Auch sah die Cousine sich völlig außerstande, Leda in irgendeiner anderen Eigenschaft bei sich zu behalten, ganz gleich, wie viel einfache oder schwierige Näharbeit zu bewältigen war. Natürlich ließ sich auch nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, Leda ein Zeugnis auszustellen, damit das junge Mädchen sich in einer Schreibstube bewerben konnte. Es tat der Cousine sehr leid, ja wirklich, sehr leid, aber schließlich wußte sie nichts über Miss Leda Etoile, außer daß ihre Mutter Französin gewesen war; und welchen Nutzen sollte es haben, so etwas in einem Empfehlungsschreiben zu erwähnen?
Und tatsächlich schien es, wie Leda bald herausfinden sollte, als gäbe es für eine junge Dame von eleganten Manieren und zweifelhafter französischer Herkunft nur zwei Arten von Häusern, in denen sie willkommen war – wobei der Verkaufsraum einer modischen Kostümschneiderin die einzige Alternative war, die in Frage kam.
Leda holte tief Luft. »Nun, in den Karokleidern werden wir sicher schottischer aussehen als jede Schottin es sich wünschen könnte, hm?« sagte sie zu dem Lehrlingsmädchen. »Ist meiner schon fertig?«
Das Mädchen nickte. »Ich muß nur noch den Saum heften. Sie haben einen Termin für acht Uhr. Ausländer.«
»Ostasiaten«, murmelte Leda geistesabwesend und folgte dem weißbeschürzten Mädchen in einen Raum, in dem Unmengen Stoffetzchen in allen Farben und Mustern den Teppich und einen langen Tisch übersäten. Während Leda ihr Korsett strammzog und die Drahtreifen der Turnüre hinter ihren Hüften richtete, schüttelte das Mädchen eine üppige Fülle blaugrünkarierten Stoffes aus. Leda hob die Arme und ließ sich das Kleid über den Kopf fallen.
»Ostasiaten, wie?« nuschelte das Mädchen durch die Stecknadeln in ihrem Mund. Eine nach der anderen zog sie die Nadeln heraus und steckte sie geschickt in den Saum. »Die, die im Langham Hotel den Hühnern den Hals umgedreht haben?«
»Ganz gewiß nicht«, entgegnete Leda. »Ich glaube, es war ein Sultan, der – nun – den unglücklichen Zwischenfall mit dem Geflügel heraufbeschworen hat.« Das Umdrehen von Hühnerhälsen war kein geziemender Gesprächsgegenstand für eine Dame. Gewissenhaft ging sie daran, den Horizont des Mädchens zu erweitern. »Die Ostasiaten sind aus Japan. Oder Nippon, wie es richtiger genannt wird.«
»Und wo soll das liegen«
Leda runzelte die Stirn, denn sie war selbst in Geographie nicht besonders bewandert. Miss Myrtle war eine begeisterte Befürworterin weiblicher Erziehung gewesen, aber in Ermangelung der notwendigen Ausrüstung – eines Globusses zum Beispiel – hatten einige ihrer Lektionen nur einen ziemlich vagen Eindruck hinterlassen.
»Das läßt sich schwer beschreiben«, meinte sie ausweichend. »Ich müßte es dir auf einer Landkarte zeigen.«
Die Nadel des Mädchens glitt durch die Seide. Leda zog die Nase kraus, als sie das Spiegelbild des Karokleides in dem gesprungenen Scherben sah. Sie hatte nicht viel übrig für diese kräftigen Muster und erst recht nicht für die steife Seide, die sich hartnäckig weigerte, in anmutigem Fall über die Turnüre zu fließen. »Sie nur, wie es hinten vorsteht.« Deprimiert zupfte sie an dem üppigen Stoff hinter ihren Hüften. »Ich habe verdächtige Ähnlichkeit mit einer schottischen Henne.«
»Ach, so schlimm ist es nicht, Miss Etoile. Das Grün paßt wunderhübsch zu ihren Augen. Bringt die Farbe zur Geltung. Da drüben auf dem Tisch liegt übrigens die Kokarde, die Sie im Haar tragen sollen.«
Leda griff nach dem Schmuckstück und schob es in immer neuen Winkeln in das dunkle Mahagoni ihres Haars, bevor sie endlich mit der Wirkung zufrieden war. Das dunkelgrüne Karo der Kokarde ging im tiefen Braun ihres Haars beinahe unter, so daß Leda sie schließlich in einem Anflug kecker Verwegenheit dicht hinter die rechte Schläfe steckte. Miss Myrtle hätte nur einen Blick auf sie geworfen und bemerkt, das Ganze sei eine Spur zu kokett, um vornehm zu sein. Daraufhin hätte sie dann die Gelegenheit genutzt, um zu erwähnen, daß sie einst eine Verlobung mit einem Viscount gelöst habe – eine überaus unkluge Tat, wie sie heute zugeben mußte. Aber Mädchen von siebzehn Jahren neigten nun mal mit schöner Regelmäßigkeit dazu, sich töricht zu benehmen (an dieser Stelle folgte stets ein vielsagender Blick auf Leda, ganz gleich, ob diese nun zufällig gerade zwölf oder zwanzig Jahre alt war). Miss Myrtle selbst neigte, was ihr Äußeres betraf, zu vornehmer Untertreibung. Daß diese kultivierte Noblesse unter anderem etwas mit dem Fehlen finanzieller Mittel zum Erwerb vulgärer, exzessiver Accessoires und modischer Frivolitäten zu tun hatte – das war eine Tatsache, die man in Miss Myrtles Freundeskreis freundlicherweise zu übersehen pflegte; zumeist handelte es sich dabei nämlich um vornehm erzogene Damen, die sich in ähnlichen Umständen befanden und ihr in diesem Punkt vollkommen recht gaben.
Aber Miss Myrtle weilte jetzt nicht mehr unter ihnen. Und wie sehr Leda ihr Andenken auch ehren mochte, so war doch die von ihr propagierte Schlichtheit nicht das Rechte für eine junge Frau, die im Vorführsaal von Madame Elise arbeitete, der Königlichen Hofschneiderin Ihrer Hoheit, der Prinzessin von Wales. Also mußte es wohl das maßgeschneiderte Karokleid sein, und das Geld für elegante, geschmackvolle Olivia-Häubchen, von denen Leda geträumt hatte (Konfektionsware, die ein ausgestopfter Fink zu edler Schlichtheit emporheben sollte), würde zweifellos von den Kosten für das goldene Medaillon der Kokarde verschlungen werden.
Mrs. Isaacson, die derzeitige Autorität hinter dem Pseudonym der längst verblichenen Madame Elise, kam mit schnellen Schritten in den Zuschneideraum. Sie überreichte Leda einige Karten, musterte sie wortlos von oben bis unten und nickte kurz. »Sehr hübsch. Besonders der Haarschmuck – genau an der richtigen Stelle. Seien Sie so gut und helfen Sie bitte Miss Clark, den ihren genauso fesch ins Haar zu stecken. Das Mädchen läßt sich zu sehr hängen.« Sie tippte mit einem Finger auf die Karten. »Die Ausländerinnen werden in Begleitung einiger englischer Damen kommen. Ich glaube, daß Lady Ashland und ihre Tochter ebenfalls dunkelhaarig sind. Tageslicht und Kerzenlicht, eine komplette Ausstattung. Konzentrieren Sie sich auf die Farben der Juwelen und vielleicht noch auf Rosa – keine Spur Gelb in irgendwelchen Kleidern, das wissen Sie ja –, obwohl Elfenbein möglicherweise ebenfalls ginge; wir werden sehen. Es ist eine ziemlich große Gesellschaft – sechs oder sieben Damen gleichzeitig. Wenn ich recht verstanden habe, möchten sie alle gemeinsam beraten werden. Halten Sie sich bitte bereit für den Fall, daß ich Sie brauche.«
»Natürlich, Ma’am«, sagte Leda. Sie zögerte und zwang sich, hinzuzufügen: »Ma’am – dürfte ich Sie vielleicht einen Moment unter vier Augen sprechen?«
Mrs. Isaacson sah sie argwöhnisch an. »Das ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt für lange Gespräche. Geht es um das neue Kleid für den Vorführsaal?«
»Sie wissen ja, daß ich nicht im Hause wohne. Im Augenblick – ist es …« O wie schrecklich, gezwungen zu sein, so etwas auszusprechen. »Ich befinde mich zur Zeit in einer schwierigen Situation, Ma’am.«
»Die Kosten können natürlich von Ihrem Lohn abgezogen werden. In Ihrem Vertrag haben wir uns auf einen Betrag von sechs Schilling die Woche geeinigt.«
Leda hielt den Blick gesenkt. »Von dem, was davon übrig bleibt, kann ich nicht leben, Ma’am.«
Mrs. Isaacson schwieg einen Augenblick. »Sie haben sich verpflichtet, sich entsprechend ihrer Position zu kleiden. Ich kann keine Abänderung des Kontrakts gestatten, das müssen Sie verstehen. Man hat Ihnen die Bedingungen genau erklärt, als Sie zu uns kamen. Ich würde einen Präzedenzfall schaffen, den ich mir nicht erlauben kann.«
»Sicher, Ma’am«, sagte Leda verzagt.
Ein weiterer Augenblick des Schweigens verstrich, eine Zeitspanne, die trotz ihrer Kürze kaum erträglich war. »Ich werde sehen, was sich machen läßt«, sagte Mrs. Isaacson schließlich.
Eine Woge der Erleichterung durchflutete Leda.
»Vielen Dank, Ma’am. Vielen Dank.« Sie deutete einen Knicks an, und Mrs. Isaacson hob ihren Rock und wandte sich zum Gehen.
Leda warf einen Blick auf die Karten. In diesem Jahr der exotischen Besucher hatte es sich das Außenministerium zur Gewohnheit gemacht, kurze Noten zu verschicken, um den Leuten in Fragen der Etikette behilflich zu sein. Unter dem Datum standen die verschiedenen Termine aufgelistet.
Die japanische Gruppe – acht Uhr morgens.
Ihre Königliche Hoheit, die kaiserliche Prinzessin Terute-No-Miya aus Japan. Anzureden mit Eure Durchlaucht. Spricht kein Englisch.
Die kaiserliche Gemahlin Okubo Otsu aus Japan. Anzureden mit Eure Durchlaucht. Spricht kein Englisch.
Lady Inouye aus Japan. Als Tochter und Repräsentantin des Grafen Inouye, des japanischen Außenministers, nach diplomatischer Gepflogenheit mit Euer Exzellenz zu titulieren. Spricht fließend Englisch, wurde in England erzogen, wird ohne Schwierigkeiten dolmetschen.
Hawaiianische Gruppe (Sandwich-Inseln) – zehn Uhr morgens.
Ihre Majestät Königin Kapiolani der Hawaii-Inseln. Anzureden mit Euer Majestät. Spricht sehr wenig Englisch, wird einen Dolmetscher brauchen.
Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Liliyewokalani, Kronprinzessin der Hawaii-Inseln. Anzusprechen mit Euer Hoheit. Spricht fließend Englisch, kann ohne Schwierigkeiten dolmetschen.
Lady Ashland, Marquise von Ashland, und ihre Tochter, Lady Catherine. Zur Zeit wohnhaft auf den Hawaii-Inseln. Beide Vertraute der hawaiianischen Königin und deren Tochter.
Leda ging sämtliche Informationen noch einmal durch und versuchte sich die Titel einzuprägen, während das Lehrlingsmädchen die Saumnaht beendete. Jetzt war Leda ganz in ihrem Element. Miss Myrtle Balfour hatte ihre Mission, Leda in Sachen Etikette eine ordentliche Erziehung zukommen zu lassen, sehr ernst genommen. Sie wollte es ihrem Schützling ermöglichen, sich in der feinen Gesellschaft zu bewegen, ohne Anstoß zu erregen. Und wahrhaftig, die Witwen und alten Jungfern in der South Street hatten Leda stets überaus höflich empfangen. Die Aura der prickelnd Skandalösen, die Miss Myrtle noch aus den Tagen jenes unsäglichen Mannes anhaftete, öffnete ihr noch immer allerlei Türen, auch wenn sie mittlerweile über vierzig Jahre still und zurückgezogen im Haus ihrer Eltern gelebt hatte. Einer Balfour mußte man eine gewissen Exzentrizität nachsehen, ja, man mußte sie sogar dazu ermutigen, denn ihre Waghalsigkeiten verliehen der prüden kleinen Gesellschaft in der South Street einen Hauch von Abenteuer. Daher hatten die Damen der South Street die Nackenhaare aufgestellt und jedem einen ziemlich direkten Dämpfer verpaßt, der es wagte, Miss Myrtles Verstand in Frage zu stellen, als diese die kleine Tochter einer Französin bei sich aufnahm. Später hatten sie Leda dann mit offenen Armen willkommen geheißen. So kam es, daß sie inmitten der verblichenen Blumen der Mayfair-Aristokratie zur Frau herangewachsen war und die älteren Töchter von Earls und die betagten Schwestern von Baronets zu ihren Freundinnen zählte.
Aber all diese zu erwartenden Majestäten und Hoheiten waren doch ein wenig imposanter als das, was sie gewöhnt war, und sie war deshalb dem Außenministerium wirklich dankbar für seine Belehrungen; so würde es bestimmt keine peinlichen Entgleisungen geben. Das Ganze mußte glatt über die Bühne gehen, genauso wie bei der Maharani, den siamesischen Damen und dem weiblichen Mandarin, mit denen sie es letzte Woche zu tun gehabt hatten.
Als ihr Saum fertig war, machte Leda sich an die Auswahl der Stoffe. Sie trug Ballen um Ballen schwerer Brokate, Samtstoffe und duftige Seide in den Vorführsaal, wo die hohen, verspiegelten Wandvertäfelungen das üppige Muster des violett- und bernsteinfarbenen Teppichs widerspiegelten. Andere Frauen, die im Vorführsaal arbeiteten, taten es ihr gleich. Sie bereiteten sich auf den Ansturm der Stammkundinnen vor, von denen die meisten sich jedoch für eine viel spätere und zivilisiertere Stunde angekündigt hatten. Leda war gerade dabei, den letzten Ballen gestreifter Seide auf den Stapel zu legen, als der Lakai die Hoheiten aus Japan hereinführte.
Mrs. Isaacson alias Madame Elise eilte herbei, um vor den vier zierlichen ostasiatischen Damen zu knicksen, die wie verschreckte Rehe an der Tür stehengeblieben waren. Alle vier starrten auf ihre nach westlicher Mode gefertigten Schuhe hinab und preßten die Hände flach auf ihre Röcke. Die Scheitel ihrer tiefschwarzen Haare waren schnurgerade und blitzten so weiß wie ihre porzellanklaren Gesichter. Madame Elise hieß sie mit ihrem schönsten französischen Akzent und großer Förmlichkeit willkommen und bat sie, ihr doch bitte zu folgen.
Sie trat zurück. Nach drei Schritten war klar, daß keine der hochwohlgeborenen Japanerinnen ihr folgen würde. Sie standen nur schweigend da und starrten zu Boden.
Madame Elise sah den Lakaien verstohlen an und formte mit den Lippen die Frage: Lady Inouye? Der Lakai zuckte beinahe unmerklich mit den Schultern. Madame mußte sich der fürchterlichen Peinlichkeit unterziehen, laut und in eindeutig akzentfreiem Englisch zu fragen: »Lady Inouye – dürfte ich um die überaus große Ehre bitten, Euer Exzellenz kennenzulernen?«
Niemand sagte etwas. Eine der beiden Japanerinnen, die halb verborgen hinter den anderen standen, zeigte mit einer winzigen Handbewegung auf die Gestalt direkt vor ihr. Madame Elise machte einen Schritt auf bewußte Dame zu. »Euer Exzellenz …?«
Die junge Japanerin hob ihre Finger an die Lippen, lächelte hinter vorgehaltener Hand und ließ dann ein scheues Kichern hören. Mit einer hübschen, mädchenhaften Stimme, die kaum mehr war als ein Wispern, sagte sie irgend etwas Unverständliches, das verdächtig danach klang, als versuche sie, mit einem Mund voller Wasser zu singen. Dann verbeugte sie sich leicht, zeigte auf die Tür, durch die sie gekommen waren, und verbeugte sich abermals.
»Ach herrje!« sagte Madame Elise. »Ich dachte, Ihre Exzellenz spricht Englisch.«
Das Mädchen zeigte abermals mit der Hand auf die Tür. Dann legte sie eine Hand an die Kehle, krümmte sich und hustete theatralisch. Und deutete ein drittes Mal auf die Tür.
Zweifelndes Schweigen erfüllte den Raum.
»Madame Elise?« meldete Leda sich zu Wort. »Ist es möglich, daß Lady Inouye nicht mitgekommen ist?«
»Nicht mitgekommen?« Ein Anflug von Panik lag in Madame Elises Stimme.
Leda machte einen Schritt nach vorn. »Ihre … Ex-zel-lenz ist krank?« fragte sie langsam und deutlich. Dann griff sie sich an die Kehle, hustete, wie es das andere Mädchen getan hatte, und zeigte ebenfalls auf die Tür.
Die vier Japanerinnen verbeugten sich. Zwei von ihnen neigten dabei nur huldvoll den Kopf, während die beiden anderen den ganzen Oberkörper senkten.
»Ach du liebe Güte«, sagte Madame Elise.
Ein weiterer Augenblick des Schweigens verstrich.
»Mademoiselle Etoile«, flüsterte Madame Elise plötzlich Leda zu, »Sie dürfen diese Kundinnen übernehmen.« Dann faßte sie Leda am Ellbogen und schob sie nach vorn. Sie präsentierte sie den ausländischen Damen wie ein Geschenk und brachte sich dann selbst mit einem Knicks in Sicherheit.
Leda holte tief Luft. Sie hatte keine Ahnung, wer die Prinzessin und die Kaiserliche Gemahlin waren, aber sie vermutete stark, daß es sich um die beiden Damen handeln mußte, die vorhin nur kurz den Kopf geneigt hatten, statt sich zu verbeugen. Mit einer einladenden Geste versuchte sie, die kleine Gruppe zu den Stühlen zu lotsen, die man vor die größte der Theken gestellt hatte.
Wie eine folgsame kleine Gänseschar trippelten die Japanerinnen mit winzigen Schritten zu den Stühlen. Zwei von ihnen setzten sich, während die beiden anderen sich mit gesenktem Blick und großer Anmut auf die Knie sinken ließen.
Das bedeutete also, daß die beiden Damen auf den Stühlen Mitglieder der Königsfamilie sein mußten und die anderen irgendwelche Dienerinnen. Leda nahm einen Modekatalog von der Theke. Da sie nicht wußte, welche der Damen den Vorrang hatte, die Prinzessin oder die Kaiserliche Gemahlin, bot sie ihn derjenigen an, die die ältere der beiden zu sein schien.
Die Dame lehnte mit einer abwehrenden Geste ab und legte sich die Hand wie einen Fächer vors Gesicht. Leda entschuldigte sich mit einem tiefen Knicks bei der anderen und hielt dieser den Katalog hin.
Auch die war jedoch nicht geneigt, den Katalog mit den Zeichnungen entgegenzunehmen. Leda sah voller Verzweiflung die beiden Frauen auf dem Fußboden an. Es war doch nicht möglich, daß … die niedrigere Position in ihrem Land den Vorrang hatte? Sie sah jedoch keine andere Möglichkeit: also hielt sie den Katalog einer der beiden am Boden knienden Damen hin.
Es war die junge Frau, die ihnen zuvor mit einer Pantomime Lady Inouyes Indisponiertheit bedeutet hatte. Aber auch sie hob nur abwehrend die Hand. Dann drehte sie sich um und sprach leise mit der jüngeren der beiden Damen auf den Stühlen. Die flüsterte ihr nun ihrerseits etwas ins Ohr. Leda stand hilflos daneben, während die vier Asiatinnen miteinander tuschelten. Das kniende Mädchen drehte sich schließlich wieder zu ihr um, berührte mit der Stirn den Fußboden und sagte dann: »San-weesh.«
Leda biß sich auf die Lippen, gewann ihre Fassung jedoch schnell wieder. »San-weesh«, wiederholte sie. »Mode?« fragte sie und hielt ihnen das Buch abermals hin.
Es traf auf einhellige Ablehnung. Leda knickste verzweifelt, trat hinter die Theke, wählte zwei Ballen Samt und rollte sie auf. Vielleicht wollte sie mit den Stoffen beginnen?
Auch dieser Versuch war ein Fehlschlag. Die Japanerinnen starrten die Samtstoffe an, ohne auch nur den Versuch zu machen, sie zu berühren. Statt dessen begannen sie wieder miteinander zu tuscheln.
»San-weesh«, sagte die kniende Dienerin noch einmal. »San-weesh aye-ran.«
»Es tut mir so leid«, erwiderte Leda hilflos. »Ich verstehe nicht.« Sie versuchte es mit einem limonengrünen Seidenstoff. Vielleicht stand ihnen der Sinn ja nach einem leichteren Gewebe.
»San-weesh aye-ran« kam die leise, nachdrückliche Antwort. »San-weesh aye-ran.«
»Oooh!« Leda ging ein Licht auf. »Sie meinen die Sandwich-Inseln?«
Das kniende Mädchen klatschte in die Hände und verbeugte sich. »San-weesh!« wiederholte sie strahlend. Die vier Japanerinnen kicherten. Die ältere Frau hatte geschwärzte Zähne, so daß ihr Mund wie eine leere Höhle erschien, wann immer sie ihn öffnete – eine sehr seltsame und ein wenig beunruhigende Wirkung.
»Sie wollen auf Ihre Majestät von den Sandwich-Inseln warten?« fragte Leda.
Die Dienerin antwortete mit einem japanischen Wortschwall. Leda knickste und trat unsicher beiseite. Die Damen falteten ihre kleinen, bleichen Hände auf den Schößen und senkten die Augen.
Zwei geschlagene Stunden bis zum Zehn-Uhr-Termin der Königin der Sandwich-Inseln harrten sie in dieser Position aus. Leda stand wie eine sittsame Wächterin neben der kleinen Gruppe, während die Frauen selbst nur geduldig dasaßen und weder nach links noch nach rechts schauten, sondern nur gelegentlich miteinander tuschelten. Die einzige Atempause, die ihnen während dieser qualvollen Prozedur vergönnt war, verdankten sie einem Geistesblitz von Madame Elise, die ein Tablett mit Tee und Savoykuchen hineinschicken ließ. Die Damen machten sich mit wohlerzogener Begeisterung und neuerlichem Gekicher über Tee und Gebäck her. Sie wirkten wie lächelnde Puppen, klein und scheu.
In dem großen Vorführsaal war es so still, daß jeder die Kutsche hören könnte, die endlich draußen vorfuhr. Dann die englischen Stimmen im Flur; Leda war so erleichtert, daß sie ihren schmerzenden Rücken vergaß und in einen tiefen Knicks versank. »Die Sandwich-Inseln«, sagte sie hoffnungsvoll und zeigte auf die Fenster.
Die vier Japanerinnen blickten auf, lächelten und verbeugten sich, jede auf ihre Weise.
Einige Augenblicke später stand die hawaiianische Gesellschaft an der Tür. Eine überaus würdevolle Frau trat langsam als erste ein. Sie trug ein exzellent geschnittenes Morgenkleid aus purpurner Seide, das von ihrem üppigen Busen wunderbar ausgefüllt wurde. Hinter ihr erschien eine ebenso große und anmutige Dame, ein wenig jünger und hübscher als die erste, mit braunem Haar, breiten Wangenknochen und königlicher Haltung.
Madame Elise erschien sofort und machte einen tiefen Knicks. Die jüngere der beiden eindrucksvollen Kundinnen sagte: »Guten Morgen« – in einem angenehmen, absolut verständlichen Englisch. Dann deutete sie mit dem Kopf auf die Frau in dem purpurnen Seidengewand. »Das ist meine Schwester, Ihre Majestät Kapiolani.«
Mit einem hörbaren Seufzer der Erleichterung verfiel Madame Elise augenblicklich wieder in ihren französischen Tonfall. »Das bescheidene ’aus von Madame Elise fühlt sisch geehrt von der Anwesen’eit Eurer Majestät«, gurrte sie und geleitete die Damen in den Raum.
Hinter den Hoheiten war der Rest der Gruppe in der Tür stehengeblieben. Leda blickte auf. Für den Bruchteil einer Sekunde vergaß sie ihre guten Manieren und starrte die beiden Damen dort mit unverhohlener Bewunderung an.
Vor ihr standen die beiden schönsten Frauen, die Leda jemals gesehen hatte. Mutter und Tochter – denn das waren sie wohl – besaßen dieselben hohen Wangenknochen, dieselbe makellose Haut, dasselbe glänzend schwarze Haar und die wunderbarsten Augen, die man sich denken konnte. Sie boten einen atemberaubenden Anblick. Beide waren schlicht gekleidet: Lady Ashland trug ein bescheidenes dunkelblaues Gewand über einem nichtssagenden Tageskleid. Die Tochter – nach dem Schreiben des Außenministeriums mußte es sich um Lady Catherine handeln – zeigte das helle Rosa der Debütantinnen, und ihre Halbkrinoline war, wie es der Mode entsprach, ein wenig weiter ausgestellt als das Kleid darunter.
Madame Elise war indes immer noch mit der Frage beschäftigt, wie sie ein Gespräch zwischen der Königin der Sandwich-Inseln und den japanischen Damen in Gang bringen konnte, daher übernahm Leda die Aufgabe, Lady Ashland und ihre Tochter willkommen zu heißen.
Lady Ashland lächelte ihr freundlich zu; winzige Fältchen, von denen ihre Tochter bisher verschont geblieben war, entstanden dabei um die Augen. »Sie haben sicher viel zu tun«, meinte sie zuvorkommend. »Wir werden Sie nicht lange aufhalten – die Königin hätte gern ein Morgenkleid von Madame Elise persönlich. Sie hat uns gebeten, Ihnen zu sagen, daß es jedoch keine Eile hat.«
Leda verspürte sofort den Wunsch, jegliche Aufträge einer Freundin dieser angenehmen Dame vor allen anderen zu erledigen. »Es ist uns eine Ehre und ein Vergnügen, Ihrer Majestät zu dienen, Mylady. Und wir freuen uns sehr, Ihrer Ladyschaft auf jede erdenkliche Weise helfen zu können. Sie machen uns keinerlei Umstände.«
Lady Ashland lachte und zuckte die Schultern. »Nun, ich bin kein Modepüppchen, aber vielleicht …« Sie warf ihrer Tochter einen fragenden Blick zu. Leda bemerkte einige vereinzelte Silbersträhnen in ihrem rabenschwarzen Haar. »Möchtest du nicht irgend etwas haben, Kai?«
»Arme, dumme Mama«, entgegnete Catherine lebhaft und mit einem deutlichen amerikanischen Akzent. »Du weißt, daß ich für ein Korsett genauso viel übrig habe wie du.« Sie legte den Kopf zur Seite und lächelte Leda vertrauensvoll zu. »Ich kann diese abscheulichen Dinger einfach nicht ausstehen.«
Kein Korsett? Lady Catherine war mit der Art Figur gesegnet, daß sie selbst in einem Mehlsack elegant ausgesehen hätte, aber kein Korsett? Leda konnte förmlich spüren, wie Miss Myrtle sich im Grabe umdrehte. »Wir hätten einen wunderschönen blaßrosa Schweizermusselin«, sagte sie. »Daraus ließe sich ein sehr schönes Morgenkleid fertigen. Sehr bequem und leicht, aber überaus elegant.«
Die jüngere Frau sah sie fragend an, und in ihren Augen blitzte ein winziger Funke des Interesses auf, den Leda sofort erkannte. Sie lächelte und deutete auf eine der Theken.
»Lady Tess?« Die süße, tiefklingende Stimme der hawaiianischen Prinzessin unterbrach sie. »Es scheint da irgendwelche Probleme mit der Kaiserlichen Gesellschaft zu geben.«
Alle Hoffnungen, daß die Königin der Sandwich-Inseln mit den Japanerinnen würde reden können, schienen sich in Luft aufgelöst zu haben. Madame Elise stand todunglücklich zwischen den Fremden, während einige der Japanerinnen irgendwelche Gebilde in die Luft zeichneten, die weder der hawaiianischen Königin noch ihrer Schwester etwas zu sagen schienen.
»Wir haben keinen Dolmetscher«, erklärte Leda Lady Ashland ihre mißliche Lage, »aber die Damen scheinen eine ziemlich konkrete Vorstellung davon zu haben, wie sich das ändern ließe. Nur verstehen wir leider nicht, was sie meinen.«
»Samuel!« sagten Lady Ashland und ihre Tochter wie aus einem Mund.
»Ist er schon weg?« rief Lady Catherine und stürzte ans Fenster. Sie öffnete es hastig und beugte sich hinaus. »Samuel!« rief sie überaus undamenhaft. »Manō Kane, warte! Komm her!« Ihre Stimme verwandelte sich augenblicklich und verriet große Zuneigung. »Wir brauchen dich, Manō. Du mußt uns wieder einmal aus der Patsche helfen.«
Lady Ashland stand einfach da und machte keine Anstalten, etwas gegen die unmanierliche Zügellosigkeit ihrer Tochter zu unternehmen. Lady Catherine schloß das Fenster und kehrte zu ihnen zurück. »Ich hab’ ihn noch erwischt!«
»Mr. Gerard kann übersetzen«, sagte Lady Ashland.
»O ja, er spricht fließend Japanisch.« Lady Catherine deutete mit einem ermutigenden Nicken auf die Asiatinnen. »Was für ein Glück, daß ausgerechnet er uns heute morgen hierher gebracht hat.«
Leda schien dies ebenfalls ein bemerkenswerter Glücksfall zu sein; es gab wohl kaum viele Leute mit perfekten Japanischkenntnissen, einem so einzigartigen Talent, die zufällig irgendwelche Damen zu irgendwelchen Londoner Schneidern geleiteten. Aber Lady Ashland und ihre Tochter lebten natürlich ganz in der Nähe Nippons.
Zumindest vermutete Leda das. Sie war sich auch in bezug auf die Lage der Sandwich-Inseln nicht so ganz sicher.
Sie blickte zur Tür, ganz in der Erwartung, einen dieser schnurrbärtigen Yankee-Geschäftsmänner eintreten zu sehen, die mit ihren wohlgefüllten Geldbörsen und ihren überlauten Stimmen jeden Winkel der Welt zu durchwandern schienen. Der Lakai trat ein und meldete mit dem gewichtigen Timbre, das laut Madame Elise für die geziemend majestätische Wirkung sorgen sollte: »Mr. Samuel Gerard!«
Als Mr. Gerhard in der Tür erschien, hielt in dem Raum voller Frauen eine ganz uncharakteristische Stille Einzug … gefolgt von einem unhörbaren Aufseufzen der versammelten Weiblichkeit: Ein goldener, leicht windzerzauster Gabriel war auf die Erde herniedergestiegen, und nichts fehlte ihm zur Vollkommenheit als die Flügel.
Kapitel 2Der Junge
Hawaii 1869
Direkt neben der Laufplanke, die unter den Füßen der anderen von Bord gehenden Passagiere vibrierte und ächzte, stand er still und reglos am Kai. Menschen drängten an ihm vorbei und liefen auf andere Menschen zu, und überall um ihn herum gab es Gelächter und tränenreiche Wiedersehensszenen. Er scharrte mit den Füßen, die ihm in den neuen, seit London für eben diesen Augenblick geschonten Schuhen weh taten. Wie gern hätte er an seinem Finger gekaut. Er mußte die Hände auf den Rücken legen und fest zusammenkrampfen, um sich daran zu hindern.
Er sah Frauen in leuchtenden, langen Kleidern in Scharlachrot und Gelb mit Kränzen aus dunklen Blättern um den Hals und Männer, die nichts am Leibe trugen als Hosen, eine Weste und einen Strohhut. Inmitten des Menschenauflaufs saßen Mädchen rittlings und ohne Sattel auf ihren Pferden: dunkelhäutige, lachende Schönheiten mit langem schwarzem Haar, das ihnen über die Schultern fiel, und Kronen aus Blumen auf den Köpfen; ihre braunen Beine baumelten über die Flanken der Pferde, und sie riefen und winkten den Herren in den Kutschen und den Damen mit ihren Sonnenschirmchen munter zu. Und hinter all dem bunten Treiben erhoben sich die grünen Berge in den Nebel, und ein zweifacher Regenbogen spannte sich über die ganze Stadt.
Auf dem Schiff hatte er Angst davor gehabt, seine Kabine zu verlassen. Während der ganzen Fahrt war er in seinem eigenen behaglichen Kämmerchen unter Deck geblieben, wo er die Dampfmaschine pulsieren hörte, wo es nach Kohle roch und der Steward gerade so viel zu essen brachte, wie er schaffen konnte. Bis heute morgen hatte er sich dort versteckt, dann waren sie gekommen und hatten ihm gesagt, er solle seine besten Kleider anziehen, weil das Schiff Diamond Head umrundet habe und auf den Hafen von Honolulu zulaufe.
Die Luft roch gut hier und hatte einen fremden, frischen Duft, so sauber wie der Himmel und die Bäume. Es waren seltsame Bäume, wie er sie noch nie zuvor gesehen hatte, mit merkwürdigen, gefiederten Kronen, die in der Sonne glitzerten und sich auf hohen, kahlen Stämmen in der leichten Brise wiegten. In seinem ganzen Leben hatte er noch keine so saubere Luft gerochen oder die Sonne so strahlend und warm auf seinen Schultern gespürt.
Er stand allein dort und versuchte, gleichzeitig unauffällig zu sein und auffällig, denn er befürchtete, daß man ihn vergessen hatte.
»Sammy?«
Es war eine sanfte Stimme wie der Wind, der sein Haar zerzauste und ihm die goldenen Strähnen in die Augen wehte. Schnell drehte er sich um und hob eine Hand an die Lippen, um sich die Finger zu befeuchten und die demütigende Locke wieder an ihren Platz zu schieben.
Sie stand ein oder zwei Meter vor ihm mit einem leicht zerfledderten Gewirr leuchtend bunter Blumen überm Arm. Er blickte zu ihrem Gesicht auf. Die unverständlichen Rufe und das Geschnatter der Eingeborenenkinder umschwirrten ihn. Jemand stieß ihn von hinten an und schob ihn einen halben Schritt auf sie zu.
Sie kniete in ihrem weiten, lavendelfarbenen Rock nieder und hielt ihm die Hand hin. »Erinnerst du dich noch an mich, Sammy?«
Er blickte sie hilflos an. Ob er sich an sie erinnerte? Während all der einsamen Tage und verhaßten Nächte, in all den dunklen Zimmern, in denen sie ihm die Hände gebunden und mit ihm gemacht hatten, was ihnen gefiel, während all der Tage und Wochen und Jahre stummen Elends hatte er sich an sie erinnert. An dieses eine helle Gesicht in seinem Leben. Das eine freundliche Wort. Die einzige Hand, die sich je erhoben hatte, um ihn zu schützen.
»Ja«, flüsterte er. »Ich erinnere mich.«
»Ich bin Tess«, sagte sie, als könne er das vielleicht doch vergessen haben. »Lady Ashland.«
Er nickte und stellte fest, daß er die Faust gegen den Mund gepreßt hatte. Mit einer schnellen, unbeholfenen Bewegung zwang er sich, die rebellische Hand zu senken und sie zusammen mit der anderen hinterm Rücken zu verschränken.
»Ich bin so froh, dich zu sehen, Sammy.« Ihre Arme waren noch immer geöffnet und schienen darauf zu warten, ihn zu umfangen. Sie sah ihn mit diesen schönen, blaugrauen Augen an. Ein riesiger Klumpen in seiner Kehle machte es ihm fast unmöglich, zu atmen. »Darf ich dich nicht in die Arme nehmen?«
Irgendwie trugen seine Füße in den zu engen Schuhen ihn nach vom, erst langsam und dann immer schneller, bis er mit einem Ungestüm in ihre Arme fiel, daß ihm die Schamröte in die Wangen stieg. Aber sie zog ihn mit einem leisen, glücklichen Aufschrei an sich, warf ihm den Blumenkranz über den Kopf und preßte ihre weiche Wange an die seine. Ihr Gesicht war feucht. Das spürte er, als sie ihn an sich drückte, und der Klumpen in seiner Kehle tat weh und pochte, als wolle da etwas hinaus, was nicht hinaus konnte.
»O Sammy«, sagte sie. »O Sammy. Wir haben so lange gebraucht, dich zu finden.«
»Es tut mir leid, Mom.« Die Worte klangen gedämpft zwischen den Blumen und der weichen Spitze ihres Kragens hervor.
Sie hielt ihn ein Stückchen von sich weg. »Es war nicht deine Schuld!« Jetzt lachte und weinte sie gleichzeitig. Sie schüttelte ihn ganz sachte. »Jede einzelne Minute des Suchens hat sich gelohnt. Ich wünschte nur, diese abscheulichen Detektive hätten dich schneller gefunden. Wenn ich mir vorstelle, wo du gewesen bist …«
Er sah sie nur an, denn er wußte nichts von Detektiven oder von einer Suche nach ihm und wünschte, sie hätte keine Ahnung gehabt, wo er gewesen war. Beschämt zog er den Kopf ein. »Es tut mir leid«, sagte er noch einmal. »Ich wußte nicht – ich wußte nicht, wo ich sonst hätte hingehen können.«
Sie schloß die Augen. Einen entsetzlichen Moment lang dachte er, es sei Abscheu, und den verdiente er. Er wußte, daß er ihn verdiente. Er hätte diese Dinge nicht mit sich geschehen lassen dürfen; er hätte etwas tun müssen; er hätte nicht so hilflos und verängstigt sein sollen.
Aber sie wandte sich nicht von ihm ab. Statt dessen zog sie ihn abermals ganz eng an sich, eine warme, heftige Umarmung, die nach Wind und Blumen roch. »Niemals wieder«, sagte sie leidenschaftlich. Ihre Stimme brach, und er wußte, daß sie weinte. »Vergiß alles, Sammy. Vergiß alles, was vor dem heutigen Tag geschah. Du bist jetzt zu Hause.«
Zu Hause. Er überließ sich ihrer Umarmung, verbarg sein Gesicht in den kühlen Blumen und hörte dumpfe kleine Geräusche, die aus seiner eigenen Kehle kamen, ein leises Wimmern, für das sich selbst ein Baby geschämt hätte. Mühsam versuchte er, das Schluchzen zu unterdrücken, versuchte wie ein Erwachsener zu reden, so wie es sich für ihn gehört hätte – acht Jahre war er alt oder vielleicht neun, und er sollte doch eigentlich in der Lage sein, etwas Vernünftiges zu sagen. Ihre Tränen befeuchteten ihrer beider Wangen, und er wollte endlich weinen, aber seine Augen waren trocken und aus seiner Kehle kamen nur immer wieder diese dummen kleinen Geräusche … Zu Hause, wollte er sagen … Danke, o danke. Oh – zu Hause …
Kapitel 3
Leda starrte ihn an.
Plötzlich merkte sie, was sie da tat, aber nicht bevor Samuel Gerard ihr direkt in die Augen gesehen hatte und ihre Blicke einander für eine Sekunde begegnet waren: der ihre wie gebannt, seiner wie flüssiges Silber und von brennender Intensität, absolut atemberaubend in einem Gesicht maskuliner, makelloser Übermenschlichkeit … vollkommen … vollkommen über die Vollkommenheit bloßer marmorner Kunst hinaus, vollkommener als alles andere, abgesehen von Träumen vielleicht.
Es war wirklich ein denkbar seltsamer Augenblick. Er sah Leda an, als kenne er sie und habe nicht erwartet, sie hier zu finden. Aber sie kannte ihn nicht. Sie hatte ihn noch nie gesehen.
O nein. Noch nie.
Sein Blick ging an ihr vorbei. Lady Catherine trat vor und sprach mit ruhiger Stimme auf ihn ein, ganz vertraulich, als sei es die normalste Sache der Welt, mit diesem Erzengel zu reden, der auf die Erde herabgekommen war, um zwischen den Sterblichen einherzuschreiten. Sein Mund wölbte sich schwach; er bedachte Lady Catherine zwar nur mit dem Hauch eines Lächelns, aber plötzlich dachte Leda: Er liebt sie.
Natürlich. Sie gaben ein Paar ab, das vom Schicksal selbst zusammengefügt zu sein schien, so perfekt paßten sie zueinander. Eine dunkle Schönheit und ein heller, von der Sonne berührter Gott. Füreinander bestimmt.
Also gut.
»Schön, jetzt kläre du uns auf – was versuchen diese armen Damen zu sagen?« fragte Lady Catherine, die ihn hinter sich her zog.
Er ließ ihre Hand los und verbeugte sich förmlich vor jeder einzelnen der sitzenden Japanerinnen. Die Morgensonne fiel durch die hohen Fenster auf ihn herab, als wolle sie ihm eine besondere Gunst erweisen und dem dunklen Goldton seines Haars einen zusätzlichen Schimmer verleihen. Nachdem er sich wieder aufgerichtet und den Blick gehoben hatte – und wirklich, wie schön seine Wimpern waren, dicht und lang, viel dunkler als sein Haar –, begann er in derselben, von merkwürdig abgehackten Silben geprägten Sprache zu reden und verbeugte sich dann mit höflicher Ehrerbietung noch einmal, bevor er seine kleine Ansprache beendete.
Die jüngere der Damen antwortete mit einer Flut von Worten und Gesten und deutete dabei einmal kaum merklich und mit einem scheuen Lächeln auf Königin Kapiolani.
Er befragte sie abermals. Sie kicherte und zeichnete eine schwungvolle Gestalt in die Luft, ließ ihre Hände weit um ihren eigenen Leib fliegen und zeigte dann herab auf ihre Füße.
Als sie geendet hatte, wiederholte Mr. Gerard seine Verbeugung. Er sah die Königin und ihre Schwester an. »Es ist eine Frage der Mode, Ma’am, und offensichtlich geht es um ein ganz besonderes Kleid.« Wie bei Lady Catherine war sein Akzent eher amerikanisch als englisch, und er sprach mit einem Ernst, als stünde das Schicksal von Nationen auf dem Spiel. »Ihre Majestät, Königin Kapiolani, hat bei Hof ein weißes Kleid getragen, Ma’am? Mit üppigen Stickereien?« Er machte eine knappe Handbewegung – eine vage, verlegene, sehr männliche Nachahmung der eindrücklichen Gesten der japanischen Prinzessin. Eine leichte Röte stieg ihm in die Wangen. »Locker? Ohne – ähm …«
»Ohne Korsett«, ergänzte Lady Catherine weise.
Mr. Gerard wurde unter seiner Sonnenbräune tiefdunkelrot. Er wandte den Blick ab. Sämtliche Damen sämtlicher Nationalitäten lächelten. Also wirklich, Männer konnten so bezaubernd unbeholfen sein.
»Ja«, bemerkte die Prinzessin. »Das mu’umu’u aus japanischer Seide.« Sie sprach mit ihrer Schwester und verwendete dabei noch eine andere Sprache, eine, die flüssiger und hübscher klang als das Japanische.
Mr. Gerard lächelte. »Japanische Seide, ja?« Wieder richtete er das Wort an die ostasiatischen Damen und erhielt zur Antwort erfreutes Nicken und aufgeregtes Geplapper. Er drehte sich zu den anderen um und übersetzte: »Sie möchten Eurer Majestät für die Ehre danken, die Sie ihrem Land erwiesen haben.«
Worauf eine Reihe von Knicksen ausgetauscht wurde und jeder mit jedem anderen im Raum höchst zufrieden schien. Madame Elise klatschte in die Hände und verfiel wieder in ihr überschwengliches französisches Getue.
»Natürlich, die fließende Rrrobe aus weißem Brokat nach awaiisches Mode geschnitten. Ich habe davon in der Zeitschrift Die Königin gesehen.« Sie verbeugte sich unterwürfig. »Vielleicht wünschen Ihre Durchlaucht, daß wir das Kleid kopieren, falls Ihre Majestät die Freundlischkeit ’aben sollten, das zu gestatten?«
Es sah so aus, als sei dies der Fall. Ihre Majestät zeigte sich vollauf zufrieden damit, ihre Gunst auf ihre schätzenswerten königlichen Schwestern aus Japan auszudehnen. Ein Lakai wurde ausgesandt, um das in Frage stehende Gewand aus dem Hotel herbeizubringen; in der Zwischenzeit mußte der Stoff ausgewählt werden: Es sollte ein heller Brokat sein, und der arme Mr. Gerard saß als Übersetzer wirklich und wahrhaftig im Netz der internationalen Modediplomatie gefangen.
Leda eilte davon, um festzustellen, was das Lager zu bieten hatte. Sie kehrte mit fünf Rollen weißer und hellbeiger Seide zurück, die sie so übereinander gestapelt hatte, daß sie ihr bis zur Nase reichten. Als sie in den Verkaufsraum trat, kam Mr. Gerard auf sie zu und nahm ihr den schweren Stapel mit einer einzigen geschickten Bewegung ab.
»O nein, bitte …« Sie war ein wenig außer Atem. »Machen Sie sich keine Mühe, Sir.«
»Ist doch keine Mühe«, sagte er leise, während er die Stoffrollen auf der Theke ausbreitete. Leda senkte den Blick und tat so, als sei sie ganz mit der Seide beschäftigt. Dann schaute sie verstohlen unter ihren Wimpern noch einmal zu ihm auf. Er sah sie immer noch an.
Sie konnte nicht ergründen, was sie in seinem Gesicht las. Im gleichen Augenblick wandte er sich ab, und sie vermochte nicht zu sagen, ob sein Interesse an ihr mehr als hoffnungsvolle Einbildung war. Nicht daß sie gewünscht hätte, daß er sich für sie interessierte: nicht hier, niemals hier; das hätte sie nicht ertragen können – nicht die Art von Beachtung, die ein Mann einer Bediensteten aus einem Verkaufsraum zu zeigen pflegte. Natürlich war sowieso alles nur ein Märchen – dieser atemberaubend schöne Mann ein prachtvoller Anblick, den sie nur bewundern konnte.
Trotzdem … auf seltsame Weise kam er ihr vertraut vor, obwohl dieses makellose männliche Gesicht doch unvergeßlich war; selbst die Art, wie er sich bewegte, war einzigartig und geprägt von einer beherrschten und konzentrierten Anmut. Seine breiten Schultern in dem gut geschnittenen Mantel, seine hochgewachsene Gestalt, diese bemerkenswerten dunklen Wimpern und die grauen Augen: Schon jetzt hatte er sich unauslöschlich in ihr Gedächtnis eingebrannt. Sie konnte nur vermuten, daß sie irgendwo einmal ein Bild von einem strahlenden Helden gesehen haben mußte, in einem Buch – den edlen Ritter auf seinem weißen Roß –, und hier stand er nun plötzlich in Madame Elises Verkaufsraum, stand gedankenverloren da, umgeben von farbenprächtiger Seide und plappernden Frauen.
Die anderen Mädchen aus dem Verkaufsraum machten sich jede nur erdenkliche Ausrede zunutze, um einen Blick auf die erlauchte Versammlung zu erhaschen. Die Nachricht von Mr. Gerard hatte sich herumgesprochen. Als Leda einen elfenbeinfarbenen Brokat auf der Theke ausrollte, fing sie ein verstohlenes, aufreizendes Grinsen von Miss Clark auf, die sich ungeheure Mühe gab, ein Regal aufzuräumen, das wirklich und wahrhaftig nicht aufgeräumt werden mußte.
Leda versuchte sie zurechtzuweisen, indem sie das Grinsen ignorierte. In Miss Myrtles Augen waren Männer eine Art Bürde gewesen, die irgend jemand der Welt auferlegt hatte; höchstens als Gegenstand höflicher Konversation akzeptiert. Als Beispiel für alle diente ihr jener unsägliche Mann, der ganz für sich allein ein Hort sämtlicher Laster und Verderbtheiten war, denen die menschliche Seele überhaupt anheimfallen konnte. Jener unsägliche Mann wurde daher für sie zu einem perfekten Gesprächsthema und demzufolge im Laufe der Jahre in Miss Myrtles Wohnzimmer im Hinblick auf Ledas Unterrichtung und Weisung mit überwältigender Regelmäßigkeit mißbraucht.
Leda fürchtete sich ein wenig vor Männern. Aber zu guter Letzt konnte sie einfach nicht anders, als Miss Clarks Grinsen zaghaft zu erwidern.
Dieser Mann war auch zu umwerfend. Wirklich!
Jedesmal, wenn Leda einen neuen Stoffballen präsentierte, nahm er ihr den vorhergehenden ab, rollte ihn eigenhändig wieder auf und kam auf wunderbare Weise mit dem sperrigen, schweren Ding zurecht. Und er machte auch nicht viel Getue deswegen; er half ihr bei der Arbeit und übersetzte gleichzeitig vom Japanischen ins Englische und wieder zurück, während Madame Elise jeden Stoff vors Fenster hielt, seine Vorzüge erklärte und darüber sprach, wie er sich bei Kerzenschein und im Gaslicht ausnehmen würde.
Als Leda ihre Schere hinfiel, hob er sie für sie auf. Sie nahm die Schere mit einem gemurmelten Wort des Dankes entgegen, und eine Woge der Schüchternheit schien sie zu überrollen. Wenn seine bloßen Hände die ihren berührten, fühlte sie sich so zittrig wie eine alte Jungfer.
Leda war so damit beschäftigt, ihn verstohlen anzusehen, daß sie erschrocken zusammenfuhr, als der Lakai ihr von hinten etwas ins Ohr flüsterte. Sie schaute herab und erblickte in seiner behandschuhten Hand einen mit einem Monogramm versehenen und mit einem Krönchen versiegelten Brief.
»Für Mademoiselle Etoile.« Der Diener hielt ihr den Umschlag hin.
Alle außer Madame Elise, die pausenlos weitersprach, sahen sie an. Leda spürte, wie ihr ein sengendes Rot in die Wangen stieg. Sie nahm dem Lakaien den Brief ab, versteckte ihn hinter ihrem Rücken und wünschte sich sehnlichst, dort eine Tasche zu haben.
Madame Elises falsches Französisch plätscherte weiter, aber plötzlich hob sie den Blick und sah Leda eine Sekunde lang direkt an. Leda ließ den Brief auf den Fußboden hinter sich fallen und stellte sich so hin, daß ihr Rock ihn verdeckte. Sie schluckte, blickte zu Boden und machte sich blindlings an dem Stoff auf der Theke zu schaffen.
Sie brauchte das Schreiben nicht zu öffnen. Sie brauchte sich nicht einmal das Krönchen näher anzusehen. Es spielte keine Rolle, welchem Peer das Siegel gehören mochte – ein solcher Brief konnte nur eine Sache bedeuten und nur zu einem Ende führen.
Das was es also, wovon Mrs. Isaacson gesprochen hatte, als sie meinte, sie wolle ›sehen, was sich machen ließe‹. Leda fühlte sich angewidert und gedemütigt; sie war wütend auf Mrs. Isaacson und ärgerte sich gleich darauf, weil ihr klar wurde, daß ihre Arbeitgeberin vielleicht der Meinung gewesen war, daß sie genau um so etwas gebeten hatte. Viele der Mädchen gingen mit Männern aus …, aber nein … Nein – es durfte nicht so beginnen, im Vorführsaal vor den anderen Mädchen und den Kunden.
Sie war öffentlich gebrandmarkt – ihre Position kristallklar gemacht. Verkauft zum Preis eines karierten Seidenkleids und einer Kokarde …
Um sie herum ging alles weiter wie bisher. Als sie endlich den Mut gefunden hatte, wieder aufzublicken, diskutierten die japanischen Damen gerade darüber, wann die Oberschneiderin zum Maßnehmen in ihr Hotel kommen sollte. Inmitten des Getümmels stand Mr. Gerard und übersetzte. Er mußte den Brief ebenfalls gesehen haben. Sie alle hatten ihn gesehen, aber natürlich schenkte niemand den Angelegenheiten einer jungen Frau aus dem Vorführsaal einer Schneiderei irgendwelche Beachtung.