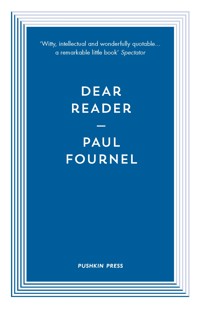9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Covadonga Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ein echter Klassiker der Radsportliteratur: Geistreiche und erhellende Wahrheiten über Fahrräder und das Radfahren »Das Rad an sich ist also schon eine Form von Doping. Was die Sache nicht leichter macht. Es ist ein Instrument, dem die Schnelligkeit innewohnt, es ist die beste Möglichkeit für den Menschen, über sich hinauszuwachsen: doppelt so schnell, doppelt so frisch, doppelt so viel Wind im Gesicht. So gesehen ist es nur natürlich, dass man nicht davon lassen kann.« In 55 kurzen, wunderbar pointierten Texten entwirft der französische Schriftsteller Paul Fournel ein Universum, in dessen Zentrum das Rennrad steht. Beginnend mit der kindlichen Freude, das Radfahren zu lernen, erzählt Die Liebe zum Fahrrad von den Qualen des Kletterns und der Angst vor Stürzen, vom seligen Endorphinrausch und dem Wunder des Windschattens und von all den anderen universellen Momenten und Gefühlen, die jeder passionierte Radfahrer kennt. Die Geräusche, die Gerüche, die Leiden und Freuden des Fahrens in einem Peloton Gleichgesinnter und als einsamer Solist, das Besitzergreifen der Landschaft, das Verirren, das Wiederentdecken vertrauter Strecken – Paul Fournels Klassiker bringt in unnachahmlicher Manier auf den Punkt, warum wir alle das Fahrrad brauchen und immer wieder in den Sattel steigen wollen… »In dieser Ode an das Fahrrad hört man den Wind pfeifen, spürt den Schmerz der angespannten Muskeln und die Rauheit des Asphalts, der einem die Haut von der Hüfte reißt, wenn man stürzt. Fournel schreibt beschwörend, romantisch, einfühlsam, nachdenklich und führt seine Leser von einer sehr vertraut vorkommenden Situation zur nächsten und von einer überraschenden Beobachtung zur nächsten. Das Ergebnis ist eine allumfassende, mitreißende Liebeserklärung an das Fahrrad, ein Buch für alle, die das Fahrrad lieben oder die Liebe zum Fahrrad (ein wenig) verloren haben und sich danach zurücksehnen.« (Procycling) Ausgezeichnet als bestes französisches Sportbuch des Jahres mit dem Prix Sport-Scriptum.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
PAUL FOURNEL
DIE LIEBE ZUM FAHRRAD
Erzählungen
Aus dem Französischenvon Nathalie Mälzerund Stefan Rodecurt
Die Originalausgabe dieses Buches ist unter dem Titel »Besoin de vélo« bei Éditions du Seuil, Paris, erschienen.
© Éditions du Seuil, 2001
Paul Fournel:
Die Liebe zum Fahrrad
Aus dem Französischen
von Nathalie Mälzer und Stefan Rodecurt
© der deutschsprachigen Ausgabe: Covadonga Verlag, 2012
1. Taschenbuchausgabe / 2022
ISBN (Print): 978-3-95726-072-7
ISBN (E-Book): 978-3-95726-073-4
Umschlagbild: Axel Gercke, »Maillot Jaune 8/7«, 60 x 80 cm, Öl auf Leinwand, 2016 / www.axelsbilder.com
Druck und Bindung: Westermann Druck Zwickau GmbH
Der Anhang »Sur le Tour de France 1996« (Seiten 161 bis 236 der französischen Originalausgabe) ist nicht Teil der deutschsprachigen Ausgabe.
Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags.
Covadonga ist der Verlag für Radsportliteratur.
Besuchen Sie uns im Internet: www.covadonga.de
… und er ist ein schnellerer Mensch.
Maurice Leblanc, Nun wachsen uns Flügel
Für meinen Freund Louis, der ins Blaue pedaliert.
Für den Baron, Chacha und Mado, Rémy, Sébastien, Rino, Jean-Noël, Plaine, Jacques, Jean-Loup, Jean, Titch, Furnon, Madel, Philippe, für Jean-Louis, für Daniel, für Marc, für Denis, für Ernest, für Harry, für Claire, für Jean-Emmanuel, für Christian …
Und für alle, die mir vorausgegangen sind und die ich hier vergessen habe.
Inhalt
Rasendes Rad
Lust aufs Fahrrad
Der Drang nach Frischluft
Mittendrin
Rund laufen
RASENDES RAD
Longchamp
Ich erinnere mich sehr gut an den Hund. Er hatte gelbes Fell, ein Boxer. Ich erinnere mich genau, dass ich ihn als Letzter lebend gesehen habe, schließlich habe ich ihn überfahren.
Im selben Augenblick spürte ich, wie mein Vorderrad sich verbog und der Lenker meinen linken Arm quetschte. Ich spürte den Atem des Pelotons, das schreiend auseinanderstob. Dann wachte ich auf. Ich saß in Longchamp auf dem Boden und versuchte, meine Telefonnummer in den Sand zu schreiben – falls ich noch mal in Ohnmacht fallen würde.
Zuerst kam die Klinik, in dem das Ärzteteam mit meinem übel zugerichteten Arm überfordert war. Dann kam die schlecht gefederte Ambulanz, in der ich bei jeder kleinsten Bodenwelle wimmerte, und schließlich die Endstation: das Krankenhaus Boucicaut mit der Notfallabteilung für Handchirurgie.
Es war fünfzehn Uhr, und meine Sonntagvormittags-Ausfahrt ragte schon weit in den Nachmittag hinein.
Meinen Arm hatte man mit einer Schiene ruhiggestellt.
»Sie haben Knochensubstanz verloren, wir müssen Schraubenimplantate einsetzen und für die Transplantation Knochenmaterial aus der Hüfte entnehmen«, erklärte mir der Chirurg und ging Mittagessen. Ich verdaute noch meinen Müsliriegel, den ich während meiner Ausfahrt gegessen hatte, als man mich in den Operationstrakt hinunterbrachte.
Zu dem Zeitpunkt fuhr eine sechsköpfige Gruppe an der Spitze, und ich hatte den Eindruck, dass der große Demeyer in der Defensive blieb. Er ging die Abschnitte mit dem Kopfsteinpflaster vorsichtig an, fuhr zwar kraftvoll wie immer, doch so wie auf Zehenspitzen. Moser und De Vlaeminck schienen nicht den besten Tag erwischt zu haben. Hinault führte die Ausreißergruppe an, mit verbissener Miene, wie an allen harten Tagen. Paris–Roubaix, die »Hölle des Nordens«, ist kein Rennen, bei dem die Fahrer zum Scherzen aufgelegt sind. Hinaults Regenbogentrikot war schmutzig, so schmutzig, dass man es nicht einmal mit Schutzhandschuhen anfassen mochte. Die Großaufnahmen zeigten ihn – konzentriert und verschlossen. Aber er machte kaum Anstalten, seine Verfolger abzuschütteln, und nichts war ärgerlicher, als mitansehen zu müssen, wie er alle ins Schlepptau nach Roubaix nahm.
Die Fahrer waren nur noch zehn Kilometer vom Ziel entfernt, dem Velodrom von Roubaix, als der Chirurg zurückkehrte.
»Es geht los, der OP-Saal ist bereit.«
»Nur noch ein paar Minuten … Ich möchte mir die Schlussphase ansehen.«
»Wir erzählen sie Ihnen hinterher.«
»Ich werde nicht einschlafen, wenn ich nicht weiß, wie das Rennen ausgeht.«
»Das sollte mich wundern, bei dem, was wir Ihnen gleich verabreichen!«
Dann beging der Chirurg den entscheidenden Fehler: Er drehte sich zum Fernseher um und konnte nicht mehr umhin, sich auf meine Bettkante zu setzen. Die Schlussphase war derart spannungsgeladen, dass er kein Wort mehr hinzufügte.
Kuiper bog als Erster in die altehrwürdige Radrennbahn ein, mit De Vlaeminck am Hinterrad. Vierhundert Meter vor dem Ziel übernahm Hinault, der »Dachs«, das Kommando und machte Druck. Demeyer versuchte, innen zu passieren – doch vergebens. Niemand vermochte ihn bei seinem fulminanten Schlussspurt abzufangen.
Hinault reckte seinen Blumenstrauß in die Höhe und verkündete öffentlich, dieses Rennen sei totaler Schwachsinn. Er wusste, wovon er redete.
Danach kam die erste Spritze, die Krankenbahre, der grüne Kittel, die zweite Spritze. Ich schwebte auf einer Wolke über dem OP-Tisch und nahm die Instrumente in Augenschein, die funkelnd dalagen: Nägel, Schrauben, Schienen, Klammern, eine Säge …
Darunter ein Bohrer von Black & Decker. Voll Bedauern, dass es keiner von Peugeot war, schlief ich ein … Ein tolles Team, die Jungs von Peugeot!
Saint-Julien
Das war nicht mein erster Crash gewesen.
Jeder Radfahrer, selbst der blutigste Anfänger, weiß, dass er in seinem Leben über kurz oder lang einmal Bekanntschaft mit einer Autotür machen wird. Die Tür kann jederzeit, mal links, mal rechts, vor ihm aufspringen. Immer und überall lauert die Gefahr, auch dort, wo er sie am wenigsten erwartet: an einer Kreuzung, einem Abzweig, auf einer schnurgeraden, menschenleeren Straße.
Als Stadtradler verfüge ich über einen breiten Erfahrungsschatz: rechte Tür, linke Tür, höher gelegte Lkw-Tür, tiefer gelegte Cabriotür, samt der Palette an Begleitkommentaren – von dem höchst seltenen »’Tschuldigung« über »Pass doch auf!« bis hin zu dem pittoresken »Sie haben mir eine Schramme in den Lack gemacht«. Bei mäßiger Geschwindigkeit geht es relativ glimpflich aus: eine Fingerfraktur, ein ausgekugeltes Schultergelenk, eine hartnäckige Migräne, ein gefährlicher Spagat auf einer stark befahrenen Straße.
Ich habe sehr früh mit dieser Disziplin angefangen und gleich zu Beginn meiner Karriere meine erste Tür abgekriegt. Auf dem Rückweg von einer kleinen Radtour mit meinen Cousins fuhr ich artig auf der rechten Seite, wie man es mir beigebracht hatte. Wir kurbelten ziemlich eilig, weil es bereits Essenszeit war.
Da wurde gedankenlos vor mir eine Wagentür aufgerissen. Mein Fahrrad stoppte, ich hingegen flog im hohen Bogen über die Tür – damals benutzte ich noch keine Hakenpedale. Ich landete ziemlich unsanft kopfüber im Rollsplitt. Die eine Gesichtshälfte war mit kleinen schmutzigen Steinen übersät. Ich spürte, wie meine Lippen und die eine Augenbraue anschwollen. Ich wurde einäugig und stumm. Würde meine eigene Mutter mich wiedererkennen?
Die Frau, die mir diese Überraschung bereitet hatte, kam angesichts meines zarten Alters in arge Verlegenheit. Sie nahm mich auf den Arm, trug mich in ihren Garten und dachte sich alles Mögliche aus, um die Erinnerung an unser leidvolles Zusammentreffen auszulöschen. Vor allem wollte sie sich vergewissern, dass bei mir nichts gebrochen war, und schien jeden Knochen einzeln nachzählen zu wollen. »Es war keine Absicht«, versicherte sie mir. Das glaubte ich ihr gern, denn ich kannte bereits tausend wirkungsvollere Methoden, seinen Nächsten aus dem Weg zu räumen. Sie erschien mir allmählich ziemlich wirr, und so wartete ich immer ungeduldiger auf meine Mutter.
In dem Augenblick kam der Frau der geniale Einfall, mir ein großes Glas Martini zu bringen, um mich wieder aufzupäppeln. Ich leerte es in einem Zug, und so folgte auf meine erste Kollision mit einer Autotür mein erster gründlicher Rausch. Die Dame beugte sich über mein geschwollenes Gesicht, und pausbackig wie sie war hätte ich sie am liebsten geohrfeigt. Ich war volltrunken, übel zugerichtet, gewaltbereit und hatte nur noch einen Wunsch: wieder aufs Rad zu steigen.
Die kleine Landstraße
Mit dem Ende der Tour de France war der Sommer an seinen Tiefpunkt gelangt: Lange, heiße und ereignislose Nachmittage erwarteten mich.
Der einzige Lichtblick in diesem grauen Einerlei war die Aussicht auf das alljährliche Eliterennen unseres Dorfes, wo wir die Fahrer vor unserem Haus mit Ersatzreifen und Wasserflaschen versorgten.
Ich war zehn Jahre alt, hatte ein grünes Rad und bereitete mich auf das Ereignis vor, als ginge ich selbst an den Start. Mein Training bestand aus einer Reihe irrwitziger Sprints vom Haus bis ins Dorf. Die Landstraße war damals menschenleer. So konnte ich Schlangenlinien fahren, ohne meinen ärgsten Konkurrenten, André Darrigade, zu gefährden, mit dem ich mir auf den letzten dreihundert Metern denkwürdige Duelle lieferte, während der Dritte im Bunde, der tapfere Roger Hassenforder, weit abgeschlagen und mit hängender Zunge hinter uns herfuhr. In aller Regel fuhr ich mit siegreich gen Himmel gereckten Armen über die Ziellinie, die genau vor meiner Haustür lag. Manchmal, wenn der Kampf auf Messers Schneide stand, musste ich das Rad im Panthersprung über den Zielstrich wuchten, um Darrigade den Sieg um eine Reifenbreite zu entreißen. Aber wehe, ich verlor hauchdünn! Dann trommelte ich mit Fäusten auf meinen Lenker ein und verlangte Revanche.
Der Wettkampf an jenem Nachmittag war dramatisch. Es herrschte eine brütende Hitze, und wir hatten uns im staubigen Sonnenschein eine Serie von Sprints geliefert. Mir brannte die Kehle, meine Muskulatur war verhärtet. Da ich zugegebenermaßen von eher molliger Statur war, wurden meine Oberschenkelmuskeln mächtig beansprucht. So musste ich im Blindflug mit gekrümmtem Rücken und eingezogenem Kopf in den Zielsprint gehen.
Als ich mit einem letzten Ächzen wieder den Kopf hob, um mich zu vergewissern, dass ich auch wirklich gewonnen hatte, sah ich eine beleibte Dame auf mich zusteuern, nur noch wenige Zentimeter von mir entfernt. Für ein Ausweich- oder Bremsmanöver war es zu spät. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem Obst und Gemüse durch die Luft wirbelten.
Mein Vorderrad war genau gegen ihres geprallt. Die Kiste, die sie auf ihrem Gepäckträger transportierte, das Baguette und der Wein aus dem Korb am Lenker lagen am Boden verstreut. Die Dame saß auf dem Asphalt, ihr schwarzes Kleid war hochgerutscht, der Dutt hing schief über dem rechten Ohr. Ich pustete kräftig auf mein Knie, das wie Feuer brannte, sowie auf meinen aufgeschürften Ellbogen. Sie fragte mich lediglich, was ich auf dieser Seite der Straße zu suchen hätte, das sei schließlich ihre Seite. Mit hängendem Kopf sammelte ich jede Aubergine und jede Zucchini auf, darauf bestand ich, und spannte die Gepäckspinnen, bevor ich nach Hause humpelte, wo ich mich endlich ausweinen konnte.
Im Ance-Tal
Nach längerer Diskussion hatten wir uns durchgerungen, die Mädels mitzunehmen. Wir wollten am Ufer der Ance picknicken, und den Ältesten unter uns erschien die Anwesenheit von Frauen unverzichtbar.
Die Schönen saßen auf ihren Stadträdern, die zum Einkaufen und für Strandausflüge justiert waren: mit schlecht geölten, quietschenden Ketten. Ein Mädchen fuhr mit wiegenden Hüften auf dem Rad ihrer großen Schwester, ein anderes strampelte sich auf dem Drahtesel ihres kleinen Bruders ab, wobei ihr die Knie bei jedem Pedaltritt bis an die Schultern reichten. Unsere bunt zusammengewürfelte Truppe war alles andere als ein Peloton. Anfangs war das noch ganz spaßig, doch dann wurde uns die Zeit lang. Bei der Bummelei würde aus unserem Picknick ein später Imbiss, ein Abendessen oder gar eine Nacht unter sternenklarem Himmel werden, mal ganz abgesehen davon, dass wir uns einen Riesenärger mit unseren Eltern einhandeln würden.
Also gaben wir ein höheres Tempo vor und lösten uns an der Spitze ab. Es galt, die Mädels an der richtigen Stelle anzuschieben, damit sie besser den Anstieg meisterten.
Mit meiner Partnerin hatte ich kein Glück. Zwar zeigte sie guten Willen, war aber reichlich plump. Sie hatte sehr wohl verstanden, dass wir das ganze Theater nur veranstalteten, um ihr zu helfen, und wollte sich erkenntlich zeigen. In dem Moment, als ich sie mit einem kräftigen Schubs am Gesäß nach vorne bringen wollte, kam sie auf die großartige Idee – sie wollte meine Kräfte schonen –, aus dem Sattel zu gehen und zu beschleunigen. Meine Hand stieß ins Leere, und so stürzte ich durch meinen eigenen Schwung zu Boden.
In kritischen Situationen verwandeln sich die kleinen, nützlichen Extras an den modernen Rädern aufgrund einer Alchimie, die jedem Radsportler bekannt ist, in furchterregende Waffen. Diesmal entpuppte sich der harmlose Schalthebel als scharfe Klinge, die sich in meinen rechten Oberschenkel bohrte.
Meine Kameraden vollführten mit meinem Fahrrad eine virtuose Pirouette und entfernten auf diese Weise den metallenen Fremdkörper aus der Wunde. Blut spritzte, Fettpartikel traten zutage. Die Wunde, so schien es, würde wohl oder übel genäht werden müssen.
Der Arzt empfing mich mit den verdrießlichen Worten: »Schon wieder! Ich habe deine Faxen auf dem Rad langsam satt. Ich sehe doch, wie du mit deiner Bande durchs Dorf fegst. Die Wunde werde ich nähen – drei Wochen strikte Bettruhe! –, aber ich werde ohne Narkose nähen. Das wird dir eine Lehre sein.«
Gesagt, getan. Er war ein echter Landarzt.
Longchamp
In jenem Sommer hatte ich dreiundzwanzig Mal einen Platten. Vom vielen Auf- und Nachpumpen in Gräben und Böschungen war der Umfang meiner Arme mittlerweile größer als der meiner Oberschenkel. Ich hatte mein Budget für Reifen weit überzogen, und der allerallerletzte Ersatzmantel, den ich mir geleistet hatte, war unter meinen Sattel geschnallt. Er war noch zu neu, ich hatte ihn eilig für wenig Geld erstanden. Eigentlich nimmt man keinen Schlauchreifen mit, der nicht eingefahren ist: Er ist nicht gedehnt, hat keine Klebereste und lässt sich schwer montieren.
Als mein Vorderreifen, den ich am Vorabend aufgezogen hatte, nach zwanzig Kilometern seinen Odem an einer spitzen Reißzwecke aushauchte, sprang ich in voller Fahrt vom Rad und montierte schweren Herzens meinen letzten Schlauchreifen. Ich zog ihn, ohne frischen Kleber aufzutragen, auf ein schlecht präpariertes Felgenbett auf. Solche gravierenden Fehler macht man, wenn einem nach dem vierundzwanzigsten Zischen der Kragen platzt: Wer Tempo fährt, will nicht abrupt anhalten. Und wenn das Peloton davonzieht, bezahlst du bei der Aufholjagd jede Sekunde mit Schmerzen in den Oberschenkeln – ein platter Reifen ist nun einmal nicht das Ziel beim Radsport.
Das Dehnen des neuen Schlauchreifens – wie immer schien er viel zu klein auszufallen –, das Aufziehen unter vollem Einsatz des Oberkörpers, das Aufpumpen und das Einsetzen des Laufrads kosteten mich eine sechs Kilometer lange Verfolgungsjagd, bei der ich mich tief über den Lenker beugte, mir der Schweiß in die Augen tropfte und sich meine rechte Schulter verkrampfte. Der schlecht montierte Reifen lief am Ventil unrund und machte bei jeder Umdrehung klick … Ich spürte es in den Handgelenken und der Schulter. Zum Glück gab es lange gerade Abschnitte, und ich behielt das Peloton im Blickfeld.
Aus Angst, den Anschluss zu verlieren, schloss ich etwas zu schnell wieder zum Feld auf, wie das häufig passiert, wenn man unbedingt zurück in den Windschatten der Gruppe will. Als ich es endlich geschafft hatte, war ich völlig ausgelaugt, und ausgerechnet in dem Moment zogen sie an der Spitze das Tempo an.
Den Hintern genau in dieser Sekunde wieder aus dem Sattel zu heben, obwohl ich doch erst zu Atem kommen musste, war eine Tortur – es wurden gewiss schon weitaus frischere Fahrer abgehängt. Trotzdem stemmte ich mich im Wiegetritt in die Pedale, bereit, meine Oberschenkel noch einmal zum Glühen zu bringen. An der Spitze schien es nun ernsthaft zur Sache zu gehen, und die ersten verausgabten Fahrer ließen abreißen. Ich beschloss, alles in die Waagschale zu werfen, und umklammerte den Unterlenker, um das Loch zuzufahren. In altbewährter Sprintermanier begann ich, mein Rad von einer Seite zur anderen zu werfen, um alle Kraft auf die Pedale zu bringen. Ein kurzer Blick genügte: Drei Radlängen musste ich aufholen, dann starrte ich wieder auf die Vorderradnabe, um dem Wind möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten.
So konnte ich aus nächster Nähe beobachten, wie sich mein Vorderrad verkantete und der Reifen von der Felge sprang. Dann sah ich, wie er sich wand, sich am Gabelkopf verfing und mich schließlich zu der brutalsten Vollbremsung meiner Radfahrkarriere zwang. Der Schlauch hatte sich regelrecht verknotet. Diesen Knoten könnte ich noch heute zeichnen, denn ich hatte Gelegenheit, ihn aus jeder Perspektive zu betrachten, und ließ ihn nicht aus den Augen, während ich über den Lenker katapultiert wurde, rücklings auf dem Asphalt aufschlug und unter meinem Fahrrad begraben wurde – mit dem verfluchten vierundzwanzigsten Schlauchreifen.
Eine atemraubende Strecke.
Zum ersten Mal ertrank ich wahrhaftig im Teer und schnappte nach Luft.
San Francisco
Damals verbrachte ich einige Zeit in Kalifornien und hatte vorsorglich zwei Rennräder mitgenommen. Vor Ort kaufte ich mir zusätzlich ein gebrauchtes Mountainbike – eine lokale Marke mit 24-Gang-Schaltung –, das mir helfen sollte, beim täglichen Weg zur Arbeit die steilen Hügel zu erklimmen.
Die Kalifornier sind besonnene und höfliche Autofahrer. An jeder Kreuzung sind vier Stoppschilder aufgestellt, die auch beachtet werden, die Vorfahrt gewährt man auf liebenswürdige Weise demjenigen, der zuerst kommt (aber nicht dem erstbesten Dahergelaufenen). Sobald die Autofahrer einen Fußgänger auch nur von weitem sehen, treten sie aufs Bremspedal und lassen ihn mit einem Lächeln auf den Lippen passieren.