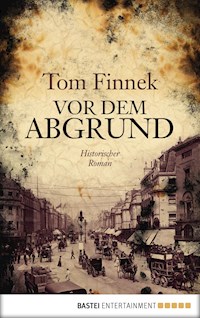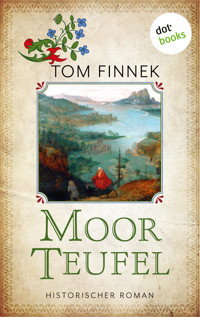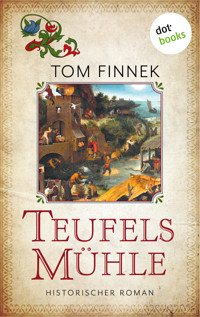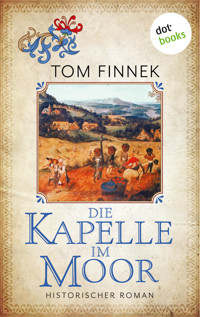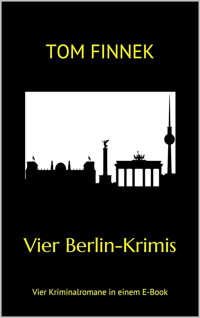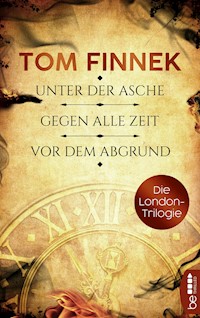
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Tauchen Sie ein in das historische London - eine Welt voller Gauner, Huren und Gesetzloser! Drei spannende Romane plus Bonus-Kurzgeschichte von Tom Finnek erstmals als Sammelband im eBook. Mehr als 1.400 Seiten Lesevergnügen!
DAS VERRÄTERTOR
Eine Erzählung aus dem alten London (Bonus-Kurzgeschichte)
***
ROMAN 1: UNTER DER ASCHE
London 1666 - vier Tage lang verschlingt ein Feuer die Stadt. Im Armenviertel Southwark lebt der Straßenjunge Geoff, der mehr schlecht als recht versucht, seine Familie durchzubringen. Seine Schwester Jezebel, die sich in einer verruchten Spelunke als Schankmagd verdingt, birgt ein Geheimnis - und verschwindet eines Tages spurlos. Auf der Suche nach ihr stößt Geoff auf ein Netz aus Intrigen, Schuld und ungesühnter Rache ...
***
ROMAN 2: GEGEN ALLE ZEIT
Ein stinkender Keller voll Schlafender und ein fluchender Mann mit Dreispitz: Henry Ingram traut seinen Augen nicht, als er nach einem heftigen Rausch zu sich kommt. Nur langsam begreift er das Unglaubliche. Er wurde um dreihundert Jahre in der Zeit zurückversetzt, mitten hinein ins London des 18. Jahrhunderts, ein London der Ganoven und Diebe. Als er unfreiwillig dem Räuberhauptmann Jack Sheppard dabei hilft, aus dem berüchtigten Newgate-Gefängnis auszubrechen, wird er so selbst zum Gejagten und Gesetzlosen ...
***
ROMAN 3: VOR DEM ABGRUND
Londons schwarzes Herz. Im Herbst 1888 kommen zwei junge Menschen ins East End, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die verarmte Celia Brooks versucht verzweifelt, ihren Vater zu finden. Der Hotelierssohn Rupert Ingram will hingegen nur seine Pflichten im sündigen Treiben vergessen. Doch im East End hat alles seinen Preis: Antworten ebenso wie das Vergessen. Und während die Huren ihre Dienste feilbieten und ein Mörder namens Jack the Ripper in den Schatten lauert, stoßen Celia und Rupert auf Geheimnisse, die ihr Leben für immer verändern ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2432
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Tauchen Sie ein in das historische London – eine Welt voller Gauner, Huren und Gesetzloser! Drei spannende Romane plus Bonus-Kurzgeschichte von Tom Finnek erstmals als Sammelband im eBook.
Das Verrätertor: Eine Erzählung aus dem alten London
Unter der Asche: London 1666 – vier Tage lang verschlingt ein Feuer die Stadt. Im Armenviertel Southwark lebt der Straßenjunge Geoff, der mehr schlecht als recht versucht, seine Familie durchzubringen. Seine Schwester Jezebel, die sich in einer verruchten Spelunke als Schankmagd verdingt, birgt ein Geheimnis – und verschwindet eines Tages spurlos. Auf der Suche nach ihr stößt Geoff auf ein Netz aus Intrigen, Schuld und ungesühnter Rache …
Gegen alle Zeit: Ein stinkender Keller voll Schlafender und ein fluchender Mann mit Dreispitz: Henry Ingram traut seinen Augen nicht, als er nach einem heftigen Rausch zu sich kommt. Nur langsam begreift er das Unglaubliche. Er wurde um dreihundert Jahre in der Zeit zurückversetzt, mitten hinein ins London des 18. Jahrhunderts, ein London der Ganoven und Diebe. Als er unfreiwillig dem Räuberhauptmann Jack Sheppard dabei hilft, aus dem berüchtigten Newgate-Gefängnis auszubrechen, wird er so selbst zum Gejagten und Gesetzlosen …
Vor dem Abgrund: Londons schwarzes Herz. Im Herbst 1888 kommen zwei junge Menschen ins East End, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die verarmte Celia Brooks versucht verzweifelt, ihren Vater zu finden. Der Hotelierssohn Rupert Ingram will hingegen nur seine Pflichten im sündigen Treiben vergessen. Doch im East End hat alles seinen Preis, Antworten ebenso wie das Vergessen. Und während die Huren ihre Dienste feilbieten und ein Mörder namens Jack the Ripper in den Schatten lauert, stoßen Celia und Rupert auf Geheimnisse, die ihr Leben für immer verändern …
Über den Autor
Tom Finnek heißt im wahren Leben Mani Beckmann und wurde 1965 in Westfalen geboren. Er ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Mit seiner Familie lebt und arbeitet Tom Finnek in Berlin, wo er als Filmjournalist, Drehbuchlektor und Schriftsteller tätig ist. Neben seiner London-Trilogie erscheint bei beTHRILLED auch die bislang dreiteilige Münsterlandkrimi-Reihe um die Ermittler Tenbrink und Bertram.
TOM FINNEK
Die London-Trilogie
Unter der Asche Gegen alle Zeit Vor dem Abgrund
beTHRILLED
Originalausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Massimo Peter-Bille
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-7727-9
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
TOM FINNEK
DAS VERRÄTERTOR
Eine Erzählung aus dem alten London
Bonus-Kurzgeschichte
Jeremiah Ingram lebte gerne auf der Brücke. Andere mochten darüber klagen, dass die London Bridge viel zu eng und überbordend bebaut sei, dass es auf der schmalen und löchrigen Gasse zwischen den Fachwerkhäusern kein Durchkommen gebe und dass obendrein die Themse zu ihren Füßen wegen des enormen Tidenhubs und der engen Brückenbögen so reißend sei, dass es lebensgefährlich sei, mit dem Boot an einem der steinernen Stützpfeiler anzulegen. Doch Jeremiah liebte die altersschwache und oft geschmähte Brücke. Sie war sein Zuhause, so wie sie das Zuhause für Generationen von Ingrams vor ihm gewesen war. Seine Familie führte seit jeher einen kleinen Kurzwarenladen auf der Südseite der Brücke, gleich zwischen dem so genannten Verrätertor, auf dem die abgeschlagenen Köpfe vieler Hingerichteter vor sich hinmoderten, und den Getreidemühlen, die durch riesige Mühlräder unter den beiden südlichsten Bögen angetrieben wurden. Jeremiah war nicht wohlhabend, aber auch nicht arm – er hatte sein tägliches Auskommen. Und da auch seine Frau Lucilla und die beiden Kinder Martin und Nelly ebenso fleißig wie folgsam waren, hatte er wenig zu klagen. Die London Bridge, weit und breit der einzige Übergang über die Themse, sorgte gut für sie und ließ den Strom der kaufwilligen Passanten und Reisenden nie abbrechen.
Jeremiah war auch deshalb so zufrieden und sorglos, weil ihn die mitunter dramatischen Ereignisse außerhalb seiner Familie und jenseits der Brücke kaum interessierten. Dass England seit wenigen Jahren mit Jakob I. einen ungeliebten Stuart als König hatte und dass erst vor kurzem eine handvoll papistischer Verschwörer versucht hatte, das Parlament in Westminster in die Luft zu sprengen, verfolgte Jeremiah ohne allzu große Gemütsregungen. Zwar fand er es bedauerlich, dass der jungfräulichen Königin Elizabeth ein hochnäsiger Schotte auf den englischen Thron gefolgt war. Und auch der unselige Kampf zwischen Protestanten und Katholiken war ihm nicht entgangen. Aber er ließ sich wegen derlei Unbill nicht aus der Ruhe bringen und des Schlafs berauben. Denn auf seinen Schlaf achtete er mehr als auf alles andere. Schon seine Großmutter hatte stets, mit Blick auf die Bibel, gesagt: »Umsonst ist es, dass ihr früh euch erhebt und spät euch niedersetzt, das Brot der Mühsal zu essen. Ganz mit Recht gibt der Herr seinen Geliebten den Schlaf.« Und wer war Jeremiah Ingram, die weisen Worte der Heiligen Schrift anzuzweifeln?
Tatsächlich war Jeremiah mit einem ebenso tiefen wie traumlosen Schlaf gesegnet, der ihn morgens ausgeglichen und erholt aufstehen ließ. Während Lucilla oft nächtens wach lag oder sich träumend im Bett herumwälzte, vor Sorge um die Kinder oder den allgemeinen Lauf der Dinge, kannte Jeremiah weder drückende Nachtmahre noch quälende Schlaflosigkeit. Er ging abends zeitig zu Bett, schloss die Augen, fiel prompt in einen todesähnlichen Schlaf und wachte morgens frohgemut auf und begann den neuen Tag mit einem Lächeln auf den Lippen.
Dieser beneidenswerte Zustand änderte sich jedoch schlagartig in der Johannisnacht des Jahres 1606. Wie jedes Jahr im Juni wurde in Southwark, am Fuße der Brücke, ein großes Feuer entfacht, um die Mittsommernacht zu feiern und den kommenden Johannistag zu begehen. Doch anders als in den vergangenen Jahren sollte es diesmal ein richtiges »Bone-Fire« auf dem Platz vor dem Verrätertor geben, mit der Zugabe tierischer Knochen, wie einst bei den heidnischen Opferfeuern. Dieser alte gälische Brauch war zwar seit der Reformation verboten, doch das störte die betrunkenen Spaßvögel in Southwark nicht, die seit jeher in ihrem Viertel einen recht freimütigen Umgang mit Gesetz und Ordnung pflegten. So schlugen vor dem Verrätertor die Flammen in die Höhe und beleuchteten die abgeschlagenen und geteerten Köpfe der Verräter, dass es aussah, als würden sie sich bewegen.
Im Nachhinein wusste niemand zu sagen, wie es dazu gekommen war. Entweder hatte der Zahn der Zeit an den Lanzen genagt, auf denen die Schädel aufgepflanzt waren, oder irgendwelche Trunkenbolde waren aufs Tor geklettert und hatten sich einen ganz eigenen Spaß erlaubt. Wie dem auch sei, jedenfalls fiel plötzlich einer der geteerten Köpfe hinunter und landete direkt vor Jeremiahs Füßen. Nach einem ersten Schrei des Entsetzens johlte die Menge vor Vergnügen und forderte Jeremiah auf, den Schädel ins Feuer zu werfen.
Einige behaupteten, es handele sich um Guy Fawkes, den Anführer der papistischen Schießpulver-Verschwörer, doch das war wegen des Teers kaum auszumachen. Jeremiah hatte weit über das Maß getrunken und war blendender Laune. Mit einem unbedachten Fußtritt beförderte er den Kopf ins Feuer, was ihm einen tosenden Applaus einbrachte und das geteerte Haupt zur brennenden Fackel machte. Wie ein loderndes Menetekel.
In dieser Nacht wurde Jeremiah erstmals von einem seltsamen Traum heimgesucht, der ihn mitten in der Nacht schweißnass und wie gerädert aufwachen ließ. Er erklärte sich den Alpdruck durch den starken Branntwein, den er nicht vertrug und kaum gewohnt war, und dachte sich zunächst nichts dabei. Doch in der folgenden Nacht träumte er abermals schwer, und in der darauf folgenden erneut. Es waren insgesamt drei Träume, immer dieselben und stets in derselben Reihenfolge, die ihn fortan Nacht für Nacht quälten und nicht zur Ruhe kommen ließen. Und um seinen erholsamen Schlaf war es mit einem Mal geschehen.
Nach einiger Zeit erzählte er seiner Frau davon, und die legte ihm dringend ans Herz, Rat bei einer alten Frau im Marschland von Lambeth zu holen, die in dem Ruf stand, hellsichtig zu sein und in die Zukunft schauen zu können. Außerdem kenne sie sich mit Geistern und jenseitigen Geschöpfen aus. Jeremiah hielt nicht viel von solchen Ammenmärchen und lachte Lucilla aus. Doch als die Albträume nicht aufhören wollten und ihn auch körperlich zu schwächen begannen, suchte er die seltsame Alte auf, die fernab der City in einem Cottage im Sumpfland wohnte.
»Drei wiederkehrende Träume?«, knurrte die Frau und nickte bedächtig, als hätte sie derlei schon öfter gehört. »Und jede Nacht nur einen?«
Jeremiah bestätigte und erzählte: »In dem ersten Traum bin ich ein reicher Gentleman, wohne im wunderschönen Nonesuch-House auf der Brücke und lebe in Saus und Braus, wie es sich für einen angesehenen Alderman der City von London geziemt. Meine Frau ist fleißig und folgsam, unsere Kinder sind munter und fidel. Es ist eigentlich ein sehr schöner und angenehmer Traum, und dennoch wache ich anschließend zitternd und in Schweiß gebadet auf, als hätte ich den schwarzen Tod erblickt.«
»Und der zweite Traum?«, fragte die Alte.
»In der darauf folgenden Nacht träume ich, dass ich ein armer Müllergeselle bin, in den Getreidemühlen unter der Brücke. Die Arbeit ist mühselig und bringt mir so wenig ein, dass meine Familie an Krankheit und Hunger leidet. Der Meister prügelt und schikaniert mich, doch ich muss mich fügen und alles murrend ertragen, auch wenn mir das Blut unter den Nägeln hervorquillt und mir der geschundene Rücken zum Buckel wird.«
»Was geschieht in dem dritten Traum?«, fragte die Frau, deren Miene zusehends finsterer geworden war.
»Das ist der schlimmste Traum von allen. Immer in der Nacht nach dem Müller-Traum träume ich ihn. Darin bin ich ein verkrüppelter Bettler und lebe ohne Obdach in der Gosse auf der Brücke. Eine schreckliche Pest wütet in London, überall prangen rote Kreuze an den Häusern, meine Frau und meine Kinder hat die Seuche dahingerafft, und auch mir fault das verbeulte Fleisch von den Knochen. Ich krepiere langsam und elendig im Dreck der Gosse, wie die verflohten Ratten, die überall auf der Brücke zu Hunderten verrecken.«
»Guter Mann!«, entgegnete die Frau und schlug die Hände vor den Mund. »Woran habt Ihr Euch versündigt?«
»Was meint Ihr damit?«, wunderte sich Jeremiah.
»Ganz mit Recht gibt der Herr seinen Geliebten den Schlaf«, zitierte die Alte genau jenen Psalm, den auch Jeremiahs Großmutter so oft bemüht hatte. Dann fuhr sie fort: »Aber den Ungeliebten kann der Herr den Schlaf auch nehmen.«
»Wovon redet Ihr?«, fragte Jeremiah erschrocken.
»Ich wünsche Euch weiterhin einen festen Schlaf, braver Mr. Ingram. Hütet ihn wohl! Denn solltet Ihr während eines Traumes wach werden, so wird er zur Wirklichkeit. Und nichts wird mehr so sein wie zuvor.«
Zunächst war Jeremiah so erschrocken, dass ihm das Herz raste und der Atem fehlte. Doch auf dem Weg nach Hause, an der Themse entlang, erblickte er schließlich die London Bridge mit dem unvergleichlichen Nonesuch-House gleich neben der Zugbrücke, und er fand plötzlich Gefallen an dem Gedanken, als Gentleman in diesem Haus zu wohnen. Wenn die alte Frau Recht hatte, was er zugleich anzweifelte und doch ein wenig hoffte, dann bot dieser Traum ihm die Möglichkeit, zum Alderman der Stadt London zu werden und vom kleinen Krämerladen an der Gasse in die oberen Stockwerke des Nonesuch-House zu ziehen. Was konnte man sich mehr wünschen?
Also befahl er seiner Frau, ihn in der betreffenden Nacht zu wecken. Da die drei Träume stets in derselben Reihenfolge kamen und ihn in seinem Bett herumwälzen ließen, war es für Lucilla ein Leichtes, ihn zum richtigen Zeitpunkt aus dem Schlaf zu reißen. Seine Frau ahnte nicht, was er vorhatte, und tat gehorsam, wie ihr geheißen. Sie wartete, bis ihr schlafender Mann zu schwitzen und zu zucken begann, und weckte ihn.
Der Krämer wachte auf und war …
Jeremiah Ingram, Esquire, angesehener Kaufmann, Wappenträger und ehrenwerter Alderman der City von London.
Es war das Jahr 1616, die Engländer hatten sich an den seltsamen Schotten auf dem Thron und dessen Vorliebe für männliche Höflinge wie den Herzog von Buckingham abgefunden, und Jeremiah kehrte ohnehin lieber vor der eigenen Haustür. Sein Haus auf der Londoner Brücke, dessen obere Stockwerke er selbst bewohnte, war nämlich das schönste und eigentümlichste Gebäude in ganz London. Vor beinahe 40 Jahren hatte sein Vater das auffällige Fachwerkhaus mit seinen Zwiebeltürmen in Flandern errichten lassen, dann in nummerierten Einzelteilen nach London geschafft und dort auf der Brücke wieder zusammengesetzt. Nicht ein einziger Nagel oder eine Schraube waren in dem hölzernen Fachwerk zu finden, alles war ausschließlich mit Nuten, Federn, Keilen und Zapfen verbunden, eine handwerkliche Meisterleistung. »Nonesuch House« war, wie der Name schon sagte, ein Haus ohnegleichen.
Nicht nur das schöne Haus und sein großes Ansehen in London ließen Jeremiah glücklich und zufrieden erscheinen. Auch seine Frau Lucilla und die beiden Kinder bereiteten ihm viel Freude und selten Verdruss. An sein früheres Dasein als Krämer auf der Brücke konnte er sich nicht erinnern. Als hätte es niemals den Kleinwarenhändler Ingram gegeben.
Getrübt wurde sein erfülltes und reiches Leben allein durch zwei böse Träume, die ihn jede Nacht abwechselnd heimsuchten. Er träumte, er wäre ein armer und geschundener Müllergeselle in den Getreidemühlen unter der Pfeilern oder ein pestkranker und dem qualvollen Tod ausgelieferter Bettler auf der Brücke. Diese Träume quälten und beunruhigten Jeremiah derart, dass er eine Hellseherin in Lambeth aufsuchte, die ihm seine Frau ans Herz gelegt hatte.
Als er das kleine Cottage im Marschland betrat, wurde er von der alten Frau mit den merkwürdigen Worten empfangen: »Mr. Ingram, ich hatte Euch schon früher erwartet. Vor zehn Jahren, um genau zu sein. Ihr habt also meinen Ratschlag nicht befolgt.«
Jeremiah verstand nicht, was die seltsame Alte damit meinte, doch als er ihr berichtete, was ihm in den Nächten widerfuhr, und sie ihm weissagte, was die beiden Träume aus ihrer Sicht zu bedeuten hatten, da stieß er einen Schrei des Grauens aus. Zwar zweifelte er insgeheim daran, dass ein bloßer Traum zur Wirklichkeit werden könnte, doch um ganz sicher zu gehen, befahl er allen Bewohnern des Hauses, dass fortan nichts und niemand seine Nachtruhe stören oder ihn gar wecken dürfe. Selbst wenn das Haus in Flammen stünde oder die Themse über die Ufer trete. Sein Schlaf war ihm heilig.
Leider jedoch wurde seine kleine Tochter Nelly eines Nachts von starken Zahnschmerzen heimgesucht, die das kleine Mädchen jämmerlich schreien ließen. Weil sie sich nicht anders zu helfen wusste, lief sie entgegen dem Befehl ihres Vaters ins Schlafgemach der Eltern und weckte mit ihrem Gebrüll Jeremiah, während dieser unruhig träumte …
Als armer Müllergeselle wachte Jeremiah Ingram auf, um seine kleine Tochter zu beruhigen und ihre Zahnschmerzen mit einer Heilsalbe zu lindern, die er von seiner Mutter erhalten hatte. Diese lebte einsam und abgeschieden im Marschland von Lambeth und wurde von den Nachbarn wegen ihrer Heilkräuter und wirren Vorahnungen für eine Hexe gehalten. Jeremiahs Leben war eine einzige Mühsal, seine Arbeit war hart und brachte so wenig ein, dass seine Familie an Krankheit und Hunger litt. Der Müller prügelte und schikanierte ihn, und doch musste er sich fügen und alles stillschweigend ertragen, auch wenn ihm das Blut unter den Nägeln hervorquoll und ihm der geschundene Rücken allmählich zum Buckel wurde.
Sein Leben war auch deshalb so beschwerlich, weil ihm die viel zu kurzen Nächte keine Ruhe und Erholung brachten. Denn jede Nacht träumte er denselben grässlichen Traum von einem pestverbeulten Bettler auf der Brücke. Jede Nacht. Ein Traum, aus dem es scheinbar kein Erwachen gab.
Eines Nachts jedoch entzündete sich der Staub der Mühle. Der unvorsichtige und betrunkene Müllermeister hatte ein Fenster geöffnet, um Luft in den stickigen Raum zu lassen, in dem die Mühlräder sich lärmend im Kreis drehten. Dummerweise hatte der Müller vergessen, die Kerze zu löschen, die in einer Laterne neben dem Fenster stand. Es kam zu einer gewaltigen und unerklärlichen Explosion, wie man sie schon von anderen Kornmühlen gehört hatte, und durch die Wucht und den Lärm der Detonation wurde Jeremiah aus dem Schlaf gerissen, als er sich gerade unruhig träumend umherwälzte.
Er riss entsetzt die Augen auf und befühlte seinen Körper. Auf der Suche nach den Pestbeulen.
»Was ist mit dir?«, fragte Lucilla, die neben ihm im Bett lag und ebenfalls geweckt worden war.
»Was war das?«, fragte Jeremiah, der nicht verstehen konnte, was geschehen war. »Es hat einen Knall gegeben, oder?«
»Vermutlich das Feuerwerk«, antwortete seine Frau. »Es ist doch Johannisnacht. In Southwark haben die Leute bestimmt Schießpulver entzündet. Leg dich wieder hin, Jeremiah. Du hast nur schlecht geträumt. Du weißt, dass du den Branntwein nicht verträgst.«
Jetzt erst begriff Jeremiah, dass er immer noch als kleiner Krämer auf der Brücke lebte, dass dies die Mittsommernacht des Jahres 1606 war und dass er am Abend den geteerten Kopf des Guy Fawkes mit dem Fuß ins heidnische »Bone-Fire« gestoßen hatte.
Statt sich wieder hinzulegen, sprang Jeremiah auf und zog sich in Windeseile an. Er rannte über die Brücke und zum Verrätertor hinaus, wo das Freudenfeuer inzwischen niedergebrannt war. Unter den erstaunten Blicken und belustigten Kommentaren einiger übrig gebliebener Trunkenbolde stürzte er sich wie ein Verrückter in die immer noch glimmende Glut und hielt schließlich in den verbrannten Händen, wonach er gesucht hatte: Den Schädel des Verschwörers.
TOM FINNEK
UNTER DER ASCHE
Historischer Roman
DIE WICHTIGSTEN HANDELNDEN PERSONEN
In London
Geoff(rey) Ingram, die 13-jährige »Plage von Southwark«
Jez(ebel) Ingram, seine hübsche Schwester
Edward Ingram, Geoffs verschwundener älterer Bruder
Paul Ingram, sein pestkranker Vater
Eleanor Ingram, seine verschollene Mutter
Master Gerrard, Lehrer der Armenklasse,»Eremit von St. Olave«
Rat Scabies, Geoffs verrückter Nachbar und Rattenfänger
Rancid Ray, eigentlich Raymond Webster,Gauner und Taschendieb
Bernard & Marjory Collins, Wirte des»Boar’s Head Inn« in Southwark
Glen Matlock, Geoffs bester Freund
Mutter Southwood, Wirtin des »Maiden Inn« in Lambeth
Hum(ble) Southwood, ihre Tochter
Penelope, Fatty Fanny und Ada, Schankfrauenim »Maiden Inn«
James Hollar, ein junger Maler
Wenceslaus Hollar, sein Vater,böhmischer Kupferstecher und Radierer
In Surrey
Mildred Oldershaw, Bäuerin der»Twin Oaks Farm« in Oxshott
Josh(ua) Oldershaw, ihr Mann
Mary & Joseph, deren Kinder
Jane Holcombe, alte Magd der Oldershaws,Hebamme
John Platt, Gutsherr von Cobham Manor,Pfarrer der Gemeinde von St. Andrew
Margaret Platt, seine Frau
Robert Gavell, John Platts ermordeter Stiefsohn
Nathaniel Holcombe, Janes Sohn, Schafhirteund ehemaliger Digger
Tom Farynor, Sohn des königlichen Bäckersin der Londoner Pudding Lane
PROLOG
–––––
DIE DREIBEINIGE STUTE
»Here by the permission of heaven, hell broke loose on this protestant city,from the malicious hearts of barbarous Papists by the hand of their agent, Hubert,who confessed and on the ruins of this place declared this fact,for which he was hanged.«
(»Hier brach, mit Billigung des Himmels, die Hölle über diese protestantische Stadt herein, heraufbeschworen aus den heimtückischen Herzenbarbarischer Papisten durch die Hand ihres Erfüllungsgehilfen, Hubert,der geständig war und auf den Ruinen dieses Ortes offenbarte,wofür er gehängt wurde.«)
Inschrift einer Gedenktafel in Pudding Lane
–––––
Samstag, 27. Oktober 1666
London dämmerte. Ein warmes, rötliches Abendlicht legte sich wie ein unpassend gefärbtes Leichentuch über die Stadt und ließ die Verwüstung und Zerstörung noch unwirklicher erscheinen. Fast hatte es den Anschein, als glühten die verbrannten Überreste immer noch. Die hagere Gestalt stand seit etwa einer Stunde regungslos am Fenster und starrte hinaus ins Halbdunkel. Auch das Gesicht des Mannes war unbewegt, die knittrige fahle Haut schimmerte im Abendlicht, als wäre sie vom Fieber gerötet. Der weiße Haarschopf und die buschigen Augenbrauen schienen ebenfalls wie vom großen Feuer erfasst, das die gesamte City von London vor beinahe zwei Monaten in Schutt und Asche gelegt hatte. Noch immer lastete Brandgeruch auf den Häusern und dem Fluss, und manchmal kam es dem Mann so vor, als hätte sich dieser Gestank in seinem Kopf eingebrannt wie ein unsichtbares Kainsmal.
Durch das Fenster seiner Dachstube schaute er auf den Friedhof und die alte gotische Kirche von St. Olave. Dahinter sah er die breite Themse und am gegenüberliegenden nördlichen Ufer die niedergebrannten Ruinen der Häuser und Kirchen, die wie eine grässliche Verhöhnung ihrer einstigen Größe wirkten. Zur Linken wurde der Blick durch die London Bridge versperrt, deren dicht gedrängte und ausladende Häuser durch eine Baulücke am anderen Ende gerettet worden waren. Ein Brand vor über dreißig Jahren hatte diese Lücke gerissen und damit ein Übergreifen des furchtbaren Feuers auf die Südseite der Brücke und den Stadtteil Southwark verhindert. Vielleicht, ging es dem Mann durch den Kopf, machte es das nur noch schlimmer: dass sie ungeschoren und unbeschadet davongekommen waren.
Sein Blick wanderte vom hohlen Zahn des einst mächtigen Kirchturms der St. Paul’s Kathedrale zu den Hügeln von Hampstead und Islington am nördlichen Horizont, wo die Bewohner der City in den ersten Wochen nach dem Brand ihre Lager errichtet und vorübergehend Zuflucht gefunden hatten. Inzwischen waren viele wieder in die Stadt zurückgekehrt und hausten in Zelten oder provisorischen Hütten inmitten der Trümmer. Manche wohnten in den Kellern oder zwischen rußgeschwärzten Mauern unter freiem Himmel, andere fanden Unterkunft in den unversehrten Hallen und Kirchen am Stadtrand. Doch obwohl die einstmals lärmende und pulsierende City von London wieder bewohnt war, wirkte sie nun tot und gespenstisch, vor allem bei Nacht. Niemand wagte sich nach Sonnenuntergang auf die wenigen frei geräumten Straßen oder Trampelpfade, denn Diebe und Räuber trieben sich herum und suchten in den Ruinen nach zurückgelassenen Schätzen oder sonstigen brauchbaren Gerätschaften. Jede Katastrophe gebiert ihre Parasiten, dachte der Mann. Bei der Pest im vergangenen Jahr waren es die Quacksalber und falschen Propheten gewesen, nach dem Brand waren es das Diebesgesindel und die Bierbrauer, die ihre Trinkstände in der City errichtet hatten, bevor die Asche der Ruinen abgekühlt war.
Sein Blick schweifte weiter zu den Überresten des Rathauses und der königlichen Börse, die in dem Durcheinander kaum auszumachen waren, und verharrte schließlich bei der völlig zerstörten Kirche von St. Magnus am nördlichen Ende der Brücke. Ganz in der Nähe, nur einen Steinwurf entfernt, befanden sich die Pudding Lane und die Bäckerei des Thomas Farynor, in der das schreckliche Feuer am ersten Sonntag im September seinen Anfang genommen hatte. Östlich davon, direkt am Ufer, sah der Mann den Fischmarkt von Billingsgate und das Zollamt, beide nicht mehr als solche zu erkennen. Beinahe alles, was sich innerhalb der Stadtmauern befunden hatte, war niedergebrannt, eingestürzt und schwarz verkohlt. Mehr als hunderttausend Menschen hatten ihr Obdach verloren, Zehntausende Häuser, Hunderte Straßen und zahllose Kirchen waren verwüstet und zerstört. Sie waren nur noch unkenntliche Überreste eines monströsen Scheiterhaufens. Nur der Tower von London stand wie eh und je auf seinem Hügel, als hätte er mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun gehabt. Wie durch ein Wunder war die Festung östlich der Stadtmauer von den Flammen verschont worden. Aber an Wunder glaubte der Mann schon lange nicht mehr.
»Master Gerrard!«, hörte er plötzlich eine aufgeregte und atemlose Jungenstimme hinter sich. Die Zimmertür, die nie verriegelt war, fiel krachend ins Schloss.
Ohne sich nach dem Jungen umzudrehen, fragte der Mann: »Robert Hubert ist tot?«
»Ay, Master«, antwortete der Junge, der nicht mehr Kind, aber noch nicht erwachsen war und dessen ärmliche Kleider zerschlissen und verdreckt waren. »Die dreibeinige Stute hat den Franzosen gefressen«, setzte er hinzu und blieb nahe der Tür stehen, als wolle er gleich wieder Reißaus nehmen.
»Geoffrey Ingram!«, sagte Master Gerrard tadelnd.
»Aber alle nennen den Galgen von Tyburn so«, beharrte der Junge, nahm die Mütze vom Kopf und fuhr sich mit gespreizten Fingern durch das rotblonde Haar. »Steht auf drei Beinen wie ein Schemel, nur sitzen kann man nicht drauf. Und statt Zügeln und Zaumzeug gibt’s ’nen dicken Strick mit ’ner Schlinge.«
»Der Henker hat also ganze Arbeit geleistet?«, fragte Master Gerrard verbittert.
»Na ja, ganz wie man’s nimmt.« Der Junge verstummte und biss sich auf die blassen Lippen.
Verwundert wandte sich der Mann um. »Was heißt das?« Er winkte den Jungen zu sich. »Was ist geschehen?«
Geoffrey räusperte sich und kam zögernd näher, schließlich murmelte er: »Sie haben ihn in Stücke gerissen.«
»Wie meinst du das?«
»So wie ich’s sage«, antwortete der Junge achselzuckend und zog die Nase kraus. »Sie haben ihn zerfetzt.«
»Wer? Wen? Wieso?« Master Gerrard packte den Jungen am Kragen und schüttelte ihn, dass ihm die Mütze aus den Händen fiel. »Nun red schon, Bengel! Oder soll ich’s aus dir rausprügeln?«
»Tja«, druckste Geoffrey herum und schien nach den rechten Worten zu suchen. »Erst war alles ganz normal und wie immer. Nur dass mehr Leute da waren als sonst. Zwei Tribünen haben sie aufgebaut, damit auch alle was sehen können. Erst hat der Henker eine Rede gehalten, dann kam der Priester, und dann haben sie den Franzosen auf einen Pferdekarren gestellt und ihm den Strick um den Hals gelegt. Anschließend hat der Henker dem Pferd die Peitsche gegeben, und der Franzose hat gebaumelt und gezappelt, bis er tot war. Das hat ganz schön gedauert, weil sich keiner an seine Beine gehängt hat.«
Master Gerrard ließ den Jungen los und bekreuzigte sich.
»Beinahe ’ne Stunde hat der danach noch gehangen, wie’s so üblich ist bei Hinrichtungen, und der Henker hat an einem der drei Pfähle gehockt und ’ne Tonpfeife geraucht, als würde er das schöne Wetter genießen. Dann hat er ihn schließlich runtergenommen, und ein Arzt hat festgestellt, dass der Franzose tot ist. War ja nicht zu übersehen.«
»Und weiter?«
»Sie wollten ihn auf den Karren hieven, aber dazu kam’s nicht mehr.« Der Junge schüttelte den Kopf, als könne er nicht glauben, was er gesehen hatte. »Normalerweise gehen die Leute nach Hause, wenn der Mann am Strick nicht mehr zappelt. Gibt ja nichts mehr zu sehen. Aber diesmal war’s anders. Alle sind geblieben, als würden sie auf ’n weiteres Spektakel warten, keiner hat sich vom Fleck gerührt. Und als der tote Franzose auf den Karren geladen werden sollte, da haben sie sich plötzlich auf ihn gestürzt. Alle! Wie auf ein Kommando. Plötzlich hatten sie Nägel und Messer in der Hand, und wenn der Henker und der Doktor nicht beiseitegesprungen wären, hätten sie die auch kaltgemacht.« Geoffrey schluckte, er presste die Lippen aufeinander, und plötzlich liefen ihm Tränen über die sommersprossigen Wangen. »Sie haben ihn mit den Nägeln und Messern bearbeitet, bis nichts mehr von ihm übrig war. In tausend Stücke haben sie ihn zerlegt. Und den abgeschnittenen Kopf haben sie wie einen Ball hin und her geworfen und mit Füßen getreten.«
»Oh, mein Gott!« Master Gerrard vergrub das Gesicht in den Händen und murmelte: »Was für Dummköpfe und Tölpel! Wie kann man nur so verblendet und einfältig sein? ›Lüge und Unwahrheit herrschen im Land‹, spricht der Herr, ›von Bosheit zu Bosheit schreiten sie voran.‹« Plötzlich hob er ruckartig den Kopf, starrte den Jungen an und rief: »Das ist unser Werk, Geoffrey! Wir haben das Blut dieses armen Menschen an unseren Händen.«
»Ihr, Sir? Was habt Ihr denn mit dem Feuer zu tun?«
»Es hängt alles zusammen, merkst du das nicht? Wir alle haben gelogen oder die Wahrheit verschwiegen, und deshalb musste der Franzose sterben.«
»Aber er hat gestanden«, sagte der Junge und wischte sich die Tränen aus dem vor Schmutz starrenden Gesicht. »Das hätte er doch nicht tun müssen. Wieso macht er so was? Was können denn wir dafür, dass er sagt, er war’s? Selbst unter dem Galgen hat er wiederholt, dass er das Feuer gelegt hat. Als wär er stolz darauf. Dann muss er sich nicht wundern, wenn sie ihn hängen.«
»Wir wissen es besser, Geoffrey«, antwortete Master Gerrard. »Sie brauchten einen Sündenbock und haben sich einen hinkenden Schwachkopf gegriffen, der weder geistig noch körperlich in der Lage war, ein derartiges Komplott zu schmieden, wie es ihm angelastet wird. Und wieso haben sie das getan? Nur weil er ein Franzose und angeblich ein Spion des Papstes war. Dummes Zeug!«
»Er hat gestanden«, beharrte Geoffrey mit störrischer Miene.
»Pah!«, schnaufte Master Gerrard und starrte aus dem Fenster. Die Sonne war inzwischen untergegangen, der Himmel über der Brücke war blutrot, Dunkelheit senkte sich auf die Stadt herab und ließ ihre Umrisse verschwimmen. »Nicht einmal seine Richter haben ihn für schuldig gehalten. Nur die Geschworenen haben das unsinnige Geständnis für bare Münze genommen, aber die Jury bestand ja auch größtenteils aus der Familie des Bäckers.«
»Farynor«, sagte Geoffrey und nickte.
»Das ist aber alles völlig unerheblich. Die Frage ist nämlich: Sind wir schuldig?«
»Was hätten wir denn tun sollen, Sir?«, fragte der Junge leise.
»Genau das ist der entscheidende Punkt«, entgegnete Master Gerrard.
»Sie hätten mir kein Wort geglaubt, wenn ich ihnen die Wahrheit erzählt hätte«, murmelte Geoffrey. »Nicht, solange Jez verschwunden ist und der Sohn des Bäckers …« Er ließ den Satz unbeendet, schüttelte stattdessen den Kopf und sagte: »Sie hätten mich einen Lügner genannt.«
»Mag sein«, erwiderte Master Gerrard gedankenverloren. »›Einer täuscht den anderen‹, spricht der Herr, ›Wahrheit redet man nicht.‹« Plötzlich fuhr er herum und schaute sich im Zimmer um, ohne in der Dunkelheit wirklich etwas erkennen zu können. »Deshalb müssen wir anfangen zu graben.«
»Graben, Sir?«, wunderte sich der Junge.
»Was siehst du, wenn du auf die Stadt schaust?«, fragte Master Gerrard und deutete aus dem Fenster.
»Weiß nicht«, antwortete Geoffrey achselzuckend. »Dunkle Nacht?«
»Schwarze Asche, mein Junge«, verbesserte Master Gerrard. »Doch unter der Oberfläche glimmt und glüht es, dass man sich verbrennen kann, auch jetzt noch, man muss nur tief genug graben.« Er bückte sich, kramte auf seinem Schreibtisch und in den verstreut liegenden Papieren herum und sagte: »Deshalb werden wir auf der Stelle damit anfangen.«
»Womit?«
»Wir graben nach der Wahrheit!«, rief Master Gerrard und hielt einen Gänsekiel in der Hand. »Auch wenn sie niemand hören oder glauben will.«
»Das ist eine Feder, Sir.« Geoffrey hob zweifelnd die Augenbrauen.
»Du sagst es«, antwortete Master Gerrard und drückte sie dem verdutzten Jungen in die Hand. »Eine Feder.«
ERSTER TEIL
–––––
DARK ENTRY
»The borough is reputed to be a somewhat dirty suburb of London,in which chiefly poor people live, and in which many foul and disagreeabletrades are carried on. It was not always so.«
(»Der Bezirk gilt als etwas dreckiger Vorort von London,in dem vor allem arme Leute leben und in dem viele übleund fragwürdige Geschäfte abgewickelt werden.Das war nicht immer so.«)
William Rendle, »A few particulars of Old Southwark«
–––––
1. KAPITEL
Handelt von einem dunklen Eingangund einem Rattenfänger
Meine Familie hatte schon immer ein glückliches Händchen, wenn es darum ging, die falschen Dinge zur falschen Zeit zu tun. Ich weiß, man kann sich seine Sippschaft nicht aussuchen, und Blut ist bekanntlich dicker als Wasser, wenn’s nicht gerade die stinkende Brühe der Themse ist. Ich will auch nicht undankbar erscheinen oder herumjammern. Ich sag nur, wie ich’s sehe, und das wird ja wohl noch erlaubt sein.
Nehmt zum Beispiel meine Mutter. Als ihr klar wurde, dass das triste Familienleben nichts für sie war und sie nicht an der Seite eines armseligen Fährmanns an der Themse leben wollte, war sie dreißig Jahre alt und hatte diesem Flussschiffer gerade das dritte Kind geschenkt: mich! Was sie jedoch nicht davon abhielt, nur einen Monat nach der Geburt ihr Bündel zu schnüren, Mann und Kinder zurückzulassen, sich einem herumziehenden Soldatentross anzuschließen und auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Das war vor etwas mehr als dreizehn Jahren, im Sommer 1653, und wenn ich ehrlich bin, kann ich’s ihr nicht einmal verdenken. Vielleicht hätte ich’s genauso gemacht. Aber trotzdem war’s das Falsche zur falschen Zeit, wenn ihr mich fragt.
Mit meinem Vater verlief’s ganz ähnlich, wenn auch auf völlig andere Art und geraume Zeit später. Es war vor einem halben Jahr, im Mai 1666. Über Monate hinweg waren die Leute wie die Fliegen an der Pest gestorben, das ganze vergangene Jahr waren sie in London krepiert, als wollte die Stadt binnen kürzester Zeit aussterben. Jedes zweite Haus war mit dem Krankheit und Tod verkündenden roten Kreuz und dem frommen Wunsch »Herr erbarme dich unser!« gezeichnet. Man hatte Mühe, die Unmengen an Leichen fortzuschaffen und in geweihter Erde Platz für sie zu finden. Nur unser elendes Dark Entry, eine winzige Sackgasse am Südende der London Bridge, war bislang verschont geblieben. Was beinahe ein Wunder war, wenn man bedachte, was für kranke Kreaturen dort hausten – und damit meine ich ausnahmsweise nicht meine Familie.
Als es im Dezember des vergangenen Jahres hieß, die Pest sei am Abklingen, und in den folgenden Wochen immer weniger Leute an der Seuche starben, atmeten alle Londoner erleichtert auf. Der Winter ging, der Frühling kam, die Pest schien besiegt und hatte ihren Schrecken verloren. Es gab vereinzelte Freudenfeuer, Dankgottesdienste wurden abgehalten, die Gasthäuser waren wieder bis weit in die Nacht geöffnet. Die feinen Herrschaften (unter ihnen der König) kehrten von ihren Landsitzen in die Stadt zurück, und von den Kanzeln predigten die Pfaffen, die ebenfalls das Weite gesucht hatten, der Herr im Himmel habe endlich das Flehen der sündigen Menschen erhört. Hinter vorgehaltener Hand munkelten einige, die Seuche sei eine Strafe Gottes für die losen Sitten am königlichen Hof gewesen. Doch nun war das Schlimmste überstanden, da waren sich alle einig. Erleichterung machte sich breit.
Nur mein Vater hatte nichts Besseres zu tun, als sich im Mai 1666 die eitrigen Beulen auf den Buckel zu holen und binnen weniger Tage an der Pest einzugehen. Hat man so etwas Dummes schon gehört?
Vermutlich merkt ihr bereits, was mit meiner Familie los ist: Sie hat kein Gespür für den rechten Zeitpunkt. Und ihr verzeiht hoffentlich, dass ich mich erst jetzt vorstelle: Mein Name ist Geoffrey Ingram, geboren am 30. Juli 1653, als Sohn von Paul und Eleanor Ingram, Bruder von Jezebel und Edward, bis vor Kurzem wohnhaft am hinteren Ende des Dark Entry, im Borough von Southwark, London, Königreich England. Nicht sehr aufschlussreich, oder? Aber mehr gibt’s eigentlich nicht über mich zu sagen, zumindest nichts, was teure Tinte und Papier wert wäre. Ich bin nur ein einfacher Bursche, weder besonders klug und erst recht nicht wohlhabend. Kaum der Rede wert oder wie mein Bruder Edward zu sagen pflegte: »So nützlich wie ein verdammter Kropf.« Und weil das so ist, handelt das, was ich auf diesen Seiten berichten werde, auch weniger von mir als von anderen Personen, die mir über den Weg gelaufen sind oder sich aus sonstigen Gründen in mein Leben eingemischt haben. Ob ich’s nun wollte oder nicht. Von meiner Schwester Jezebel beispielsweise, die sozusagen eine Meisterin der falschen Dinge zur falschen Zeit ist. Oder dem Eremiten von St. Olave, der allerdings kein Mitglied der Familie ist, auch wenn ich Master Gerrard – wie er eigentlich heißt – öfter zu Gesicht bekam, als mir und ihm lieb sein konnte. Aber das werdet ihr alles noch früh genug erfahren. Immer hübsch der Reihe nach.
Zunächst will ich euch meine alte Nachbarschaft beschreiben, damit ihr einen ungefähren Eindruck bekommt, womit ihr es hier zu tun habt. Mein Vater hat oft gesagt: »Wir wohnen im Hinterhof von London, mein Junge. Und du weißt ja, was man im Hinterhof findet. Den Unrathaufen, die Sickergrube und das Scheißhaus.« Vermutlich darf man solche Worte gar nicht zu Papier bringen, und es würde mich nicht wundern, wenn die Tinte vor Scham durchsichtig würde, aber so hat er’s nun mal gesagt, und gemeint hat er damit Folgendes: Alle Welt kannte London. War ja eine riesige Stadt mit vielen Straßen, einem Gewimmel von Häusern, unzähligen Einwohnern, mächtigen Kirchen und einer hübschen Stadtmauer drum herum. Das Zentrum der Zivilisation, wie manche behaupteten. Die Stadt Gottes, sagten andere. Und obwohl Southwark ein Stadtteil von London war, gehörte es nicht wirklich dazu, denn es lag sozusagen auf der falschen Seite des Flusses. Ihr müsst euch das wie eine riesige Sanduhr vorstellen, mit der London Bridge wie ein steinernes Nadelöhr in der Mitte.
Während es oben in der City das Rathaus, die Kathedrale von St. Paul, die königliche Börse und den mächtigen Tower gab, fand man unten in Southwark nur Wirtshäuser, Bordelle, Abdecker, Brauereien und Gefängnisse. Wenn London bekannt und berüchtigt war für seinen Lärm und Trubel, dann war es Southwark für seinen Gestank. Ein einziger riesiger Unrathaufen eben. Und was Southwark für London war, das war unser Dark Entry für Southwark. Der Hinterhof vom Hinterhof, wenn’s so was überhaupt gibt.
Eigentlich war es nicht einmal eine richtige Straße, vielmehr die Rückseite eines Hofs, zu der man von der Hauptstraße aus nur gelangen konnte, weil das Haus, das den Dark Entry von der Straße absperrte, vor einigen Jahren abgebrannt war. Deswegen hieß es ja Dark Entry: weil der Eingang schwarz verkohlt war. Ich lebte also in einer winzigen Sackgasse, die weder als Straße noch als Platz gedacht und eher zufällig entstanden war. Wahrscheinlich versteht ihr gar nicht, was ich mit meinem Gerede eigentlich sagen will, also versuch ich’s noch mal von vorn: In unserem Borough gab’s eine Hauptstraße, die von Süden aus geradewegs zur Brücke führte. Der einzigen Brücke über die Themse, jedenfalls in London. An dieser Straße wimmelte es von Gasthöfen, Wirtshäusern und Absteigen, die jeweils durch eine kleine Einfahrt und über einen ringsum bebauten Innenhof zu erreichen waren. Eine dieser Schänken war das »Boar’s Head Inn«, wo ich bis vor Kurzem als Laufbursche und Hausknecht geschuftet hatte, und wenn man am Ende des Hofs an den Misthaufen und Latrinen vorbei zur Rückseite des Gasthofs ging, gelangte man zum Dark Entry, der sich sozusagen im Schatten des »Boar’s Head« befand. Weil vorne an der Hauptstraße das Haus abgebrannt und eingestürzt war, musste man natürlich nicht mehr über die Misthaufen steigen, aber das sagte ich bereits.
Nur drei winzige und windschiefe Häuschen gab’s in unserer Straße, für mehr wäre gar kein Platz gewesen. Eigentlich waren sie nichts anderes als ehemalige Ställe oder Geräteschuppen, die man notdürftig zu Wohnungen umgebaut hatte. So war unser Haus früher ein Hühnerstall und Taubenschlag gewesen, und unsere winzigen Schlafkammern unterm Dach waren die Verschläge gewesen, in denen immer noch der Taubendreck an den Wänden klebte. Nicht dass ihr einen falschen Eindruck von unserem »Haus« bekommt.
Um euch zu erklären, was ich vorhin mit den kranken Kreaturen meinte, will ich euch einen meiner ehemaligen Nachbarn vorstellen: den alten Rat Scabies vom vorderen Ende des Dark Entry. Na, werdet ihr jetzt sagen, »Ratte Krätze«, das ist aber ein seltsamer Name für einen ausgewachsenen Mann, denn das war er. Sicherlich fragt ihr euch: Wie kann man denn mit Vornamen wie ein Nager und mit Nachnamen wie eine Krankheit heißen? Das will ich euch gern erklären.
»Scabies« wurde er genannt, weil er die Krätze hatte, solange ich denken konnte. Seine Haut war schon ganz grau und welk, weil die Kratzwürmer sie wie Maulwürfe durchlöchert und aufgewölbt hatten, dass die Haut in großen Fetzen abschuppte. Das war kein schöner Anblick, das könnt ihr mir glauben, vor allem bei Mondlicht, dann war die Haut so bleich und rissig wie bröckelnder Kalk. Und »Rat« hieß er, weil er einen echten Rattenfimmel hatte. Den hatte er seit der letzten großen Pest im Jahr 1625, wo ihm seine junge Frau Eliza und zwei Kinder abhandengekommen waren. Rat hat sie wohl sehr geliebt, also nicht die Pest, sondern seine Frau, und aus irgendeinem Grund glaubte er seit Elizas Tod, die verdammten Ratten hätten die Seuche nach London gebracht. Was natürlich Unsinn war, weil jeder wusste, dass der warme Südwind den Pesthauch herwehte und Hunde und Katzen ihn über die Stadt verbreiteten. Deswegen hatte man die Viecher ja auch im letzten Jahr zu Tausenden totgeschlagen und sogar Kopfgeld für jeden Kadaver gezahlt. Rat aber wollte davon nichts wissen, er blieb bei seinen Ratten und sagte, dass die Nager zu Hunderten krepiert seien, kurz bevor’s mit der Pestilenz losging. Und genauso sei’s vor vierzig Jahren gewesen. Erst die Ratten, dann die Menschen.
Nun ja, Rat war ein verdammter Sturkopf, und was einmal in seinem runzligen Schädel war, das brachte keiner mehr heraus. Also machte er seit Jahrzehnten Jagd auf Ratten, schlug sie tot, wo er sie kriegen konnte, und freute sich wie ein Kind über jeden stinkenden Kadaver. Mit seinem Verstand stand’s eindeutig nicht zum Besten, das könnt ihr mir glauben. Vor lauter Rattenfang kam er kaum noch dazu, mit seinem Bauchladen durch die Straßen zu ziehen und seine Kurzwaren zu verkaufen, denn eigentlich war Rat ein fahrender Händler. Früher jedenfalls. Unter den Nagern schien sich inzwischen herumgesprochen zu haben, dass Rat ihnen auf den Fersen war, denn in unserer Straße sah man sie kaum noch. Waren ja schlaue und gescheite Tierchen. Aber es genügte unserem alten Rat nicht, die Viecher nur zu töten, nein er verbrannte sie anschließend, weil er meinte, dass man den leibhaftigen Satan nur mit Feuer bekämpfen könne. So stünde es in der Bibel, sagte er. Und darum zündelte er wie ein königlicher Feuerwerker und röstete seine Ratten.
Wenn ihr jetzt eins und eins zusammenzählt, werdet ihr vermutlich erraten, wieso das Haus an der Hauptstraße vor Jahren niedergebrannt ist. Es wurde nie wirklich geklärt, wie’s zu dem Brand kam, und keiner hat den guten Rat Scabies je beschuldigt, aber ich bin mir sicher, dass alles mit einer brennenden Ratte angefangen hatte. Ganz schön verrückt, oder? Aber so ist das mit der Liebe, sie schlägt gern in Wahnsinn um, das ist zumindest meine bescheidene Erfahrung, und genau davon handelt diese Geschichte. Vom Irrsinn der Liebe. Nach dem Tod seiner Frau hat Rat jedenfalls kein Lebewesen mehr an sich herangelassen, außer den Kratzwürmern natürlich, aber die zählten vermutlich nicht. Wie Rat Scabies in Wahrheit hieß, wusste übrigens kein Mensch. Da alle ihn nur mit seinem Spitznamen riefen, hatte er’s wahrscheinlich selbst vergessen.
Wieso hab ich euch das jetzt eigentlich erzählt? Ach ja, um euch einen Eindruck von der Nachbarschaft zu geben, in der ich groß geworden bin. Den habt ihr ja nun, und ich kann endlich mit meiner Geschichte beginnen. Das Problem ist nur, dass ich nicht recht weiß, wo und wie ich anfangen soll. Habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt, was? Ist schließlich das erste Mal, dass ich so was mache, und wenn der Eremit von St. Olave mir nicht Gänsefeder und Papier in die Hand gedrückt und mich regelrecht gezwungen hätte, mit dem Schreiben anzufangen, hätte ich’s gleich gelassen. Was soll’s auch bringen, es macht die Dinge ja nicht ungeschehen.
Natürlich könnte ich mit meiner Geburt anfangen, mit dem Verschwinden meiner Mutter und mit meiner verlotterten Kindheit in Southwark, aber das würde zu weit führen und euch nur langweilen. Andererseits wär’s ebenso denkbar, mit dem furchtbaren Feuer von London zu beginnen, das vor wenigen Wochen in Windeseile beinahe die ganze Stadt zerstört hat, aber das würde bedeuten, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Und das ist bekanntlich niemals ratsam. Auf das Feuer komme ich ja am Ende noch ausführlich zu sprechen. Alles zu seiner Zeit!
In gewisser Weise hat der ganze Schlamassel an dem Tag angefangen, als meine Schwester Jezebel verschwand. Eigentlich müsste ich sagen: als sie zum ersten Mal verschwand, denn später hat sie es ein zweites Mal getan und sich damit gleich doppelt als würdige Tochter ihrer Mutter erwiesen. Ich sagte ja bereits, dass meine Schwester eine Meisterin der falschen Dinge zur falschen Zeit ist. Doch während meine Mutter eine Geburt – meine! – zum Anlass nahm, das Weite zu suchen, war es bei Jezebel ein Todestag. Der unseres Vaters!
2. KAPITEL
In dem von der Pest und einer Nachricht die Rede ist
Es war vor einem halben Jahr, am 29. Mai 1666, dem Dienstag vor Pfingsten. Das weiß ich so genau, weil’s der Geburtstag vom König war. Und Restaurationstag obendrein. Vor genau sechs Jahren war der vertriebene König Charles – also der Sohn von dem geköpften König Charles – unter dem Jubel seiner Untertanen aus Frankreich nach London zurückgekehrt, eigentlich ein Tag zum Feiern und Frohlocken. Nur nicht in unserem Haus. Schon in der Frühe, als überall in London die Kirchenglocken den Feiertag einläuteten, war abzusehen, dass unser Vater den nächsten Morgen nicht mehr erleben würde.
Die Pest war eine seltsame Sache, man begriff einfach nicht, was es damit auf sich hatte. Manche Kranken hatten wochenlang Beulen unter den Achseln, am Hals und zwischen den Beinen, waren aber ansonsten putzmunter, andere bekamen auf der Stelle Fieber, spuckten Blut und starben binnen kürzester Zeit, obwohl überhaupt keine Beulen oder eitrigen Furunkel zu sehen waren. Bei unserem Vater war’s die Beulenpest, das ist sicher, aber wie lang er schon krank war, kann ich nicht genau sagen. Er war vor lauter Dreck beinah schwarz an den Händen und im Gesicht, sodass man die Beulen und Pusteln kaum sehen konnte, außerdem hatte er in den Tagen zuvor immer nur betrunken auf seinem Stroh in der dunklen Ecke der Stube gelegen und sich mit Brandy zugeschüttet. Zur Arbeit war er schon seit Wochen nicht mehr gegangen, daran war in seinem Zustand nicht zu denken gewesen, ständig hat er den Fusel in sich hineingekippt. Wahrscheinlich weil er die brandigen Beulen bemerkt hatte und sich lieber totsaufen wollte, als elendig an der Pest zu krepieren. Hat nur nichts genützt, so schnell starb ein geübter Säufer nicht am Suff. An diesem Dienstag kamen jedenfalls das Schüttelfieber und die Ohnmacht, immer abwechselnd, und an den schwarzen Bläschen um die Augen konnte ich erkennen, dass es nicht mehr lange dauern würde. Wer die schwarzen Linsen an den Augen hatte, der war so gut wie hinüber. Gevatter Tod stand schon vor der Tür und wetzte die Sichel.
War ein ganz schöner Schreck für mich, meinen Vater so zu sehen, denn die Pest bedeutete nicht nur den meist sicheren Tod für den Kranken, sondern auch für alle anderen im Haus. Selbst wenn die gar nicht krank waren. Sofort kamen die Männer mit der roten Farbe, schmierten das vermaledeite Kreuz an die Tür und nagelten das Haus für vierzig Tage zu, samt allen Unglücklichen, die darin wohnten. Und dann: »Herr erbarme dich unser!« Wachmänner mit Hellebarden wurden vor dem Haus postiert, damit niemand entkommen konnte. Mitgefangen, mitgehangen. Quarantäne nannte man das, hat der Eremit von St. Olave gesagt. Ein hässliches Wort für eine hässliche Sache.
Während ich noch überlegte, wie und wohin ich unseren Vater heimlich fortschaffen sollte, wenn er denn erst mal gestorben war, und ob ich mich vielleicht längst angesteckt hatte, hämmerte es an der Tür, als hätten die Männer mit der Farbe bereits Wind von der Sache gekriegt. Am liebsten hätte ich mich hinterm Herd versteckt, das könnt ihr mir glauben. Es waren aber keine Amtsbüttel, die vor der Tür standen, sondern der junge Bernie Collins, der Sohn vom alten Bernard Collins, dem Wirt vom »Boar’s Head«. Er steckte den Kopf zur Tür rein und fragte: »Jez da?«
Bernie war immer etwas mundfaul, mit langen Sätzen hatte er’s nicht so. Da war er wie sein Vater. Selten mal mehr als drei Worte und meistens gebrüllt: »Mach dies, mach das, zieh Leine, halt’s Maul!«
Ich schaute mich in unserer düsteren Stube um, als müsste ich mich erst vergewissern, und sagte: »Nee, sieht nicht so aus.« Aus Vaters Ecke kam kein Mucks, er war wohl gerade wieder in Ohnmacht gefallen.
»Soll schleunigst rüberkommen«, sagte Bernie und lugte um die Ecke. »Der Alte tobt schon wieder. ’ne Menge Gäste zum Mittag. Und von Jez nichts zu sehen.« Er machte eine Pause nach der langen Rede und setzte hinzu: »Wo steckt ’n die?«
»Keine Ahnung«, antwortete ich und wollte die Tür schließen, »ist mir seit gestern Abend nicht unter die Augen gekommen.«
»Soll ihren Arsch rüberschieben. Sag ihr das!«
Ich nickte und antwortete: »Wird gemacht.«
Jezebel arbeitete wie ich im »Boar’s Head«, doch während ich die Ehre hatte, den Boden zu säubern, Kisten und Flaschen herumzuschleppen, die Spucknäpfe zu entleeren und sonstige Drecksarbeit zu erledigen, war Jez für die Küche und die Bedienung der Gäste zuständig. Auch kein Zuckerschlecken und genauso schlecht bezahlt, aber immerhin eine anständige Arbeit, wenn die Gäste nicht allzu betrunken waren und ihr untern Rock griffen. Was jedoch nur selten vorkam. Höchstens dreimal am Tag.
Bernie fasste sich an die Mütze, die ihm wie ein umgestülpter Nachttopf auf dem Schädel saß, und wollte unsere ärmliche Hütte bereits wieder verlassen, als Vaters Ohnmacht ins Schüttelfieber umschlug. Ein echter Ingram, keine Frage!
»Was war ’n das?«, fragte Bernie.
»Mein alter Herr hat mal wieder einen übern Durst getrunken.«
»Hört sich an, als würd er krepieren.«
»Wenn’s mal so wäre«, antwortete ich und lachte laut. »Der Alte ist zäh, das bisschen Branntwein bringt den nicht um. Der kann einiges vertragen.«
Bernie hatte inzwischen die Tür wieder aufgestoßen und schielte in die Ecke, in der sich mein Vater auf seinem Strohsack hin und her wälzte und dabei zuckte und viehische Töne von sich gab, die man gar nicht aufschreiben kann, weil’s keine Buchstaben dafür gibt.
»’n Bad in der Themse müsste der nehmen.« Bernie grinste wie eine Bulldogge. »Das hat noch jeden Säufer kuriert. Auf ’nem Stuhl festbinden, ran an den Flaschenzug und ab ins Wasser. Wie bei den zänkischen Weibern. Bis sie zur Besinnung kommen.«
»Gestern haben sie wieder ’ne alte Vettel an der Bankside in die Themse getitscht«, sagte ich und packte Bernie, der sich dem Strohsack nähern wollte, an der Schulter. »Muss ein ziemliches Spektakel gewesen sein. War die Frau von ’nem armen Schlucker, der seine Schulden nicht zahlen konnte und den sie unten im Clink-Gefängnis eingelocht haben. Wahrscheinlich hat das Weib zu laut gekeift und sich beschwert, drum haben sie ihr das lose Maul gestopft.« Die ganze Zeit versuchte ich, Bernie von meinem Vater fernzuhalten, damit er das verbeulte und brandige Gesicht nicht zu sehen bekam.
»Hm«, machte Bernie und zuckte mit den Schultern. »Hauptsache, es gab was zu lachen.« Er deutete auf meinen Vater, der sich auf dem Boden wand und seltsam gurgelnde Geräusche von sich gab: »Ist der immer so?«
»Nur wenn er Selbstgebrannten gesoffen hat. Der wird noch mal blind von dem Fusel, das sag ich dir.«
»Armer Teufel!«
Zum Glück wurde mein Vater in diesem Moment wieder ohnmächtig. Er schrie einmal laut auf und verfiel dann in eine plötzliche Starre, dass er aussah wie eine Leiche. Bernie erschrak, schüttelte sich und stammelte: »Grundgütiger!« Er wandte sich schleunigst um, ging zur Tür zurück und verabschiedete sich mit den Worten: »Sag’s ihr!«
»Soll ihren Arsch rüberschieben, ich weiß.«
»Gilt auch für dich«, knurrte er.
»Bin erst am Nachmittag wieder dran, weißte doch.«
»Verdammter Faulpelz!« Und draußen war er.
Erleichtert schloss ich die Tür und vergewisserte mich, dass Vater ruhig auf seinem Strohsack lag. Obwohl kaum Licht durch das winzige Fenster in die Stube kam, konnte ich sehen, dass seine Stirn schweißgebadet war und er sich im Krampf die Lippen blutig gebissen hatte. Es ging wirklich zu Ende mit ihm. Und obwohl ich eigentlich kein gutes Wort über meinen alten Herrn verlieren konnte, tat’s mir irgendwie leid um ihn. Sicher, er war ein verdammter Trunkenbold, der auf alles eindrosch, was sich bewegte, vor allem wenn es sich um Mitglieder seiner Familie handelte. Kein Wunder, dass Mutter sich den Soldaten angeschlossen und Edward ihn vor zwei Jahren beinahe umgebracht hatte. Beides mit dem gleichen Resultat: Sie waren weg und würden nie wiederkommen. Aber ihn jetzt so daliegen zu sehen war auch nicht gerade schön. Kein Mensch hatte die Pest verdient, nicht mal ein Grobian wie Paul Ingram. Mein Mitgefühl kann allerdings nicht ganz so groß und dauerhaft gewesen sein, wie es jetzt vielleicht den Anschein hat, denn im nächsten Moment zuckte ich mit den Schultern und dachte an das, was Bernie vorhin gesagt hatte: »Von Jez nichts zu sehen.«
Es ist nicht so, dass meine Schwester mir immer gesagt hätte, was sie gerade anstellte oder wo und mit wem sie sich herumtrieb, und eigentlich interessierte es mich auch nicht sonderlich. Jez war schon immer eine Einzelgängerin und Geheimniskrämerin gewesen, nie redete sie über etwas, und stets gab sie schnippische Antworten, wenn man was von ihr wissen wollte. Sie konnte es auf den Tod nicht ausstehen, wenn man sich ungefragt in ihre Angelegenheiten einmischte. Vor allem konnte sie’s nicht ertragen, wenn ich mich in ihre Sachen einmischte. Dass sie an diesem Tag nicht zur Arbeit erschienen war, sah ihr zwar nicht ähnlich, aber es war andererseits auch nicht besonders alarmierend oder besorgniserregend. Sie war schließlich siebzehn Jahre alt und konnte tun und lassen, was sie wollte. Sah man mal davon ab, dass der Lohn für ihre Arbeit im »Boar’s Head« mit der Miete für unsere Bruchbude verrechnet wurde, genauso wie meine Schufterei in der Schänke. Denn der alte Bernard Collins war nicht nur der Wirt der Kneipe, sondern auch unser Vermieter. Ihm gehörte der gesamte Dark Entry samt allen Verrückten, die darin wohnten. Doch das nur nebenbei.
Obwohl Jez niemand war, um den man sich Sorgen machen musste, hatte ich doch sofort so eine komische Ahnung, dass irgendwas nicht stimmte. Vielleicht kam’s daher, dass unser Vater im Sterben lag, und bekanntlich kam ein Unglück selten allein. Es hätte zu Jez gepasst, wenn sie ausgerechnet an diesem Tag irgendeinen Unsinn anstellte. Jedenfalls ging ich sofort hoch in Jezebels Kammer unter dem Dach, die früher einmal Vaters Schlafkammer gewesen war, bis er sich bei einem Sturz von der steilen Treppe derart die Rippen gequetscht und den Schädel gehauen hatte, dass er seitdem seinen Rausch lieber unten auf einem Strohsack in der Stube ausschlief.
Natürlich wisst ihr bereits, dass Jez nicht in ihrer Kammer war, denn dummerweise hab ich euch ja anfangs verraten, dass dies der Tag war, an dem meine Schwester zum ersten Mal verschwand. Was ihr aber nicht wissen könnt, ist, dass in der Kammer nicht nur von Jez nichts zu sehen war, sondern auch ihre sämtlichen Kleider aus der Holztruhe verschwunden waren und ein schmieriger Zettel auf dem Bett lag. Darauf stand in krakeligen Buchstaben: »Ich mus gen Jes.«
Wie ihr seht, war das Schreiben von Nachrichten nicht Jezebels Stärke. Zwar hatte Edward, der von uns dreien nicht nur der älteste, sondern auch der hellste Kopf war, vor einigen Jahren versucht, ihr das Lesen und Schreiben beizubringen, aber leider nur mit bescheidenem Erfolg. Mit geschriebenen Worten hatte sie es nicht so. Wozu brauchte man eine Feder, wenn man einen Mund hatte? Den hat sie allerdings auch nicht so oft aufgetan. Und jetzt war sie weg. Musste sie gehen, wie sie es nannte. Einfach so und ohne jede weitere Erklärung.
Wahrscheinlich war es vor allem der Zettel, der mich in Panik geraten ließ, denn dass Jez überhaupt eine Nachricht schrieb, kam mir wie ein böses Omen vor. Wenn sie einfach verschwunden wäre, wie alle anderen in der Familie, dann wär’s nicht weiter aufgefallen. Eine mehr in der Sammlung der Ingrams. Aber dieses »Ich mus gen« ließ mich schaudern, als hätte mich einer von hinten am Schlafittchen gepackt. Wann hatte ich Jezebel zuletzt gesehen? Zu Bernie hatte ich gesagt: »Gestern Abend«, und das stimmte auch, aber wann genau?
Obwohl Jez und ich beide im »Boar’s Head« arbeiteten, taten wir das selten zusammen, sondern meistens abwechselnd. Ich war frühmorgens dran, um den Dreck der vergangenen Nacht wegzuräumen und die Höhle des Löwen auszumisten, gegen neun kam Jezebel und kümmerte sich mit der Wirtin oder der Küchenmagd Tracy um die Fuhrleute und Reisenden, die zum Frühstück oder Mittagessen einkehrten, anschließend durfte ich dann wieder den Müll beseitigen, den Boden wischen und die Spucknäpfe säubern. Am Abend ging’s genauso, nur dass ich seit einiger Zeit zusätzlich den Laufburschen spielte und den Gebrechlichen oder Faulenzern ihre Rationen nach Hause brachte. Zu diesen Faulenzern gehörte auch der Eremit von St. Olave, dem ich jeden Abend das Essen und einen Krug Gerstenwasser aufs Zimmer hinaufschleppte, doch darauf komme ich später noch zurück. Ab acht Uhr abends mussten wir dann beide ran, aber wenn der Laden voll war, kriegten wir uns trotzdem kaum zu Gesicht.
Zwar zählte das »Boar’s Head« eher zu den kleineren Inns an der Hauptstraße und war nicht mit den bekannteren Gasthäusern wie dem »George«, dem »White Hart« oder dem »Tabard« zu vergleichen, wo die Pferdekutschen Halt machten und deshalb viel mehr Gäste über Nacht blieben, dennoch war die Schänke meistens gut besucht. Für mich war normalerweise um zehn oder elf Uhr Feierabend, während Jez dableiben musste, bis die letzten Gäste gegangen oder vom Wirt rausgeworfen worden waren. Genauso war’s gestern gewesen: Als ich das »Boar’s Head« verlassen hatte, war Jez noch in der Schänke gewesen und hatte Bier und Branntwein ausgeschenkt.
Während ich nun in ihrer Kammer stand und den seltsamen Zettel betrachtete, überlegte ich, ob irgendetwas anders oder eigenartig gewesen war, aber ich konnte mich zunächst an nichts Besonderes erinnern. Alles war wie immer gewesen: laut, dreckig und betrunken! Wieder starrte ich auf den Zettel, und erst jetzt bemerkte ich, worauf Jezebel ihre Nachricht gekritzelt hatte. Es war die Rückseite von einem Steckbrief, der im Moment überall in London aushing und auf dem vom sogenannten »Southbank Slasher«, dem Schlitzer von der Southbank, die Rede war. In den letzten beiden Jahren waren mehrere Frauenleichen aus der Themse gefischt oder am Ufer gefunden worden, und bevor man sie ins Wasser geworfen hatte, waren sie fürchterlich mit dem Messer massakriert worden. Bei einigen der Frauen sollen einzelne Teile des Körper gefehlt haben, eine Hand, ein Bein, der Kopf. Das behauptete jedenfalls Master Collins, und der hatte es angeblich von einem schwatzhaften Konstabler erfahren. Wie dem auch sei, fünfzig Pfund Sterling wurden demjenigen versprochen, der den Slasher fasste oder die Büttel auf seine Fährte brachte, und das war eine erstaunliche Summe, wenn man bedachte, dass es sich bei den Ermordeten durchweg um Schankfrauen oder Dirnen aus den Gemeinden am Südufer der Themse handelte. Das Einzige, was sich ansonsten über die Ermordeten sagen ließ, war, dass sie allesamt rabenschwarzes Haar gehabt und das dreißigste Lebensjahr noch nicht erreicht hatten. Anfangs waren die Leichen nicht weiter aufgefallen, die Pest hatte so gewütet, dass Flussleichen nichts Ungewöhnliches waren. Geschlitzt oder nicht geschlitzt. Aber erst in der vergangenen Woche war wieder eine Dunkelhaarige nahe der London Bridge aus dem Fluss gefischt worden. Angeblich die Geliebte irgendeines feinen Pinkels aus der City. Das erklärte natürlich auch das Kopfgeld.
Ich weiß nicht, wieso, aber als ich den Steckbrief überflog, der nur wenig über das jüngste Opfer und rein gar nichts über den Täter verriet, hatte ich plötzlich den Gentleman vor Augen, der sich am Abend zuvor ins »Boar’s Head« verirrt hatte. Nicht dass der was mit den Frauenleichen zu tun hatte, aber er hatte nach Jez gefragt und sich einige Zeit mit ihr unterhalten. Jetzt erinnerte ich mich plötzlich wieder. In einer Ecke hatten sie gesessen und sehr lange die Köpfe zusammengesteckt, bis dem Wirt der Kragen platzte und er Jez Prügel androhte, wenn sie nicht sofort ihre Privatgespräche beendete und wieder hinterm