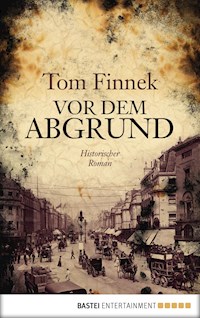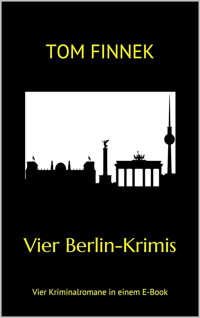4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Münsterland-Reihe
- Sprache: Deutsch
Auf der Beerdigung des jungen Oliver Herzog wendet sich die Mutter des Toten an Heinrich Tenbrink. Angeblich habe Oliver sich umgebracht, nachdem er seine Freundin Anna vom Dach einer alten Ziegelei gestoßen hat. Doch Olivers Mutter glaubt nicht an Selbstmord und bittet den pensionierten Kriminalrat um Hilfe. Eher widerwillig recherchiert Tenbrink im Umfeld der Ziegelei, die inzwischen von einer Künstlerkommune bewohnt wird, und stößt auf einen Jahre zurückliegenden mysteriösen Todesfall. Auch Tenbrinks ehemaliger Kollege und Oberkommissar Maik Bertram ermittelt in dem voller Widersprüche steckenden Fall - und hat es kurz darauf mit einer weiteren Leiche zu tun ...
Während Tenbrink gleichzeitig mit Liebeskummer zu kämpfen hat und Bertram sich Sorgen um die Gesundheit seiner kleinen Tochter macht, stoßen die beiden ungleichen Ermittler auf ein Gespinst von Lügen, Geheimnissen und Verbrechen.
Der fünfte Fall der beliebten Münsterland-Krimis! Bisher sind in der Reihe erschienen:
GALGENHÜGEL
TOTENBAUER
SCHULDACKER
RAUCHLAND
TOTENSANG (Kurz-Krimi)
Stimmen unserer Leser und Leserinnen zur Reihe:
"Die Hauptfiguren der Serie sind mir schnell ans Herz gewachsen und ich hoffe, dass es noch weitere Folgen in der Serie gibt. Und zwar bald, ich kann's kaum erwarten ..." (BrittDreier, Lesejury)
"Tom Finnek hat hier ein ungewöhnliches, sehr sympathisches Ermittlerpaar geschaffen, das durch die bildhafte Beschreibung sofort im Kopf des Lesers haften bleibt. Die beiden agieren glaubhaft und kommen authentisch rüber." (Ladybella911, Lesejury)
"Ein wunderbarer, mit dezentem Humor gespickter, spannender Regionalkrimi mit einem außergewöhnlichen Ermittlerduo, welches einem schnell ans Herz wächst." (Honigmond, Lesejury)
"Spannender Plot, interessante Figuren, tolle Atmosphäre" (_inga_, Lesejury)
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Prolog
Dienstag, 1. Oktober
Erster Tag
Samstag, 19. Oktober 1
2
3
4
Zweiter Tag
Sonntag, 20. Oktober 1
2
3
4
5
6
7
Dritter Tag
Montag, 21. Oktober 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vierter Tag
Dienstag, 22. Oktober 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Fünfter Tag
Mittwoch, 23. Oktober 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sechster Tag
Donnerstag, 24. Oktober 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Siebenter Tag
Freitag, 25. Oktober 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Epilog
Samstag, 26. Oktober 1
2
Weitere Titel des Autors
Galgenhügel
Totenbauer
Schuldacker
Rauchland
Totensang – Kurz-Krimi
Über dieses Buch
Auf der Beerdigung des jungen Oliver Herzog wendet sich die Mutter des Toten an Heinrich Tenbrink. Angeblich habe Oliver sich umgebracht, nachdem er seine Freundin Anna vom Dach einer alten Ziegelei gestoßen hat. Doch Olivers Mutter glaubt nicht an Selbstmord und bittet den pensionierten Kriminalrat um Hilfe. Eher widerwillig recherchiert Tenbrink im Umfeld der Ziegelei, die inzwischen von einer Künstlerkommune bewohnt wird, und stößt auf einen Jahre zurückliegenden mysteriösen Todesfall. Auch Tenbrinks ehemaliger Kollege und Oberkommissar Maik Bertram ermittelt in dem voller Widersprüche steckenden Fall – und hat es kurz darauf mit einer weiteren Leiche zu tun ...
Während Tenbrink gleichzeitig mit Liebeskummer zu kämpfen hat und Bertram sich Sorgen um die Gesundheit seiner kleinen Tochter macht, stoßen die beiden ungleichen Ermittler auf ein Gespinst von Lügen, Geheimnissen und Verbrechen.
Über den Autor
Tom Finnek wurde 1965 im Münsterland geboren und arbeitet als Filmjournalist, Drehbuchlektor und Schriftsteller. Er ist verheiratet, Vater von zwei Söhnen und lebt mit seiner Familie in Berlin.
Tom Finnek
Finsterbusch
Ein Münsterland-Krimi
Kriminalroman
Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Arno Hoven
Lektorat/Projektmanagement: Stephan Trinius
Covergestaltung: Guter Punkt GmbH Co. KG unter Verwendung von Motiven von © yanikap/shutterstock; Marc Venema/shutterstock; TY Lim/shutterstock; S.N.Ph/shutterstock
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-0884-5
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
»Es ist bekanntlich ja unendlich trostloser,für albern als für schlimm zu gelten.«
Annette von Droste-Hülshoff,»Bei uns zu Lande auf dem Lande«
Prolog
Dienstag, 1. Oktober
Das war nicht seine Absicht gewesen! Ganz bestimmt nicht! Das hatte er nicht gewollt. Niemals! Er hatte sie doch geliebt, liebte sie immer noch, wie er noch nie zuvor jemanden geliebt hatte. Dass er sie angeschrien und zu Boden gestoßen hatte, war unentschuldbar und nicht wieder gutzumachen. Egal, was sie ihm angetan hatte. Egal, wie sehr sie ihn mit ihren bösen Worten verletzt hatte. Sie hatte es ja nicht so gemeint, hatte ihm bloß wehtun wollen, um sich selbst wehzutun. Wie fremdgesteuert. Sie war nicht sie selbst gewesen. Nicht seine Anna. Das begriff er inzwischen, auch wenn es jetzt zu spät war. Er hatte viel zu heftig reagiert, war völlig ausgerastet und hatte die Kontrolle verloren. Hatte alles nur noch schlimmer gemacht, alles zerstört. Dabei gehörten sie doch zusammen. Anna und Oliver. Das A und O, wie sie manchmal gescherzt hatte. Jetzt war sie tot, und er trug die Schuld daran. Er hatte sie umgebracht. Er allein!
Als er Annas Körper auf dem lehmigen Boden gesehen hatte, seltsam verrenkt und im Dunkeln zwischen dem Gerümpel kaum auszumachen, da wäre er am liebsten ebenfalls gestorben. Auf der Stelle. Um wenigstens im Tod mit ihr vereint zu sein. Für immer, wie sie es sich versprochen hatten. Es wäre so einfach gewesen. Aber ihm hatte der Mut gefehlt – mal wieder. Stattdessen war er davongerannt, auf dem Trampelpfad durch den Finsterbusch: weg von der alten Ziegelei, weg von allem. Kopflos, hilflos. Er hätte die Polizei rufen müssen, den Notarzt, die Feuerwehr, irgendwen. Doch auch dazu hatte er nicht den Mut gehabt. Er war schon immer ein verdammter Feigling gewesen. Sonst wäre es gar nicht so weit gekommen.
Erst als er wenig später in seiner Wohnung angekommen war, hatte er begriffen, was eigentlich geschehen war. Was er getan hatte. Und was nun zu tun war. Um nachzuholen, was er an der Ziegelei versäumt hatte.
Es war schließlich nicht das erste Mal. Er besaß eine gewisse Erfahrung darin. Erfahrung? Nein, er sollte ehrlich zu sich sein. Es war nur eine Erfahrung im Versagen. Doch diesmal würde er es zu Ende bringen und nicht so stümperhaft und halbherzig vorgehen. »Eher ein Hilferuf als ein ernsthafter Suizidversuch«, hatte der Arzt im Krankenhaus nach jenem dilettantischen Versuch gesagt. Seitdem waren einige Jahre vergangen, und er hatte viel recherchiert, sich schlau gemacht, einen Masterplan erstellt. Wie eine Anleitung zum Sterben. Für alle Fälle.
Nachdem er und Anna wieder ein Paar geworden waren, hatte er gedacht, dass er diesen Plan niemals benötigen würde. All die Angst und das Düstere und das Schwere, die er in den letzten Jahren empfunden hatte, waren von ihm abgefallen. Der Bann war gebrochen. Er hatte endlich angefangen, zu leben. Mit Anna! Doch jetzt war alles wieder da, schlimmer als jemals zuvor. Und es gab nur einen Weg, es zu beenden.
Es war eigentlich ganz einfach. Eine Badewanne mit warmem Wasser, einige Aspirintabletten zur Blutverdünnung, eine große Dosis Triazolam gegen die Angst und natürlich ein Cuttermesser, scharf wie ein Skalpell. Er hatte sogar daran gedacht, den Duschvorhang vorzuziehen, für den Fall, dass es zu sehr spritzte. Das tat es aber gar nicht, weil er die Wanne randvoll gefüllt und die Arme unter Wasser aufgeschlitzt hatte. Längs, nicht quer, er war ja nicht blöd. So lag er also in der Wanne und schaute dem Wasser dabei zu, wie es sich rot färbte.
Oliver hatte sich strikt an seinen Masterplan gehalten. Auch an die Terrassentür hatte er gedacht. Es war ja nicht nötig, dass man die Wohnungstür eintreten musste, um ihn zu finden. Alles nach Plan. Nur vorher an der Ziegelei nicht; da war die Sache aus den Fugen geraten. Er versuchte, nicht daran zu denken und nicht auf den pochenden Schmerz zu achten. Der war aber gar nicht so schlimm, wie er befürchtet hatte. Vermutlich wegen der Tabletten, die er geschluckt hatte. Das war auch der Grund, warum er alles so gedämpft und verschwommen wahrnahm. Wie durch einen Schleier.
Irgendwo läutete es, ganz leise und weit entfernt. Wahrscheinlich passierte das nur in seinem Kopf, als könnte er bereits die Totenglocken hören. Die Müdigkeit kam plötzlich und mit vorher nie gekannter Vehemenz. Alles erstarrte, erst wie in Zeitlupe, dann völliger Stillstand. Als schliefe er mit offenen Augen. Als hätte das alles gar nichts mit ihm zu tun. Er wollte sich zwingen, die Augen zu schließen, aber auch dazu war er zu müde. Sein Körper gehorchte ihm nicht mehr. Er starrte, ohne etwas zu erkennen.
Nur das Licht war jetzt anders. Irgendwie dunkler. Ja, da war ein Schatten. Auf dem Duschvorhang. Es sah beinahe so aus, als bewegte sich der Vorhang am Fußende der Wanne. Und der Schatten wurde zu einem Schemen. Wie in dem Märchen vom Gevatter Tod, das ihm sein Vater früher so oft vorgelesen hatte. »Es hatte ein armer Mann zwölf Kinder ...« Mama hatte dann stets mit Papa geschimpft. So eine gruselige Geschichte sei doch nichts für kleine Kinder, da könne einem ja angst und bange werden. Sie hatte recht gehabt, ihm war angst und bange geworden. Doch damit war es nun vorbei. Keine Angst mehr. Ein für alle Mal. Endlich ...
Erster Tag
Samstag, 19. Oktober1
Der Finstendorper Friedhof lag verschlafen und beinahe idyllisch am Rand des Dorfes, umgeben von abgeernteten Maisfeldern und immer noch grünen Wiesen. Der morgendliche Hochnebel hatte sich ein wenig gelichtet, und die Sonne stand als blasse Scheibe eine Handbreit über dem Horizont, konnte die Feuchtigkeit in der Luft aber nicht vertreiben. Herbstwetter eben.
Als er die Adresse »Am Sportplatz« auf dem Totenbrief gelesen hatte, waren Heinrich Tenbrink unwillkürlich schlimme Vorahnungen gekommen. Er hatte befürchtet, dass es sich um einen dieser neumodischen und seelenlosen Friedhöfe handelte, die allein nach Zweckdienlichkeit und praktischen Gesichtspunkten gestaltet waren – in Eile aus dem Boden gestampft, weil der alte Totenacker neben der Kirche von der zuständigen Behörde zum Bauland erklärt worden war. Neubaugebiete, so nannte Tenbrink in Gedanken diese meist baumlosen und mit hässlichen Betonskulpturen verunstalteten Friedhöfe, von denen er während seiner Zeit als Kriminalkommissar so viele zu Gesicht bekommen hatte.
Doch der Finstendorper Friedhof war alles andere als neu und auf eine angenehme Weise aus der Zeit gefallen. Riesige Buchen und Erlen beschatteten ein weitgehend naturbelassenes Areal, auf dem die Gräber nicht in Reih und Glied, sondern scheinbar ohne jede Ordnung verteilt waren. Als wäre der Friedhof Stück für Stück und je nach Bedarf mit dem angrenzenden Dorf gewachsen. Familiengräber und prunkvoll bebaute Grüfte befanden sich neben schlichten Einzel- und unscheinbaren Urnengräbern, auch der Bewuchs mit Bäumen, Büschen und Hecken war erfreulich uneinheitlich. In der Mitte des Friedhofs stand eine kleine und altertümlich wirkende Friedhofskapelle, weiß verputzt, mit beinahe quadratischem Grundriss und großem Kruzifix über der Eingangstür. Ein dünnes Glockentürmchen ragte oben wie die Spitze einer Pickelhaube aus dem Satteldach.
»Zu unserem Herrn Jesus Christus beten wir voll Vertrauen für unseren Bruder Oliver.« Der Priester im schwarz-violetten Gewand machte mit dem Weihwassersprengel ein Kreuzzeichen in die Luft. »Erlöse ihn, o Herr!«
»Erlöse ihn, o Herr!«, antworteten die nicht sehr zahlreichen Trauergäste, die sich um das offene Grab versammelt hatten.
»Von aller Schuld!«, rief der Priester mit Nachdruck und schwang erneut das Aspergill, während gleichzeitig der Sarg ins Grab hinabgelassen wurde.
»Erlöse ihn, o Herr!«, wiederholte die Gemeinde.
Schuld und Vergebung schienen bei dieser Beerdigung die beherrschenden Themen zu sein; das war Tenbrink bereits beim Requiem in der Kirche aufgefallen. Den Psalm 103 hatte der Priester sicherlich nicht ohne Grund als Leitmotiv der Trauerfeier ausgesucht: »Er vergibt deine ganze Schuld, heilt alle deine Gebrechen.« Auch wenn der Geistliche dabei womöglich eher an Verbrechen gedacht hatte.
Gertrud Büning drückte Tenbrinks Hand, seufzte tief und lehnte sich gegen ihn, als müsste sie gestützt werden.
»Alles in Ordnung?«, fragte er leise und tätschelte die mit Altersflecken übersäte Hand seiner Schwippschwägerin. »Willst du dich lieber hinsetzen?« Sie hielten sich etwas abseits auf, und nicht weit von ihnen entfernt stand eine Parkbank vor einer Ligusterhecke.
»Geht schon«, flüsterte Gertrud und schüttelte ihre frisch gemachte graublaue Dauerwelle. »Ich bin so froh, dass du mitgekommen bist, Heinrich. Allein hätte ich das nicht geschafft.«
»Ist doch selbstverständlich«, antwortete er achselzuckend. »Dafür ist Familie doch da.« Obwohl Gertrud im Grunde genommen gar nicht mit ihm verwandt war. Ihr verstorbener Mann war der Halbbruder seiner verstorbenen Frau Karin gewesen. Zu viele Verstorbene, dachte er und lächelte Gertrud zu.
»Traurig, oder?«, sagte sie nachdenklich.
»Was meinst du?«
Gertrud deutete mit ihrem Gehstock auf die spärliche Trauerversammlung am Grab. »Ein Junge aus dem Dorf stirbt, und es kommen gerade mal ein Dutzend Leute zum Begräbnis. Kaum Nachbarn, nur wenige Verwandte. Nicht mal seine Mannschaftskollegen sind hier. Die haben drüben vermutlich gerade ein Fußballspiel.« Sie deutete mit dem Daumen über ihre Schulter in Richtung des Sportgeländes, das der Straße den Namen gegeben hatte. »Eine Schande ist das.«
»Samstagmorgen ist eben eine ungewöhnliche Zeit für eine Beerdigung«, erwiderte Tenbrink und kam sich wie ein Heuchler vor. »Wusste gar nicht, dass Bestattungen samstags überhaupt erlaubt sind.«
»Das ist nicht der Grund«, zischte Gertrud so laut, dass einige der Trauergäste sich zu ihnen umwandten.
»Ich weiß.« Er nickte und räusperte sich. Ja, Tenbrink kannte den wahren Grund. Er hieß Anna Ostermann. Sie stammte, wie der heute beerdigte Oliver, aus Finstendorp und lag nur wenige Kilometer entfernt auf der Intensivstation des Altwicker Krankenhauses – mit schwersten inneren und äußeren Verletzungen. Seit Wochen war sie im Koma, wurde nur noch von Maschinen am Leben gehalten. Weil Oliver Herzog, Gertruds Großneffe, sie vom Dach eines Fabrikgebäudes gestoßen hatte. Aus Liebeskummer, wie es hieß. Dass er anschließend Selbstmord begangen hatte und dadurch der irdischen Strafe entgangen war, kam noch erschwerend hinzu. Kein Wunder, dass die Begräbnisfeier so schlecht besucht war. Trauer um den Täter hätte womöglich als Missachtung oder gar Verhöhnung des Opfers gedeutet werden können. Auf so was wurde in kleinen Dörfern streng geachtet.
»Von der Erde bist du genommen, und zur Erde kehrst du zurück!« Der Priester warf mit einer kleinen Schaufel etwas Erdreich ins Grab. Dumpfe Aufprallgeräusche waren zu vernehmen, als die Brocken auf den Sarg fielen. »Der Herr wird dich auferwecken.«
Während der Pastor die Arme ausbreitete und ein Vaterunser anstimmte, fiel Tenbrinks Blick auf den marmornen Grabstein in der Ecke des Familiengrabs. »Leander Herzog«, stand in großen Messinglettern darauf. Olivers Vater, der vor drei Jahren gestorben war. »Im See ertrunken«, wie Gertrud ihm auf dem Weg hierher erzählt hatte. »Die arme Claudia. Erst der Mann und jetzt der älteste Sohn. Beide auf so fürchterliche Weise gestorben. Beide im Wasser.«
Claudia Herzog, Gertruds Nichte, stand neben einem schlaksigen und etwas unbeholfen wirkenden Jugendlichen am Fußende des Grabes und warf nun ebenfalls etwas Erde in die Grube. Ihr Gesicht war durch einen dichten schwarzen Schleier verhüllt, aber an der gebückten Haltung und dem Zucken ihres Körpers konnte Tenbrink erkennen, dass sie von Weinkrämpfen geschüttelt wurde. Der Jugendliche, vermutlich Olivers jüngerer Bruder Tim, hatte sichtlich Mühe, seine Mutter zu stützen und davor zu bewahren, in die Grube zu stürzen. Erst als ein bulliger Mann mit Glatze neben sie trat, seinen Arm um ihre Schultern legte und leise auf sie einredete, schien sie sich ein wenig zu beruhigen. Das heftige Zucken ließ nach, nur die gebückte Haltung blieb. Als würde sie von einer unsichtbaren Macht zu Boden gezogen.
»Herr, gib Oliver und allen Verstorbenen die ewige Ruhe!«, rief der Priester, der sich zur Trauergemeinde umgewandt hatte.
»Und das ewige Licht leuchte ihnen«, antwortete Tenbrink automatisch, machte ein Kreuzzeichen und hakte sich bei Gertrud unter.
»Lass sie ruhen in Frieden!«
»Amen.«
Ein langer Moment der Stille folgte, bevor die Anwesenden sich allmählich gruppierten und eine kleine Schlange vor dem Grab bildeten, um sich von dem Verstorbenen zu verabschieden und den Angehörigen ihr Beileid auszudrücken.
»Blume oder Erde?«, fragte Gertrud, während sie sich am Ende der Schlange anstellten.
»Wie bitte?«
»Wirfst du eine Blume oder Erde ins Grab?«
»Erde natürlich«, antwortete Tenbrink verwundert. »Wieso sollte ich eine Blume ins Grab werfen?«
»Wird doch heutzutage so gemacht.« Gertrud ging in kleinen Trippelschritten vorwärts und seufzte tief. »Oder machen das nur die Frauen? Ist ja auch egal. Er war's übrigens nicht.«
»Wer war was nicht?«, fragte Tenbrink verwirrt.
»Oliver.« Sie wies mit dem Stock zum Grab. »Er hat das Mädchen nicht vom Dach gestoßen.«
»Wer sagt das?«
»Ich sag das. Und Claudia auch.« Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, hob sie wie drohend den Gehstock. »Oliver war ein ganz lieber und sensibler Junge. Nicht so ein Rabauke wie andere in dem Alter. Der hätte so was niemals getan. Nie im Leben. Kannst du mir ruhig glauben.«
Tenbrink wusste es aus Erfahrung besser, beließ es aber bei einem leisen Brummen und einem Augenrollen.
»Brauchst gar nicht so zu gucken, Heinrich!«, empörte sich Gertrud und klopfte mit dem Knauf ihres Gehstocks gegen seine Brust. »Er war's nicht!«
»Wenn du meinst«, erwiderte Tenbrink achselzuckend. »Wir sind an der Reihe.«
Gertrud trat schwerfällig an das Grab heran, nahm eine weiße Rose aus einem bereitstehenden Blumenkorb, warf sie auf den Sarg und machte ein Kreuzzeichen. Dann wandte sie sich zur Mutter des Verstorbenen um, die immer noch in gebückter Haltung am Grab ausharrte, nahm sie etwas umständlich in den Arm und murmelte: »Mein herzliches Beileid, Claudia. Es tut mir so leid für euch.«
»Danke, Tante Gertrud«, antwortete Claudia Herzog mit brüchiger Stimme. »Schön, dass du kommen konntest.«
»Heinrich hat mich aus dem Heim abgeholt«, brummte Gertrud und schaute sich zu Tenbrink um. »Ich hab dir doch von ihm erzählt.«
»Danke«, sagte Claudia Herzog in Tenbrinks Richtung. »Das war sehr nett.«
Bevor er darauf reagieren konnte, tröstete Gertrud die trauernde Mutter mit den Worten: »Mach dir keine Sorgen, Claudia!« Sie deutete mit dem Stock auf Tenbrink. »Heinrich kümmert sich um die Sache.«
2
Das Clubheim des »FC Finstendorp 1920 e. V.« war ein äußerst unpassender und unwürdiger Ort für einen Leichenschmaus, fand Tenbrink. Zwar befand sich das Vereinslokal gleich neben dem Sportplatz und somit direkt gegenüber vom Friedhof, doch die Gaststätte erinnerte eher an einen lieblos eingerichteten Imbiss mit Bierausschank und Außer-Haus-Verkauf für Eis, Pommes und Bockwurst. Keine angemessene Umgebung für ein Trauermahl!
Angeblich hatte Claudia Herzog diesen Ort wegen der Nähe zum Friedhof ausgewählt, doch von Gertrud hatte Tenbrink erfahren, dass keiner der beiden Gasthöfe im Dorf den Leichenschmaus bei sich hatte ausrichten wollen. Der eine befand sich in direkter Nachbarschaft des Hauses Ostermann, der andere gehörte einem entfernten Verwandten der Familie. Das Clubheim hatte Claudia Herzogs Wunsch nicht abschlagen können, weil Oliver Vereinsmitglied und Torwart der zweiten Fußballmannschaft gewesen war. Der bullige Glatzkopf, der die Mutter am Grab gestützt hatte, war Olivers Trainer gewesen.
Ein langer Tisch an der Seite des Schankraums, direkt vor einer Vitrine mit Pokalen und Medaillen, war für vierzehn Personen gedeckt, doch lediglich neun Trauergäste hatten den Weg ins Clubheim gefunden. Es gab Kaffee und Tee aus Thermoskannen und belegte halbe Brötchen. Käse, Schinken und Salami, jeweils mit einem sauren Gürkchen und etwas Petersilie belegt. Wenigstens eine Tischdecke hätte man auflegen können, fand Tenbrink und musste daran denken, dass man die Beerdigung eines Selbstmörders früher auch »Eselsbegräbnis« genannt hatte. »Er soll wie ein Esel verscharrt werden, geschleift und hinausgeworfen vor die Tore Jerusalems«, hieß es in der Bibel. Altes Testament. Jeremias, wenn Tenbrink sich nicht irrte. Aber bei der Bibel irrte er sich selten.
Der Pfarrer war übrigens der Erste, der sich nach einem eher pflichtschuldigen Schluck Kaffee entschuldigte und den Leichenschmaus wegen dringender seelsorgerischer Termine verließ. Eine ältere Frau und der bullige Fußballtrainer nahmen die Gelegenheit beim Schopf und verabschiedeten sich ebenfalls.
»Nochmals mein Beileid, Claudia«, sagte die Frau und schnäuzte sich in ein Taschentuch. »Kopf hoch!«
»Ich muss rüber zu den Jungs«, meinte der Trainer und deutete durchs Fenster zum Sportplatz, auf dem sich gerade zwei Mannschaften aufwärmten. »Unsere A-Jugend spielt gleich gegen Fortuna Westerwick.«
»Danke, dass ihr da wart«, entgegnete Claudia Herzog, die am Kopfende des Tisches saß, inzwischen ihren Hut samt Schleier abgenommen hatte und ein verweintes und um die Nase herum rot angelaufenes Gesicht präsentierte. Sie sah alt und erschöpft aus, obwohl sie, wie Tenbrink von Gertrud wusste, gerade mal Mitte vierzig war.
»Nehmt wenigstens ein paar Brötchen mit!«, rief sie den beiden nach, als diese das Clubheim bereits verlassen hatten. Leise setzte sie hinzu: »Was soll ich denn damit machen, wenn keiner was isst? Ist alles bezahlt.«
Außer Tenbrink und Gertrud waren nur noch zwei Gäste anwesend: eine etwa fünfzigjährige, hagere Frau, die keinen Ton sagte und immer nur mit dem Kopf schüttelte, und ein Verwandter der Herzogs aus Münster. Ein Cousin des verstorbenen Vaters, wenn Tenbrink es richtig verstanden hatte.
»Und?«, wollte Gertrud wissen. Sie saß direkt neben Claudia Herzog und beugte sich seitlich zu Tenbrink hinüber. »Was sagst du dazu?«
»Du hast recht«, antwortete er. »Es ist traurig. Ich habe selten eine trostlosere Trauergesellschaft erlebt.«
»Ich meine die Sache mit Oliver und Anna.«
»Ach so.« Er putzte seine Brille, die in dem etwas klammen Raum zum wiederholten Mal beschlagen war, und setzte sie wieder auf seine Nase. »Hm.«
»Kümmerst du dich darum?«
»Das ist eine Angelegenheit der Polizei, und ich bin im Ruhestand, wie du weißt.« Tenbrink goss noch etwas Milch in den viel zu starken und etwas bitter schmeckenden Kaffee, nippte daran und verzog das Gesicht. Auch nicht besser!
»Ruhestand!«, knurrte Gertrud. »Mumpitz!«
»Die Ermittlungen sind wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen«, erwiderte Tenbrink. »Meine ehemaligen Kollegen wissen genau, was zu tun ist und wie sie es zu tun haben. Der Fall ist bei ihnen in guten Händen.«
»Deine Kollegen halten Oliver offenbar für den Täter.«
»Vielleicht aus guten Gründen«, antwortete Tenbrink möglichst leise und schaute vorsichtig zu dem jungen Tim Herzog, der ihm direkt gegenübersaß und neugierig herüberschaute. »Es mag ja sein, dass Oliver ein lieber Junge war, aber das beweist leider nicht seine Unschuld.«
»Er hat Anna angehimmelt«, sagte Claudia Herzog und richtete sich plötzlich auf. Offenbar hatte Tenbrink nicht leise genug gesprochen. »Die beiden waren schon in der Schule ein Paar und haben sich geliebt. Oliver war ganz vernarrt in Anna und wollte ihr einen Heiratsantrag machen. Das hat er mir selbst gesagt. Ist noch gar nicht lange her.«
Auch das war kein Beweis für seine Unschuld. Eher im Gegenteil. Tenbrink wusste nur zu gut, dass ein Großteil der Gewaltdelikte Beziehungstaten waren. Und Liebe war nicht selten das Tatmotiv. Vor allem, wenn sie verschmäht wurde oder abhandenkam. Das dachte er, sagte es aber nicht. Stattdessen beließ er es bei einer Floskel: »Die Polizei wird die Wahrheit schon herausfinden.«
»Dieser Kommissar Bremer ist ein Dummkopf!«, rief Tim Herzog aufgebracht, wischte sich eine strähnige Haartolle aus dem Gesicht und funkelte Tenbrink wütend an. »Der hat doch keine Ahnung.«
»Tim!«, ermahnte ihn seine Mutter. »Benimm dich!«
»Ist doch wahr«, murrte der Junge, dessen Alter Tenbrink auf sechzehn schätzte. »Der Typ hat behauptet, Oliver wär ein Psycho gewesen und hätte Anna belästigt. Wie so 'n verdammter Stalker.«
»Das hat er nicht behauptet«, korrigierte ihn Claudia Herzog. »Jedenfalls nicht direkt. Und nicht mit diesen Worten.«
»Hauptkommissar Bremer ist ein sehr erfahrener Polizist«, sagte Tenbrink ausweichend und schaute auf das allzu weiche Käsebrötchen, das er vor seinem Mund in der Schwebe hielt. »Ein sorgfältiger und gewissenhafter Ermittler.« Keine direkte Lüge, aber im Grunde war er Tims Meinung: Bremer war ein Dummkopf. Doch das behielt er natürlich für sich.
»Was ist denn mit deinem Mitbewohner?«, fragte Gertrud und stieß Tenbrink von der Seite an. »Der hübsche Kerl aus dem Osten. Wie heißt der noch mal?«
»Maik?« Tenbrink biss in sein Brötchen. Es schmeckte nach nichts. »Was soll mit ihm sein?«
»Hast du nicht gesagt, dass er nach seiner Elternzeit wieder arbeitet?«
»Ja, aber nur in Teilzeit und erst seit dieser Woche. Mit dem Fall hat er vermutlich nichts zu tun.«
»Könntest du ihn nicht ...?«
»Nein, das kann ich nicht!«, unterbrach Tenbrink sie barsch und warf das pappige Brötchen auf den Teller. Die hagere Frau neben ihm schaute überrascht auf und unterbrach ihr Kopfschütteln. Und der Cousin aus Münster verschluckte sich an seinem Kaffee.
»'tschuldigung«, murmelte Tenbrink. »Tut mir leid.«
»Warum denn nicht?«, beharrte Gertrud und legte ihre Hände auf den Tisch. »Ist doch nichts dabei. Schließlich wohnt ihr in einem Haus. Da könntest du doch einfach mal ...«
»Lass gut sein, Tante Gertrud!«, sagte Claudia Herzog, senkte den Blick und legte ihre Hand auf Gertruds Unterarm. »Ist nicht so wichtig. Wir beide wissen, dass Oliver unschuldig ist. Und der Herrgott im Himmel weiß erst recht, dass Oliver das nicht getan hat. Ob die Polizei das auch wissen will, spielt keine Rolle mehr. Jetzt, wo Oliver tot ist, spielt nichts mehr eine Rolle.«
»Sag so was nicht, Claudia!« Gertrud schaute Tenbrink vorwurfsvoll an und schüttelte den Kopf. »Was wahr ist, muss wahr bleiben. Das gilt auch für die Polizei.«
Tenbrink senkte den Blick. Er hatte nichts Falsches gesagt oder getan, und dennoch fühlte er sich schäbig. Als hätte er den Verstorbenen und dessen Familie mit Dreck oder Unrat beworfen. »Er soll wie ein Esel verscharrt werden.«
Er seufzte, hob langsam den Kopf und sagte: »Ich kann mich ja mal bei Maik nach dem Stand der Ermittlungen erkundigen. Ganz unverbindlich, versteht sich.«
»Sicher, natürlich, ganz unverbindlich«, sagte Gertrud erfreut und tätschelte seine Hand.
»Das heißt aber nicht, dass ich für dich Miss Marple spielen werde.«
»Nein, keine Miss Marple. Das säh auch ein bisschen komisch aus, wenn du dich als Frau verkleiden würdest.«
»Ich meine es ernst, Gertrud!«
»Weiß ich doch«, erwiderte sie aufgeregt und wandte sich zu Claudia Herzog um. »Hab ich's nicht gesagt, Claudia? Heinrich kümmert sich darum.«
3
Hätte ihm jemand vor einem Jahr gesagt, dass er an diesem nasskalten Samstagnachmittag mit seiner kleinen Tochter im Kinderwagen und einem lockigen Pudel an der Leine durch den historischen Ortskern von Schöppingen flanieren würde, so hätte er ihn vermutlich ausgelacht und für verrückt erklärt. Während Maik Bertram zum wiederholten Mal das Alte Rathaus mit seinen auffälligen rot-weißen Fensterläden umrundete, konnte er kaum fassen, was in diesem einen Jahr alles passiert und auf ihn eingestürmt war.
Vor etwas mehr als neun Monaten hatte Ella das Licht der Welt erblickt, nur wenig später war Martina Derksen, ihre Mutter, an den Folgen einer Fruchtwasserembolie gestorben, und Bertram, der von Martina eigentlich nur als ahnungsloser Samenspender, nicht aber als sozialer Vater vorgesehen war, hatte kurz darauf beim Amtsgericht in Münster die Vaterschaftsfeststellung beantragt. An das anschließende juristische und bürokratische Hickhack dachte Bertram nicht ohne Schaudern zurück. Erst die Vaterschaftsanerkennung beim Standesamt, dann die Auseinandersetzungen mit dem Jugendamt wegen des sogenannten Abstammungsgutachtens und des vorläufigen Sorgerechts, und schließlich das Eilverfahren beim Familiengericht, das zur endgültigen Feststellung der Vaterschaft führte, mit allen rechtlichen Konsequenzen.
Seit ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus vor nicht ganz acht Monaten lebte Ella nun bei ihm, anfangs nur vorläufig und unter Beistandschaft des Jugendamtes, später dann mit alleinigem Sorgerecht, wenn auch weiterhin unterstützend bis misstrauisch vom Jugendamt begleitet.
Kein Ereignis hatte sein Leben bislang derart auf den Kopf gestellt wie die Ankunft des Kindes. Nicht einmal sein nicht ganz freiwilliger Umzug von Magdeburg ins Münsterland vor mittlerweile vier Jahren hatte ihn so aus dem Konzept gebracht. Es war, als hätte jemand einen Schalter umgelegt und sich plötzlich eine völlig neue Perspektive aufgetan. Nicht nur, weil er beruflich eine Pause nahm und in Elternzeit ging oder Tenbrinks Haus plötzlich zum Zentrum seines schrumpfenden Universums wurde. Bisher Verlässliches oder Selbstverständliches verlor seine Gültigkeit, Unvorstellbares wurde zum Normalfall, Prioritäten verschoben sich, ungeahnte Herausforderungen türmten sich vor ihm auf – und all das mit einer Radikalität und Plötzlichkeit, dass Bertram ganz mulmig wurde und er mehr als nur einmal seinen Entschluss infrage stellte. Und manchmal auch bereute. Weil ihm alles zu viel und zu anstrengend wurde.
Zwar hatte Hannah Nachtweih, Martinas ältere Schwester und Ellas Tante, vollmundig versprochen, ihm jede denkbare Unterstützung zukommen zu lassen, aber sie und ihr Mann Jörg wohnten in Bonn und hatten sich in den letzten Monaten nur sporadisch blicken lassen und lediglich dann und wann angerufen. Telefonate waren allerdings nur bedingt hilfreich, wenn ihm alles über den Kopf wuchs. Zum Glück war in diesen Momenten Heinrich Tenbrink zur Stelle und sorgte auf seine knurrige und unaufgeregte Art dafür, dass die Dinge nicht ausuferten, dass das Neue und Unbekannte seinen anfänglichen Schrecken verlor. Bis neuer Schrecken drohte.
»Wer keine Fehler macht, ist bereits tot«, lautete Tenbrinks Credo. »Eltern sind schließlich dazu da, Fehler zu machen. Sonst haben die Kinder später keinen Grund, sich bei ihnen zu beschweren.« Doch Bertram hasste Fehler, vor allem wenn sie ihm unterliefen, und er war sich nicht sicher, ob er die Vaterschaftsfeststellung und das Sorgerecht beantragt hätte, wenn ihm klar gewesen wäre, was auf ihn zukommen würde.
Auf der anderen Seite war Ella das Beste und Schönste, das ihm bislang in den vierzig Jahren seines Lebens widerfahren war. Vielleicht gerade, weil der Start so schwierig und kompliziert gewesen war, so traurig und ungewiss. Manchmal ertappte er sich dabei, wie er am Bettchen seiner Tochter stand und ihr beim Schlafen zusah, beinahe zu Tränen gerührt und regelrecht überschwemmt von Glückshormonen. Dopamin, Serotonin und Konsorten. Dann vergaß er all die Ängste, die Schlaflosigkeit, die körperliche Anstrengung und die mentale Überforderung.
Vor allem die Sorgen um Ellas körperliche und geistige Gesundheit machten Bertram mehr zu schaffen, als er sich und anderen eingestehen wollte. Noch immer war nicht völlig auszuschließen, dass die Fruchtwasserembolie samt der verminderten Sauerstoffversorgung zu neurologischen Folgeerscheinungen führen würde. Zwar waren bei den bisherigen Vorsorgeuntersuchungen keine besorgniserregenden Auffälligkeiten festgestellt worden, und Ella entwickelte sich physiologisch, motorisch und geistig ihrem Alter entsprechend. Sie begann zu krabbeln, war imstande, sich herumzurollen und für kurze Zeit zu sitzen, und ertastete alles mit ihren Händen. Andere Kinder waren in dem Alter womöglich weiter, aber das hatte nichts zu sagen. Alles im grünen Bereich, wie der Kinderarzt sagte. Vorsichtshalber sollte allerdings die nächste Untersuchung, die U6, bei der speziell auf Entwicklungsstörungen geachtet wurde, etwas früher erfolgen. Am kommenden Dienstag hatte Ella den Termin. Aber Bertram solle sich keine Sorgen machen, hatte der Arzt gemeint, noch sei alles normal. Jedes Kind entwickle sich eben anders.
Nur mit dem Artikulieren von Lauten schien Ella dauerhaft auf Kriegsfuß zu stehen. Sie gab mit ihrem Mund kaum etwas von sich, weder ein Brabbeln noch Silben-Gestammel, noch sonstige Töne. Sah man einmal von seltsamen Pupsgeräuschen ab, die sie mit den Lippen machte. Und natürlich von dem wütenden Schreien, wenn sie Hunger hatte oder die Windel voll war. Tenbrink hatte eine ganz eigene Erklärung für ihre stimmliche Enthaltsamkeit: »Ella ist eben eine Münsterländerin und schweigt lieber stille. Wenn sie was zu sagen hat, wird sie sich schon melden.«
Ella, bitte melden!, dachte Bertram schmunzelnd.
Als hätte sie seine Gedanken gelesen, fing die Kleine in diesem Moment an, lauthals zu schreien und mit den Händen zu fuchteln. »Was ist denn, mein Schatz?«, säuselte er. Als er sich über sie beugte, konnte er den Grund ihres Missmutes bereits riechen.
Der Pudel schien nur auf die Gelegenheit gewartet zu haben, hockte sich genau in diesem Moment vor die Tür des alten Renaissance-Rathauses und verrichtete sein Geschäft.
»Locke, nicht da hin!«, rief Bertram und zerrte an der Leine, aber es war bereits zu spät. Zu allem Überfluss klingelte nun auch noch sein Handy: »Exit light, enter night!« Er wickelte die Hundeleine um den Griff des Kinderwagens, zog das Smartphone aus der Hosentasche und schaute aufs Display: Heide Feldkamp.
»Verdammt!«, zischte er. Die Verabredung mit ihr hatte er völlig vergessen. Auch die Geschichte mit Heide war etwas, das er vor einem Jahr niemals vorausgeahnt hätte.
»Hallo, Heide«, meldete er sich und kramte gleichzeitig mit der linken Hand in der Jackentasche nach den Kotbeuteln. »Ist gerade ein schlechter Moment.«
»Wo steckst du?«
»Bin mit Ella und Locke unterwegs, und wie üblich haben sich die beiden zum Synchron-Kacken verabredet. Wo bist du?«
»In deiner Wohnung. Heinrich kam gerade nach Hause und hat mich reingelassen. Ich hab Apfelkuchen gebacken.« Ihre Stimme klang ein wenig genervt. »Wir waren verabredet, Maik. Schon vergessen?«
»Nein, natürlich nicht«, log er. »Bin gleich da.«
»Wir müssen reden.«
»Schieß los.«
»Nicht jetzt. Später.«
»Okay. Dauert nicht mehr lange. Muss nur noch ein paar Exkremente beseitigen.«
»Mach das!« Dann war die Verbindung gekappt.
»Keine Beziehung, keine Verpflichtungen, kein Stress! Nur Sex!« So hatten sie es Anfang des Jahres abgemacht. Aber das war eigentlich bloß noch graue Theorie. Offiziell waren sie zwar nach wie vor kein Paar, das kam unter Kollegen nicht in Frage, war quasi ein Tabu. Aber von »Kein Stress!« konnte ebenfalls nicht die Rede sein. Von »Nur Sex!« ganz zu schweigen. Dafür war er oft schlichtweg zu müde und erschöpft. Und lustlos.
4
Eine halbe Stunde später lag Ella mit frischen Windeln im riesigen, sechseckigen Laufstall in Bertrams Wohnzimmer, das früher einmal das Schlafzimmer von Tenbrink und seiner Frau Karin gewesen war. Ella starrte zufrieden auf das Bienchen-und-Blumen-Mobile, das direkt über ihr von der Decke hing, und kaute auf einem genoppten Beißring herum. Sie zahnte mal wieder. Bisher hatte sie zwei Schneidezähne unten und einen oben. Die meisten Leute fanden, sie sehe aus wie ein kleines Häschen, aber Bertram musste manchmal, wenn er sie betrachtete, an Klaus Kinski denken. In der Rolle des Vampirs Nosferatu. Das sagte er natürlich nicht laut.
Heide hatte einen Teil des Blechkuchens auf drei Teller verteilt und verschwand in der provisorischen Speisekammer, um Milch und Zucker zu holen. Die Kammer war vorher Tenbrinks Abstellraum gewesen. Bertram und Tenbrink teilten sich in ihrer Männer-WG nach wie vor die Küche und das Bad im Erdgeschoss, denn im oberen Stockwerk gab es dummerweise keinen Wasseranschluss, doch Bertram hatte immerhin einen Kühl- und Gefrierschrank in das kleine Kabuff verfrachtet und ein paar Regale für Lebensmittel an der Wand angebracht.
»Ich will wirklich nicht stören«, sagte Tenbrink, der gerade mit einer Kanne Kaffee und Locke aus dem Flur hereinkam und immer noch den anthrazitgrauen Anzug trug. Nur die schwarze Krawatte hatte er abgenommen. »Ich meine, wenn ihr lieber ungestört sein wollt.«
»Sei nicht albern!« Bertram setzte sich aufs Sofa und deutete zum Tisch, auf dem die Teller bereitstanden. »Heide hat so viel Kuchen gebacken, dass eine Fußballmannschaft davon satt werden könnte.«
»Ich meine, wenn ihr lieber ...« Tenbrink stellte die Thermoskanne ab und wollte sich neben Bertram aufs Sofa setzen, hielt dann aber plötzlich inne und entschied sich für den Fernsehsessel, den er erst etwas umständlich in Richtung Sofatisch schob. »Wenn ihr lieber allein sein wollt, meine ich. Du weißt schon.«
»Ich weiß, was du meinst.« Bertram goss Kaffee in die Tassen und schüttelte grinsend den Kopf. »Wenn ich Heide plötzlich an die Wäsche gehe, kannst du ja unauffällig den Raum verlassen.« Dann setzte er mit ernster Miene hinzu: »Wie war die Beerdigung? So schlimm wie befürchtet?«
»Schlimmer. Weißt du, was ein Eselsbegräbnis ist?«
Bertram nickte stumm. Ja, das wusste er.
»Wer ist eigentlich beerdigt worden?«, fragte Heide, die in diesem Moment mit Kaffeesahne und Würfelzucker ins Zimmer kam und skeptisch den Pudel betrachtete, der an seinem Stammplatz auf einem zotteligen Flokati neben dem Laufstall lag. Als wollte er Ella bewachen.
»Ein Großneffe meiner Schwägerin«, antwortete Tenbrink ausweichend und schaute Bertram fragend an.
Bertram zuckte mit den Achseln, schob die Unterlippe vor und sagte: »Oliver Herzog.« Er nahm Heide Milch und Zucker ab, bemerkte ihr Stutzen und setzte mit einem Kopfnicken hinzu: »Ja, genau. Der Oliver Herzog.«
»Im Ernst?« Heide setzte sich neben Bertram aufs Sofa. »Bist du mit dem verwandt, Heinrich?«
»Nein. Ich hab Gertrud nur aus Gefälligkeit begleitet. Mit der Familie Herzog hab ich nichts zu tun.« Er beugte sich vor und goss Milch in seine Tasse. »Ermittelt ihr noch in dem Fall?«
»Vermutlich nicht mehr lange«, antwortete Bertram und ließ zwei Würfel Zucker in seinen Kaffee plumpsen. »Arno hat mir aufgetragen, die Akten zu ordnen und die Berichte zu aktualisieren. Damit ich mich einarbeite und auf dem Laufenden bin. Ich schätze, er will den Fall demnächst schließen und an Staatsanwalt Kramer übergeben.«
»Kramer ist seit Kurzem Oberstaatsanwalt«, verbesserte Heide ihn und verdrehte die Augen. »Ich wünschte wirklich, du wärst noch dabei, Heinrich. Mit dir und Martina Derksen war wenigstens Leben in der Bude. Auch wenn manchmal die Fetzen geflogen sind.« Sie zuckte unmerklich zusammen, legte ihre Hand auf Bertrams Oberschenkel, zog sie aber sofort wieder weg und beeilte sich hinzuzufügen: »Sorry, Maik.«
»Kein Grund, sich zu entschuldigen. Hast ja recht.« Bertram probierte den Kuchen und stutzte. Zu wenig Zucker, kaum Äpfel und obendrein mit Vollkornmehl gebacken. Mit vollem Mund setzte er hinzu: »Arno Bremer und Klemens Kramer sind nicht gerade die Blues Brothers.«
»Ist das so?«, fragte Tenbrink nachdenklich.
»Du kennst doch Arno«, erwiderte Heide und strich sich eine blonde Locke hinters Ohr. »Immer will er Mr Perfect sein. Und Kramer ist einfach nur eine Schlaftablette.«
»Nein, ich meinte eigentlich den Fall Oliver Herzog.«
»Nach dem, was ich bislang gelesen habe, liegt hier die Sache klar auf der Hand«, antwortete Bertram und hörte Ella in ihrem Laufstall mit den Lippen Pupsgeräusche machen. Vielleicht kamen die Geräusche aber auch nicht aus ihrem Mund. »Immerhin hat er ein Geständnis hinterlassen und sich umgebracht. Viel eindeutiger geht's nicht, oder?«
»Seine Mutter hält ihn für unschuldig.«
»Natürlich denkt sie das. Wer hat schon gern einen Gewalttäter zum Sohn?« Bertram spülte das Kuchenstück, das sich in seinem Mund gerade wie Beton verfestigte, mit etwas Kaffee hinunter. »Aber die Fakten und Indizien sprechen eine andere Sprache. Oliver Herzog hat Anna Ostermann über Wochen belästigt und gestalkt. Sie hatten kurz vor der Tat einen lautstarken und handgreiflichen Streit, und anschließend wurde er in der Nähe des Tatorts gesehen.«
»Gibt es auch Zeugen für die Tat?«
Bertram schüttelte den Kopf. »Es war mitten in der Nacht, und der Tatort ist eine Art Vordach mit Mauern drumherum. Oben auf einer Lagerhalle und von unten nicht einzusehen.«
»Wie eine versteckte Terrasse«, setzte Heide hinzu und leckte sich über die Lippen. »Früher hat da oben vermutlich ein Kran oder eine Seilwinde gestanden, heute gibt's nur noch das Podest.«
»Und woher weiß man dann, dass sie einen handgreiflichen Streit hatten?«, wollte Tenbrink wissen.
»Der Streit war nicht auf dem Hallendach, sondern in einem anderen Gebäude der Fabrik. Eine Zeugin hat ausgesagt, dass Oliver Herzog Anna Ostermann angeschrien und geschlagen hat. Als die Zeugin eingegriffen hat, ist Herzog weggerannt. Das war gegen zehn Uhr abends.«
»Und wann ist Anna Ostermann vom Dach gestürzt?«
»Das lässt sich nicht genau sagen, weil es ja keinen Tatzeugen gibt und die Verletzte erst am nächsten Morgen gefunden wurde«, antwortete Bertram und zuckte mit den Schultern. »Vermutlich zwischen elf Uhr und Mitternacht.«
»Etwa um diese Zeit wurde Herzog im angrenzenden Wald gesehen«, fügte Heide kauend hinzu. »In Tränen aufgelöst und völlig außer sich. Er hat einen Mann, der mit seinem Hund am Waldrand unterwegs war, fast über den Haufen gerannt.«
»Merkwürdig«, sagte Tenbrink und schüttelte den Kopf. »Wenn sie sich vorher gestritten hatten, wie kam es denn dann überhaupt zu dem Treffen auf dem Dach?«
»Sie hat ihm um elf Uhr eine SMS geschickt«, antwortete Bertram. »›Lass uns in Ruhe reden. Bin auf dem Dach.‹ Das hätte sie besser nicht schreiben sollen.«
Heide wechselte abrupt das Thema. »Wie schmeckt euch der Kuchen?«, wollte sie plötzlich wissen.
»Lecker«, behauptete Bertram und steckte sich pflichtbewusst ein weiteres Stück in den Mund. »Eigenes Rezept?«
»Fettarm und mit ganz wenig Zucker«, erklärte sie, nickte stolz und hob die Augenbrauen. »Ein gesunder Kuchen.«
»Super«, murmelte Bertram, obwohl er der Meinung war, dass ein Kuchen nicht gesund sein musste. Das war ein Widerspruch in sich. Wenn er etwas Gesundes essen wollte, bevorzugte er Obst oder Gemüse.
»Oliver und Anna waren schon in der Schule ein Paar«, sagte Tenbrink unvermittelt und nahm einen großen Schluck Kaffee. Vermutlich war es auch für ihn ein mittelschweres Problem, den Betonkuchen hinunterzuschlucken. »Seine Mutter hat erzählt, dass er seiner Freundin einen Heiratsantrag machen wollte.«
»Anna Ostermann war nicht seine Freundin«, widersprach Bertram kopfschüttelnd. »Nur wenige Tage bevor er sie vom Dach gestoßen hat, ist sie zur Polizei gegangen und hat ihn angezeigt. Wegen Nachstellung. Wenn überhaupt, dann war er ihr Ex-Freund.«
»Was ist das eigentlich für eine Fabrik?«
»Eine ehemalige Ziegelei, die heute so 'ne Art alternatives Wohn- und Kulturprojekt ist«, antwortete Heide und kaute genüsslich auf einem Stück Apfelkuchen. »Nennt sich Kulturziegelei. Da leben und arbeiten verschiedene Künstler, Autoren und Musiker. Ist so was Ähnliches wie eine Kommune. Anna Ostermann war Malerin.«
»Das ist sie immer noch«, korrigierte Bertram. »Noch ist sie nicht tot.«
»Sie wird sterben, Maik.« Wieder landeten Heides Finger auf Bertrams Oberschenkel, und erneut zog sie die Hand sofort zurück. »Die Familie wehrt sich noch dagegen, aber die Ärzte werden die Maschinen demnächst abstellen.«
Bertram zuckte wie unter Schmerzen zusammen. Vor neun Monaten war er dabei gewesen, als man bei Martina Derksen die lebenserhaltenden Maschinen abgestellt hatte. Noch heute hatte er Albträume davon. Vor allem den seltsam säuerlichen Geruch des Todes bekam er nicht mehr aus seinem Kopf. Es hatte gerochen wie bei einem sauren Aufstoßen. Er schüttelte sich und sagte: »Am Montagmorgen bin ich übrigens mit dem behandelnden Arzt im Altwicker Krankenhaus verabredet.«
»Warum?«, fragte Tenbrink. »Gibt's irgendwas Neues?«
Bertram schüttelte den Kopf. »Arno möchte einen Abschlussbericht für die Akten. Ich soll den ›Status Quo der Geschädigten‹ dokumentieren. Arnos Worte, nicht meine.«
»Bist du sicher, dass du dir das antun willst?« Tenbrink stellte das nur zur Hälfte gegessene Kuchenstück auf den Tisch, leerte seine Tasse und lehnte sich im Sessel zurück. »Das kann doch auch Frank machen. Oder Reinhard.«
»Wird schon gehen.« Bertram winkte ab und versuchte sich an einem Lächeln, das sich aber etwas unecht anfühlte. »Ich kann schließlich nicht den Rest meines Lebens einen Bogen um jedes Krankenhaus machen, nur weil darin Menschen sterben. Dann müsste ich mir einen neuen Job suchen.«
»Trotzdem«, beharrte Tenbrink. »Bisschen unsensibel von Arno.« Sein Blick verfinsterte sich, und er putzte ausgiebig seine Brille. Ein untrügliches Zeichen, dass er in Gedanken versunken war. Dann richtete er sich plötzlich im Sessel auf und setzte die Brille wieder auf die Nase. »Ihr seid also sicher, dass Oliver Herzog der Täter ist?«
»Er hat immerhin ein Geständnis auf seinem Laptop hinterlassen«, entgegnete Bertram, um nicht mit Ja oder Nein antworten zu müssen. »Erstellt in der Nacht seines Todes.«
»Das hat mir nie so ganz geschmeckt«, sagte Heide.
»Was meinst du?«, fragte Bertram. »Den Kuchen?«
»Was? Nein.« Heide starrte ihn verwirrt an. »Ich meine das Geständnis. Wieso? Schmeckt dir der Kuchen nicht?«
»Doch, doch«, antwortete Bertram schnell und schob sich gleich noch ein Stück in den Mund. »Bisschen trocken vielleicht.«
»Ich hab extra nicht so viel Butter genommen«, erwiderte Heide sichtlich pikiert. »Wegen der Kalorien.«
Bertram nickte eifrig und möglichst anerkennend.
»Was war denn mit dem Geständnis?«, fragte Tenbrink.
»Na ja, das war irgendwie komisch, fand ich.« Heide schaute dabei aber Bertram an, der mit dem Kuchen kämpfte und krampfhaft versuchte, nicht zu würgen.
»Inwiefern komisch?«
»Das Geständnis war als Brief an die tote Anna Ostermann abgefasst.« Bertram hielt sich die Hand vor den Mund, weil er aufstoßen musste. »Wie ein Abschiedsbrief.«
»Das meine ich nicht«, erwiderte Heide. »Ich fand den Text nur so fürchterlich schwülstig und pathetisch. Ganz viel unglückliche Liebe und Herzschmerz und Schuld. Irgendwie übertrieben und zu dick aufgetragen.«
»Er hatte vor, sich umzubringen.« Bertram zuckte mit den Schultern. »Da kann man schon mal dick auftragen.«
»Mag sein. Aber ich fand den Brief trotzdem seltsam. Er gibt sich zwar die Schuld an ihrem Tod und sagt auch, dass er sie umgebracht hat, aber er bleibt dabei so seltsam vage und unbestimmt.«
»Er schreibt, dass er sie umgebracht hat«, sagte Bertram mit Nachdruck. »Was ist daran vage?«
»Die Art und Weise, wie er das schreibt. Das kam mir beinahe vor wie ...« Heide suchte nach einem passenden Wort und setzte schließlich hinzu: »... wie ein Gedicht.«
»Verstehe«, murmelte Tenbrink und machte ein finsteres Gesicht. »Du meinst, Oliver Herzog war eigentlich nicht sehr poetisch veranlagt.«
»Weiß nicht. So ungefähr.« Heide nickte und zuckte dann mit den Achseln. »Aber Maik hat natürlich recht. Eigentlich ist der Fall klar. Das war halt nur so 'n komisches Gefühl. Auch weil wir das Geständnis auf seinem Computer gefunden haben. Er hat es nicht einmal ausgedruckt.«
»Tatsächlich?«, brummte Tenbrink. »Aber an dem Suizid besteht kein Zweifel?«
Diesmal schüttelten Bertram und Heide synchron den Kopf und sagten wie aus einem Mund: »Nein!«
Als hätte der Ausruf ihr gegolten, schrie Ella plötzlich laut auf, strampelte mit Händen und Füßen und warf den Beißring durch das Gitter des Laufstalls.
Der angesabberte Ring landete direkt neben dem Pudel auf dem Vorleger und wurde sofort neugierig beschnuppert.
»Locke, pfui!«, rief Tenbrink.
»Sie zahnt«, sagte Bertram, nahm noch einen Schluck Kaffee und kümmerte sich um seine jämmerlich weinende Tochter. Vermutlich drohte ihm wieder eine kurze Nacht.
Zweiter Tag
Sonntag, 20. Oktober1
Tenbrink hatte getan, worum er von Gertrud gebeten worden war. Er hatte mit Maik Bertram und Heide Feldkamp über den Fall gesprochen und dabei erfahren, was er auch vorher schon vermutet hatte: Es war eine eindeutige Angelegenheit und würde in Kürze an die Staatsanwaltschaft übergeben. Nichts Auffälliges, Fragwürdiges oder Verdächtiges. Sah man einmal von Heides komischem Gefühl wegen des Geständnisses ab.
Eigentlich hätte Tenbrink die Sache damit auf sich beruhen lassen können. Gefallen getan und Pflicht erfüllt! Doch dummerweise war er ein Mensch, der sehr viel auf Gefühle gab. Vor allem, wenn sie komisch waren. In den vielen Jahren als Ermittler hatte er häufig – und sehr zum Missfallen seiner Kollegen und Vorgesetzten – auf sein Bauchgefühl gehört und nicht selten damit richtig gelegen. Nicht weil er ein quasi übersinnliches Gespür hatte oder an so was überhaupt glaubte, sondern weil es meistens gute Gründe für diese Gefühle gab. Und deshalb hatte er sich entschieden, nun doch Miss Marple zu spielen und sich einen Frühschoppen im Finstendorper »Burgfried« zu gönnen. Denn wenn man sich einen Überblick verschaffen wollte, konnte ein Besuch in der Dorfkneipe nie schaden. Ganz unverbindlich, versteht sich.
»Was soll's sein?«, fragte der Wirt, als Tenbrink sich an den Tresen setzte und Locke neben dem Hocker Platz machen ließ. Der Mann war eine imposante Erscheinung, bestimmt zwei Meter groß und mit einem phänomenalen Bierbauch, den er nur leidlich unter einer dunkelgrünen Anglerweste versteckte.
»Erst mal 'n Pils, dann sehen wir weiter«, antwortete Tenbrink und deutete auf den Pudel, der lieber noch etwas herumgeschnüffelt hätte und sich nur sehr unwillig auf dem Boden niederließ. »Ist das okay mit dem Hund?«
»Solange er die Klappe hält und stubenrein ist«, brummte der Wirt, schielte über den Rand einer Lesebrille, die ihm sehr tief auf der Nasenspitze saß, und hielt ein Tulpenglas unter den Zapfhahn.
»Noch nicht viel los«, bemerkte Tenbrink und schaute sich im ringsum vertäfelten und mit allerlei Fotos und Gemälden ausstaffierten Schankraum um. Ein junger Mann mit Lockenkopf und dünnem Flaum auf der Oberlippe saß am hinteren Ende des Tresens und ein alter Mann mit weißgrauem Vollbart an einem Ecktisch. Außer Tenbrink waren sie die einzigen Gäste.
»Die sind alle noch drüben in der Kirche.« Der Wirt deutete mit der Nase zum bleiverglasten Fenster neben dem Eingang, durch das man einen etwas verzerrten Blick auf den Kirchplatz hatte. »Um elf wird's voller.«
»Was hat es eigentlich mit der Burg auf sich?«, fragte Tenbrink und deutete auf die Bilder an den Wänden, bei denen es sich vor allem um Darstellungen mittelalterlicher Festungen handelte. »Das Hotel an der Wallstraße heißt ›Burghof‹, dies ist der ›Burgfried‹, und sogar die Hauptstraße an der Kirche heißt Burgstraße. Dabei gibt's in Finstendorp doch gar keine Burg.«
»Nicht mehr.« Der Wirt schob sich die Brille etwas höher und fügte mit bedeutsamem Nicken hinzu: »Früher gab's hier in der Nähe die Finsterburg. Richtung Altwick, ungefähr da, wo heute die alte Ziegelei steht. Daher hat das Dorf auch seinen Namen.« Als befürchtete er, Tenbrink könnte ihn unterbrechen, hob er die fleischige Hand – eine richtige Pranke – und beeilte sich hinzuzufügen: »Das hat aber nichts mit ›finster‹ zu tun, wie man vielleicht denken könnte.« Erst jetzt machte er eine Pause, zapfte noch ein wenig Bier nach und schien zu warten.
Tenbrink tat ihm den Gefallen und fragte: »Sondern?«
»Das kommt von den Grafen zu Finst«, erklärte der Wirt und ließ ein weiteres bedeutsames Nicken folgen. »Die haben die Burg im 14. Jahrhundert gebaut, mit zwei Wassergräben und einem Burgwall aus Stein. Das waren nämlich Raubgrafen. Später wurde die Burg vom Bischof von Münster erobert. Leider sind von der Anlage nur noch die Fundamente übrig. Vor zweihundert Jahren ist die Burg bei einem Sturm eingestürzt; der Bischof hat sie abtragen lassen und mit den Steinen die Kirche im Dorf erweitert.« Wieder deutete seine Nase zum Fenster, dann stellte er das fertig gezapfte Bier auf den Tresen. »Nur der Name ist geblieben. Und die Burgzinnen im Wappen von Finstendorp.«
»Interessante Geschichte«, sagte Tenbrink und nippte an seinem Bier. »Sie scheinen sich gut auszukennen.«
»Erwin ist der Vorsitzende vom Heimatverein«, merkte der junge Mann am hinteren Ende des Tresens an, der bisher nur auf sein Bier gestarrt und keinen Ton von sich gegeben hatte. »Stimmt's, Erwin?«
»Wenn's sonst keiner macht«, lautete die Antwort des Wirts. »Irgendjemand muss sich ja darum kümmern. Sonst geraten die Sachen in Vergessenheit. Wir haben schließlich nur diese eine Heimat.«
»So isses, Erwin!« Der junge Mann klopfte sich mit der Faust auf die Brust. Tenbrink dachte zunächst, er täte dies vor Rührung oder Stolz, doch dann folgte ein lauter Rülpser, und der Mann fügte ungerührt hinzu: »Mach mir noch mal 'n Pils!«
»Und heute steht da eine Ziegelei?«, sagte Tenbrink möglichst beiläufig und putzte seine Brille. »Werden da noch Ziegel gebrannt?«
»Sie sind nicht aus der Gegend, was?«, fragte der Wirt.
»Schöppingen«, antwortete Tenbrink.
»Ach so«, erwiderte der Wirt, als wäre damit alles gesagt. »In der Ziegelei wird schon seit vielen Jahren nichts mehr gebrannt. Jedenfalls keine Steine.« Es sah für einen Moment so aus, als würde noch etwas folgen, doch dann beließ er es bei einem Schnaufen und kümmerte sich um das Bier.
»Da wohnen jetzt die Hippies«, sagte der junge Mann, stand auf und setzte sich ungefragt neben Tenbrink. »Schimpft sich Kulturziegelei. Na ja, was man eben so Kultur nennt. Nichts für unsereins, was, Erwin?«
»Kann ich nix von sagen.« Der Wirt zapfte eine Schaumkrone auf das Bier und stellte es auf die Theke. »Sind halt junge Leute. Bisschen albern vielleicht, aber nicht weiter schlimm. Muss einem ja nicht gefallen, was die da machen. Ich hatte jedenfalls noch nie Ärger mit denen.« Wieder schielte er über seine Brille und fügte knurrend hinzu: »Was ich von dir nicht behaupten kann, Stefan.«
»Hippies?« Tenbrink tat erstaunt. »Gibt's die heute überhaupt noch? Ist das so 'ne Art Kommune?«
»Keine Ahnung, ob das Kommunisten sind«, antwortete der junge Mann, fuhr sich mit dem Zeigefinger über den Schnurrbartflaum und schaute hilfesuchend über den Tresen. »Künstler eben. Oder, Erwin? Den Schornstein der Ziegelei haben sie mit Farbe beschmiert, und überall stehen so komische Eisendinger rum. Völlig schief und verrostet.«
»So was nennt man Skulpturen«, erklärte der Wirt und verdrehte die Augen. »Das ist Kunst.«
»Mir doch egal, wie man das nennt. Sieht jedenfalls scheiße aus.« Der junge Mann hielt Tenbrink sein Bier zum Anstoßen hin und sagte: »Stefan Gesenhues.«
»Heinrich Tenbrink«, erwiderte Tenbrink, stieß mit ihm an und nahm einen kleinen Schluck. Er war mit dem Wagen da und wollte mit seinem Bier gut haushalten. »Wohnen in der Ziegelei nur Künstler aus Finstendorp?«
»Sie stellen ziemlich viele Fragen«, knurrte der Wirt.
»Vermutlich eine Berufskrankheit. Ich war früher mal Kommissar bei der Kriminalpolizei.«
»Echt jetzt?«, rief Stefan Gesenhues begeistert. »So 'n richtiger Kommissar? Cool! Da haben Sie doch bestimmt von der Sache mit Anna Ostermann gehört. Die kommt nämlich aus Finstendorp und hat in der alten Ziegelei gewohnt.«
»Ich bin pensioniert«, sagte Tenbrink, um nicht zu lügen. »Mit aktuellen Fällen hab ich nichts zu tun. Gott sei Dank! Wer ist denn diese Anna Ostermann?«
»Ein Mädchen aus dem Dorf. Die ist vor ein paar Wochen vom Dach der Ziegelei gestürzt.«
»Selbstmord?«, fragte Tenbrink. »Oder Unfall?«
»Weder noch. Die wurde geschubst.« Gesenhues griente, als fände er Gefallen an dem Gedanken. »Und jetzt raten Sie mal, von wem!«
»Woher soll ich das wissen?« Tenbrink zuckte mit den Schultern. »Von einem der Künstler?«
Gesenhues schüttelte den Kopf und grinste noch breiter. »Von einem Jungen aus dem Dorf. Oliver Herzog. Mit dem hab ich früher zusammen Fußball gespielt. Schrecklich, oder?«
»Ja, schrecklich«, bestätigte Tenbrink, obwohl der junge Mann eher freudig erregt wirkte. »Waren Sie mit diesem Oliver befreundet?«
»Nein!« Gesenhues hob abwehrend die Hand und nahm einen großen Schluck Bier. »Oliver war eher so 'n Einzelgänger. Typisch Torwart! Ich glaube, der hatte keine Freunde, jedenfalls nicht in der Mannschaft. Kein Wunder, wenn man immer aus der Wäsche guckt wie sieben Tage Regenwetter.« Er zog eine übertrieben leidende Grimasse. »Ich hab den nie richtig lachen gesehen. Immer nur depri. Hätte einem vielleicht zu denken geben sollen.«
»Goddorie! Redet doch nicht so 'n Quatsch!«, meldete sich in diesem Moment der alte Mann mit Vollbart zu Wort. »Das ist längst noch nicht gesagt.«
»Was ist nicht gesagt, Hermann?«, fragte der Wirt.
»Dass der Junge das war.«
»Doch, Oliver war's; immerhin hat er sich anschließend umgebracht«, erwiderte Stefan Gesenhues, aber eher in Tenbrinks Richtung. »In der Badewanne.« Er fuhr sich mit dem rechten Zeigefinger über die Innenseite des linken Unterarms. »Mit 'nem Teppichmesser, heißt es.«
»Dumm Tüüg!«, knurrte der Alte und erhob sich ächzend. »Das waren die Gammler aus der Ziegelei. Fiete Vossbülten und seine verlauste Bande. Künstler! Dass ich nicht lache! Tagediebe sind das! Von den Vossbültens ist noch nie was Gutes gekommen. Steck sie alle in 'nen Sack, hau mit 'nem Knüppel drauf, und du triffst immer den Richtigen! Meine Meinung.« Er stützte sich auf einen geschwungenen Knotenstock mit auffälligem Hirschhorngriff und schlurfte zum Ausgang. »Schreib's auf'n Deckel, Erwin!« Er deutete mit dem seltsamen Stock zum Ecktisch, an dem er gesessen hatte, und blaffte plötzlich Tenbrink an: »Du da, aus Schöppingen! Nimm deine halbe Portion da weg!«
Erst jetzt sah Tenbrink, dass Locke direkt vor dem alten Mann stand, große Hundeaugen machte und mit dem Schwanz wedelte. Vermutlich glaubte er, der lustig gebogene Stock sei ein Spielzeug und werde gleich zum Apportieren geworfen.
»'tschuldigung!« Tenbrink kletterte vom Hocker, marschierte zum Ausgang und nahm den Pudel auf den Arm. »Hab nicht aufgepasst.«
»Solltest du aber, Herr Kommissar!«, knurrte der Alte und tippte sich an die Nase. »Immer aufpassen! Sonst bist du ruckzuck auf dem Holzweg! Meine Meinung!« Dann schnaufte er abfällig und verließ grußlos die Kneipe.
»Wer war das denn?« Tenbrink wandte sich zum Wirt um und schüttelte verwirrt den Kopf. »Ist dem eine Laus über die Leber gelaufen?«
»Das ist Laukamps Hermann«, antwortete der Wirt und lachte. »Machen Sie sich nichts draus! So ist er halt. Kommen Sie, auf den Schreck geb ich einen Schnaps aus.«
»Hermann ist nicht ganz richtig im Kopf«, setzte Stefan Gesenhues hinzu und tippte sich an die Stirn, während Tenbrink gemächlich zurückkehrte.
»Mit seinem Kopf ist alles in Ordnung«, widersprach der Wirt. »Er wird nur eben schnell kiebig und laut.«
»Stimmt genau. Ein richtiger Esselpott«, ergänzte Gesenhues. »Und auf die Familie Vossbülten war er noch nie gut zu sprechen.«
»Fiete Vossbülten ist vermutlich einer der Künstler aus der Ziegelei?«, fragte Tenbrink, setzte sich wieder an den Tresen und nahm Locke sicherheitshalber auf den Schoß.
»Das ist 'ne andere Geschichte«, antwortete der Wirt schmallippig, stellte drei Pinneken auf den Tresen und füllte sie mit einer durchsichtigen Flüssigkeit aus einer unbeschrifteten Flasche. »Wohlsein!«
»Prost!«, sagte Tenbrink und stieß mit den beiden an. Eine andere Geschichte also, dachte er, lächelte unmerklich und kippte den Schnaps hinunter. Sofort verzog er sein Gesicht und musste husten. Der Schnaps brannte wie Feuer und schmeckte wie Terpentin. »Was ist das?«, keuchte er.
Der Wirt lachte dröhnend, klopfte sich auf den Bierbauch und rief: »Wacholder! Selbst gebrannt. Gibt's so was in Schöppingen nicht?«
Tenbrink versuchte zu lächeln und kämpfte mit den Tränen. Locke schien zu bemerken, dass mit seinem Herrchen etwas nicht stimmte, und leckte ihm tröstend über den Handrücken.
»Ganz unrecht hat Hermann aber nicht«, sagte Stefan Gesenhues, der den Wacholderschnaps wie Wasser getrunken hatte und sich genüsslich mit dem Handrücken über die Lippen fuhr. Dann blickte er den Wirt an. »Wär besser gewesen, wenn der alte Vossbülten euch die Ziegelei gegeben hätte und ihr ein Museum daraus gemacht hättet. Dann würde Oliver vielleicht noch leben. Und Anna läg nicht im Koma.«
»Et is wie 't is«, antwortete der Wirt und sammelte die Gläser ein. »Und et kümp wie 't kümp.«
»Was denn für ein Museum?«, fragte Tenbrink, nachdem sich sein Rachen wieder erholt hatte.
»Ein Burgmuseum. Oder, Erwin?«
Der dicke Wirt grunzte nur, schielte über seine Lesebrille und hob die Schultern.
»Der Heimatverein wollte aus der alten Ziegelei eigentlich ein Heimathaus und Burgmuseum machen, weil da doch früher die Burg gestanden hat«, erklärte Gesenhues und hob drei Finger. »Mach uns noch mal drei Wacholder, Erwin!«
»Für mich nicht, danke!«, rief Tenbrink erschrocken und wandte sich an den Wirt: »Und warum hat das mit dem Museum nicht geklappt?«
Der Wirt tat so, als hätte er die Frage nicht gehört, und griff nach der Wacholderflasche.
»Der Mietvertrag war eigentlich schon so gut wie unterschrieben«, antwortete Stefan Gesenhues anstelle des Wirts. »Aber dann hat Vossbülten seine Ziegelei lieber an den Sohnemann und dessen Freunde vermietet!« Er schnaufte geringschätzig und schüttelte den Kopf. »Das ganze Gelände mit allem Drum und Dran, vom alten Ringofen bis zum Finsterbusch.«
»Finsterbusch?«, hakte Tenbrink nach.
»Das Wäldchen an der Lehmkuhle, gleich neben der Ziegelei. Da haben die früher den Lehm abgebaut. Ist inzwischen mit Wasser vollgelaufen und so 'ne Art Baggersee.« Gesenhues beugte sich zu Tenbrink vor, tätschelte Lockes Wuschelkopf und setzte mit bedeutungsvoller Miene hinzu: »Die Lehmkuhle wird heute gern zum Baden genutzt, obwohl's eigentlich streng verboten ist. Wegen den steilen Wänden, und weil das Wasser so tief und fast schwarz ist. Das kommt von dem ganzen Ton in der Erde. Unter Wasser sieht man nix. Sind schon einige in dem Baggerloch ertrunken.«
»Du redest zu viel, Stefan!«, knurrte der Wirt und stellte drei gefüllte Schnapsgläser auf die Theke. »Trink lieber, dann kommt weniger Unsinn aus deinem Mund.«
»Ich wollte eigentlich keinen mehr«, sagte Tenbrink und deutete auf den Wacholder. »Ich muss noch fahren.«
»Stefan hat drei bestellt, also werden drei getrunken«, erwiderte der Wirt, und es klang beinahe wie eine Drohung. »So halten wir das nämlich in Finstendorp. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch in Schöppingen ist, aber hier stehen wir zu dem, was wir sagen. Oder, Stefan?«
»Stimmt genau, Erwin!«
Auf die Heimat!, dachte Tenbrink, nickte zögerlich und griff nach dem Pinneken. »Prost!«