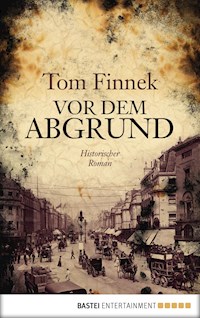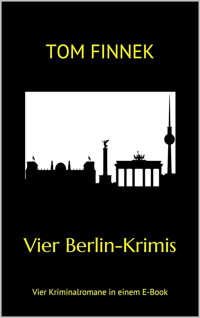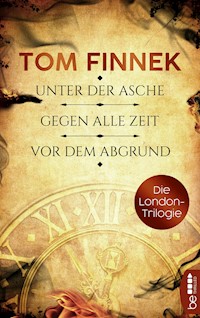Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein faszinierender Roman rund um das große Feuer von London
London 1666 - vier Tage lang verschlingt ein Feuer die Stadt. Im Armenviertel Southwark lebt der Straßenjunge Geoff, der mehr schlecht als recht versucht, seine Familie durchzubringen. Seine Schwester Jezebel, die sich in einer verruchten Spelunke als Schankmagd verdingt, birgt ein Geheimnis - und verschwindet eines Tages spurlos. Auf der Suche nach ihr stößt Geoff auf ein Netz aus Intrigen, Schuld und ungesühnter Rache - ein Gemisch, das schließlich den größten Brand der Geschichte entfachen sollte ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 901
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Tom Finnek
Unter der Asche
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG Originalausgabe Copyright © 2009 by Bastei Lübbe AG, Köln Textredaktion: Michael Kubiak Karten: Reinhard Borner, Wipperfürth Titelillustration: © View of London, French School (17th century) / Private Collection / Bridgeman Berlin Umschlaggestaltung: Pauline Schimmelpenninck Büro für Gestaltung, Berlin Datenkonvertierung E-Book: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-8387-0085-4 Sie finden uns im Internet unter: www.luebbe.de Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
INHALT
Die wichtigsten handelnden Personen
PROLOG Die dreibeinige Stute
ERSTER TEIL Dark Entry
ZWEITER TEIL Twin Oaks
DRITTER TEIL Old Barge House
VIERTER TEIL Lambeth Marsh
FÜNFTER TEIL Little Heath
SECHSTER TEIL Winchester House
SIEBENTER TEIL Cocksparrer
ACHTER TEIL Pudding Lane
EPILOG Feuer und Asche
ANHANG Anmerkungen und Übersetzungen
DIE WICHTIGSTEN HANDELNDEN PERSONEN
In London
Geoff(rey) Ingram, die 13-jährige »Plage von Southwark«
Jez(ebel) Ingram, seine hübsche Schwester
Edward Ingram, Geoffs verschwundener älterer Bruder
Paul Ingram, sein pestkranker Vater
Eleanor Ingram, seine verschollene Mutter
Master Gerrard, Lehrer der Armenklasse,»Eremit von St. Olave«
Rat Scabies, Geoffs verrückter Nachbar und Rattenfänger
Rancid Ray, eigentlich Raymond Webster,Gauner und Taschendieb
Bernard & Marjory Collins, Wirte des»Boar’s Head Inn« in Southwark
Glen Matlock, Geoffs bester Freund
Mutter Southwood, Wirtin des »Maiden Inn« in Lambeth
Hum(ble) Southwood, ihre Tochter
Penelope, Fatty Fanny und Ada, Schankfrauenim »Maiden Inn«
James Hollar, ein junger Maler
Wenceslaus Hollar, sein Vater,böhmischer Kupferstecher und Radierer
In Surrey
Mildred Oldershaw, Bäuerin der»Twin Oaks Farm« in Oxshott
Josh(ua) Oldershaw, ihr Mann
Mary & Joseph, deren Kinder
Jane Holcombe, alte Magd der Oldershaws,Hebamme
John Platt, Gutsherr von Cobham Manor,Pfarrer der Gemeinde von St. Andrew
Margaret Platt, seine Frau
Robert Gavell, John Platts ermordeter Stiefsohn
Nathaniel Holcombe, Janes Sohn, Schafhirteund ehemaliger Digger
Tom Farynor, Sohn des königlichen Bäckersin der Londoner Pudding Lane
PROLOG
–––––
DIE DREIBEINIGE STUTE
»Here by the permission of heaven, hell broke loose on this protestant city,from the malicious hearts of barbarous Papists by the hand of their agent, Hubert,who confessed and on the ruins of this place declared this fact,for which he was hanged.«
(»Hier brach, mit Billigung des Himmels, die Hölle über diese protestantische Stadt herein, heraufbeschworen aus den heimtückischen Herzenbarbarischer Papisten durch die Hand ihres Erfüllungsgehilfen, Hubert,der geständig war und auf den Ruinen dieses Ortes offenbarte,wofür er gehängt wurde.«)
Inschrift einer Gedenktafel in Pudding Lane
–––––
Samstag, 27. Oktober 1666
London dämmerte. Ein warmes, rötliches Abendlicht legte sich wie ein unpassend gefärbtes Leichentuch über die Stadt und ließ die Verwüstung und Zerstörung noch unwirklicher erscheinen. Fast hatte es den Anschein, als glühten die verbrannten Überreste immer noch. Die hagere Gestalt stand seit etwa einer Stunde regungslos am Fenster und starrte hinaus ins Halbdunkel. Auch das Gesicht des Mannes war unbewegt, die knittrige fahle Haut schimmerte im Abendlicht, als wäre sie vom Fieber gerötet. Der weiße Haarschopf und die buschigen Augenbrauen schienen ebenfalls wie vom großen Feuer erfasst, das die gesamte City von London vor beinahe zwei Monaten in Schutt und Asche gelegt hatte. Noch immer lastete Brandgeruch auf den Häusern und dem Fluss, und manchmal kam es dem Mann so vor, als hätte sich dieser Gestank in seinem Kopf eingebrannt wie ein unsichtbares Kainsmal.
Durch das Fenster seiner Dachstube schaute er auf den Friedhof und die alte gotische Kirche von St. Olave. Dahinter sah er die breite Themse und am gegenüberliegenden nördlichen Ufer die niedergebrannten Ruinen der Häuser und Kirchen, die wie eine grässliche Verhöhnung ihrer einstigen Größe wirkten. Zur Linken wurde der Blick durch die London Bridge versperrt, deren dicht gedrängte und ausladende Häuser durch eine Baulücke am anderen Ende gerettet worden waren. Ein Brand vor über dreißig Jahren hatte diese Lücke gerissen und damit ein Übergreifen des furchtbaren Feuers auf die Südseite der Brücke und den Stadtteil Southwark verhindert. Vielleicht, ging es dem Mann durch den Kopf, machte es das nur noch schlimmer: dass sie ungeschoren und unbeschadet davongekommen waren.
Sein Blick wanderte vom hohlen Zahn des einst mächtigen Kirchturms der St. Paul’s Kathedrale zu den Hügeln von Hampstead und Islington am nördlichen Horizont, wo die Bewohner der City in den ersten Wochen nach dem Brand ihre Lager errichtet und vorübergehend Zuflucht gefunden hatten. Inzwischen waren viele wieder in die Stadt zurückgekehrt und hausten in Zelten oder provisorischen Hütten inmitten der Trümmer. Manche wohnten in den Kellern oder zwischen rußgeschwärzten Mauern unter freiem Himmel, andere fanden Unterkunft in den unversehrten Hallen und Kirchen am Stadtrand. Doch obwohl die einstmals lärmende und pulsierende City von London wieder bewohnt war, wirkte sie nun tot und gespenstisch, vor allem bei Nacht. Niemand wagte sich nach Sonnenuntergang auf die wenigen frei geräumten Straßen oder Trampelpfade, denn Diebe und Räuber trieben sich herum und suchten in den Ruinen nach zurückgelassenen Schätzen oder sonstigen brauchbaren Gerätschaften. Jede Katastrophe gebiert ihre Parasiten, dachte der Mann. Bei der Pest im vergangenen Jahr waren es die Quacksalber und falschen Propheten gewesen, nach dem Brand waren es das Diebesgesindel und die Bierbrauer, die ihre Trinkstände in der City errichtet hatten, bevor die Asche der Ruinen abgekühlt war.
Sein Blick schweifte weiter zu den Überresten des Rathauses und der königlichen Börse, die in dem Durcheinander kaum auszumachen waren, und verharrte schließlich bei der völlig zerstörten Kirche von St. Magnus am nördlichen Ende der Brücke. Ganz in der Nähe, nur einen Steinwurf entfernt, befanden sich die Pudding Lane und die Bäckerei des Thomas Farynor, in der das schreckliche Feuer am ersten Sonntag im September seinen Anfang genommen hatte. Östlich davon, direkt am Ufer, sah der Mann den Fischmarkt von Billingsgate und das Zollamt, beide nicht mehr als solche zu erkennen. Beinahe alles, was sich innerhalb der Stadtmauern befunden hatte, war niedergebrannt, eingestürzt und schwarz verkohlt. Mehr als hunderttausend Menschen hatten ihr Obdach verloren, Zehntausende Häuser, Hunderte Straßen und zahllose Kirchen waren verwüstet und zerstört. Sie waren nur noch unkenntliche Überreste eines monströsen Scheiterhaufens. Nur der Tower von London stand wie eh und je auf seinem Hügel, als hätte er mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun gehabt. Wie durch ein Wunder war die Festung östlich der Stadtmauer von den Flammen verschont worden. Aber an Wunder glaubte der Mann schon lange nicht mehr.
»Master Gerrard!«, hörte er plötzlich eine aufgeregte und atemlose Jungenstimme hinter sich. Die Zimmertür, die nie verriegelt war, fiel krachend ins Schloss.
Ohne sich nach dem Jungen umzudrehen, fragte der Mann: »Robert Hubert ist tot?«
»Ay, Master«, antwortete der Junge, der nicht mehr Kind, aber noch nicht erwachsen war und dessen ärmliche Kleider zerschlissen und verdreckt waren. »Die dreibeinige Stute hat den Franzosen gefressen«, setzte er hinzu und blieb nahe der Tür stehen, als wolle er gleich wieder Reißaus nehmen.
»Geoffrey Ingram!«, sagte Master Gerrard tadelnd.
»Aber alle nennen den Galgen von Tyburn so«, beharrte der Junge, nahm die Mütze vom Kopf und fuhr sich mit gespreizten Fingern durch das rotblonde Haar. »Steht auf drei Beinen wie ein Schemel, nur sitzen kann man nicht drauf. Und statt Zügeln und Zaumzeug gibt’s ’nen dicken Strick mit ’ner Schlinge.«
»Der Henker hat also ganze Arbeit geleistet?«, fragte Master Gerrard verbittert.
»Na ja, ganz wie man’s nimmt.« Der Junge verstummte und biss sich auf die blassen Lippen.
Verwundert wandte sich der Mann um. »Was heißt das?« Er winkte den Jungen zu sich. »Was ist geschehen?«
Geoffrey räusperte sich und kam zögernd näher, schließlich murmelte er: »Sie haben ihn in Stücke gerissen.«
»Wie meinst du das?«
»So wie ich’s sage«, antwortete der Junge achselzuckend und zog die Nase kraus. »Sie haben ihn zerfetzt.«
»Wer? Wen? Wieso?« Master Gerrard packte den Jungen am Kragen und schüttelte ihn, dass ihm die Mütze aus den Händen fiel. »Nun red schon, Bengel! Oder soll ich’s aus dir rausprügeln?«
»Tja«, druckste Geoffrey herum und schien nach den rechten Worten zu suchen. »Erst war alles ganz normal und wie immer. Nur dass mehr Leute da waren als sonst. Zwei Tribünen haben sie aufgebaut, damit auch alle was sehen können. Erst hat der Henker eine Rede gehalten, dann kam der Priester, und dann haben sie den Franzosen auf einen Pferdekarren gestellt und ihm den Strick um den Hals gelegt. Anschließend hat der Henker dem Pferd die Peitsche gegeben, und der Franzose hat gebaumelt und gezappelt, bis er tot war. Das hat ganz schön gedauert, weil sich keiner an seine Beine gehängt hat.«
Master Gerrard ließ den Jungen los und bekreuzigte sich.
»Beinahe ’ne Stunde hat der danach noch gehangen, wie’s so üblich ist bei Hinrichtungen, und der Henker hat an einem der drei Pfähle gehockt und ’ne Tonpfeife geraucht, als würde er das schöne Wetter genießen. Dann hat er ihn schließlich runtergenommen, und ein Arzt hat festgestellt, dass der Franzose tot ist. War ja nicht zu übersehen.«
»Und weiter?«
»Sie wollten ihn auf den Karren hieven, aber dazu kam’s nicht mehr.« Der Junge schüttelte den Kopf, als könne er nicht glauben, was er gesehen hatte. »Normalerweise gehen die Leute nach Hause, wenn der Mann am Strick nicht mehr zappelt. Gibt ja nichts mehr zu sehen. Aber diesmal war’s anders. Alle sind geblieben, als würden sie auf ’n weiteres Spektakel warten, keiner hat sich vom Fleck gerührt. Und als der tote Franzose auf den Karren geladen werden sollte, da haben sie sich plötzlich auf ihn gestürzt. Alle! Wie auf ein Kommando. Plötzlich hatten sie Nägel und Messer in der Hand, und wenn der Henker und der Doktor nicht beiseitegesprungen wären, hätten sie die auch kaltgemacht.« Geoffrey schluckte, er presste die Lippen aufeinander, und plötzlich liefen ihm Tränen über die sommersprossigen Wangen. »Sie haben ihn mit den Nägeln und Messern bearbeitet, bis nichts mehr von ihm übrig war. In tausend Stücke haben sie ihn zerlegt. Und den abgeschnittenen Kopf haben sie wie einen Ball hin und her geworfen und mit Füßen getreten.«
»Oh, mein Gott!« Master Gerrard vergrub das Gesicht in den Händen und murmelte: »Was für Dummköpfe und Tölpel! Wie kann man nur so verblendet und einfältig sein? ›Lüge und Unwahrheit herrschen im Land‹, spricht der Herr, ›von Bosheit zu Bosheit schreiten sie voran.‹« Plötzlich hob er ruckartig den Kopf, starrte den Jungen an und rief: »Das ist unser Werk, Geoffrey! Wir haben das Blut dieses armen Menschen an unseren Händen.«
»Ihr, Sir? Was habt Ihr denn mit dem Feuer zu tun?«
»Es hängt alles zusammen, merkst du das nicht? Wir alle haben gelogen oder die Wahrheit verschwiegen, und deshalb musste der Franzose sterben.«
»Aber er hat gestanden«, sagte der Junge und wischte sich die Tränen aus dem vor Schmutz starrenden Gesicht. »Das hätte er doch nicht tun müssen. Wieso macht er so was? Was können denn wir dafür, dass er sagt, er war’s? Selbst unter dem Galgen hat er wiederholt, dass er das Feuer gelegt hat. Als wär er stolz darauf. Dann muss er sich nicht wundern, wenn sie ihn hängen.«
»Wir wissen es besser, Geoffrey«, antwortete Master Gerrard. »Sie brauchten einen Sündenbock und haben sich einen hinkenden Schwachkopf gegriffen, der weder geistig noch körperlich in der Lage war, ein derartiges Komplott zu schmieden, wie es ihm angelastet wird. Und wieso haben sie das getan? Nur weil er ein Franzose und angeblich ein Spion des Papstes war. Dummes Zeug!«
»Er hat gestanden«, beharrte Geoffrey mit störrischer Miene.
»Pah!«, schnaufte Master Gerrard und starrte aus dem Fenster. Die Sonne war inzwischen untergegangen, der Himmel über der Brücke war blutrot, Dunkelheit senkte sich auf die Stadt herab und ließ ihre Umrisse verschwimmen. »Nicht einmal seine Richter haben ihn für schuldig gehalten. Nur die Geschworenen haben das unsinnige Geständnis für bare Münze genommen, aber die Jury bestand ja auch größtenteils aus der Familie des Bäckers.«
»Farynor«, sagte Geoffrey und nickte.
»Das ist aber alles völlig unerheblich. Die Frage ist nämlich: Sind wir schuldig?«
»Was hätten wir denn tun sollen, Sir?«, fragte der Junge leise.
»Genau das ist der entscheidende Punkt«, entgegnete Master Gerrard.
»Sie hätten mir kein Wort geglaubt, wenn ich ihnen die Wahrheit erzählt hätte«, murmelte Geoffrey. »Nicht, solange Jez verschwunden ist und der Sohn des Bäckers …« Er ließ den Satz unbeendet, schüttelte stattdessen den Kopf und sagte: »Sie hätten mich einen Lügner genannt.«
»Mag sein«, erwiderte Master Gerrard gedankenverloren. »›Einer täuscht den anderen‹, spricht der Herr, ›Wahrheit redet man nicht.‹« Plötzlich fuhr er herum und schaute sich im Zimmer um, ohne in der Dunkelheit wirklich etwas erkennen zu können. »Deshalb müssen wir anfangen zu graben.«
»Graben, Sir?«, wunderte sich der Junge.
»Was siehst du, wenn du auf die Stadt schaust?«, fragte Master Gerrard und deutete aus dem Fenster.
»Weiß nicht«, antwortete Geoffrey achselzuckend. »Dunkle Nacht?«
»Schwarze Asche, mein Junge«, verbesserte Master Gerrard. »Doch unter der Oberfläche glimmt und glüht es, dass man sich verbrennen kann, auch jetzt noch, man muss nur tief genug graben.« Er bückte sich, kramte auf seinem Schreibtisch und in den verstreut liegenden Papieren herum und sagte: »Deshalb werden wir auf der Stelle damit anfangen.«
»Womit?«
»Wir graben nach der Wahrheit!«, rief Master Gerrard und hielt einen Gänsekiel in der Hand. »Auch wenn sie niemand hören oder glauben will.«
»Das ist eine Feder, Sir.« Geoffrey hob zweifelnd die Augenbrauen.
»Du sagst es«, antwortete Master Gerrard und drückte sie dem verdutzten Jungen in die Hand. »Eine Feder.«
ERSTER TEIL
–––––
DARK ENTRY
»The borough is reputed to be a somewhat dirty suburb of London,in which chiefly poor people live, and in which many foul and disagreeabletrades are carried on. It was not always so.«
(»Der Bezirk gilt als etwas dreckiger Vorort von London,in dem vor allem arme Leute leben und in dem viele übleund fragwürdige Geschäfte abgewickelt werden.Das war nicht immer so.«)
William Rendle, »A few particulars of Old Southwark«
–––––
1. KAPITEL
Handelt von einem dunklen Eingangund einem Rattenfänger
Meine Familie hatte schon immer ein glückliches Händchen, wenn es darum ging, die falschen Dinge zur falschen Zeit zu tun. Ich weiß, man kann sich seine Sippschaft nicht aussuchen, und Blut ist bekanntlich dicker als Wasser, wenn’s nicht gerade die stinkende Brühe der Themse ist. Ich will auch nicht undankbar erscheinen oder herumjammern. Ich sag nur, wie ich’s sehe, und das wird ja wohl noch erlaubt sein.
Nehmt zum Beispiel meine Mutter. Als ihr klar wurde, dass das triste Familienleben nichts für sie war und sie nicht an der Seite eines armseligen Fährmanns an der Themse leben wollte, war sie dreißig Jahre alt und hatte diesem Flussschiffer gerade das dritte Kind geschenkt: mich! Was sie jedoch nicht davon abhielt, nur einen Monat nach der Geburt ihr Bündel zu schnüren, Mann und Kinder zurückzulassen, sich einem herumziehenden Soldatentross anzuschließen und auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Das war vor etwas mehr als dreizehn Jahren, im Sommer 1653, und wenn ich ehrlich bin, kann ich’s ihr nicht einmal verdenken. Vielleicht hätte ich’s genauso gemacht. Aber trotzdem war’s das Falsche zur falschen Zeit, wenn ihr mich fragt.
Mit meinem Vater verlief’s ganz ähnlich, wenn auch auf völlig andere Art und geraume Zeit später. Es war vor einem halben Jahr, im Mai 1666. Über Monate hinweg waren die Leute wie die Fliegen an der Pest gestorben, das ganze vergangene Jahr waren sie in London krepiert, als wollte die Stadt binnen kürzester Zeit aussterben. Jedes zweite Haus war mit dem Krankheit und Tod verkündenden roten Kreuz und dem frommen Wunsch »Herr erbarme dich unser!« gezeichnet. Man hatte Mühe, die Unmengen an Leichen fortzuschaffen und in geweihter Erde Platz für sie zu finden. Nur unser elendes Dark Entry, eine winzige Sackgasse am Südende der London Bridge, war bislang verschont geblieben. Was beinahe ein Wunder war, wenn man bedachte, was für kranke Kreaturen dort hausten– und damit meine ich ausnahmsweise nicht meine Familie.
Als es im Dezember des vergangenen Jahres hieß, die Pest sei am Abklingen, und in den folgenden Wochen immer weniger Leute an der Seuche starben, atmeten alle Londoner erleichtert auf. Der Winter ging, der Frühling kam, die Pest schien besiegt und hatte ihren Schrecken verloren. Es gab vereinzelte Freudenfeuer, Dankgottesdienste wurden abgehalten, die Gasthäuser waren wieder bis weit in die Nacht geöffnet. Die feinen Herrschaften (unter ihnen der König) kehrten von ihren Landsitzen in die Stadt zurück, und von den Kanzeln predigten die Pfaffen, die ebenfalls das Weite gesucht hatten, der Herr im Himmel habe endlich das Flehen der sündigen Menschen erhört. Hinter vorgehaltener Hand munkelten einige, die Seuche sei eine Strafe Gottes für die losen Sitten am königlichen Hof gewesen. Doch nun war das Schlimmste überstanden, da waren sich alle einig. Erleichterung machte sich breit.
Nur mein Vater hatte nichts Besseres zu tun, als sich im Mai 1666 die eitrigen Beulen auf den Buckel zu holen und binnen weniger Tage an der Pest einzugehen. Hat man so etwas Dummes schon gehört?
Vermutlich merkt ihr bereits, was mit meiner Familie los ist: Sie hat kein Gespür für den rechten Zeitpunkt. Und ihr verzeiht hoffentlich, dass ich mich erst jetzt vorstelle: Mein Name ist Geoffrey Ingram, geboren am 30.Juli 1653, als Sohn von Paul und Eleanor Ingram, Bruder von Jezebel und Edward, bis vor Kurzem wohnhaft am hinteren Ende des Dark Entry, im Borough von Southwark, London, Königreich England. Nicht sehr aufschlussreich, oder? Aber mehr gibt’s eigentlich nicht über mich zu sagen, zumindest nichts, was teure Tinte und Papier wert wäre. Ich bin nur ein einfacher Bursche, weder besonders klug und erst recht nicht wohlhabend. Kaum der Rede wert oder wie mein Bruder Edward zu sagen pflegte: »So nützlich wie ein verdammter Kropf.« Und weil das so ist, handelt das, was ich auf diesen Seiten berichten werde, auch weniger von mir als von anderen Personen, die mir über den Weg gelaufen sind oder sich aus sonstigen Gründen in mein Leben eingemischt haben. Ob ich’s nun wollte oder nicht. Von meiner Schwester Jezebel beispielsweise, die sozusagen eine Meisterin der falschen Dinge zur falschen Zeit ist. Oder dem Eremiten von St.Olave, der allerdings kein Mitglied der Familie ist, auch wenn ich Master Gerrard– wie er eigentlich heißt– öfter zu Gesicht bekam, als mir und ihm lieb sein konnte. Aber das werdet ihr alles noch früh genug erfahren. Immer hübsch der Reihe nach.
Zunächst will ich euch meine alte Nachbarschaft beschreiben, damit ihr einen ungefähren Eindruck bekommt, womit ihr es hier zu tun habt. Mein Vater hat oft gesagt: »Wir wohnen im Hinterhof von London, mein Junge. Und du weißt ja, was man im Hinterhof findet. Den Unrathaufen, die Sickergrube und das Scheißhaus.« Vermutlich darf man solche Worte gar nicht zu Papier bringen, und es würde mich nicht wundern, wenn die Tinte vor Scham durchsichtig würde, aber so hat er’s nun mal gesagt, und gemeint hat er damit Folgendes: Alle Welt kannte London. War ja eine riesige Stadt mit vielen Straßen, einem Gewimmel von Häusern, unzähligen Einwohnern, mächtigen Kirchen und einer hübschen Stadtmauer drum herum. Das Zentrum der Zivilisation, wie manche behaupteten. Die Stadt Gottes, sagten andere. Und obwohl Southwark ein Stadtteil von London war, gehörte es nicht wirklich dazu, denn es lag sozusagen auf der falschen Seite des Flusses. Ihr müsst euch das wie eine riesige Sanduhr vorstellen, mit der London Bridge wie ein steinernes Nadelöhr in der Mitte.
Während es oben in der City das Rathaus, die Kathedrale von St.Paul, die königliche Börse und den mächtigen Tower gab, fand man unten in Southwark nur Wirtshäuser, Bordelle, Abdecker, Brauereien und Gefängnisse. Wenn London bekannt und berüchtigt war für seinen Lärm und Trubel, dann war es Southwark für seinen Gestank. Ein einziger riesiger Unrathaufen eben. Und was Southwark für London war, das war unser Dark Entry für Southwark. Der Hinterhof vom Hinterhof, wenn’s so was überhaupt gibt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!