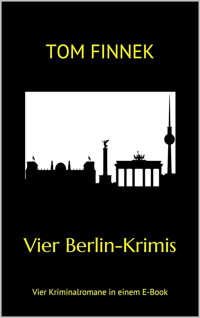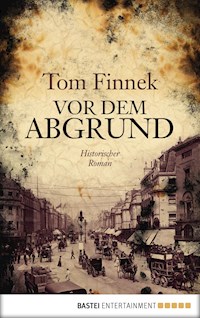
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit diesem historischen Roman ist dem Schriftsteller Tom Finnek in seiner London-Trilogie ein neues spannendes Werk gelungen. Er führt den Leser mitten hinein in die dunkle britische Halbwelt Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Zwischen Opiumhäusern, Kneipen und Bordellen ist die Stimmung aufgeheizt: Während die britische Heilsarmee versucht, dem sündigen Treiben ein Ende zu machen, kämpft die Skeleton Army mit allen Mitteln für die Gewinne der Schankwirte und Brauhäuser.
Welten prallen aufeinander
Im Herbst 1888 kommen zwei junge Menschen ins Londoner East End, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die verarmte Celia Brooks versucht verzweifelt, ihren Vater zu finden. Der Hotelierssohn Rupert Ingram will hingegen seine Pflichten im sündigen Treiben vergessen. Doch im East End hat alles seinen Preis, Antworten ebenso wie das Vergessen. Und während die Huren ihre Dienste feilbieten und ein Mörder namens Jack the Ripper in den Schatten lauert, stoßen Celia und Rupert auf Geheimnisse, die ihr Leben für immer verändern -
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 780
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
ÜBER DEN AUTOR
Tom Finnek, 1965 in Westfalen geboren, lebt als Filmjournalist und Schriftsteller in Berlin. Als Autor beschäftigt er sich schon länger mit historischen Stoffen. Für ihn ist gerade London mit seiner langen, wechselhaften Geschichte besonders faszinierend, und dem trägt er in seinen Romanen UNTER DER ASCHE, GEGEN ALLE ZEIT und VOR DEM ABGRUND Rechnung: Sie spielen alle in London, aber in unterschiedlichen Jahrhunderten. Tom Finnek ist verheiratet und stolzer Vater von zwei Söhnen.
TOM FINNEK
VOR DEM ABGRUND
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Kai Lückemeier Umschlaggestaltung: Pauline Schimmelpenninck Büro für Gestaltung, Berlin Umschlagmotiv: © Hulton-Deutsch Collektion/CORBIS, © missbehavior.de E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-4485-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
INHALT
Die handelnden PersonenERSTER TEILCelia BrooksZWEITER TEILRupert IngramDRITTER TEILCelia BrooksVIERTER TEILNed BrooksFÜNFTER TEILRupert IngramSECHSTER TEILCelia BrooksSIEBTER TEILRupert IngramACHTER TEILNed BrooksNEUNTER TEILCelia und RupertEPILOGThe RefugeANHANGAnmerkungen und ÜbersetzungenDIE HANDELNDEN PERSONEN
Celia Brooks, ein Mädchen aus Essex
Ned Brooks, Seemann, Celias verschollener Vater
Mary Brooks, ihre verstorbene Mutter
Rupert Ingram, Hoteliersohn
Harvey Ingram, sein Vater, Hotelier und Witwer
Mortimer & William Ingram, Ruperts ältere Brüder
Meredith Wright Barclay, Ruperts Verlobte aus Bury Hill, Dorking
Robert Barclay, Bierbrauer (Barclay, Perkins & Co.), Merediths Onkel
Graham Maggott, genannt Gray, Laufbursche im Crown Hotel
Simeon Solomon, Maler und Ruperts Freund
Eva Booth, Captain der Heilsarmee, Tochter von William Booth, dem Gründer und 1. General der Heilsarmee
Florence Soper Booth, Evas Schwägerin, Leiterin des Frauenasyls
Adam Bedford, ein Heilsarmist
Heather, Obdachlose und Gelegenheitshure
Maureen Watson, genannt Sheila, die Schlangenfrau, Bühnendarstellerin
Mary Jane Kelly, genannt Ginger, Prostituierte
Joseph Barnett, Fischträger, ihr Lebensgefährte
Elizabeth Stride, genannt Long Liz, Prostituierte und Mordopfer
Michael Kidney, Hafenarbeiter, ihr Lebensgefährte
Rod(ney) Webster, Wirt des George Inn
Tom Dudley, Kapitän der Mignonette
Edwin Stephens, Maat auf der Mignonette
Richard Parker, genannt Dick, Kabinenjunge
ERSTER TEIL
CELIA BROOKS
»O, where shall I go to, or what can I do? I’ve no one to tell me what course to pursue; I’m weary and foot sore, I’m hungry and weak, I know not what shelter to-night I may seek.«
(»Oh, wo soll ich hingehen, oder was kann ich tun? Ich habe niemanden, der mir sagt, welchen Weg ich einschlagen soll; Ich bin müde, meine Füße sind wund, ich bin hungrig und schwach, Ich weiß nicht, welchen Schutz ich heute Nacht suchen kann.«)
William S. Hays, Driven from home, 1868
DONNERSTAG, 18. OKTOBER 1888
1
Celia war noch nie zuvor in London gewesen, und trotz der zahlreichen und ausführlichen Erzählungen ihrer Mutter war sie nicht auf das gefasst, was sie in der Hauptstadt erwartete. Als sie aus dem überfüllten Abteil der dritten Klasse auf den Bahnsteig des Bahnhofs Waterloo stieg, da war es ihr, als beträte sie eine fremde Welt. Die Größe und Unübersichtlichkeit dieses verschachtelt gebauten Bahnhofs schüchterten Celia ein, und die Menschenmassen und das aggressive Gedränge auf dem Bahnsteig nahmen ihr im wahrsten Sinn des Wortes die Luft. Es war, als hätten die Leute die Absicht, sich gegenseitig von der Plattform zu stoßen. »London ist wie zwei Bienenvölker in einem Bienenschlag«, hatte ihre Mutter oft gesagt, und jetzt begriff Celia, was sie damit gemeint hatte.
Kofferträger und Kutscher bedrängten die Passagiere der London and South Western Railway* und wollten sie zu ihren Wagen locken, aufdringliche Händler boten Essen und Getränke an, Männer mit umgehängten Pappschildern machten Werbung für umliegende Hotels oder Gasthäuser, und Zeitungsjungen hielten Gazetten in die Luft und posaunten die Schlagzeilen des Tages heraus: »Neuer Brief des Rippers! Polizei tappt weiter im Dunkeln! Bürgerwehr fordert Belohnung! Jack the Ripper schickt Brief! Lesen Sie alles darüber!«
Kaum hatten Celias Füße das Pflaster des Bahnsteigs berührt, schon wurde sie vom Strom der Menschen mitgerissen, in Richtung der Ausgänge, die sich auf der Nordseite des Kopfbahnhofs befanden. Die Waterloo Station schien aus vielen kleineren Bahnhöfen zu bestehen, die wie ein Strauß Blumen von unterschiedlicher Länge und Größe gebündelt waren. Da es keine zentrale Empfangshalle gab und der eine Bahnsteig oft nur zu einer weiteren, höher oder tiefer gelegenen Plattform führte, mussten sich die Passagiere den Weg zu den Ausgängen durch unterirdische Tunnel oder über Fußbrücken erkämpfen; verfolgt von den lärmenden Heerscharen, die schon auf dem Bahnsteig auf sie einstürmten.
Während Celia an den braunen Waggons und der erbsengrünen Lokomotive vorbeigeschoben wurde und aufpassen musste, nicht zwischen die Wagen aufs Gleisbett zu geraten, wünschte sie sich zurück nach Southampton, wo am Morgen ihre Reise begonnen hatte. Oder besser gleich nach Brightlingsea in Essex, wo sie bis vor wenigen Tagen zu Hause gewesen war. Wie gern hätte sie in diesem Moment an der Mündung des Flüsschens Colne gesessen, den Dockarbeitern und Fischern am Hafen zugeschaut oder ihre Angelrute in den Brightlingsea Creek gehalten, wie sie es als Kind oft an den Wochenenden getan hatte. Damals, als ihre arme Mutter noch gelebt hatte und ihre älteren Brüder Peter und John noch nicht den Atlantik zwischen Liverpool und New York befahren hatten. Als Celias Vater noch eine verblassende Erinnerung und nicht ihr letzter verzweifelter Hoffnungsanker gewesen war.
»Pass doch auf, verdammt!«, schimpfte eine Frau.
Celia war ihr vor der schmalen Treppe zu einer Fußgängerbrücke versehentlich auf den Rocksaum getreten. »’tschuldigung, Ma’am«, murmelte sie erschrocken und hätte um ein Haar den braunen Lederkoffer fallen gelassen, in dem sich ihr gesamtes Hab und Gut befand. Sie klammerte sich an den Koffer wie an einen Rettungsring und ließ sich von der Menge über die Brücke zu einem der beiden Ausgänge treiben. Als sie schließlich einen kleinen überdachten Vorplatz erreichte, an dem zahlreiche Droschken, Mietkutschen und Lastkarren auf Kundschaft warteten, wandte sie sich an einen der schwarz uniformierten Kutscher, der ihr eilfertig die vordere Klappe des zweirädrigen Hansom Cabs aufhielt.
»Steigen Sie nur ein, Miss!«, rief er und lüpfte den fettfleckigen Bowler. »Wo soll die Reise hingehen?«
»Können Sie mir sagen, wie ich ins East End komme?«, fragte Celia und lächelte schüchtern. »Ich muss zur Whitechapel Road.«
»Whitechapel?« Der Kutscher machte ein überraschtes Gesicht. »Keine Gegend für ’ne hübsche junge Miss, gerade in dieser Zeit.« Er hob bedeutungsvoll die Brauen und deutete auf einen Zeitungsjungen, der krächzend seine Gazette anpries. Als Celia nicht darauf reagierte, zuckte er mit den Schultern und wies mit der Hand auf sein Cabriolet. »Bitte einzusteigen.«
»Ich habe kein Geld«, erwiderte Celia. Jedenfalls nicht für eine Kutschfahrt, setzte sie in Gedanken hinzu. »Könnten Sie mir die Richtung zeigen?«
Die Miene des Kutschers nahm schlagartig einen säuerlichen Ausdruck an. Vermutlich weil er seine Zeit vergeudet und andere Kunden unbehelligt vorbeigelassen hatte. Sofort wandte er sich an einen jungen Gentleman, der sich eilends von hinten näherte, Celia grob zur Seite stieß und sie dabei achtlos mit seinem Reisekoffer streifte.
»Bitte einzusteigen, Sir«, sagte der Kutscher, nahm dem jungen Mann den Koffer ab und fragte: »Wo soll es hingehen?«
»Piccadilly, Ecke Dover Street«, antwortete der Mann, nahm den eleganten Zylinder vom Kopf, schüttelte sein langes, in der Mitte gescheiteltes Haar und stieg in das vorne offene Hansom Cab ein. »Zum Hatchett’s Hotel, aber etwas plötzlich, mein Guter!« Er strich seinen Gehrock glatt, klappte den vorderen Beinschutz herunter und fuhr sich geziert über den blonden Schnauzbart, der noch sehr an kindlichen Flaum erinnerte.
Celia betrachtete den Gentleman neugierig, nicht nur weil er ein ebenso hübscher wie hochnäsig wirkender Mann war, sondern vor allem wegen eines auffälligen Muttermals auf seiner rechten Wange, das nur leidlich von einem dünnen Backenbart verdeckt war. Das Mal hatte die Größe einer Half-Crown-Münze und die Form eines Herzens.
»Was gibt’s da zu starren, Mädchen?«, fuhr der Mann sie an und warf ihr durch das seitliche Fenster einen bösen Blick zu. »Schleich dich!«
»Hast du nicht gehört, was der Gentleman gesagt hat?«, knurrte der Kutscher, verschnürte den Koffer auf der Ablage und stieg auf den erhöhten Sitz hinter dem Verdeck. »Verzieh dich gefälligst!«
»In welche Richtung soll ich mich verziehen, Sir?«, fragte Celia und hielt ihren Koffer vor der Brust, als könnte er sie wie eine Rüstung schützen.
»Wo soll das East End schon sein? Im Osten natürlich«, maulte der Kutscher, nahm die Zügel in die linke Hand und griff mit der rechten nach der Peitsche. Er hielt sie bereits in die Luft, um das Pferd anzutreiben, als er plötzlich innehielt und sich zu Celia umwandte. »Siehst du die Gleise da vorne?« Er wies auf eine Bahntrasse, die in der Nähe an der Waterloo Station vorbeiführte. »Folge ihnen, dann kommst du automatisch zur London Bridge Station. Dort musst du über die Themse und am Tower vorbei nach Nordosten. Ist aber ’n weiter Weg nach Whitechapel. Wirst in die Dunkelheit kommen.«
»Das macht mir nichts«, antwortete Celia.
»Keine Gegend für ’ne hübsche junge Miss«, wiederholte der Kutscher und tippte sich an den Bowler. »Schon gar nicht im Dunkeln.«
»Danke, Sir! Ich komme schon zurecht.«
Der blonde Gentleman in der Kutsche hatte das kurze Gespräch zunächst abschätzig und ungeduldig verfolgt, doch als er das Wort Whitechapel vernahm, hatte er sich plötzlich vorgebeugt und neugierig aus dem Fenster geschaut. Offenbar hatte die Tatsache, dass Celia ins East End wollte, sein Interesse geweckt. Er betrachtete sie eingehend, wobei sich sein Gesichtsausdruck merklich wandelte. Beinahe schien es ihr, als wäre er überrascht oder verwundert.
Der Gentleman schüttelte den Kopf und fragte: »Wie alt bist du, Mädchen?«
»Sechzehn, Sir.«
»Sechzehn«, wiederholte der Mann und schüttelte erneut den Kopf. Dann öffnete er den Mund, als wollte er noch etwas sagen, doch im nächsten Augenblick setzte sich das Hansom Cab in Bewegung und verschwand auf der im Halbkreis führenden Zufahrtsstraße im Abendverkehr.
Celia tat, wie ihr der Kutscher geraten hatte, und folgte den Bahngleisen nach Osten. Die Sonne stand nur noch eine Handbreit über dem Bahnhof Waterloo, und als Celia wenig später auf die viel befahrene Blackfriars Road stieß, hörte sie hinter sich das hübsche Glockenspiel der Turmuhr von Big Ben, das sie von einer Spieldose ihrer Mutter kannte. Anschließend erklangen sechs tiefere Glockenschläge.
Der Kutscher hatte recht. Es war Mitte Oktober, und die Sonne würde untergegangen sein, bevor Celia den Tower, geschweige denn Whitechapel erreicht hätte. Doch was blieb ihr anderes übrig, als unbeirrt weiterzugehen? Sie kannte niemanden in London, sie hatte nur noch wenige Münzen in der Geldbörse, und das Einzige, was sie außer ihren Kleidern und einigen wenigen Erinnerungsstücken an ihre Mutter besaß, war die zerknitterte Ansichtskarte eines Kuriositätenkabinetts mit einer Adresse im East End: The Silver King, 123 Whitechapel Road, London E.
Für einen kurzen Augenblick war sie versucht, auf einen der zahlreichen Pferdeomnibusse aufzuspringen, die auf der Blackfriars Road über die Themse fuhren, doch dann besann sie sich, schulterte ihren Koffer und ging keuchend weiter. Das wenige Geld, das sie noch besaß, durfte sie nicht verschleudern, nur weil ihr die Füße und der Rücken von der langen Zugfahrt schmerzten, die sie weitestgehend im Stehen hatte verbringen müssen. Oder weil die Gassen, durch die sie ging, zusehends schmaler, dunkler und dreckiger wurden.
Links und rechts der Bahntrasse stießen die backsteinernen und rußgeschwärzten Häuser nun regelrecht an die über Stahlkonstruktionen führenden Gleise. Hier staute sich der Verkehr wie vor einem Nadelöhr. Celia stieg ein so beißender Geruch in die Nase, dass ihr die Tränen in die Augen stiegen. Sie sah sich um und las auf einem rostigen Schild über einer Hofeinfahrt: »Potts’ Vinegar Works«. Auf der anderen Straßenseite befand sich die Brauerei Barclay, Perkins & Co., die ihr Bier bis nach Essex lieferte – Celia kannte das Zeichen der Firma von den Pubs in ihrer Heimat. Direkt neben der Brauerei standen die baufälligen Hütten und windschiefen Hallen einer Färberei.
Es roch nach Brausud, Hopfen, Essig, Teer und Kohle. Überall ragten Fabrikschlote in den Himmel und stießen schwarzen Qualm in die kühle Oktoberluft. Celia wurde übel von dem Gestank, deshalb hielt sie sich das bestickte Leinentaschentuch ihrer Mutter vor die Nase. Weil das Tuch seit vielen Jahren unbenutzt in der Kommode gelegen hatte, war es nach dem Typhustod der Mutter nicht wie der Rest der Kleidung verbrannt worden. Das kleine Textil war einst das Verlobungsgeschenk von Celias Vater gewesen. In einer Ecke hatte er Mutters Namen mit rotem Faden einsticken lassen: Mary.
Außer dem Taschentuch und einigen wertlosen Gegenständen wie einer emaillierten Blechdose und einem vergilbten Familienfoto war ihr nichts von der Mutter geblieben. Was nicht aus Angst vor Ansteckung verbrannt worden war, hatte Celia zum Pfandleiher gebracht, um die Ärzte zu bezahlen und für die Beerdigung aufzukommen. Immerhin hatte Celia auf diese Weise dafür gesorgt, dass Mary Brooks nicht in einem namenlosen Grab auf dem Armenfriedhof von All Saints bestattet wurde. Alle Schulden waren getilgt, alle Rechnungen beglichen, auch die Miete war bis auf den letzten Penny gezahlt. Und das von ihrem letzten Geld. Da Celia sich in den letzten Wochen ausschließlich um ihre sterbenskranke Mutter gekümmert hatte und kaum dazu gekommen war, ihrer Arbeit als Näherin und Schneidergehilfin nachzukommen, stand sie nun fast völlig ohne Mittel da.
»Vorsicht, Miss!«, schrie eine Männerstimme. »Aus dem Weg!«
Celia fuhr auf und wich hastig einen Schritt zurück. Im gleichen Augenblick donnerte ein zweispänniger Lastwagen um Haaresbreite an ihr vorbei. »Verdammt noch mal! Hast du keine Augen im Kopf?« Der Fluch des Fuhrmanns verhallte im Wind, der kühl und heftig aus nördlicher Richtung blies.
Celia sah sich mit wild klopfendem Herzen um und erkannte, dass sie die High Street von Southwark erreicht hatte. Dies war die Straße, in der ihre Mutter vor vielen Jahren gelebt hatte. In einem der zahlreichen Gasthöfe, die die breite Hauptstraße säumten, hatte sie eine Zeit lang als Dienstmagd gearbeitet, bevor das Schicksal sie nach Essex verschlug, wo sie den Seemann Ned Brooks geheiratet hatte. Celia suchte nach einem Schild oder Zeichen, das auf das George Inn hinwies, doch in der Straße wimmelte es von Läden, Gasthäusern und einfachen Gin-Schänken, sodass ihr bald der Kopf brummte. Und was hätte sie auch davon gehabt, das Gasthaus zu entdecken? Ihre Mutter hatte wenig Gutes über die Schänke und ihren Besitzer zu berichten gewusst. Und es war sicherlich kein Zufall gewesen, dass sie sich ausgerechnet in einem verschlafenen Nest wie Brightlingsea niedergelassen hatte. »London laugt einen aus«, hatte die Mutter immer wieder gesagt, und doch hatte Wehmut in ihren Worten mitgeklungen. Als trauerte sie einer vertanen Chance nach.
Celia passierte eine sehr alte Kirche zur Linken und einen unansehnlichen Bahnhof zur Rechten und ging mit immer schneller werdenden Schritten zur nahen London Bridge, auf der sich der Verkehr staute, weil ein Lastkarren umgestürzt war und die Kisten und Körbe auf der Fahrbahn lagen. Als Celia den Scheitelpunkt der Brücke erreicht hatte, bot sich ihr ein beeindruckendes Panorama: Die Sonne ging gerade unter und tauchte London in ein warmes orangefarbenes Licht. Auf der Themse, die gen Westen von mehreren Brücken überbaut war, drängelten sich schwere Dampfkähne, kleinere Segelschiffe und Ruderboote sowie elegante Passagierdampfer, deren seitliche Antriebsräder bunt verkleidet waren. Am Nordufer thronte die Kathedrale von St. Paul. Mit ihrem auffälligen Kuppeldach schien sie über die unzähligen kleineren Kirchen zu wachen, deren Türme im Wettstreit mit den zahlreichen Fabrikschloten in den Himmel ragten. Im Vordergrund sah Celia einen weiteren Bahnhof, dessen riesiges Gewölbe aus Stahl und Glas von zwei steinernen Türmen flankiert war.
Auch auf der Ostseite war der Anblick atemberaubend. Unweit des Towers, den Celia zum ersten Mal sah, dessen Aussehen ihr jedoch von Bildern und Postkarten vertraut war, wurde eine weitere Brücke gebaut, die sich jedoch merklich von den übrigen unterschied. Es handelte sich, soweit sich das trotz der Baugerüste und hölzernen Verkleidungen sagen ließ, um eine mehrstöckige Zugbrücke, deren untere Fahrbahn in der Mitte hochgeklappt werden konnte, um den größeren Schiffen die Durchfahrt zu den westlich gelegenen Hafenanlagen zu ermöglichen.
Beim vertrauten Anblick der Frachter und Handelsschiffe, die an den Kais vertäut waren und deren Schlote, Masten und Takelagen in Celia ein unerwartetes Heimatgefühl weckten, dachte sie plötzlich an ihren Vater, dem sie womöglich noch an diesem Abend gegenüberstehen würde. In Gedanken versunken schlenderte sie weiter.
Celia war acht Jahre alt gewesen, als Ned Brooks seine Familie verlassen und jeden Kontakt zu seiner Frau und den drei Kindern abgebrochen hatte. Er war nach Southampton gegangen, wie Celia inzwischen wusste, und hatte von dort die Welt umsegelt, während sich seine Familie in Essex mehr schlecht als recht über Wasser gehalten hatte. Celia besaß nur eine vage Erinnerung an ihren Vater, zu dessen Verschwinden ihre Mutter hartnäckig jeden Kommentar verweigert hatte. Wenn die Kinder nach ihm gefragt hatten, hatte sie lediglich geantwortet: »Mr. Brooks ist nicht mehr euer Vater. Findet euch damit ab! Es gibt ihn nicht mehr. Und damit Ende!«
Irgendwann hatten die Kinder aufgehört, nach dem Vater zu fragen. Sie waren wahrlich nicht die einzigen vaterlosen Sprösslinge in Brightlingsea. Nur drei Jahre nach Neds Verschwinden war beinahe die Hälfte der Fischereiflotte des Ortes in einem gewaltigen Sturm vor der Nordseeinsel Terschelling zugrunde gegangen. Über zwanzig Seeleute hatten in nur einer Nacht ihr Leben gelassen. Ob ihr Vater nun wie die anderen Männer beim Austernfang ertrunken oder aus unerfindlichen Gründen das Weite gesucht hatte, das machte für die Kinder letzten Endes keinen Unterschied. Es gab den Vater nicht mehr und damit Ende!
Mit der Zeit war das Bild, das Celia von Ned Brooks gehabt oder sich zurechtgelegt hatte, verblasst. Sie erinnerte sich an seine stattliche Figur, an den üppigen Rauschebart, die hohe Stirn und die dunklen Haare, die ihm in Locken bis auf die Schultern fielen, doch wenn der Vater ihr in diesem Augenblick entgegengekommen wäre, hätte Celia ihn vermutlich nicht erkannt. Es gab kein Porträt von ihm; das vergilbte Familienfoto, das Celia im Koffer mit sich herumtrug, war erst einige Jahre nach Neds Verschwinden aufgenommen worden. Manchmal kam es Celia so vor, als hätte sie niemals einen Vater besessen. Er hatte keine sonstigen Verwandten in Brightlingsea zurückgelassen, und enge Freunde schien er auch nicht gehabt zu haben. Nie redete jemand über ihn oder nannte ihn auch nur beim Namen. Gerade so, als brächte es Unglück, ihn zu erwähnen. Und wenn die Mutter aus irgendwelchen Gründen gezwungen war, den Kindern gegenüber von ihm zu sprechen, so nannte sie ihn nicht »Ned« oder »euer Vater«, sondern immer »Mr. Brooks«. Wie einen völlig Fremden.
Deshalb war Celia so überrascht, als die Mutter ihr auf dem Sterbebett plötzlich ins Ohr flüsterte: »Hüte dich vor deinem Vater, mein Kind!«
»Wie soll ich mich vor ihm hüten«, antwortete Celia erschrocken, »wenn ich gar nicht weiß, wo er steckt? Und ob er überhaupt noch lebt.«
»Wo soll er schon stecken?«, rief die Mutter im Fieber und starrte Celia mit glühenden Augen an. »Vermutlich hockt er in irgendeiner Kaschemme in Southampton, mit einer Hure auf dem Schoß und einer Flasche Brandy in der Hand!«
Mary Brooks hatte die letzten Tage vor ihrem Tod fast durchgängig im Delirium gelegen. Durch das hohe Fieber war sie die meiste Zeit kaum bei Bewusstsein, und wenn sie zwischendurch plötzlich die Augen geöffnet und zusammenhangsloses Zeug gebrabbelt hatte, hatte niemand mit Bestimmtheit sagen können, ob sie tatsächlich bei Verstand war oder irre redete.
»Southampton?«, fragte Celia, ohne den Worten der Mutter allzu viel Bedeutung beizumessen. »Woher willst du das wissen?«
»County Tavern«, antwortete die Mutter und lachte ein beängstigendes Lachen. »Dein Vater ist ein Verbrecher! Ein verdammter Teufel! Hüte dich vor ihm, Celia!« Damit schloss sie die Augen, stieß einen letzten Seufzer aus und verstummte.
Celia war so entsetzt von diesen Worten, dass sie erst nach einem Moment begriff, dass ihre Mutter gerade gestorben war. Seit Tagen wartete sie darauf, dass die Qualen der Mutter ein Ende fanden und sie von ihrem Leiden erlöst wurde, doch als es nun so weit war, vergaß Celia, der Mutter die beiden Pennys, die sie auf dem Nachttisch bereitgelegt hatte, auf die geschlossenen Augen zu legen.
Hüte dich vor ihm, Celia! Was für ein seltsames und zugleich bedrückendes Vermächtnis. Und eine Anklage obendrein.
Vermutlich hätte Celia wenig auf die im Fieberwahn gesprochenen Worte der sterbenden Mutter gegeben, wenn sie nicht wenige Tage später – die Mutter war gerade beerdigt und ihre Kleidung und Bettwäsche verbrannt – beim Aufräumen der Wohnung auf die unscheinbare Emailledose in einem Schubfach des Küchenschranks gestoßen wäre. Neben dem bestickten Taschentuch, von dem Celia zwar gehört, das sie aber noch nie zu Gesicht bekommen hatte, hatte sie in der Blechdose auch die handtellergroße Fotografie gefunden, auf der Celia, ihre Mutter und ihre beiden Brüder Peter und John vor einer auf Leinwand gemalten Heidelandschaft posierten. Außerdem befanden sich mehrere Zeitungsausschnitte, einige lose Zettel, ein kleines London-Handbuch und wertloser Nippes wie schimmernde Fischköder aus Perlmutt oder bunte Glasperlen darin. Celia überflog hastig die Papiere und hielt plötzlich den Atem an, als sie auf zwei geschriebene Worte stieß, die sie unlängst aus dem Mund der Mutter gehört hatte: »County Tavern«.
Sie hielt einen Brief in der Hand, der von ihrem ehemaligen Nachbarn Mr. Hutchinson stammte und vor etwas mehr als vier Jahren, im März 1884, geschrieben worden war. In krakeliger Handschrift hatte der alte Walfänger, der im vergangenen Jahr vor Grönland aus der Takelage in den Tod gestürzt war, folgende Worte zu Papier gebracht:
Libe Mary,
dachte es würd dich intressiern, das dein Ned noch lebt.
Hab ihn gestern in Southampton gesehn in der County Tavern in Northam. Da wont er auch, bei den Egertons, wenn er nich grade auf See ist.
Er wollte nich, das ichs dir verrate, weil er von Brigtlingsea nix mehr wissen will, sagt er. Aber ich dachte, wo wir doch immer gute Nachbarn warn und all das, sag ichs trotsdem. Ned ist immer noch der alte, säuft vil und redet wenig. Aber wem sag ich das.
Also machs gut und grüs Betty von mir.
Bis zum Sommer, wenn ich wider in Brigtlingsea bin. Dann mehr.
Bart Hutchinson
Southampton also, dachte Celia, nachdem sich der erste Schrecken gelegt hatte. Sie schob den Brief zurück in die Dose. Vier Jahre waren eine lange Zeit, ging es ihr durch den Kopf, und wer konnte schon wissen, ob der Vater immer noch in der County Tavern logierte. Vielleicht hatte er sich inzwischen zu Tode gesoffen oder er war auf hoher See umgekommen. Das tat auch gar nichts zur Sache, schalt sie sich im selben Augenblick, denn es änderte nichts daran, dass er sie feige im Stich gelassen hatte und nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollte. Und niemals wäre Celia auf die abenteuerliche Idee gekommen, nach Southampton zu fahren, wenn nicht plötzlich Dr. Arthur, Mutters behandelnder Arzt, mit einem Mitglied des Gemeinderats vor der Tür gestanden hätte. Er sagte etwas von behördlichen Maßnahmen und zwangsweiser Quarantäne und überbrachte ein amtliches Schreiben aus Colchester, das ihr für mehrere Wochen und unter Androhung von Strafe bei Nichtbefolgung den Umgang mit allen Menschen und das Verlassen der Wohnung untersagte.
Celia verstand nicht, was die Männer von ihr wollten. Schließlich hatte sie seit Mutters Tod schon oft das Haus verlassen und sich um die Beerdigung und die Begleichung der Schulden gekümmert. Ihre Mutter war seit Wochen krank gewesen, und in der ganzen Zeit hatte niemand von Quarantäne gesprochen.
»Das Schreiben kommt aus Colchester«, sagte Dr. Arthur und deutete auf den amtlichen Stempel, als wäre das ein schlagkräftiges und nicht zu debattierendes Argument. Mit Typhus sei nun mal nicht zu spaßen, meinte der Arzt in mahnendem Ton und versprach, regelmäßig nach dem Rechten zu sehen. Da Celia sich bislang nicht angesteckt habe, sei nicht davon auszugehen, dass sie noch erkranken werde. Und der Mann vom Gemeinderat, der zuvor immer nur genickt und geschwiegen hatte, fügte väterlich hinzu, dass Celia in der betreffenden Zeit natürlich mit allem Nötigen versorgt würde. Dafür komme die Gemeinde von All Saints selbstredend aus Spendenmitteln auf. Sie überreichten ihr das Schreiben und verabschiedeten sich.
Celia nickte verschüchtert, schloss hinter ihnen die Tür und hörte, wie draußen etwas an die Wohnungstür genagelt wurde. Vermutlich eine amtliche Verlautbarung oder etwas in der Art. Für einen kurzen Augenblick befürchtete sie, man werde die ganze Tür vernageln, als wäre die Pest im Haus. Doch dann hörte sie die Schritte der Männer auf der Treppe und das Schlagen der Haustür, und im selben Moment traf sie eine Entscheidung. Sie wollte sich nicht so ohne Weiteres wegsperren lassen, denn sie hatte nichts verbrochen. Und auf die Almosen der Gemeinde konnte sie erst recht verzichten. Plötzlich erschien ihr der Gedanke, nach Southampton zu fahren und ihren Vater zu suchen, gar nicht mehr so abwegig. Jedenfalls nicht abwegiger, als in Brightlingsea zu bleiben, wo sie weder Familie noch Arbeit hatte und man sie nun auch noch wie eine Gefangene behandelte.
Celia wusste, dass in den frühen Morgenstunden des kommenden Tages eine Segeljacht, die in den Docks überholt worden war, nach Southampton überführt werden sollte. Ein Freund der Familie hatte als Schiffszimmermann bei der Reparatur geholfen und Celia davon erzählt, dass er die Gelegenheit nutzen wolle, an der Südküste entlang nach Southampton zu gelangen, um dort auf einem großen Segler anzuheuern und nach Amerika auszuwandern. Es kam ihr vor wie ein Wink des Schicksals. Nichts sprach dagegen, dass Celia ihn auf dem ersten Teil seiner Reise begleitete. Es musste ja niemand erfahren, was die wahren Gründe dafür waren. Sie würde lediglich behaupten, sie müsse dringend in einer Familiensache nach Southampton. Da ihre Mutter gerade gestorben war, würde niemand an Bord peinliche Fragen stellen oder ihr die Mitfahrt verweigern.
Kurz vor Sonnenaufgang stand sie mit ihrem Lederkoffer an den Docks. Und ehe jemand im Ort von ihrem Vorhaben erfuhr, war sie schon auf dem Weg zur Südküste Englands. Heimlich und ohne sich zu verabschieden. Genau wie ihr Vater vor acht Jahren.
Jemand rief: »Whitechapel Road und Mile End!«
Celia wachte wie aus einem Traum auf und schaute sich verwirrt um. Sie war so in ihren Erinnerungen versunken gewesen, dass sie kaum auf ihre Schritte oder die Umgebung geachtet hatte. Sie hatte lediglich die Anweisungen des Droschkenkutschers befolgt, war an der Themse entlang zum Tower und von dort weiter in nordöstlicher Richtung gelaufen. Inzwischen war die Sonne untergegangen, und die schmalen und eng bebauten Straßen wurden von den spärlichen Gaslaternen nur notdürftig beleuchtet. Auch der beinahe volle Mond stand so tief über den Dächern, dass sein Licht nicht bis auf den Boden fiel. Celia stand an einer viel befahrenen Straßenkreuzung und las auf einem Metallschild an einer Hauswand: »Fenchurch Street«. Wieder rief jemand: »Whitechapel Road und Mile End!« Und eine Glocke wurde geschlagen.
Celia schaute in Richtung der Glocke und sah etwas, das sie noch nie zuvor gesehen hatte: einen Wagen, der auf in das Straßenpflaster eingelassenen Schienen fuhr und von Pferden gezogen wurde. Eine Pferde-Eisenbahn. Auf einen derart seltsamen Einfall konnte man nur in einer Stadt wie London kommen, dachte Celia. Und vielleicht war es gerade die Absonderlichkeit des Gefährts, die Celia auf die Kreuzung laufen und dem uniformierten Mann auf dem Führerstand zuwinken ließ.
»123 Whitechapel Road?«, fragte sie.
»Macht ’nen Penny die Meile.«
Celia öffnete ihre Geldbörse und zögerte beim Anblick der wenigen Münzen, die noch darin waren. Sie schüttelte kaum merklich den Kopf.
»Ha’penny tut’s auch«, sagte der Bahnkutscher und zwinkerte ihr zu. »Weil’s schon so spät ist, Miss.«
Celia lächelte dankbar, gab dem Mann die Bronzemünze und stieg in den Waggon der Straßenbahn.
*Anmerkungen und Übersetzungen im Anhang
2
Das Haus mit der Nummer 123 war ein unscheinbares zweistöckiges Backsteingebäude mit rotem Spitzdach und einem weit vorstehenden Erker im ersten Stock. Wie bei den meisten Häusern in der Umgebung fiel der Putz von den Wänden, die hölzernen Stützbalken und Fensterläden waren verwittert. Je weiter die Pferdebahn nach Osten gefahren war, desto ärmlicher waren die Behausungen geworden. Mit bangem Blick hatte Celia vom Wagen aus verfolgt, was sich ihr im Halbdunkel der relativ breiten Hauptstraße und im Gewirr der kleineren Nebengassen und Höfe präsentierte. Sie sah betrunkene Männer, die durch die Gossen wankten oder an Mauern gelehnt ihren Rausch ausschliefen, aber auch schamlos gekleidete Frauen, die sich in aller Offenheit vor den zahlreichen Pubs den Freiern anboten, und zerlumpte Kinder, die neben der Straßenbahn herliefen, um die Passagiere anzubetteln oder zu beschimpfen, wenn sie kein Geld herausrücken wollten. Ganze Familien sammelten sich unter den Gaslaternen, um dort auf einer Sitzbank die Nacht zu verbringen. Obwohl die Sonne vor mehr als einer Stunde untergegangen war, tummelten sich die Menschen auf den Straßen, als hätten die meisten von ihnen kein Zuhause. Als Celia im Vorbeifahren auf der linken Straßenseite das Gebäude mit der Hausnummer 123 erkannte, stieß sie einen leisen Schrei aus, fasste sich an die Brust und hatte beinahe Angst, an der nächsten Haltestelle die Straßenbahn zu verlassen.
Es waren nicht das vernachlässigte Aussehen der Fassade oder die Erbärmlichkeit der Nachbarschaft gewesen, die Celia einen solchen Schrecken eingejagt hatten, sondern das vollständige Fehlen eines Schildes oder Schaufensters. Wieder starrte sie auf die Ansichtskarte in ihrer Hand und verglich sie mit dem darauf abgelichteten Original. Wo auf dem Papier ein Holzschild mit der Aufschrift »The Silver King« über dem Eingang prangte, da befand sich nun ein dunkles Loch im Mauerwerk. Und wo auf dem Bild ein Schaufenster mit Plakaten und Bildern auf vermeintlich sehenswerte Kuriositäten und absonderliche Gestalten aufmerksam machte, da sah Celia nur eine mit Brettern verschlagene und glaslose Nische. Das Kuriositätenkabinett des sogenannten »Silberkönigs« war verschwunden, die gesamte Ladenwohnung verwaist und vernagelt.
Celia drehte die Postkarte um, und obwohl es zu dunkel war, um irgendetwas zu entziffern, las sie in Gedanken die Worte, die sie längst auswendig kannte:
An Mr. Sydney Egerton, County Tavern,
118 Millbank Street, Northam, Southampton.
Lieber Mr. Egerton.
Bin in London angekommen. In dringenden (!) Fällen – Nachricht an Tom Norman, The Silver King, 123 Whitechapel Road, London E.
Beste Grüße
Ned Brooks
Beim Blick auf die leer stehende Ladenwohnung dachte Celia an das, was Mr. Egerton, der Wirt der County Tavern, ihr prophezeit hatte. Noch am Morgen hatte er sie gewarnt: »Du wirst deinen Vater nicht finden. Nicht in London und auch sonst nirgendwo. Weil er nämlich nicht gefunden werden will. Lass es bleiben, Kind, und fahr nach Hause!«
»Ich hab kein Zuhause mehr.«
»Dann such dir ein neues«, hatte Mr. Egerton achselzuckend geantwortet. »Aber nicht bei Ned Brooks. Das würdest du nur bereuen. Vergiss deinen Vater, das ist mein Rat. Er ist es nicht wert.«
Als Celia am Abend zuvor nach der mehr als zweitägigen Überfahrt von Brightlingsea in Southampton angekommen war, hatte der befreundete Schiffszimmermann sie in einem bescheidenen, aber respektablen Gasthof in der Nähe des Jachthafens unterbringen wollen, doch Celia hatte sich lediglich bei den Seeleuten für die Unterstützung bedankt und sich gleich zum Stadtteil Northam aufgemacht, um nach der County Tavern Ausschau zu halten. Das freundliche Angebot des Zimmermanns, sie zur Millbank Street zu begleiten, hatte sie dankend und mit dem Hinweis auf die »Familienangelegenheit« ausgeschlagen.
Celia hatte nicht lange suchen müssen. Die County Tavern war eine düstere und heruntergekommene Seefahrerschänke nur einen Steinwurf von den Northam Docks entfernt. Das Innere der Schänke war ebenso trostlos wie die äußere Erscheinung. Bärtige Männer saßen schweigend an grob gezimmerten Tischen und starrten missmutig auf ihr Bier, das in riesigen Humpen vor ihnen stand. Niemand schaute auf, als sie die Schänke betrat, und obwohl sie das einzige weibliche Wesen in dem verräucherten und spärlich beleuchteten Raum war, schien auch der Wirt kaum Notiz von ihr zu nehmen. Celia kam sich beinahe vor, als hätte sie ein Wachsfigurenkabinett betreten. Auf ihre Frage, ob er einen Seemann namens Ned Brooks kenne, zuckte der Wirt lediglich achtlos mit den Schultern.
»Er hat hier gewohnt, vor vier Jahren«, sagte sie, reichte ihm den Brief ihres ehemaligen Nachbarn Mr. Hutchinson und fragte: »Sind Sie Mr. Egerton?«
»Der bin ich«, antwortete der Wirt, ein hagerer Mann mit abstehenden Ohren und dichtem Backenbart. Er las den Brief, schaute überrascht zu Celia, dann verfinsterte sich sein Blick, und er gab ihr das Papier zurück. »Wer bist du?«, wollte er wissen. »Und was willst du von ihm?«
»Mein Name ist Celia Brooks. Ich bin seine Tochter.«
»Ned Brooks hatte keine Tochter. Er hatte nicht mal ’ne Frau.«
»Hatte?«, rief Celia erschrocken. »Soll das heißen, dass er …«
»Dass er nicht mehr hier ist«, antwortete Mr. Egerton mürrisch und wischte sich die Hände an einem fleckigen Tuch ab. »Schon lange nicht mehr. Hab ihn seit Jahren nicht gesehen. Und vermissen tu ich ihn auch nicht.«
»Können Sie mir sagen, wo ich ihn finde?«
»Was willst du von ihm?«, wiederholte der Wirt seine Frage.
»Ich bin seine Tochter«, wiederholte auch Celia ihre Worte.
»Sieht Ned das auch so?«
Celia schaute Mr. Egerton verwirrt an. Dann begriff sie, was der Wirt mit seinen Worten gemeint hatte, und schüttelte den Kopf. »Er hat uns vor acht Jahren verlassen.«
»Acht Jahre sind eine lange Zeit«, sagte Mr. Egerton nickend. »Und seitdem hast du nichts von ihm gehört, stimmt’s? Du weißt gar nichts von Ned Brooks.«
»Nur das, was in dem Brief steht. Mutter hat nie von ihm gesprochen.«
»Kann ich ihr nicht verdenken.« Der Wirt schnaufte laut und rieb sich das unrasierte Kinn. »So ist das also«, murmelte er leise und räusperte sich.
»So ist was?«
»Nichts.« Wieder ein Räuspern, dann sagte der Wirt: »Ned Brooks war schon lange nicht mehr in Southampton. Jedenfalls soweit ich weiß.«
»Und wissen Sie vielleicht, wohin er gegangen ist?«
»Vergiss deinen Vater!« Er deutete auf den Brief in Celias Hand. »Du hast doch gelesen, was dieser Mr. Sowieso geschrieben hat. Ned wollte offensichtlich mit euch nichts mehr zu tun haben. Und wenn du mich fragst, kannst du froh drüber sein. Ned Brooks hat nichts getaugt. Da kannst du fragen, wen du willst. Das sehen alle in Southampton so.«
»Ned Brooks?«, mischte sich ein alter Seebär ein, der an den Tresen gekommen war, um seinen Bierhumpen nachfüllen zu lassen. »Ein verdammter Judas Ischariot, wenn du mich fragst! Ein feiger Verräter.«
»Halt’s Maul, Jim!«, schnauzte der Wirt und hielt den Humpen unter den Zapfhahn, ohne den Hebel zu betätigen. »Sonst kriegst du nichts mehr.«
»Meine Meinung, Syd«, brummte der Alte beleidigt und fuhr sich über das wettergegerbte Gesicht. »Nur meine Meinung.«
»Die will hier keiner hören«, antwortete Mr. Egerton, füllte den Bierkrug und hielt ihn dem Seemann vor die Nase. »Und jetzt hock dich in die Ecke.«
»Ay, Sir!«, knurrte der Alte, griff nach dem Bier und tat, wie ihm befohlen.
Celia hatte das Wortgefecht der beiden Männer verstört verfolgt. Weder begriff sie, warum der Seemann ihren Vater einen Judas und Verräter genannt hatte, noch verstand sie, was der Wirt mit seinen Worten gemeint hatte: »Das sehen alle in Southampton so.« Gerade so, als würde die ganze Stadt ihren Vater kennen. Was Celia jedoch begriff, war die Tatsache, dass sie die lange Reise von Brightlingsea bis an die Südküste umsonst unternommen hatte. Ihr Vater war nicht mehr in Southampton, vielleicht war er auf hoher See, womöglich wohnte er mittlerweile in irgendeinem anderen Teil des Landes oder war längst gestorben. Celia wusste nur, dass der Brief von Mr. Hutchinson sie in eine Sackgasse geführt hatte. Und dass sie unverrichteter Dinge wieder gehen müsste.
»Wo willst du jetzt hin?«, fragte der Wirt, als hätte er Celias Gedanken gelesen. »Es ist schon spät. So ein hübsches Mädchen sollte um diese Zeit nicht mehr allein unterwegs sein.«
Celia zuckte mit den Schultern.
»Kannst du kochen?«
Sie verstand nicht.
»Die Missis ist bei ihrer Familie und kommt erst morgen Mittag aus Lyndhurst zurück«, sagte Mr. Egerton und zupfte sich am Backenbart. »Und das Dienstmädchen hat letzte Woche ihre Stellung aufgegeben.«
»Aha«, sagte Celia. Sie verstand noch immer nicht.
»Wenn du mir morgen beim Frühstück hilfst und dich an den Herd stellst, kannst du heute Nacht in der Kammer unterm Dach schlafen.« Der Wirt lächelte schief und fügte augenzwinkernd hinzu: »Kostet dich nichts.«
»Danke, Sir«, antwortete Celia, überlegte kurz und nickte dann zögerlich.
»Man ist ja kein Unmensch«, meinte Mr. Egerton, legte seine Hand auf ihre Schulter, nahm ihr mit der anderen den Koffer ab und führte sie nach oben.
Es wurde eine unruhige und schlaflose Nacht, und das lag nicht allein daran, dass ein heftiger Sturm aufzog und der Regen beinahe ununterbrochen auf das Dach und gegen das winzige Giebelfenster prasselte. Im ganzen Haus pfiff und jaulte es, als feierten die Gespenster einen Ball. Gleichzeitig surrten Celia die Gedanken wie ein Mückenschwarm durch den Kopf, tänzelnd und scheinbar ohne jede Ordnung. Dabei aber beißend und schmerzhaft. Immer wieder schalt sie sich für ihr überhastetes und unbedachtes Handeln und wünschte sich nach Brightlingsea zurück, wo sie in aller Ruhe und versorgt von der Gemeinde die Quarantäne hätte absitzen können. Was um alles in der Welt hatte sie sich dabei gedacht, wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend zu flattern? Warum hatte sie das Ganze nicht einfach auf sich beruhen lassen? Was war nur in sie gefahren? Wieso war sie nur immer so ungeduldig und brach die Dinge übers Knie, auch wenn dazu gar keine Notwendigkeit bestand? »Celias Vorwitz«, so hatte ihre Mutter das immer genannt. »Mit dem Mund und den Füßen schneller, als der Kopf hinterherkommt.«
Es war bereits nach Mitternacht, als das Stimmengewirr aus dem Schankraum abebbte und die Schänke geschlossen wurde. Kurz darauf hörte Celia die schlurfenden Schritte des Wirts auf der Treppe, dann das Knarren einer Bohle direkt vor ihrer Tür, kurz darauf wurde der eiserne Türknauf mit einem quietschenden Geräusch gedreht. Celia war froh, dass sie den Stuhl unter den Griff geschoben und schräg gegen das Holz verkantet hatte, sodass die Tür von außen nicht zu öffnen war. Das seltsame Lächeln im Gesicht des Wirts, als er »Kostet dich nichts« gesagt hatte, hatte ihr nicht gefallen. Nun wusste sie, dass sie sein schiefes Grinsen richtig gedeutet hatte.
Erneut drehte sich der Türknauf, es quietschte, dann ruckelte es an der Tür, zunächst sachte, schließlich immer heftiger. Doch der angelehnte Stuhl blieb in Position. Nach einiger Zeit gab der Wirt, der die ganze Zeit keinen Ton von sich gegeben hatte, auf und schlurfte ärgerlich knurrend zu seiner Kammer im unteren Stockwerk. Celia atmete tief durch, als sie die leiser werdenden Schritte auf der Treppe hörte, doch an einen festen oder gar erholsamen Schlaf war anschließend natürlich kaum noch zu denken.
Am nächsten Morgen wurde Celia durch ein Rütteln und Klopfen an der Tür geweckt. Kurz vor Sonnenaufgang waren ihr die Augen vor Erschöpfung zugefallen, und als sie jetzt das abermalige Pochen an der Tür hörte, fuhr sie in die Höhe und stieß sich dabei den Kopf an der Dachschräge. Die Sonne schien bereits durchs Dachfenster.
»Brauchst dich nicht länger zu verbarrikadieren«, meldete sich eine Frauenstimme von draußen. »Kannst rauskommen, Kleines. Dir passiert nichts.«
»Was soll ihr auch passieren?«, hörte Celia die Stimme von Mr. Egerton.
»Du bist still, Syd!«, befahl die Frau. Celia vermutete, dass »die Missis« etwas früher als geplant aus Lyndhurst zurückgekommen und womöglich nicht sehr erbaut von dem weiblichen Besuch in der Dachkammer war.
»Keine Bange, kleine Miss Brooks, ich beiße nicht«, sagte Mrs. Egerton. »Und meinen Mann halte ich an der Kandare.«
»Danke, Ma’am«, antwortete Celia und stieg aus dem Bett, um sich anzukleiden.
»Wir sind unten«, sagte Mrs. Egerton und lachte, ohne dass es besonders erfreut geklungen hätte. »Komm frühstücken. Ich hab was für dich.«
Als Celia nur wenige Minuten später im Schankraum erschien, lächelte der Wirt sie freundlich an, als wäre gar nichts vorgefallen. »Hast du gut geschlafen?«, fragte er und wies auf einen Tisch neben dem Eingang, auf dem ein Teller mit Bohnen, Speck und Rührei für sie bereitstand. »Hast Angst gehabt, was? Kein Wunder, bei dem Sturm letzte Nacht. Das ganze Haus hat gewackelt, dass man dachte, es würde einem an der Tür gerüttelt. Da kann man’s schon mal mit der Angst zu tun bekommen und sich verkriechen.«
»Red nicht!«, wurde Mr. Egerton durch seine Frau unterbrochen, die mit einem gefüllten Tablett aus der Küche kam. »Und lass das Mädchen in Ruhe!«
»Man wird ja wohl noch fragen dürfen, wie die Nacht war«, maulte der Wirt, zog sich aber schleunigst hinter den Schanktisch zurück, als Mrs. Egerton ihn mit einem bösen Blick bedachte. Sie versorgte die Gäste, die zu dieser frühen Stunde bereits zahlreich anwesend waren, mit Ei, Brot und Porridge und setzte sich anschließend zu Celia an den Tisch.
»Iss das, und dann verschwinde!«, sagte sie leise und deutete auf den Teller. Sie war eine große, grobe und stämmige Frau mit bleicher Hautfarbe, die von riesigen Sommersprossen übersät war. Obwohl sie sich durchaus hilfsbereit gab, war ihr Blick finster und ausgesprochen unfreundlich.
»Ich habe nichts Unrechtes getan«, verteidigte sich Celia.
»Darum geht es nicht«, sagte die Wirtsfrau. »Verschwinde einfach!«
»Sie könnte doch als Dienstmädchen bei uns arbeiten«, schlug Mr. Egerton vor, während er Dünnbier einschenkte und auf den Tresen stellte.
»Willst du das?«, wandte sich die Missis mit hochgezogenen Augenbrauen an Celia. »Wärst du gern unser Dienstmädchen?«
Celia schüttelte den Kopf.
»Gut«, sagte die Frau und erhob sich. »Und jetzt iss!«
»Ma’am?«
»Ja?«
»Warum nennt man meinen Vater einen Judas?«
»Warum?« Mrs. Egerton dachte eine Weile nach, dann hob sie die Achseln und meinte: »Das ist eine Frage, die nur dein unseliger Vater beantworten kann.«
»Aber wo steckt er?«
Die Wirtin tauschte einen Blick mit ihrem Mann, der hinter dem Schanktisch stand und heftig den Kopf schüttelte. Schließlich griff sie in die Tasche ihrer Schürze und zog eine Postkarte hervor, die sie vor Celia auf den Tisch legte. »Ich hab ja gesagt, dass ich noch was für dich habe«, flüsterte die Wirtin.
»Was soll das, Weib?«, rief Mr. Egerton erbost. »Du weißt, dass sie ihn dort nicht finden wird. Der verdammte Kerl kann sonst wo stecken.«
»Und wenn schon«, antwortete seine Frau. »Antworten gibt’s nicht umsonst. Wenn das Mädchen ihn finden will, dann soll sie ihn gefälligst suchen. Geht uns nichts an. Und dich schon gar nicht, Sydney!«
Celia betrachtete die Ansichtskarte, und als sie die Londoner Adresse auf der Rückseite las, ahnte sie, dass Mrs. Egerton ihr die Postkarte nicht aus Hilfsbereitschaft gegeben hatte, sondern um sie aus dem Weg zu haben. Was Celia letztendlich egal sein konnte. Sie nickte und sagte artig: »Danke, Ma’am.«
»Brauchst gar nicht so zu tun!« Mrs. Egerton funkelte sie an und schnaufte verächtlich, dann beugte sie sich vor und flüsterte Celia ins Ohr: »Du bist eine von denen, die verheirateten Männern den Kopf verdrehen. Die alles durcheinanderbringen, mit ihren großen Augen und dem niedlichen Gesicht. So eine bist du.«
»Ma’am?«, fragte Celia verständnislos.
»Du hast gehört, was ich gesagt habe!« Damit wandte sie sich ab und verschwand in der Küche.
Während Celia völlig verwirrt und mit rotem Kopf auf die Karte in ihrer Hand starrte, hörte sie Mr. Egerton sagen: »Du wirst es bereuen und womöglich teuer bezahlen.«
»Antworten gibt’s nicht umsonst«, murmelte sie in Gedanken versunken.
»Tu, was du nicht lassen kannst!«, antwortete Mr. Egerton achselzuckend.
Statt auf die mahnenden Worte des Wirtes zu hören oder wenigstens in aller Ruhe nachzudenken, was nun zu tun sei, war Celia direkt nach dem Frühstück zum Bahnhof geeilt und hatte einen Fahrschein dritter Klasse nach London gekauft. Wie sie inzwischen wusste, hatte sie das Ticket lediglich von einer Sackgasse in die nächste geführt. Mit dem nicht unwesentlichen Unterschied, dass sie nun noch weniger Geld in der Börse hatte.
The Silver King existierte nicht mehr. Das Kuriositätenkabinett des Mr. Norman war weitergezogen oder hatte sich in Luft aufgelöst. Und beim Anblick der verrammelten Ladenwohnung gingen Celia all die Fragen durch den Kopf, die sie in Southampton hätte stellen müssen: Wen hatte ihr Vater verraten? Wieso hielt ihn ganz Southampton für einen Judas? Hatte die Mutter ihn aus dem gleichen Grund einen Verbrecher und Teufel genannt? Und was hatte der Seemann Ned Brooks mit einem billigen Tingeltangel zu schaffen, in dem man bärtige Frauen, knochenlose Schlangenmenschen und ähnliche Monstrositäten zur Schau stellte? Im Stadtteil Northam, wo ihr Vater gewohnt hatte und wo man ihn immer noch kannte – und offenkundig verabscheute –, hätte sie womöglich Antworten auf diese Fragen gefunden. Nicht unbedingt in der County Tavern, aber anderswo in Southampton. »Da kannst du fragen, wen du willst«, hatte Mr. Egerton gesagt.
Ja, hätte sie das nur getan! Doch wieder einmal war Celia Hals über Kopf losmarschiert, ohne ein zweites Mal und in Ruhe nachzudenken. Erneut waren ihre Beine schneller als ihr Verstand gewesen und hatten sie keinen Schritt vorwärtsgebracht. Es war zum Haareraufen!
Celia stand reglos auf dem Gehweg und wurde immer wieder von Passanten angerempelt und mit ärgerlichen Kommentaren bedacht. Hinter ihr ratterte eine Pferde-Straßenbahn vorbei, die Metallbeschläge der Räder quietschten laut in den Gleisen. Ein unbeschreiblicher Gestank umgab sie. Er unterschied sich deutlich von dem beißenden Geruch der Fabriken in Southwark. Hier roch es nach den Ausdünstungen und Ausscheidungen von Mensch und Tier. Kuhfladen, Schweinedung und Pferdeäpfel lagen auf dem Pflaster. Celia vermutete, dass auf der Whitechapel Road die Viehherden aus den östlichen Dörfern in die Stadt getrieben wurden, um dort auf den Märkten verkauft zu werden.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich ein monumentales Gebäude mit einer riesigen Uhr im Giebel, und über dem Eingang stand in großen Lettern: »The London Hospital«, wie Celia im Licht des Mondes erkennen konnte. Doch immer wieder ging ihr Blick zu dem verwaisten Kuriositätenkabinett, als hoffte sie, der deprimierende Anblick könnte sich auf wundersame Weise ändern.
Eine alte Frau stellte sich neben sie, schaute ebenfalls zur Fassade des leer stehenden Hauses und sprach in einer ihr unbekannten Sprache auf sie ein. Als die Alte die Hand aufhielt und ihr entgegenstreckte, schüttelte Celia bedauernd den Kopf. Die Alte brummte irgendetwas und verschwand.
Schließlich steckte Celia die Postkarte ein und betrat einen schmalen, nach Fäkalien und Unrat stinkenden Durchgang neben dem Haus mit der Nummer 123, der zu einem rückwärtigen, ringsum bebauten Yard führte. Dort befand sich neben einem schäbigen Wirtshaus und einem hölzernen Viehstall auch eine Pfandleihe, deren Schaufenster mit einem schweren Metallgitter gesichert war. Genau in dem Augenblick, als Celia den mit Gaslicht beleuchteten Hof betrat, kam ein Mann im schwarzen Mantel aus dem Laden und schloss die Eingangstür von außen ab. Der Pfandleiher hatte einen langen Rauschebart und trug einen seltsamen Hut auf dem Kopf, der an einen platt gedrückten Zylinder erinnerte.
»Verzeihung, kennen Sie zufällig den ›Silver King‹?«, wandte sich Celia an den Mann, der bei der Anrede vor Schreck herumfuhr, als fürchtete er, gemeuchelt zu werden.
»Gott im Himmel!«, entfuhr es ihm, doch bei Celias Anblick beruhigte er sich und fragte: »Welchen König?«
»Den Silberkönig«, antwortete Celia. »Ein Kuriositätenkabinett. Es war früher mal in dem Haus an der Straße.« Sie wies zur Whitechapel Road.
»Das Haus steht leer«, antwortete der Pfandleiher und zündete sich eine Pfeife an. »Seit Jahren schon. Keine Ahnung, wer da vorher drin war. Hab meinen Laden noch nicht so lange. Tut mir leid.«
»Danke«, sagte Celia und senkte den Kopf.
»Frag doch drüben im Cloak and Dagger!« Der Mann deutete auf die Schänke im hinteren Teil des Hofs und lächelte aufmunternd. »Der Wirt heißt Boyle, er führt das Haus schon seit vielen Jahren. Gut möglich, dass er was von deinem König weiß.«
Wieder sagte Celia Danke. Doch auch als der Mann sich verabschiedet und den Hof verlassen hatte, rührte sie sich nicht vom Fleck. Das Gasthaus mit dem seltsamen Namen machte auf sie einen wenig einladenden Eindruck. Wie alles in dieser Gegend war es alt, verwittert, verwahrlost und baufällig. Zwei betrunkene schnauzbärtige Gestalten hockten aneinandergelehnt auf einer Bank vor dem Eingang und schienen ihren Rausch auszuschlafen. Ein weiterer Mann stand an einem Durchlass zwischen Schänke und Viehstall und pinkelte an die Mauer.
Schließlich gab Celia sich einen Ruck, umklammerte ihren Koffer und ging in Richtung der Schänke. Als sie die Tür öffnete, schlug ihr ein unbeschreiblicher Gestank entgegen, es roch nach Schweiß und Erbrochenem, nach Tabakrauch und feuchtem Moder. Offenkundig war der Schankraum seit Wochen nicht gelüftet, geschweige denn gereinigt worden. Celia hielt sich das Taschentuch ihrer Mutter vor die Nase und ging zur Theke, an der ein etwa dreißigjähriger Mann und eine jüngere, aber verlebt aussehende Frau sich gerade lautstark stritten, während der Wirt ihnen zusah. Davon abgesehen war die Schänke leer, jedenfalls soweit Celia das erkennen konnte, denn der Raum war düster wie eine Gruft.
»Sind Sie Mr. Boyle?«, wandte sich Celia an den stämmigen und groß gewachsenen Wirt, der sie daraufhin argwöhnisch beäugte.
»Kommt drauf an«, knurrte er.
Celia reichte ihm die Ansichtskarte über den Schanktisch und fragte: »Kennen Sie den Laden vom Silver King?«
»Das Penny Gaff?«, fragte der Wirt erstaunt. »Gibt’s schon lange nicht mehr.«
»Penny Gaff?«, wunderte sich Celia.
»Zahlst ’nen Penny, und dafür bekommst du was zu gaffen.« Mr. Boyle lachte und wandte sich an die Frau, die ihren Streit mit dem Mann unterbrochen hatte und neugierig die Postkarte betrachtete. »Weißte noch, Ginger? Da haben sie damals den Elefantenmenschen gezeigt.«
»Pfui Teufel!«, rief die Frau, fuhr sich mit der Hand durch ihr lockiges rotblondes Haar und machte ein angewidertes Gesicht. »Was für eine hässliche Kreatur. Ich muss heut noch würgen, wenn ich nur dran denke.« Sie sprach mit einem seltsamen Akzent, für Celia klang es wie eine Mischung aus Irisch und Walisisch.
»Was ist aus dem Monster eigentlich geworden?«, fragte ihr Begleiter, der sauertöpfisch dreinschaute und begann, den Dreck unter seinen Fingernägeln hervorzupulen.
»Ich glaub, den haben sich die Doktoren drüben aus dem London Hospital geholt«, meinte der Wirt und lachte dröhnend. »Wahrscheinlich haben sie ihn ausgestopft und in eine Vitrine gestellt.«
Die Frau namens Ginger rief abermals: »Pfui Teufel!« Dann drohte sie dem Wirt scherzhaft mit dem Finger und fügte hinzu: »Du bist ein Schandmaul, Joe!«
»Und der Besitzer des Ladens?«, hakte Celia nach. »Wissen Sie, was aus Mr. Norman geworden ist?«
»Vermutlich ist er im Gefängnis gelandet«, sagte Mr. Boyle und schob die Unterlippe vor. »Jedenfalls hat die Polizei ihm die Bude dichtgemacht. Das ist allerdings schon Jahre her. Weiß gar nicht genau, wann das war.«
»Ende ’84«, warf der Mann am Tresen ein.
»Bist du sicher, Joseph?«, fragte der Wirt überrascht.
»Klar«, antwortete er. »Das war kurz bevor Jane mich verlassen hat. Ich wollte ihr den Elefantenmenschen zeigen, aber da war der Laden schon zu. Und wenig später war Jane auch weg.«
»Vermutlich aus gutem Grund, du Schuft«, knurrte Ginger. »Wahrscheinlich hast du sie auch geprügelt. Mich bist du auch bald los!«
»Fang nicht schon wieder an!«, fauchte der Mann namens Joseph.
»Ist doch wahr!«
»Kennen Sie Ned Brooks?«, unterbrach Celia den sich neu entflammenden Streit. »Er soll damals in dem Kuriositätenkabinett gewohnt haben.«
»Gewohnt?«, lachte der Wirt. »Die armen Kreaturen, die bei Tom Norman gehaust haben, hatten keine Namen. Die hießen ›der Elefantenmensch‹ oder ›die Schlangenlady‹ oder ›der Mann ohne Hals‹!«
»Vermutlich hat er für Mr. Norman gearbeitet«, sagte Celia. Sie hoffte es zumindest. »Ich glaube nicht, dass er auf der Bühne gestanden hat. Er war nicht … kurios oder missgebildet.«
»Nein, ein Ned Brooks ist mir nicht untergekommen«, antwortete der Wirt kopfschüttelnd. »Euch vielleicht?«
Ginger und Joseph schüttelten ebenfalls die Köpfe.
»Nichts zu machen«, meinte der Wirt und füllte Ginger das Bierglas auf, ohne dass sie ihn darum gebeten hätte. Dann gab er Celia die Postkarte zurück und fragte ungeduldig: »Kann ich sonst noch was für dich tun?«
»Nein danke, Sir«, antwortete sie, steckte die Karte ein und wandte sich zum Gehen. Als sie das Cloak and Dagger verlassen wollte, stieß sie in der Tür mit zwei Männern zusammen, die im gleichen Augenblick den Schankraum betraten. Den schnauzbärtigen Gesichtern nach zu urteilen, waren es die beiden Kerle, die vor der Schänke auf der Bank gedöst hatten.
»Hoppla, Miss!«, rief der eine und griff Celia um die Taille. »Nicht so stürmisch, meine Hübsche!«
»Bist ’ne Draufgängerin, was?«, fragte der andere und fasste sie an der Schulter. »Soll mir recht sein, auf so was steh ich.« Er lachte dreckig und stieß seinen Saufkumpan mit dem Ellbogen an. »Was, Stanley, stehen wir doch drauf, oder?«
Er blies Celia seine Alkoholfahne ins Gesicht, die kaum den Gestank seiner fauligen Zähne überdeckte. »Lassen Sie mich!«, rief sie und riss sich los. Sie wich einige Schritte zurück und hielt ihren Koffer wie einen Schutzschild vor sich.
Die beiden Männer kamen näher und bauten sich direkt vor ihr auf.
»Mr. Boyle«, wandte Celia sich an den Wirt. »Bitte!«
»Kennst du die, Joe?«, fragte der Mann namens Stanley und fuhr Celia wie beiläufig mit der Handfläche über die Wange.
Der Wirt zuckte mit den Schultern und wandte sich demonstrativ ab.
»Schnüffelt hier die ganze Zeit rum«, meinte Ginger und leerte ihr Glas.
»Ich schnüffele überhaupt nicht«, sagte Celia und wich erneut zurück, bis sie direkt mit dem Rücken am Tresen stand.
»Willst du mal an mir schnüffeln?«, fragte Stanley, griente und griff sich in den Schritt. »Hab ich nichts gegen.«
»Kommst nicht von hier, was? Du sprichst so komisch«, meinte der andere und drängte sich an sie, bis nur noch der Koffer zwischen ihnen war. »Landeier kann ich gut leiden. Sollen ja angeblich am besten schmecken.«
»Lasst es gut sein, Jungs«, mischte sich Joseph ein. »Die ist doch noch ’n halbes Kind.«
»Kümmer du dich um dein eigenes Weibsbild, Joseph!«, schnauzte Stanley und stieß den Zeigefinger in Gingers Richtung. »Wir kümmern uns um unsers.«
»Ich bin nicht Ihr Weibsbild«, rief Celia, die nun das Knie des anderen Mannes an der Innenseite ihres Schenkels spürte. Die Tränen stiegen ihr in die Augen. »Bitte lassen Sie mich gehen!«
»Bist nicht unser Weibsbild, was?«, höhnte Stanley. »Wem gehörste dann?«
»Das Mädchen gehört zu mir«, erklang in diesem Augenblick eine helle Männerstimme von der Tür. »Sie ist meine Schwester.«
Überrascht wandten sich die beiden Männer um und starrten zum Eingang. Im gleichen Augenblick prusteten sie schallend los.
Weil die Männer ein wenig zur Seite getreten waren, hatte auch Celia einen freien Blick auf die Tür. Dort stand ein junger Mann in einer staubigen und fleckigen Uniform, die militärisch wirkte und dennoch nicht recht zu einem Soldaten passte. Jedenfalls hatte Celia eine ähnliche Uniform noch nirgends gesehen. Sie war schlicht und dunkelblau, mit einer dichten Reihe Metallknöpfe auf der Brust und hohem Stehkragen, auf dem ein weißes »S« eingestickt war. Auf dem Kopf trug der Mann eine ebenfalls dunkelblaue Kappe mit einem schmalen Hutband, auf dem zu lesen war: »The Salvation Army«.
»Deine Schwester?«, rief Stanley. Er schien der Wortführer der beiden Männer zu sein. »Wer’s glaubt, wird selig!« Wieder lachten die Männer, und auch Ginger stimmte kichernd mit ein.
Der Uniformierte nickte Celia kaum merklich zu und hob die Augenbrauen. Dann sagte er: »Ja, sie ist meine Schwester, weil sie wie ich ein Kind Gottes ist.«
Stanley bog sich vor Lachen. »Ein Kind Gottes!«, kreischte er und schlug seinem Kumpel auf den Oberarm. »Das ist gut! Den Witz muss ich mir merken.«
Wieder machte der Heilsarmist ein Zeichen mit dem Kopf in Celias Richtung und winkte gleichzeitig mit einem Stapel Papiere, den er in der Hand hielt. »Ja, ein Kind Gottes! Und wenn ihr morgen zur Church Street kommt und unserer Schwester Eva zuhört, werdet auch ihr unsere Brüder werden. Das verspreche ich euch.«
»Ich hab schon zwei Brüder«, sagte Stanleys Kumpel. »Die reichen mir. Kann sie nicht ausstehen.«
Dennoch hielt der Uniformierte ihm einen Handzettel hin und rief übertrieben laut: »Der Herr Jesus wird dir den Weg zu uns weisen! Er ist dir ein Freund und führt dich ins Licht!« Wieder nickte er Celia dabei seltsam zu.
Endlich begriff sie. Sie presste den Koffer an ihre Brust, sprang zwischen den beiden Männern hindurch nach vorn und rannte zur Tür. Als Stanley nach ihr fassen wollte, zuckte sie zur Seite, und im selben Moment warf der Mann in der Uniform ihm die Handzettel ins Gesicht mit den Worten: »Der Herr sei mit euch!«
»Teufel auch!«, fauchte Stanley und sprang ihr hinterher, doch er rutschte auf einem der Zettel aus und landete mit dem Hinterteil auf den Dielen.
Celia stieß die Tür auf und stürmte hinaus, nur eine Sekunde später folgte ihr der Heilsarmist. »Da lang!« Er deutete auf die dunkle Nische zwischen Schänke und Viehstall.
Im gleichen Augenblick wurde die Tür zur Schänke erneut aufgestoßen.
Celia und ihr Beschützer rannten zu der Nische, die sich als schmaler Durchlass entpuppte und anscheinend zu einer Parallelstraße der Whitechapel Road führte. Kaum hatten sie die schmale Gasse erreicht und waren nach links abgebogen, schon schlug der Uniformierte erneut einen Haken und bugsierte Celia in einen engen Yard, der wiederum zur Hauptstraße zu führen schien. Wenn Celia nicht in der Dunkelheit völlig die Orientierung verloren hatte, waren sie im Halbkreis gelaufen.
In der Gasse hinter ihnen erklangen eilende Fußschritte, die schnell näher kamen, sich dann aber ebenso schnell wieder entfernten. Stanley und sein Kumpel waren an dem unscheinbaren Eingang zum Yard vorbeigerannt.
»Das war knapp«, keuchte Celia und fasste sich an die Brust. »Danke!«
»Gern geschehen«, sagte der junge Heilsarmist und reichte ihr die Hand. »Mein Name ist Adam. Adam Bedford. Soldat des Heils.«
»Celia«, antwortete sie. »Celia Brooks.«
»Freut mich«, sagte Adam und drückte kräftig ihre Hand.
»Wir sollten schleunigst verschwinden«, meinte Celia und entzog ihm ihre Finger. »Bevor die beiden Kerle zurückkommen.«
»Ich hab noch was vergessen«, antwortete Adam und deutete auf eine hölzerne Latrine, die sich am Rand des Hofs befand, gleich neben einem baufälligen Gebäude, dessen schiefe Fassade mit Holzbalken gestützt war.
»Oh«, machte Celia verlegen.
Adam lachte. »Ich meine nicht den Abort, sondern die kleine Tür dahinter. Warte hier! Ich bin gleich wieder da.« Bevor sie etwas erwidern konnte, war er zu dem baufälligen Haus gelaufen und durch die Tür verschwunden. Celia folgte ihm, öffnete die Tür einen Spaltbreit und lugte hinein. Der ekelige Gestank, der ihr entgegenschlug, kam ihr bekannt vor. Sie waren auf der Rückseite der Schänke Cloak and Dagger gelandet. Die Latrine im Hinterhof gehörte anscheinend zum Wirtshaus.
Celia hörte Schritte aus dem Inneren, und im nächsten Augenblick stand Adam Bedford vor ihr und hielt triumphierend den Packen Handzettel in der Hand, den er nur kurz zuvor dem betrunkenen Stanley ins Gesicht geschleudert hatte.
»Wäre schade drum gewesen«, sagte er und lachte. »Komm!«
»Wohin?«
»Es ist schon spät.«
Die gleichen Worte hatte auch der Wirt in Southampton am gestrigen Abend benutzt. Celia zuckte unwillkürlich zurück und blieb stehen.
»Möchtest du, dass ich gehe und dich allein lasse?«, fragte Adam und zeigte ihr die Innenflächen seiner Hände. »Du musst es nur sagen. Ich werde dich nicht bedrängen. Ich will nur helfen.«
»Ich weiß nicht mehr weiter«, antwortete Celia und hatte Mühe, die Tränen zurückzuhalten. »Ich habe mich verrannt.«
»Du kannst mir vertrauen«, sagte er und reichte ihr eines der Flugblätter. »Ich bin ein Soldat der Heilsarmee und werde dich zu Freunden bringen.«
Es war inzwischen viel zu dunkel, um noch irgendetwas auf dem Papier zu lesen. Celia steckte es ein und sagte: »Ich habe keine Freunde.«
»Das ist nicht wahr«, antwortete Adam lächelnd, »du hast sie nur noch nicht kennengelernt.«
3
Niemals hätte Celia gedacht, dass schlafende Menschen so laute Geräusche und derart üble Gerüche von sich geben konnten. Während sie reglos auf ihrem harten Bett lag und zu den schrägen Bohlen des Dachstuhls hinaufstarrte, die sie in der Finsternis an ein Spinnennetz erinnerten, machten die Frauen, die mit Celia im Schlafraum lagen, einen Lärm, als wären sie wach und wollten sich gegenseitig am Einschlafen hindern. Einige redeten im Schlaf oder stießen in unregelmäßigen Abständen wirre Rufe aus, andere wälzten sich so oft hin und her, dass die Betten knarrten und quietschten, und nicht wenige schnarchten so laut, dass man sich am liebsten die Ohren hätte zuhalten mögen. Und doch war Celia froh, hier zu sein und in einem Bett zu liegen, auf einer leidlich sauberen Matratze aus Seetang, in eine dünne Decke gehüllt und mit einem Lumpenkissen unter dem Kopf. Auch wenn das hölzerne Geviert des Bettes an einen schmucklosen Sarg erinnerte.
Zwanzig dieser gezimmerten Kästen gab es in dem Dachraum, weitere Schlafsäle befanden sich im ersten Stock und im Erdgeschoss des Hauses. In der Dachstube standen sich jeweils zehn Holzkisten in Reih und Glied gegenüber, mit einem schmalen Mittelgang dazwischen, wie Soldaten beim Appell. Celia lag, vom Eingang aus gesehen, im hintersten und dunkelsten Winkel, direkt an der unverputzten Wand, unter dem Spruch »Bist du bereit zu sterben?«, der in Kopfhöhe in roten Lettern auf einem Schild zu lesen war. Celia erschien der Spruch seltsam unpassend, denn das Nachtasyl für Frauen in der Hanbury Street hatte es sich ja gerade zur Aufgabe gemacht, die mittellosen Frauen, die hier Unterschlupf fanden, nicht umkommen zu lassen.