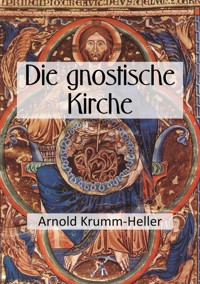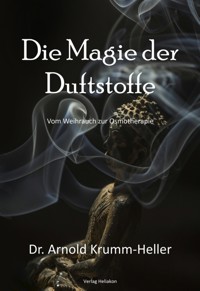
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Wie sich in der Natur für unser Menschenauge alles langsam aufbaut, aus dem Nichts wird, keimt, wächst, blüht und gedeiht, so ist es in uns mit geistigen Eindrücken und geistiger Arbeit. Wir leben und in uns leben Gedanken, Wünsche und Hoffnungen. – So fühle ich mich innerlich verpflichtet, ja gedrängt, das jahrelang Gedachte und Erlebte aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Ich entschließe mich dazu, nach langen Jahren der Sammlung, des Sammelns und Kämpfens, in der nachfolgenden Abhandlung meine festgehaltenen und niedergelegten Gedankengänge und die sich darauf stützenden Beobachtungen und Tatsachen der Feder anzuvertrauen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Magie der Duftstoffe
Vom Weihrauch zur Osmotherapie
Osmologische Heilkunde
Arnold Krumm-Heller
Dr. med. h. c. der mex. Nat. Universität
Oberst-Arzt a. D. im mex. Generalstab
Der treuesten Gehilfin meiner Forschungen,
meiner Frau Carlota gewidmet.
Verlag Heliakon
Titel: Die Magie der Duftstoffe
2025 © Verlag Heliakon, München
Umschlaggestaltung: Verlag Heliakon
Titelbild: Pixabay (brenkee)
Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH,
Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Zum Geleit!
Einleitung
I. Teil - Geschichte der Riechstoffe in Religion und Kultur
Weihrauch im Kultus des alten Testaments
Das Duftsymbol in den Religionen des Altertums
Weihrauch, Duftstoffe und Salben in der orthodoxen Kirche
Duft- und Riechstoffe im Kultus des Buddhismus
Richstoffe bei Mayas, Inkas und Azteken
Der Handel mit Räucherstoffe im Altertum und Mittelalter
Kultische Duftpflanzen
Kultus und Medizin
II. Teil – Geistige und materielle Grundlagen der Riechstoffheilkunde
Krankheiten und Riechstoffe
Die bekannten Heilsysteme und ihre Nachteile
Eigene Heil- und Abwehrkraft unseres Organismus
Innensekretion und Geruchswahrnehmung
Die Entelechie als Heilenergie
Die osmetischen Strahlen
Der Atem als Duftträger
Die Beziehungen zwischen Pflanzen und Sternen
Riechstoffe und Töne
Chemie der ätherischen Öle
Chemische Analysen
III. Teil – Medizinische Anwendung und Heilverfahren
Das Geruchsorgan
Geruch und Gefühl
Geruch und Seele
Alte und neue Heilmethoden
Heilung durch Riechstoffe
Riechstoffheilungen in aller Welt
Ausblicke für das neue Verfahren
Anhang
Verzeichnis der ätherischen Öle in den Pflanzen
Pflanzen nach ihrer Zugehörigkeit zu Tierkreiszeichen und Planeten
Zum Geleit!
Es ist für mich eine große und herzliche Freude gewesen, dies außerordentliche und bahnbrechende neueste Werk meines Jugendfreundes Oberst Dr. A. Krumm-Heller noch vor seiner Drucklegung kennenzulernen. Was exakte Forschung und Intuition dem Strahlungsfachmann sich mit zwingender Gewalt aufdrängen ließen: die Vermutung nämlich, dass jedwede Heilwirkung sei, es die von Medikamenten dieser oder jener Art, einzig und allein Strahlungswirkung ist, nur Strahlungswirkung sein kann, das zeigt uns hier ein Mann, der die Welt schon mehrmals mit neuen Erkenntnissen von Ewigkeitswert überraschte, überzeugend und eindringlich! Und noch mehr: wir sehen, hier mit beweisenden Argumenten, dort zwischen den Zeilen, dass die Initialwirkung feiner und feinster Dosierung edler Substanzen unendlich drastischere Endwirkung auszulösen vermag, als die Verwendung übersteigerter Quanten von – so häufig in der heutigen Heilpraxis verwendeten – Giften, die im Grunde genommen nie eine Krankheit, sondern günstigstenfalls nur Krankheitssymptome bekämpfen. Und also letzten Endes wertlos sind.
Meine Beziehungen zu einem Teile der Schweizer Ärzteschaft ließen mich zu meiner freudigen Genugtuung erkennen, dass auch namentlich der wissenschaftlich vorgebildete Heiler mehr und mehr für neue Methoden offen ist, und dass man also hoffen kann, dass die vorliegende Arbeit Dr. Krumm-Hellers sich die Mitarbeiterschaft seiner praktizierenden Kollegen im Sturmeslauf erobern möge. Das walte Gott! Und in diesem Sinne: wandere in die Welt hinaus, du Buch wundervollster Ausblicke, zum Segen der leidenden Menschheit! Dem lieben Verfasser aber über Strom und Tal und Hügel hinweg Händedruck und Glückauf! Vorwärts auf diesem Wege!
Zürich, im Lenzmond 1934.
Alfred Judt.
* * *
Nach dem Physiker mag auch der Arzt zu Worte kommen! Wer an dieses neue Werk Dr. Krumm-Hellers herangeht, wird erstaunt sein über die Kühnheit der Gedankengänge, die sich im Zusammenhang damit aufdrängen. Gewiss, diese ganze Osmotherapie ist etwas für uns Abendländer absolut Neues, das, wie der Verfasser selbst sagt, erst noch der weitgehendsten Klärung und Erforschung harrt: die aufgezeigten Wege und Gedanken aber sind trotzdem so deutlich wiedergegeben und begründet, dass sich den eröffneten Ausblicken niemand wird verschließen können.
Es handelt sich hier vielleicht um die Methode, an die Krankheiten des Menschen durch direkte Einwirkung auf das Zentralnervensystem heranzukommen, jene Zentrale unseres Körpers, bei der letzten Endes alle Entscheidungen über Wohl- oder Übelbefinden, Gesund- oder Kranksein getroffen werden.
Man braucht gar nicht an die Auswirkungen der auch im Buch erwähnten Feststellungen des spanischen Arztes Asuero heranzugehen, – jene durch Eingriffe an der Nase verursachten Zentralnerven-Beeinflussungen und dadurch erreichten oft überraschenden und unglaublichen Heilungen, die in der übrigen Welt weit mehr Beachtung fanden als bei uns, dank der Überheblichkeit gewisser schulmedizinischer Kreise über dem Wissen und Können anderer.
Durch meinen Aufenthalt in Lateinamerika ist mir bekannt, dass Dr. Krumm-Heller ein Könner ist, dessen Ruf in Süd- und Mittelamerika ein für unsere Begriffe ganz außerordentlicher ist; man darf ihn dazu beglückwünschen, dass er mit diesem neuen Werk seinen Mitmenschen wieder neue und bisher noch nie beschriebene Ideen vermittelt, die von nicht unerheblicher Tragweite sein können.
Der Geruchssinn des Menschen ist sehr mit Unrecht so vernachlässigt, sodass eigentlich nur bei der Narkose seine Vermittlung in der Medizin in Anspruch genommen wird; und doch regt nicht das (Gesicht, auch nicht der Speisengenuss selbst, sondern gerade der Geruch alltäglich unseren Appetit an, – ein Umstand, der schon aus dem Alltag heraus uns die Gedanken des Verfassers besonders nahe bringen sollte.
Berlin, im Mai 1934.
Dr. med. Albert Wolff, Biologischer Arzt.
Einleitung
Goethes „Faust“
Atmest du nicht mit mir die süßen Düfte,
O, wie so hold berauschen sie den Sinn,
Geheimnisvoll sie wehen durch die Lüfte,
Fraglos geb' ihrem Zauber ich mich hin.
Wie sich in der Natur für unser Menschenauge alles langsam aufbaut, aus dem Nichts wird, keimt, wächst, blüht und gedeiht, so ist es in uns mit geistigen Eindrücken und geistiger Arbeit. Wir leben und in uns leben Gedanken, Wünsche und Hoffnungen. – So fühle ich mich innerlich verpflichtet, ja gedrängt, das jahrelang Gedachte und Erlebte aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Ich entschließe mich dazu, nach langen Jahren der Sammlung, des Sammelns und Kämpfens, in der nachfolgenden Abhandlung meine festgehaltenen und niedergelegten Gedankengänge und die sich darauf stützenden Beobachtungen und Tatsachen der Feder anzuvertrauen.
Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob schon von irgendeiner anderen Seite ähnliche, seien es gelegentliche, vielleicht sogar systematische Versuche zur Klärung oder experimentellen Nachprüfung einschlägiger Erscheinungen dieses Sondergebietes unternommen worden sind. Es gibt zwar in der parapsychologischen Literatur kleine Broschüren über die Wirkung von Duftstoffen, die aber so nichts sagend, so laienhaft sind, dass sie nicht einmal Erwähnung verdienen.
Auch dieses Buch wird von Menschen, die es zur Hand nehmen und nur darin herumblättern, als uninteressant fortgelegt werden. Das ist kein Vorwurf gegen den einzelnen, sondern der Grund ist einzig und allein in unserer oberflächlich schnelllebigen und materiellen Zeit zu suchen, der wir in den letzten 14 Jahren in Deutschland angehörten.
Sicherlich wird dieses Buch mit dem dicken Schädel gewisser denkträgen Routinemenschen zusammenstoßen, und dann wird es hohl klingen. Nun, dieser hoble Ton braucht nicht unbedingt vom Buche zu kommen.
Ob es in der Tat möglich sein wird, auf den Schlüssen der gesammelten bisherigen Beobachtungen in weiterer Ausdehnung durch zielbewusste Versuche eine neue Heilmethode aufzubauen, muss die Zukunft lehren. Bei entsprechenden Voraussetzungen halte ich es für sehr möglich, und ist eine Aussicht auf Erfolg absolut denkbar. Verfrüht wäre es allerdings, irgendwelche Richtlinien für eine eventuelle neue Methode schon heute festlegen zu wollen.
Alles, was ich darf, kann, ja muss, ist bitten und einladen, mitzuhelfen und nachzuprüfen, ob nicht hier der Weg gegeben ist zur Heilung und Stärkung der Menschheit.
Ich möchte mich hier in meiner Einleitung daher mich damit begnügen, auf die nicht ganz unwichtige Frage der äußeren Bezeichnung meiner Idee und der Einreihung der neuen Methode in die in Betracht kommende Nomenklatur einzugehen.
Meine ursprüngliche Absicht, den neu zu bildenden Begriff auf dem Worte „Euodia - Wohlgeruch“ aufzubauen, habe ich nach näherer Prüfung verworfen. Wohlgeruch ist, je nach der Empfänglichkeit des mit ihm in Berührung gebrachten Individuums, wie wir später sehen werden, nach der einen oder anderen Seite immerhin ein relativer Begriff. Man könnte von diesem Gesichtspunkt und rein äußerlich genommen, das Motto anwenden: „Über den Geschmack lässt sich nicht streiten.“ Dieses Sprichwort hinkt aber hier, da wir ja nicht nur unserem äußeren Geruchssinn nachgehen wollen, sondern auf eine innere Anregung der Drüsen und dadurch einer Heilung zustreben. Durch das Verfahren dürfte der Patient in dem einen oder anderen Falle sogar gezwungen werden, genau wie bei anderen Heilmethoden, auch solche Mittel, die nicht als durchaus angenehm empfunden werden, in unserem Falle in Duftform, anzuwenden.
So habe ich mich vorderhand, bis berufenere Instanzen ihr Urteil gesprochen haben, für „Osmotherapie“ als Bezeichnung des unter Anwendung von Gerüchen gegebenen Heilverfahrens entschieden. Das aus dem Griechischen stammende Kennwort „Osme“, das ohne weiteres auf jeden Geruch anwendbar ist, unbeschadet des Empfindens, das seine spezifische Eigenschaft bei dem einen oder anderen Menschen auslöst, erscheint mir als das gegebenste.
Als ich mein Manuskript fertig hatte, sandte ich es einem Physiker, welcher ein gründlicher Kenner des Orients ist, und einem Mediziner, welcher sich durch eine hervorragende Praxis in Lateinamerika ausgezeichnet hatte. Beide m. E. Einzig Berufene, mir ein Urteil zu geben. Sie wurden Paten dieses Werkes, das ich noch mit einem gewissen Bangen der Öffentlichkeit übergebe. Neuheiten stoßen stets auf Widerstände.
Nun möge dieses Buch an ruhige unparteiische Sucher der Erkenntnis, die nicht am dogmatischen, starren Schulwissen hangen, sondern die auch Gefühlswerte zu berücksichtigen imstande sind und fortschrittlich zu denken vermögen, weitergegeben werden.
Vergesse auch der Leser nicht, dass mir die alten Archive von Mexiko inhaltlich zur Verfügung standen sowie die Nachrichten über die Kunde von den Zusammenhängen uralter weltgeschichtlicher Begebenheiten.
Die jüdischen Synagogen Spaniens besaßen wertvolle Büchereien, welche nach der Vertreibung der Juden aus Spanien an die katholischen Klöster übergingen. Von hier aus wurden bedeutende literarische Werke nach Mexiko und Peru überwiesen, die uns wertvollen Stoff gaben.
Bauen wir nun die Brücke zum medizinischen Gebiet, wenn es auch unumgänglich notwendig ist, dass wir zeitweise wieder auf die Religion zurückgreifen.
I. Teil - Geschichte der Riechstoffe in Religion und Kultur
Den heiligen Hauch oder Odem, der die ewigen Wesenheiten untereinander ausgleicht und zur wahren Ruhe bringt, soll man sich nicht als einen tatsächlichen Hauch oder Luftzug vorstellen, sondern als den sanften Duft einer Salbe oder eines aus vielen Stoffen gemischten Rauchwerkes. Es ist eine durchdringende Kraft von einer unbeschreiblichen Gewalt des Wohlgeruches, schöner als man es denken oder aussprechen kann.
(Aus einem gnostischen Katechismus)
Weihrauch im Kultus des alten Testaments
Religion und Heilkunst sind Wesensverwandtes, das bei allen Völkern von ihren Priestern gemeinsam gelehrt und ausgeübt wurde. Was für die Seele die Religion ist, das bedeutet die Heilkunst für den Körper; da aber Körper und Seele untrennbare Begriffe sind, sind auch Religion und Heilkunst in ihrer Wechselwirkung und inneren Bezogenheit auf das Engste miteinander verbunden. Wenn wir unserer osmologischen Heilkunde eine geschichtliche Rückschau vorausschicken wollen, so müssen wir, je weiter wir zurückgreifen, desto mehr gerade in der Verwendung der Riechstoffe unser Interesse auch dem religiösen, also kultischen Gebrauch zuwenden.
Die Heilkunst der alten Zeit benutzte, wie auch die primitiven Völker heute noch, die Mittel so, wie sie die Natur wachsen lässt. Daher ist es vollkommen verständlich, wenn man das Wunder der Heilung eines kranken Körpers durch die Kräfte der Natur und ihrer Produkte als etwas Göttliches ansah, ja darin, dass Wirken der Götter selbst erblickte. Daher verknüpften seit altersher die Priester wohlweislich die Heilung ihrer Kranken mit rituellen Handlungen, bis schließlich daraus eine untrennbare Einheit wurde. Es ist hier nämlich auch für den einfachen Menschen die Verbindung des Sinnlich-Übersinnlichen mit der irdischen Materie am leichtesten erkennbar.
Bei unseren folgenden Untersuchungen über das osmologische Gebiet interessiert uns aus dem Vorgenannten natürlich besonders der Gebrauch ätherischer Düfte und Dämpfe, sowie alles, was im weiteren Rahmen mit dem Geruchssinn zusammenhängt, da wir den Geruchssinn gewissermaßen als Medium der Verbindung zwischen übersinnlichen und physischen Momenten, hauptsächlich also hier die Heilwirkung auf Körper und Seele, kennenlernen wollen.
Die frühe Heilkunst kannte schon genau den großen Einfluss der Riechstoffe auf den Menschen, und wir wollen jetzt einen Blick auf den Kultus einiger Kirchen werfen, in welchen der Duft des Weihrauchs und anderer Räucher- und Riechmittel eine wichtige Rolle spielte. Wir werden dabei auch bald das starke Übergreifen in die eigentliche Heilkunst feststellen können.
Der Kultus des Alten Testaments verwendete sowohl in der Stiftshütte wie auch im Tempel in Jerusalem weitgehend wohlriechende Substanzen. Palästina dürfte damals an solchen Riechstoffen arm gewesen sein, wenn man auch heute noch auf dem großen Platz vor dem Tempel Salomons zierliche, kleine Blümchen wachsen sieht, die Träger von Wohlgerüchen sein mögen; aber nur der Libanon lieferte Weihrauch, den die hebräische Sprache darum auch mit: „l'bhonah“ bezeichnete.
Die weitaus größere Menge an Weihrauch und Riechstoffen, hebräisch unter dem Wort: „sam“ zusammengefasst, wurde aus dem Ausland für den Kultusgebrauch bezogen. So lesen wir unter anderem von Weihrauch aus dem Landa Saba, das nach Ansicht heutiger Exegeten ein Landstrich im Südwestteil Arabiens war, während frühere Theologen damit Äthiopien oder Indien gleichzusetzen pflegten. Außer dem erwähnten Weihrauch finden wir noch manche Pflanze, deren Nennung im Zusammenhang mit dem Weihrauch ebenfalls auf kultische Verwendung schließen lässt, so die Myrrhe, Safran, Narde, Zypernblumen, Ambra, Kalmus, Zimt, Aloe und Gewürzstaub; daneben werden aber auch fertige Präparate genannt, die Luther in meiner Übersetzung mit „Salben“ kurz, aber nicht ganz zutreffend, zusammenfasst. Diese aber lassen sich, mangels sicherer Anhaltspunkte, ebenso wie manche der zitierten reinen Stoffe, auch von Fachleuten nicht mehr in ihrer Art oder Zusammensetzung bestimmen.
Häufig begegnet uns auch das hebräische Wort „besem“ mit der Pluralform „b'somin“ sowohl in der Grundbedeutung der Balsamstaude als auch als Bezeichnung für die daraus gewonnenen wohlriechenden Erzeugnisse.
Als der reich gegliederte Kultus des jüdischen Volkes mit dem Verlust seiner politischen Selbstständigkeit und des Nationalheiligtums in Jerusalem sein Ende fand, bot sich auch kein weiterer Anlass mehr zur Anwendung aromatischer Stoffe bei gottesdienstlichen Handlungen. Das Gebet begann an die Stelle des Opfers zu rücken. Es ist dafür bezeichnend, dass auch heute noch einige hebräische Gebetbücher als Titel den alten Ausdruck „Opfer“ gebrauchen. Lediglich bei der sogenannten „Habdalah“, d. h. Scheidung, macht man auch heute noch, wenn auch in bescheidenem Maße, Gebrauch von Wohlgerüchen. Es ist dies ein Brauch, der nach Überlieferung der Rabbinen bereits unter Esra, also im 6. Jahrhundert v. Chr., in Übung gewesen sein soll. Es kann einen an die spagyrische Kunst der mittelalterlichen Rosenkreuzer erinnern, wenn auch mit der Feier der Scheidung allerdings der Beginn der neuen Woche am ausklingenden Sabbatabend gemeint ist.
Das uns dabei interessierende Gerät besteht aus einer durchbrochenen Metallbüchse von zylindrischer oder rechteckiger Form, meist mit einem spitzen Türmchen oder mit einer metallischen Fahne als Krönung versehen und auf einem kelchfußartigen Untersatz ruhend. Das Messing, aus dem dieses Gefäß gemacht wird, enthält die Metalle von Venus und Jupiter in gleicher Mischung, und der Kabbalist Therion meint, dass dieses durchbrochene» Messing in Richtung und Ausdehnung unbeschrankt sei, also sich nicht auf einzelne beziehe, sondern universell und symbolisch für die göttliche Liebe wäre. In der Büchse befinden sich verschiedene frisch duftende Gewürzkörner, die auch mit dem Namen „b'somim“ belegt werden. Daher heißt auch das kleine Gerät „B'somim-Büchse“.
Beim Vollzug des erwähnten Brauches am Sabbatausgang, wie er nicht nur in den strenggläubigen Synagogen, sondern auch in den Familien beobachtet wird, nimmt der Vorbeter bzw. der Familienvater die Büchse in die Hand und spricht über ihrem duftenden Inhalt folgenden Segensspruch:
Gelobet seiest Du, Herr unser Gott, König der Welt,
der Du aller Arten Gewürze erschaffen.
Dann wird der Deckel oder das Türchen der Büchse geöffnet und der Duft der Gewürzkörner eingeatmet. Dies ist der Rest kultischen Gebrauchs von Riechstoffen im heutigen Judentum. Nach orthodoxer jüdischer Auslegung bedeutet dieser Ritus in Verbindung mit einem Segensspruch über einem Becher Wein und mit einer brennenden Kerze, die darin ausgelöscht wird, einen Dank an Gott für das Feuer, den mächtigen Gehilfen des Menschen bei allem Bilden und Schaffen, beim Beginn der wöchentlichen Arbeitszeit, indem der in den Gewürzen sinnbildlich dargestellte Sabbatgeist mit in den Werktag hinübergenommen wird.
Wir gehen nach dieser Erklärung nicht fehl, wenn wir den Duft der Gewürze geradezu als religiöses Vorbeugungsmittel auffassen, das seinerseits die Wiederkehr des Sabbatgeistes nach Ablauf der neuen Woche sicherstellen soll.
Ich habe auf Rhodos und in Palästina festgestellt, dass dort auch heute noch jüdische Familien bei gewissen Beschwörungszeremonien Riechstoffe gebrauchen, die nach astrologischen Gesetzen zusammengestellt sind.
Die Juden haben zunächst wohl keine eigenen Mysterien und Kultgebräuche mit Duftstoffen gehabt, aber aufgrund ihrer Veranlagung zum Handel werden sie schon früh auch auf diesem Gebiet zugleich mit den gängigen Waren auch die entsprechenden Kenntnisse und Kultgebräuche übernommen und bei sich eingeführt haben. Der Handel mit Riechstoffen, dem ich noch ein eigenes Kapitel widmen will, war zu jeder Zeit sehr einträglich und wird auch den Juden gute Möglichkeiten für ihren Verdienst geboten haben.
Aber schon in ältester Zeit finden wir Angaben, die auf die Kenntnis osmologischer Mittel hinweisen. In der Bibel schreiben Hesekiel und Jesajas die Verwendung von Räucherstoffen vor, und auch der weise Salomo gab den Israeliten gewisse Anweisungen zur Herstellung von Räucherwerk für Kult und Heilzwecke. Selbst Mose, der Führer Israels aus Ägypten, welcher sicher in die ägyptischen Mysterien eingeweiht und dazu einer der tiefsten Kenner der Beziehungen zwischen Natur und Mensch war, verlangte, dass sein Volk die Ölung vollziehe, und gab Vorschriften zur Bereitung eines Stoffes auf aromatischen Essenzen.
Bekannt igt, dass die handelstüchtigen Juden auch die Räucherstoffe zum Eintausch gegen Waffen benutzten. Hier liefert uns die Durchforschung der jüdischen Literatur reiche Aufschlüsse über sonst Verborgenes; besonders ergibt die Kenntnis der alten Schritten der spanischen Juden vor ihrer Ausweisung im Jahre 1492 n. Chr. ein hochinteressantes Forschungsmaterial, das anzuführen uns aber über den Rahmen dieses Buches hinausführen wurde.
Das Duftsymbol in den Religionen des Altertums
Wir müssen aber in diesem Zusammenhang noch auf eine wichtige, weitere Beziehung tieferer Art zwischen Duft und Religion in vielen antiken Völkern hinweisen. Bei diesen allen treffen wir nämlich auf die Vorstellung des „göttlichen Wohlgeruchs“, eine Anschauung, die nicht an eine bestimmte Religion gebunden, sondern eine ganz allgemeine war und ihren Ursprung wohl in der Heilkunst der Priester hat.
Der Wohlgeruch ist bei ihnen ein Merkmal göttlichen Lebens, Zeichen göttlicher Nähe, ja Form der göttlichen Offenbarung. Die besondere Art und Gestalt, die das Vorstellungsleben in den einzelnen Religionen darüber gewonnen hat, werden durch die Art der Gottesanschauung bestimmt; aber immer verdichtet sich in dem Symbol des Duftes, wie in einer verkleinerten Wiedergabe, der lebendige Hauch jeder Religiosität und Gotteserfühlung.
In der jüdischen, alttestamentlichen Vorstellung finden wir, zunächst noch verhältnismäßig schlicht, die. Wohlgerüche als notwendige Begleiterscheinung des Allmächtig-Erhabenen, dem alles Schöne und Edle beigeordnet sein muss. Ihm zu Ehren wurde der Duft köstlicher Würzbaume und Würzsträucher im „Zelte“ geopfert, um ihm den Aufenthalt so angenehm wie menschenmöglich zu machen. Ihm gebührt das heilige Raucherwerk.
Eine ähnliche Vorstellung finden wir bei Henoch in seiner visionären Reise: „… sieben herrliche Berge, einen jeglichen vom anderen verschieden … der siebente überragte, einem Thronsitz ähnlich, alle an Höhe; es bedeckten ihn wohlriechende Bäume. Unter ihnen befand sich ein Baum, wie ich noch niemals einen gerochen habe; weder einer von ihnen noch andere waren ihm gleich. Er verbreitete mehr Duft als alle Wohlgerüche … Da sprach ich: Wie schön ist dieser Baum und wie wohlriechend und lieblich eine Blätter … Darauf antwortete mir Michael, einer von den heiligen und geehrten Engeln: Dieser hohe Berg, dessen Gipfel dem Throne Gottes gleich ist, ist sein Thron, wo der Herr der Herrlichkeit … sitzen wird …, um die Erde mit Gutem heimzusuchen. Diesen wohlriechenden Baum hat kein Fleisch die Macht anzurühren …“
Das Duftsymbol war aber nicht nur in der Gesamtvorstellung vom Paradies als einer göttlichen Stätte mit duftenden Bäumen lebendig, sondern es ist auch im Judentum innig auf die Gottheit selbst bezogen. In dem Leben Adams und Evas heißt es, als Gott und seine Engel das Paradies betreten: „Da bewegten sich alle Blätter des Paradieses, sodass alle Menschen, von Adam geboren, vom Wohlgeruch einschlummerten.“ Und noch deutlicher wird einmal von der Zeit berichtet, da Gott den Messias offenbaren wird (Bar. 29,7 ff.): „An jenem Tage sollen sie (die Menschen) Wunder schauen; denn Winde werden von mir ausgehen, um Morgen für Morgen den Duft der aromatischen Früchte mit sich zu führen.“
Das Bild des Wohlgeruchs als eines Zeichen der göttlichen Offenbarung auf Erden begegnet uns im Urchristentum zum ersten Mal bei Paulus im 2. Korintherbrief (2,14 ff). Hier ist das Bild des göttlichen Duftes nicht mehr Bild der leiblichen Nahe Gottes, wie wir es in der griechischen Religion finden, sondern Gleichnis der Wirkung und Offenbarung des göttlichen Geistes.
Wenn das Duftsymbol in den Anfängen des Christentums auch nur spärlich Leben und Raum gewonnen hat, eo hat es sich in den späteren Jahrhunderten, immer breiter und tiefer die mannigfaltigen, verborgenen Beziehungen seines Sinnes enthüllend, bis weit in das Mittelalter hinein entfaltet, indem es sich wieder mehr und mehr an die Heilkräfte der Natur anlehnte.
An den Ufern des Flusses, in dem einst Johannes der Täufer Jesus taufte und dieses Mysterium für die Menschheit festhielt, an der Stelle, wo die Christussubstanz mit dem Heiligen Geist in die Person des Jesus einströmte, wachst auch heute noch die heilkräftige „Amhapflanze“, ein Gewächs, das schon in vorchristlicher Zeit vom Volke gesammelt wurde und dem seit damals das Mysterium des Ortes eine besondere Kraft gegeben haben soll.
Bei den Griechen hatte man den Begriff des Duftes zu einem wirklichen Symbol erhoben. Der Wohlgeruch ist die eine Form der Epiphanie, in der sich der Gott beim Kommen und Gehen, beim Nahen und Entschwinden offenbart. Alles, was Götter berühren, nimmt an ihrem Dufte teil. Wie die Gewänder der Demeter ambrosischen Wohlgeruch atmen, so tun es die Windeln, in die das Knäblein Hermes gehüllt, oder die Wanne, in der es gebadet wird.
Man geht hier sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass die den Menschen gnädigen Gottheiten an ihrem Wohlgeruch, die menschenfeindlichen an ihrem widrigen Geruch zu erkennen seien. Schon Äschylus bezeugt von den Erynnien, die älter seien als die anderen Götter, dass sie einen giftigen Hauch von sich geben. Ober Lander und Völker hinweg bringen sie Tod oder Krankheit. Man stellt hier eigentlich schon der Heilwirkung des Wohlgeruchs die pathogene Wirkung von übel riechenden Infektionsquellen gegenüber. Eine bekannte Sitte war es bei den Griechen, aus dem Nieaen eines Menschen auf die Gegenwart eines Gottes zu schließen und gemeinsam niederzufallen und anzubeten. Die Blume nun war das äußere Zeichen des Duftsymbols für die Griechen, weil ihr Bild des Lebens zugleich den lebendigen Atem der Natur spüren lässt.
Auch bei den römischen Dichtern ist der Duft ein deutliches, traditionelles Zeichen, an dem man Gottes Gegenwart auf Erden erkennt. Das geht aus einer Stelle bei Ovid hervor:
„Omnia finierat (flora), tenues secessit in auras.
Mansit odor, posses scire fulsse deam.“
Mit der Differenzierung Arzt-Priester wandelte sich die Anschauung von dem Wohlgeruch der Götter, hat flieh nicht selten zu selbstfindiger Bedeutung entwickelt und ist nach menschlicher Analogie erweitert worden.
Ägyptens Religionen ist die Vorstellung vom Wohlgeruch der Götter seit den frühesten Zeiten nichts Ungewohntes. Auf den Wänden des Tempels zu Deir-el-Babari ist eine himmlische Scene dargestellt, die durch folgende Inschrift erläutert wird:
„Ammon verwandelt sich in die Gestalt der Majestät ihres Gemahls, der Majestät ihres Gemahls des Königs von Ober- und Unter-Ägypten; sie (Ammon und Thot) fanden sie, wie sie ruhte in der Schönheit ihres Palastes. Sie erwachte von dem Geruche des Gottes; sie lächelte seiner Majestät zu … Sie freute sich, seine Schönheit zu sehen, seine Liebe ging in ihren Leib, (der Palast) war überflutet von dem Geruche des Gottes; alle seine Düfte waren (Düfte) von Pnut.“
Mannigfach kehrt das Symbol in den religiösen Urkunden des mittleren und neuen Reiches wieder. Aus der Bilderschrift hat man sogar entziffern können, dass Ramses den Göttern Weihrauch von rotem Balsam zur Opferung brachte (also auch kultische Verwendung). Die ägyptische Religion hat den göttlichen Duft nie von wesentlich anderer Art gedacht als den Wohlgeruch eines Menschen. Ein besonderes Moment, das die ägyptische Duftvorstellung von der griechischen unterscheidet, ist der Gedanke eines speziellen Weihrauchduftes der Götter; in Griechenland begegnet uns der Weihrauchduft, so verbreitet auch das Weihrauchopfer selber war, außer im Dionysoskult nie als Symbol der Götter.
Bei den Persern ist der Geruch nur ein Gleichnis unter anderen Gleichnissen für die Götterhervorhebung, ein Bild ohne sinnliche Fülle und ohne lebendige Anschaulichkeit wie in den eben genannten Ländern.
„Ormuzd war lichtglänzend, rein, guten Geruchs, dem Guten ergehen und aller guten Handlungen fähig. Als er in den tiefsten Abgrund hinunterblickte, sah er ... Ahriman, schwarz, unrein, übel riechend, bösartig … Nun erhob sich Ahriman, um den Ormuzd zu bekriegen und … rüstete ein Heer aus dem Unreinen, Finsteren und Übel riechenden, was in ihm war.“
Wichtig iat für den Charakter der persischen Religion die weitere Ausdeutung des Duftsymbols, die nicht ohne Einfluss auf die Anschauungen des Judentums und frühen Christentums geblieben ist. Zunächst wird die Dufttorstellung auf die Anschauung vom Paradies der Seligen und der Hölle der Unseligen übertragen. Die Stätte der Gerechten ist von Wohlgeruch umflossen; Blumen blühen und Winde wehen dort, wohlriechender als alle Winde der Erde. Auch in dieser Symbolik bricht durch die sinnliche Hülle des Bildes der Dualismus der in ihm beschlossenen sittlichen und widersittlichen Grundkräfte durch.
Wie in den ägyptischen Mysterien, so findet sich auch in Indien und Zentralamerika die Überzeugung, dass stets Engel den liturgischen Handlungen des Kultus beiwohnen, aber sich nur dort aufhalten können, wo die Luft mit Wohlgerüchen geschwängert, vorbereitet und ihrem segnenden Einfluss zugänglich gemacht wurde.
Weihrauch, Duftstoffe und Salben in der orthodoxen Kirche
Zweifelsohne übertrug sich manches der jüdischen Gebräuche auf die orthodoxe Kirche, wenn diese auch größtenteils ihre eigenen hatte.
Bei der Weihe einer Kirche, einer Handlung, die bei dem orthodoxen Bekenntnis ausschließlich dem Bischof vorbehalten ist, wird namentlich die Deckplatte des neuen Altars, der nur aus einem einfachen viereckigen hölzernen Tisch besteht, zunächst mit „Nitra“, d. h. mit einer wohlriechenden Seife und warmem Wasser abgewaschen und dann unter Verwendung von Schwämmen vom Bischof selbst, der dabei mit einem Leinengewand über seinem Ornat bekleidet ist, und von den ihm assistierenden Priestern kräftig mit Rosenwasser abgerieben. Außerdem wird, wenn irgend möglich, der Altartisch selbst aus wohlriechendem Holz, meist dem der Zypresse, gezimmert. Zypressenbretter sind es auch, die ob ihres Wohlgeruches als Material für die Herstellung der Heiligenbilder in den orthodoxen Kirchen bevorzugt werden.
Aber noch einer anderen aromatischen Substanz, diesmal schon aus mehreren Stoffen zusammengesetzt, begegnen wir bei der Weihe eines neuen Altartisches. Es ist der so genannte „Wachsmastix“, der aus einer über dem Feuer in einem neuen Gefäß aufgelösten Mischung von weißem reinem Bienenwachs, pulverisiertem Mastixharz (gewonnen aus Einschnitten in die Rinde des heiligen Mastixbaumes), bei Luther „Würze aus Salbe“ übersetzt, Weihrauch aus Smyrna, Aloe, Thymian, Fichtenharz und weißem Weihrauch besteht. Mit dieser Mischung, deren gegenseitiges Mengenverhältnis in den einschlägigen liturgischen Büchern genau angegeben ist, werden, wenn sie dünnflüssig geworden ist und dann eine braune leicht bewegliche Masse bildet, in einem kelchartig gedrechselten kleinen Holzgefäß unterhalb des Altartisches kleine Reliquiensplitter fest vergossen, womit auch die eigentliche Weihehandlung beendigt ist. Darauf wird der Altartisch in die üblichen Decken eingekleidet. Zwar nicht alle Kirchen besitzen einen solchen Reliquienbehälter unter ihrem Altar. Stets aber liegt auf diesem eine zusammenlegbare gelb oder rotseidene Decke mit einer Darstellung der Grablegung Christi, in deren oberen Teil, rückseitig in einer Art kleiner Täschchen, unbedingt Reliquiensplitter in die gleiche Mastixmasse von der Hand des Bischofs fest eingebettet werden. Diese seidenen Decken werden in der griechischen Kirche „Antiminsia“ genannt und entsprechen dem „corporale“ der römischen Kirche.
Ohne ein solches Antiminsion, dessen Gebrauch in die ersten christlichen, Jahrhunderte zurückgeht, darf keine Abendmahls- oder eucharistische Feier begangen werden, und auf dieser auseinander gefalteten Decke stehen dabei Patene und Kelch.
Wegen der recht umständlichen Herstellung des Mastix wird von den Bischöfen bei einer Gelegenheit immer eine ganze Anzahl von solchen Antiminsia geweiht.
Eine andere aus außerordentlichen vielen höchst aromatischen Stoffen bestehende flüssige Substanz, deren sich sowohl die orthodoxe, wie auch die vielen kleineren morgenländischen Kirchen bei ihren heiligen Handlungen, wenn auch in beschränktem Maße und jeweils nur in ganz geringen Mengen, bedienen, ist das heilige „Myron“. In den Wörterbüchern finden wir diesen Ausdruck mit „geweihtes Öl“ oder „Salböl“ wiedergegeben. Etymologisch trifft das jedenfalls nicht zu, denn das griechische Wort myron ist aus dem Hebräischen herübergenommen, wo es in der Form mor (zusammenhängend mit mar - bitter) die Myrrhe als ein dunkelrotbraunes Harz, gewonnen von Balsamodendron myrrha (Linné), in Arabia felix heimisch, bezeichnet. Auch hier ist der Name von einem einzelen und nicht einmal gerade vorherrschenden Bestandteil entnommen und zum Namen des Ganzen geworden. In Wirklichkeit handelt es sich beim heiligen Myron um eine Zusammenstellung von einer ganzen Anzahl flüssiger und fester Duftstoffe, die in der russischen Kirche, über die wir persönlich eingehend orientiert sind, vierundzwanzig betragen, während nach literarischen Angaben z. B. die griechische Kirche Konstantinopels dazu vierzig Substanzen verwendet. Jede dieser Pflanzen ist nun mit einer außergewöhnlichen Heilkraft behaftet und das Ganze befähigt, Wunderkuren zu tätigen, wenn man es als Duftstoff einatmet.
Ebensoviel einzelne Bestandteile soll das heilige Salböl der gregorianisch-armenischen Kirche enthalten, welches aber nicht am Krankenbett zu finden ist, sondern nur bei schon verstorbenen Klerikern gebraucht wird.
Alle diese einzelnen Ingredienzien aufzuzählen, kann hier nicht unsere Aufgabe sein. Wer sich dafür interessiert, sei auf das Buch „Begräbnisritus und einige spezielle und altertümliche Gottesdienste der orthodox griechisch-katholischen Kirche des Morgenlandes“ von dem langjährig an der einstigen kaiserlich russischen Botschaftskirche in Berlin amtierenden Geistlichen Propst Magister Theologiae A. v. Maltzew (Berlin 1898) hingewiesen, wo sich im 2. Teil S. 89 bis 114 der Ritus der Bereitung des Myron in deutscher Sprache findet und die einzelnen Bestandteile angegeben sind. Hier sei nur soviel gesagt, dass die heilige Handlung selbst alljährlich am Montag der Karwoche beginnt und das unaufhörliche Kochen der aromatischen Substanzen, unter denen Wein und Rosenöl eine hervorragende Rolle spielen, bis zum Gründonnerstag dauert.
Während der ganzen Zeit werden bestimmte Abschnitte der heiligen Schrift, entsprechende Gebete, verlesen und hl. Formeln ausgesprochen. Das Feuer unter den Kesseln wird durch den jeweils rangältesten Bischof, in der russischen Kirche der Zarenzeit also durch einen Metropoliten, in der heutigen russischen Kirche und in den selbstständigen Kirchen der orthodoxen Christenheit, soweit diese Letzteren ihr Myron nicht aus Konstantinopel erhalten, durch den Patriarchen angezündet. Die weitere Unterhaltung des Feuers unterliegt alsdann anderen Bischöfen, höheren Klostergeistlichen und auch Weltpriestern.
In Moskau war (heute dürfte das wohl nicht mehr zutreffen) für die Herstellung des heiligen Myrons im historischen Kreml ein eigener mäßig großer Saal ausersehen, der „Myrowarennaja Palata“, d. h. „Myron-Kochkammer“, hieß. Hier standen in einem prächtig verzierten Herde aus Fayence eingemauert drei riesige silberne Kessel von etwa 1,50 m Höhe und dem entsprechenden Durchmesser, in denen die duftenden Stoffe dem langen Herstellungsprozess unterworfen waren.
Nach seiner Beendigung wurde das heilige Myron, in das übrigens stets ein kleines Quantum aus dem vorhergehenden Jahre gegossen wurde, in zwölf prächtige, noch aus dem alten Byzanz stammende Alabasterkrüge von rosenroter, natürlicher Farbe, je etwa 60 cm hoch, gefüllt.
Dann wurden die Krüge von ehrwürdigen alten Geistlichen nach der ebenfalls im Kreml befindlichen „Zwölf-Apostel-Kirche“ getragen. Dort wurden sie am Fuße des Altartisches aufgestellt. Zu sonstigem gottesdientlichem Gebrauch wurde diese Kirche nicht benutzt. Von hier aus wurde das heilige Myron, je nach Bedarf, den einzelnen Diözesan-Bischöfen zugestellt, die es ihrerseits den einzelnen Gemeinde-Geistlichen zuteilten, um dort auch von dem Priester, der gleichzeitig als Arzt füngierte, als Heilmittel verwendet zu werden.
Dies heilige Myron gebrauchte man auch immer bei der Krönung der Monarchen zur Salbung, was allerdings höchst selten stattfand. Man wusste aber, dass der Zar dadurch befähigt wurde, durch Handauflegen Kranke zu heilen, was man übrigens auch von dem gesalbten englischen König kennt.
Sehr wichtig ist auch der kirchliche Ritus der heiligen Myron-Salbung, der unmittelbar nach der Taufe stattfindet und so gewissermaßen der abendländischen Konfirmation oder Firmung entspricht. Hieraus erklärt sich auch, weshalb in der orthodoxen Kirche schon ganz kleine Kinder von ihren Müttern zum Abendmahl gebracht werden.
Im Übrigen ist dann der Gebrauch des Myrons noch auf jenes Sakrament beschränkt, das wir nach römisch-katholischer Parallele als extrema unctio, auf deutsch „letzte Ölung“, bezeichnen könnten, dem aber nach orthodoxer Auffassung eine andere Bedeutung zugrunde liegt. Die armenische Kirche wendet die letzte Ölung nur bei Priestern an, und zwar wenn diese bereits gestorben sind. Bemerkt sei noch, dass der Kampf um das Vorrecht der Herstellung des heiligen Myrons in den orientalischen Kirchen oft zu erbitterten Kämpfen geführt hat, deren Folgen sich stellenweise noch heute fühlbar machen.
Während bei den angeführten kultischen Handlungen, also den Sakramenten, die aromatischen Stoffe als Akzidentien zu gelten haben, denen eine symbolische Bedeutung als Träger geistiger Gnadenmittel zugeschrieben wird, ist es für unsere Zwecke interessant, aus dem Bereich der orthodoxen Kirche auch eine Weihehandlung anführen zu können, bei der aus dem begleitenden Gebet deutlich hervorgeht, wie aromatischen Krautern heilende und schützende Kräfte nicht nur in Übertragung auf das rein religiöse Gebiet zugeschrieben werden, sondern ihr duftendes Fluidum direkt als Heilmittel in medizinischem Sinne bei physischen Leiden, sogar für Vieh, Haus und Hof als Prophylaktikum gegen allerhand Fährlichkeiten und Schädigungen aufgefasst wird. Mit der Anführung dieses kurzen Textes seien auch unsere Erörterungen über den Gebrauch der Aromatika im kultischen Leben der orthodoxen Kirchen geschlossen. Wir geben hier nur noch den Wortlaut dieses Gebetes ungekürzt in deutscher Übersetzung wieder, an Hand seiner auf dem Griechischen fußenden Fassung in einer so genannten kirchenslawischen (paläobolgarischen) Ausgabe des „Trebnik“ (d. h. Agende für Kasualien), Moskau 1902, Teil I. Wir bemerken hierzu, dass von dem gleichen Gebet bereits eine andere deutsche Übersetzung existiert, die unter dem Titel „Gebet zur Segnung wohlriechender Krauter“ in dem von Propst Magister Theologiae A. von Maltzew herausgegebenen und bereits oben erwähnten Buche enthalten ist, und zwar auf Seite 791 ff. Dieses Werk ist heute eine schwer erhältliche bibliographische Seltenheit.
Gebet zur Weihe irgendeines wohlriechenden Krautes
„Herr, Gott Allerhalter, der du durch dein Wort alles erfüllest und der Erde befohlen hast, alle Früchte zu ihrer Zeit hervorzubringen, und sie zur Freude und zum Leben den Menschen gibst! Du selbst, allgütiger Gebieter, segne und weihe durch deinen heiligen Geist auch diese Samenkörner samt den verschiedenen Krautern, die in diesen heiligen Tempel gebracht werden, und diese deine Knechte, die diese Krauter mit dem Samen hinnehmen, reinige sie von allem Makel und erfülle ihre Häuser mit jeglichem Wohlgeruch, auf dass sie ihnen und allen, die sie im Glauben bewahren und denen, die mit ihnen räuchern, zur Bewahrung gereichen, zur Befreiung von allen feindlichen Anschlägen und zur Abwehr jeglicher Anfechtung, die vom Treiben des Teufels am Tage und in den Nächten kommt, zum Segen aber deinem getreuen Volk an Seele und Leib und dem Vieh und auch denen, die zum Hause ehören und den Stätten. Auf dass alle, die diese Krauter ebrauchen, sich Schutz der Seele und des Leibes erwerben, und auf dass deiner Gnade Geheimnis (Sakrament Mysterium) unserer Erlösung zur heiligen Arznei werde, damit, an welcher Stelle es auch immer niedergelegt, und wo es auch immer gebraucht werde, um Segen zu empfangen, deine Rechte, nachdem die gegnerische Kraft von dort verjagt, alles bedecke zur Herrlichkeit deines alleinigen, majestätischen und allverehrten Namens, dem da gebührt alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung mit dem Vater und dem heiligen Geiste jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten! -
Amen.“
Darauf werden die Krauter in Kreuzesform dreimal mit Weihwasser besprengt.
Schließlich sei hier auch noch, um unsere Angaben über die Verwendung der Aromatika im Kultus der orthodoxen morgenländischen Großkirche durch ein Beispiel aus einer heute ziemlich unbedeutenden christlichen Sondergemeinschaft des ägyptischen Kulturkreises zu ergänzen, eines merkwürdigen Brauches gedacht, dem wir bei den Kopten begegnen. Dort herrscht nämlich in weiten, wenn auch nicht allen Volksschichten die Überzeugung, man könne, eine Vergebung seiner Sünden erlangen, wenn man, auch ohne dass ein Priester, dem doch sonst allein die Absolutionsgewalt zusteht, dabei zugegen zu sein braucht, Weihrauch anzünde und vor den emporsteigenden wohlriechenden Dämpfen seine Sünden bekenne. Es wird also nach dieser Auffassung den Duftstoffen eine in religiösem Sinne reinigende Kraft beigemessen. Wir haben es folglich in diesem Falle mit einer Vorstellung zu tun, die gewissen Prinzipien der magischen Riten des Schamanismus und der ihm verwandten Weltanschauung nahekommt.
Dr. Steiner, der Gründer der anthroposophischen Bewegung, hat eine kultische Handlung geschaffen, die wir bei der Christengemeinschaft als Menschen-Weihehandlung kennen. Der Oberlenker dieser Christengemeinschaft ist der durch seine bedeutenden Werke weltbekannte Theologe Dr. Rittelmeyer. Dieser Gemeinschaft gehören hervorragende Gelehrte an, wie z. B. Professor Herm. Beckh, Lizentiat Emil Bock, Dr. Johannes Hemleben u. a.
Bei dieser Menschen-Weihehandlung die aus Kreisen hervorgegangen, die eigentlich der protestantischen Kirche nahe stehen, wird Räucherwerk verbrannt. Dr. Steiner war der Ansicht, dass zu jeder kultischen Handlung wie zu jeder Heilung Räuchern gehört. Mir selbst bestätigte er, dass er Düfte- und Räucheranwendung zu Heilzwecken für das älteste, aber zugleich zukunftsreichste Anwendungsgebiet halte.
Duft- und Riechstoffe im Kultus des Buddhismus
Wir wollen jetzt in einem anderen Kultus den duftenden Spuren aromatischer Substanzen nachgehen und den Buddhismus betrachten, aus dessen Gedankengut ja auch manches in den jüdischen Traditionen vorkommt. Der Buddhismus ist zu einer Art Modereligion unserer Zeit geworden, und ja wird viel über seine Lehre geschrieben. Wir haben hier nicht die Lebensäußerung jenes Lehrsystems im Auge, auch nicht seine praktische Anwendung, wie sie einst Gautama Buddha prägte und wie sie heute in den buddhistischen Gemeinschaften verbreitet ist.
Wir müssen aber feststellen, dass Buddha selbst jeder kultischen Verehrung ablehnend gegenüberstand, weil seine Lehre, wenn sie auch dem einzelnen anheimstellte, mit der Existenz von Gottheiten zu rechnen, diesen Gottheiten selbst aber in Hinblick auf das Endziel des Strebens aller Lebewesen, die Buddhaschaft, nur eine recht untergeordnete Rolle zuwies.
Der ursprüngliche Buddhismus war gar keine Religion in unserem Sinne, sondern war atheistisch, solange er rein und unverfälscht war. Seine Ausbreitung ist, besonders in den nördlichen Schulen bei den Chinesen, den Tibetanern und Mongolen, also im Lamaismus, eine gewaltige gewesen. Aber überall sollte sich aus dieser gottlosen Doktrin oder Lebensweisheit, gewissermaßen wie eine Ironie des geschichtlichen Schicksals, eine Religion im ausgeprägten Sinne dieses Wortes bilden. Der ursprünglich götter-, ja gottleere Himmel des Buddha hat sich nach und nach zu einem Pantheon ersten Ranges angefüllt, sodass er an Reichhaltigkeit von keinem anderen Himmel bekannter Religionen erreicht wird. Es gehören dazu neben den eigentlichen Göttern die gedachten Buddhas, die Heiligen, die Engel, die Feen, Dämonen, Schutz- und Ortsgenien und die machtvollen Zauberer der Tantra-Systeme. Nur noch der mexikanische Olymp, der alleine 400 Pulque-, d. h. Schnapsgötter, kennt, könnte sich mit solchem Reichtum messen.
Den Keim zur Schöpfung dieses buddhistischen Pantheons und damit überhaupt zu einem Kultus bildet die Gestalt des Gautama Buddha, und hier treten auch die Wohlgerüche und Duftstoffe sogleich in ihre Rechte. Dies muss umsomehr befremden, als der Meister selber, vor dessen Statuen heute Weihrauch verbrannt wird, gerade den Verzicht auf den Gebrauch von Duftstoffen von seinen Anhängern forderte.
So lesen wir in Olcotts buddhistischem Katechismus (Lit.-Verz.) unter der Zahl der von einem Laien auf sich genommenen Verpflichtungen: „Ich beobachte das Gebot, mich allen Schmuckes, wohlriechender Mittel, Spezereien und allen Zierrates zu enthalten.“ Wenige Seiten später können wir uns aber in demselben Buch davon überzeugen, dass das Opfer von Blumen, Weihrauch und wohlriechenden Kerzen vor dem Buddhabild als durchaus anerkennenswertes Verhalten für den Gläubigen angesehen wird.
Wenige Schritte von meinem Haus an der nördlichen Peripherie Berlins entfernt, konnte ich mich im buddhistischen Tempel von Frohnau selber davon überzeugen, dass das Standbild Buddhas mit würzigen Blumen und im Winter mit duftenden Tannenzweigen geschmückt war. Oben auf einem der Höfe steht ein großer metallener Kessel aus Bronze, der aus einem japanischen Tempel stammte, und nur zur Riechstoffverflüchtigung gebraucht wurde.
Geschichtlich betrachtet ist dieser Gebrauch von Riechstoffen darauf zurückzuführen, dass man in alten Zeiten in Indien die Mahârâjas, wenn sie ein Haus betraten, dadurch ehrte, dass man wohlriechende Blumen vor ihren Sitz streute, Riechstoffe verbreitete und dem weltlichen Herrscher zu Ehren aromatisches Räucherwerk entzündete. Dies wurde auch auf den, Herrscher der Religion „Dharmarâja“, wie Buddha später genannt wurde, übertragen, um bald im allgemeinen Kultus Eingang zu finden. Daher erklärt es sich, dass wir auf den bildlichen Darstellungen des buddhistischen Pantheons vor der Hauptfigur schwelende Weihrauchgefäße finden, besonders ausgeprägt auf den Gemälden in Tibet und in der Mongolei, also im Gebiet der sogenannten lamaistischen Kirche. Im Tempel vor den metallischen oder aus Holz gefertigten, meist vergoldeten Statuen tritt an ihre Stelle ein wirkliches Weihrauchgefäß.
So weiß der bekannte Asienforscher Dr. Wilhelm Filchner in seinem wertvollen und überaus lehrreichen Werk „Kumbum Dschamba Ling“, das Kloster der hunderttausend Bilder Maitreyas, in welchem er das Leben und Treiben in einer der Hochburgen des Lamaismus im östlichen Tibet aufgrund seiner letzten Reise 1926/28 eingehend schildert, von einer ganzen Reihe solcher Weihrauchgefäße in den einzelnen Tempeln des genannten Klosters zu berichten. Aus den begleitenden, eingehenden Schilderungen, unterstützt durch schöne Aufnahmen und detaillierte Handzeichnungen, erfahren wir, dass sich die lamaistische Kunst gerade dieser Weihrauchgefäße mit besonderer Liebe angenommen hat. Sie bestehen aus kostbaren Metallen, sind oft genug mit Edelsteinen besetzt und erreichen manchmal sehr ansehnliche Ausmaße. Unzertrennlich davon sind die ebenso schönen Weihelampen, in denen nicht nur die landesübliche ungesalzene Butter, sondern oft auch sehr wohlriechende Öle als Brennstoff dienen.
Daneben befinden sich auf den Altären in besonderen Behältern Räucherstäbchen mit mannigfaltigen Aromatika durchtränkt. Diese Weihrauchgefäße und Räucherstäbchen brennen in den Heiligtümern, werden ständig unterhalten und dürfen niemals erlöschen. Selbst die Asche der Räucherstäbchen wird später sorgfältig gesammelt und medizinischen Präparaten beigemischt. Diese Gepflogenheiten finden wir nicht nur in den Lamatempeln der Mongolei und Tibets, sondern bei allen Buddhisten, ja sogar bei den Taoisten in China, und es ist nicht ausgeschlossen, dass der Lamaismus erst von dort den Gebrauch der Aschkästen für die Reste der Weihrauchkerzen übernommen hat. Andererseits ist es bezeichnend, dass nach einer Mitteilung des verstorbenen russischen Spezialforschers auf lamaistischem Gebiet, Prof. Pozdnejev, der Gebrauch von Räucherkerzen chinesischer Herkunft in Lamaklöstern und Tempeln, die im chinesischen Gebiet und im Bereich chinesischen Einflusses liegen, durch die höhere Geistlichkeit untersagt wurde, da die Befürchtung bestand, dass bei den wechselseitigen Beziehungen der Lamas und Chinesen die strengen Vorschriften gelockert oder missachtet würden.
Hinsichtlich der Räucherkerzen, die auf den Altären der lamaistischen Tempel brennen bzw. glimmen und die auch bei den Prozessionen gebraucht werden, gibt es ganz besondere Anweisungen für die Herstellung. Eine solche Räucherkerze oder eines der beschriebenen Räucherstäbchen wird in der Kultursprache des Lamaismus „Dug-boi oder Dugbö“ genannt.
Beide Silben bedeuten in wörtlicher Übersetzung ja dasselbe nämlich, Räucherwerk. Wir sind auch nach anderen Beispielen in der tibetanischen Sprache berechtigt, die Silbe „Dug“ als eine Abkürzung des Wortes „Dugsching“ aufzufassen, womit eine Abart des Wacholderbaumes bezeichnet wird, den Botaniker nach einer Angabe im tibetanischen Wörterbuch des Inders Sarat Chandra Das mit Juniperus excelsus benennen.
Dieses Strauchgewächs muss aber nach indisch-tibetanischer Auffassung infolge seiner Riechstoffe als Spender des Wohlgeruchs für kultische Zwecke „par excellence“ gelten. Das wird noch mehr einleuchten, wenn wir in Betracht ziehen, dass die Hindus dieses Gewächs im heiligen Sanskrit als „Devadara“ bezeichnen. Von den Mongolen, die auch als Bekenner des Lamaismus gelten, wird das Räucherstäbchen „Kudschi“ genannt. Diese dünnen Räucherstäbchen oder Räucherkerzen bestehen aus einer verhärteten, harzigen Masse, die wohl nach den Angaben fachkundiger Forscher (so z. B. Przewalski) manchmal die ansehnliche Höhe von drei Metern erreichen. Die im lamaistischen Kultus verwandten Kerzen dürfen keinen Moschusgeruch abgeben, weil solchen die Eidechsen und Schlangen nicht vertragen und dadurch aus den Tempeln vertrieben werden könnten.
Um auch sonst nicht Anlass zur Vernichtung kleiner Lebewesen in den Tempeln durch Räucherkerzen zu geben, halten sie die lamaistischen Mönche in der warmen Jahreszeit unter einer Laterne, wie das Filchner in seinem Buch angibt. Da die buddhistische Grundregel vorschreibt, kein Lebewesen zu schädigen, hat sich auch der Lamaismus diese Vorschrift gegeben, und auf sie dürfte vielleicht auch noch das erwähnte Verbot chinesischer Kerzen zurückzuführen sein, da zu deren Herstellung Talg, also ein tierisches Fett, benutzt wird, das nur mit einer dünnen Wachsschicht überzogen wird, infolgedessen die Kerzen auch stark qualmen und einen hässlichen Niederschlag auf den Altarfiguren hervorrufen.
Neben den Räucherkerzen und den erwähnten Gefäßen kennt der Lamaismus auch das bei den Katholiken gebräuchliche Weihrauchfass, das sich in meiner Form und Ausführung nur wenig von diesem unterscheidet, nur dass es etwas plumper und grober gearbeitet ist. Aber auch im weltfremden Tibet kennt man elegante Ausführungen von Kultgefäßen. So berichtet Austin Waddell, ein Teilnehmer der bekannten englischen Expedition nach der Hauptstadt des verschlossenen Landes, in seinem Buche „Lhasa and its Mysteries“, dass der Dalai Lama in einer Pariser Juwelierwerkstatt goldene Weihrauchgefäße habe herstellen lassen. Auch findet man dort allerlei Gerät aus Pforzheim, dessen Stempel ja unverkennbar ist.
Der unterschied in dem Gebrauch des Räuchergerätes besteht darin, dass der amtierende Mönch dieses nicht, wie bei den Katholiken, an der Kette schwingt, sondern dass er sich dabei einer kurzen Stange bedient. Verbrannt werden im Weihrauch des lamaistischen Kultus verschiedene Harzarten, die mit einer allgemeinen Bezeichnung von den Tibetanern Dug-ba oder auch Ssang genannt werden. Interessant ist, dass die Mongolen, welche den tibetanischen Ausdruck in ihre Sprache übernommen haben, ihm noch das rein mongolische Idên, das Nahrung oder Speise bedeutet, anhängen. Also der brennende Weihrauch gilt für die Gottheit als Genussmittel, als Speise.
Der ganze, halb tibetanische, halb mongolische Ausdruck lautet: Ssang-un Idên. In den mongolischen Klöstern, die sich den Luxus echten Weihrauchs in Harzform nicht leisten können, finden wir ebenso wie bei den Israeliten wohlriechende Krauter, die nach astrologischen Regeln gesammelt und in getrocknetem und pulverisiertem Zustand verbrannt werden.
Das an Ketten hängende Weihrauchfass wird bei den Tibetanern Boi-por oder Bö-por genannt, was nach seiner sprachlichen Auflösung „Weihrauch-Schale“ ergibt. (Die Mongolen gebrauchen dasselbe Wort.) Der Ausdruck:
„vor den Göttern Weihrauch aufsteigen lassen“ lautet in der tibetanischen Sprache; Lha-la pö-dschi dug-ba (mongolisch Tenggri-dür anggilachu). Es sei uns verstattet, hier noch auf eine andere Redewendung hinzuweisen, die man (nach Sarat Chandra Das) oft in der tibetanischen Literatur antrifft) ssang ssel, d. h.: „Weihrauch vertreibt die Befleckung“. Wir haben es also mit einer ähnlichen Auffassung von der Wirksamkeit des Weihrauches zu tun, wie wir sie schon in jenem Gebrauch der koptischen Christen kennenzulernen Gelegenheit hatten, bei dem der Gläubige seine Sünden vor brennendem Weihrauch aufzählt und dadurch Vergebung davon erlangt.
Dies hat, nach Bischof Leadbeater, seine Berechtigung, da sich unsere Sünden und Verfehlungen im Astralkörper widerspiegeln und alsdann durch Riechstoffe, die astrale Wirkung haben, eliminiert werden. Schließlich sei auch noch erwähnt, dass der Lamaismus eine eigenartige religiöse Handlung kennt, bei der übelduftende Weihrauchkerzen zur Verbrennung gelangen. Es ist das ein Ritus, bei dem durch die magische Macht eines mit besonderen tantristischen Fähigkeiten und Kenntnissen begnadeten Lamas in eine Teig-Suppe von menschlicher Gestalt, oder auch in einen Opferkuchen, alle Sünen der betreffenden Klostergemeinschaft hineingebannt werden. Dünste, die von übel riechenden, brennenden pflanzlichen Substanzen aufsteigen, hüllen bei diesem Ritus das Teiggebilde ein. Seine Vernichtung erfolgt immer außerhalb der Klostermauern, und die Mönche, welche das Opfer dorthin tragen, binden ein feines Netz um ihren Mund, um nicht durch die unberechenbaren Ausdünstungen des unheilschwangeren Teiggebildes seelisch und leiblich geschädigt zu werden. An Ort und Stelle angelangt, wird das Opfer, wenn es in einer menschlichen Figur besteht, zerstückelt, und die Brocken werden einzeln in die Steppe geworfen oder verbrannt.