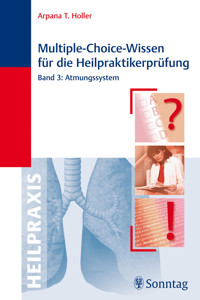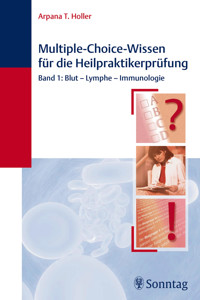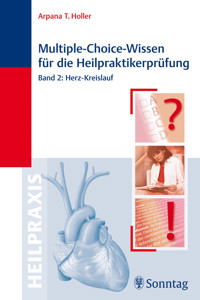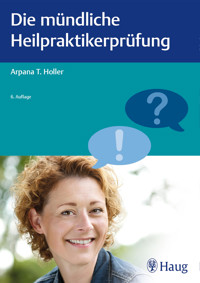
49,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haug Fachbuch
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie erkennen Sie einen Spontanpneumothorax? Was genau passiert bei einem Herzinfarkt? Wozu brauchen wir eine Milz?
Für Sie als angehenden Heilpraktiker ist die mündliche Überprüfung durch den Amtsarzt eine wichtige Hürde. Anders als in der schriftlichen Prüfung reicht reines Faktenwissen dafür nicht aus. Wichtig ist die richtige Mischung aus souveränem Auftreten, Grundlagenwissen und verständlichem Formulieren.
Dank der fast 500 Original-Prüfungsfragen und den dazugehörenden Musterantworten
- formulieren Sie selbst komplizierte Sachverhalte verständlich und faktensicher
- haben Sie ein Gefühl dafür, welche Kenntnisse den Prüfern in der Heilpraktikerprüfung besonders wichtig sind
- erlangen Sie die nötige Selbstsicherheit und antworten souverän.
Mit Prüfungsdialogen, in denen neben der Einstiegsfrage auch im Verlauf vom Prüfer gestellte Nachfragen abgebildet sind, haben Sie auch kritische Prüfungssituationen im Griff.
Gehen Sie angstfrei in die mündliche Prüfung. Überzeugen Sie anspruchsvolle Prüfer von Ihrer Eignung für den Beruf des Heilpraktikers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Die mündliche Heilpraktikerprüfung
Arpana Tjard Holler
6., aktualisierte Auflage
Vorwort zur 6. Auflage
Das Buch „Die mündliche Heilpraktikerprüfung“ hat sich etabliert und findet sich – nach Erzählungen von ehemaligen Prüflingen – auf dem Tisch einiger Prüfer, was mich sehr freut. Für die 6. Auflage habe ich den gesamten Text wieder durchgesehen, verbessert und ergänzt.
Die teilweise negative Diskussion über den Beruf der Heilpraktiker in der Presse hat dazu geführt, dass sich das Niveau der schriftlichen wie auch der mündlichen Prüfung gesteigert hat. Ich bin seit fast 25 Jahren hauptberuflich damit beschäftigt, Heilpraktikeranwärtern das medizinische Wissen zu lehren, das erforderlich ist, um bei der Tätigkeit des Heilens keine Gefahr für die Allgemeinheit zu sein. Das schließt neben dem Verständnis über die Anatomie, Physiologie und Pathologie des menschlichen Körpers vor allem das Erkennen von gefährlichen Erkrankungen mit ein. Beispiele sind das Erfragen von zurückliegenden Traumen bei starken Kopfschmerzen, um eine Sub- oder Epiduralblutung auszuschließen, das Erkennen einer Epiglottitis bei Säuglingen oder Kleinkindern, das Erkennen einer zweizeitigen Milzruptur bei einem Kind und das Erkennen noch vieler anderer lebensgefährliche Erkrankungen, die ein Heilpraktiker kennen muss – so wie auch der Arzt diese kennen muss.
In der schriftlichen und vor allem in der mündlichen Heilpraktikerprüfung wird das Vorliegen dieser Kenntnisse überprüft. Ein Heilpraktikeranwärter, der diese Prüfungen besteht, ist keine Gefahr für die Allgemeinheit. Er ist sich seiner Verantwortung den Patienten gegenüber bewusst. Ein Heilpraktiker besitzt eine Sorgfaltspflicht, so wie der Arzt sie auch besitzt. Aus dieser Sorgfaltspflicht heraus wird er seinen Patienten vor der Heilbehandlung medizinisch untersuchen lassen. Er lässt sich den medizinischen Befund zeigen und informiert sich über den körperlichen Zustand. Meiner Meinung nach ergänzen sich Ärzte und Heilpraktiker sehr gut, weil der Heilpraktiker Dinge leisten kann, die ein Arzt nicht leisten kann und umgekehrt ein Arzt Dinge leisten kann, die ein Heilpraktiker nicht leisten kann. Zum Beispiel hat ein Heilpraktiker mehr Zeit, mit dem Patienten zu reden. Dem Arzt fehlt sie oft. Andererseits kann der Arzt wichtige Medikamente verschreiben und apparative Untersuchungen oder Operationen durchführen. Dem Heilpraktiker sind diese Maßnahmen verwehrt.
Nümbrecht November 2017
Arpana Tjard Holler
Vorwort zur 1. Auflage
Die mündliche Heilpraktiker-Überprüfung durch den Amtsarzt des zuständigen Gesundheitsamtes erfolgt erst nach erfolgreicher Teilnahme der schriftlichen Überprüfung. Der Zeitraum vom Erreichen des positiven Prüfungsergebnisses der schriftlichen bis zum Termin für die mündliche Prüfung variiert je nach Gesundheitsamt sehr stark. Dem zuständigen Gesundheitsamt ist es überlassen, die Termine je nach Auslastungsmöglichkeit festzulegen. Dabei entstehen Zeiträume von 2 Wochen bis 6 Monaten. Der in etwa zu erwartende Termin ist in der Regel bei den zuständigen Gesundheitsämtern oder bei den örtlichen Heilpraktikerschulen zu erfragen.
Der mündliche Prüfungstermin ist vor allem abhängig von der Zahl der Prüflinge, die die schriftliche Prüfung bestanden haben sowie von der möglichen Prüfungskapazität des Gesundheitsamtes und meist auch von dem Anfangsbuchstaben des Familiennamens. In vielen Gesundheitsämtern wird nach Alphabet geprüft, von A bis Z, manchmal auch in umgekehrter Reihenfolge, manchmal ist es sogar möglich, einen Terminwunsch zu äußern. Letztlich ist zu raten, die endgültige Vorbereitung für die Mündliche schon vor der Schriftlichen anzugehen, es sei denn, die Erfahrung mit dem zuständigen Gesundheitsamt zeigt, dass genügend Zeit nach der schriftlichen Prüfung zur Verfügung steht, um sich detailliert auf die mündliche Prüfung vorzubereiten, wie z.B. in Heilbronn, wo seit Jahren erst 4–6 Wochen nach dem Termin der schriftlichen mit der mündlichen Überprüfung begonnen wird. Das kann sich allerdings jederzeit ändern.
Die mündliche (wie auch die schriftliche) Amtsarztprüfung ist in der Durchführungsverordnung zum „Gesetz für die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung“ (Heilpraktikergesetz) geregelt. Diese sind je nach Bundesland unterschiedlich ausgelegt, unterscheiden sich jedoch im Inhalt nur geringfügig. So sind die Prüfungsthemen, auf die sich die Überprüfung erstreckt, in allen Bundesländern gleich: Gesetzeskunde, grundlegende Kenntnisse der Anatomie und Physiologie, grundlegende Kenntnisse der allgemeinen Krankheitslehre und der Pathophysiologie, Erkennung und Erstversorgung akuter Notfälle und lebensbedrohlicher Zustände, Praxishygiene (Desinfektion, Sterilisation), Grundkenntnisse der Diagnostik (IPPAF), Injektionstechniken, Kenntnisse wichtiger Laborwerte.
In der mündlichen Prüfung sind in der Regel ein Amtsarzt als Vorsitzender und ein oder zwei Beisitzer, meist vom örtlichen Heilpraktikerverband, zugegen. Die Prüfung sollte während der Sitzung aufgezeichnet werden (in der Durchführungsverordnung festgelegt). In meiner mündlichen Prüfung 1989 in Essen hat der Amtsarzt nur die Begrüßung und die Fragen zur Gesetzeskunde auf sich genommen und anschließend das Feld den beiden Heilpraktikerinnen überlassen, die mir dann die entscheidenden Fragen zur Anatomie, Physiologie und Pathologie stellten. Das scheint aber inzwischen die Ausnahme zu sein. In den meisten Gesundheitsämtern ist der Amtsarzt die bestimmende Kraft und stellt auch die Fragen.
Der Amtsarzt hat den Auftrag zu überprüfen, ob der Heilpraktiker-Anwärter eine Gefahr für die Volksgesundheit (allgemeine Bevölkerung) darstellt. Dies ergibt sich nicht nur aus den Antworten der ihm gestellten Fragen, sondern auch aus dem Benehmen, Verhalten und Auftreten des Anwärters. An erster Stelle ist die Selbstsicherheit des zu Prüfenden zu nennen, die vom Amtsarzt erwartet wird, die allerdings begleitet werden kann von der Aufregung und Nervosität, die durch die enorme Anspannung entsteht, das in Jahren gesammelte Wissen auf Knopfdruck parat haben zu müssen.
Die Überprüfung „ist keine Prüfung im Sinne einer Leistungskontrolle zur Feststellung einer bestimmten Qualifikation“ (Originalsatz aus den Durchführungsverordnungen). Der Amtsarzt will vielmehr durch seine Fragen und die darauf erbrachten Antworten eine Bestätigung erhalten, ob er ruhigen Gewissens dem Prüfling die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde erteilen kann. Das gelingt nur, wenn der Prüfling in der Lage ist, dem Amtsarzt durch sein Auftreten zu vermitteln, dass er die Pflichten und Grenzen eines im medizinischen Bereich Handelnden kennt. Dazu gehört nicht so sehr das Abspulen des erlernten Wissens, sondern eher das Aufzeigen sicherer Kenntnisse zur Anatomie und Pathologie. Ein vergessenes Symptom oder eine Ursache einer Krankheit, die einem nicht mehr einfallen will, wird daher kaum ein Grund sein, die Prüfung nicht zu bestehen. Letztendlich ist auch der Behandelnde in der Praxis nicht davor gefeit, Informationen zu vergessen bzw. nicht zur Hand zu haben, dafür sind Wörter- bzw. Lehrbücher oder Checklisten geeignet.
Hinsichtlich des Auftretens des Prüflings in der mündlichen Amtsarztprüfung möchte ich an zweiter Stelle Demut nennen. Damit ist nicht die von vielen unterstellte Unterwürfigkeit gemeint, sondern Bescheidenheit und Fügsamkeit. Wer nicht in der Lage ist, diese Eigenschaften vor dem Amtsarzt zu zeigen, kann nicht erwarten, von diesem die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde zu erhalten. Denn diese Eigenschaften sind genauso unentbehrlich im Umgang mit Menschen in der Praxis. Abgesehen davon ist der Amtsarzt in der mündlichen Überprüfung der „Boss“ und es ist daher völlig unangebracht, in dieser Situation eine gewisse Kampfbereitschaft zu zeigen oder über übliche Grenzen hinauszugehen. Das Zeigen eines rebellischen Widerstands gehört definitiv nicht in die Prüfungssituation sondern in eine Therapiesitzung. Wer trotzdem anderer Meinung ist, wird die Prüfung nicht bestehen.
An dieser Stelle sei auch die „entsprechende“ Kleidung erwähnt, der sicherlich eine Bedeutung zukommt. Das Tragen einer schwarzen Lederhose in der Prüfung, wie sich das einer meiner männlichen Schüler in Stuttgart zutraute, wird meist als Provokation aufgefasst und ist nicht geeignet. Dieser Schüler bekam nicht die Erlaubnis, obwohl er einen Wissensstand aufwies, der dem eines Lehrers gleich kam. Ebenso ist von einer übermäßig betonten Aufmachung abzuraten.
Vom Gesetzgeber wird in den letzten Jahren der Versuch unternommen die Heilpraktikerprüfung immer mehr zu zentralisieren, so bei der schriftlichen Prüfung, die zurzeit in zehn Bundesländern zum gleichen Termin zweimal im Jahr stattfindet (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt). Auch bei der mündlichen Überprüfung gibt es die Bestrebung den Fragenkatalog zu vereinheitlichen. Praktisch sieht das so aus, dass dem Amtsarzt die Fragen und Antworten auf einer Liste vorliegen und diese für die Prüfung relevant sind. Jedoch wird noch in vielen Gesundheitsämtern nach eigener Nase geprüft und hier ist es wichtig, die „Eigenarten“ des Prüfers zu kennen. So prüft z.B. ein ehemaliger Dermatologe gerne Hauterkrankungen und zeigt z.B. Bilder mit bestimmten Hauterscheinungen, die vom Prüfling kommentiert werden müssen. Von einigen Amtsärzten werden nach wie vor nummerierte Anatomiezeichnungen zur Bezeichnung und zum Kommentieren vorgelegt, andere wiederum fragen nach der Durchführung von Injektionen oder Details zur Blutsenkungsgeschwindigkeit und stellen dementsprechend Material zur Verfügung. Beim „Spritzen“ erhält man bspw. einen Apfel, oder wenn vorhanden einen Plastikarm, in den unter Berücksichtigung der Hygiene hineingespritzt werden muss, und es gibt sogar Fälle, in denen ein menschlicher Proband zur Verfügung stand! Die Informationen über Prüfungseigenheiten der verschiedenen Amtsärzte liegen den örtlichen Heilpraktikerschulen vor.
Das bekannte Nord-Süd-Gefälle in Deutschland besteht nach wie vor. So wird z.B. im Norden viel mehr zur Anatomie gefragt, während im Süden fast nur noch Pathologie und Untersuchungsmethoden gefragt werden. Trotz allem kristallisiert sich in den letzten Jahren immer mehr heraus, welcher Schwerpunkt in der mündlichen Heilpraktikerprüfung gesetzt wird. Dieser Entwicklung kann ich in diesem Buch gerecht werden. Ich habe einen Pool von mündlichen Fragen gesammelt, die aus Aufzeichnungen von Schülern aus ganz Deutschland stammen und die meiner Meinung einem Basiswissen entsprechen und die den Anforderungen der mündlichen Amtsarztprüfung standhalten. Jedoch ist es immer ratsam, die schriftlichen Aufzeichnungen von Schülern aus vorhergegangenen mündlichen Überprüfungen des jeweiligen Gesundheitsamtes zu lesen, um auf die „Eigenarten“ der Prüfer vorbereitet zu sein.
In vielen Gesundheitsämtern werden meist zu Beginn die gesetzlichen Grundlagen gefragt (HPG, IFSG, Verbote des Heilpraktikers), und vom Prüfling wird erwartet, dass er diese ausnahmslos weiß und sie auch mit Entschlossenheit darlegt. Diesen Part habe ich nicht mit im Fragenkatalog eingeschlossen, da die Gesetze in jedem Lehrbuch aufgelistet zu finden sind und ohnehin auswendig gelernt werden müssen.
Im nachfolgenden Fragenkatalog sind die wichtigen Begriffe in den Antworten fett gedruckt hervorgehoben, um das minimal geforderte Wissen aufzuzeigen. Um der Realität der Prüfung gerecht zu werden, habe ich die Fragen nicht nach Themen geordnet, sondern sie so dargestellt, wie sie von den Schülern aus dem Gedächtnis aufgeschrieben worden sind, jedoch um der Ordnung willen in drei Themen unterteilt: in Anatomie und Physiologie, in Pathologie und in Untersuchungen.
Zu guter Letzt möchte ich noch den Ablauf der mündlichen Amtsarztprüfung vorstellen:
Die Prüfung dauert 40 bis maximal 60 Minuten und in den meisten Fällen herrscht eine freundliche Atmosphäre. Nach Begrüßung durch den Amtsarzt bzw. Amtsärztin erfolgt die Vorstellung der anwesenden Personen. Häufig beginnt die Fragerei mit der Bitte, etwas über den eigenen beruflichen Werdegang und den Entschluss, Heilpraktiker zu werden, zu berichten. Danach wird das Abfragen des erlernten Wissens in Angriff genommen. In der Regel ist der Prüfer hilfsbereit; wird eine von ihm erwartete Antwort nicht erbracht, so wird meist über weitere Fragen versucht, diese vom Prüfling zu erhalten. Jedoch ist nicht immer mit positivem oder negativem „Feedback“ zu rechnen. Sind die Antworten immer richtig, kann es schon mal sein, dass der Prüfer die Wissensgrenze testen möchte und „tiefer“ fragt und erst durch ein „weiß ich nicht“ befriedigt ist.
Tipp: Nicht zu arg auftrumpfen, eher bescheiden und ehrlich bleiben. In vielen Gesundheitsämtern wird nach Beendigung der Befragung der Antragsteller gebeten, einen Moment aus dem Raum herauszugehen und die Beratung des Prüfungsvorsitzenden mit den Prüfungsbeisitzern abzuwarten. Nachdem der Prüfling erneut hereingerufen wurde, wird er meist befragt wie er sich selber einschätze. Danach wird die (positive) Entscheidung mitgeteilt.
Bei plötzlicher Erkrankung, Auftreten eines akuten Pflegefalls oder plötzlichem Tod der Angehörigen kann durch Nachweise, z.B. bei Krankheit durch ein ärztliches Attest, der Termin zur mündlichen Überprüfung durch den Amtsarzt verschoben werden.
Ich wünsche allen ein angenehmes Prüfungserlebnis!
Köln, Frühjahr 2002
Arpana Tjard Holler
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 6. Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
Teil I Anatomie, Physiologie und Hygiene
1 Fragen zu Anatomie, Physiologie und Hygiene
Teil II Pathologie
2 Fragen zu Pathologie
Teil III Untersuchung und Fallbeispiele
3 Fragen zu Untersuchung und Fallbeispiele
Teil IV Anhang
4 Paragraphen 6 und 7 des Infektionsschutzgesetzes (IFSG)
5 Fragenverzeichnis
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
Teil I Anatomie, Physiologie und Hygiene
1 Fragen zu Anatomie, Physiologie und Hygiene
1 Fragen zu Anatomie, Physiologie und Hygiene
Frage 1
Wie ist die Funktion und Aufgabe der Venenklappen?
Die Venenklappen sind ähnlich wie die Taschenklappen im Herzen aufgebaut und befinden sich in den meisten Venen, v.a. aber in der unteren Körperpartie.
Die Venenklappen wirken wie Einwegventile und sorgen so, zusammen mit der Muskelpumpe und der arteriellen Pulsation, für den Rücktransport des venösen Blutes zum rechten Herzen.
Frage 2
Wie wirkt die Muskelpumpe?
Die Muskeln befinden sich zusammen mit den Venen in einem nicht dehnbaren Muskelsack, so dass die Venen bei Kontraktion der Muskeln zusammengepresst werden und das Blut aufgrund der sich nur nach oben öffnenden Venenklappen in Richtung Herz befördert wird.
Frage 3
Wirkt die Muskelpumpe auch im Stehen?
Nein. Die erhöhte Kontraktion der Wadenmuskulatur führt nicht zur Pumpbewegung des Blutes. Das entsteht bei den tiefen Beinvenen durch die arterielle Pulsation, da die Beinvenen parallel zu den jeweiligen Arterien verlaufen und die arterielle Pulswelle die benachbarte Venenwand eindrückt und so zur Pumpbewegung verhilft.
Frage 4
Was sind Herztöne?
Herztöne sind Laute der mechanischen Herzaktion.
Zu unterscheiden ist der erste und der zweite Herzton.
Der erste Herzton entsteht als Anspannungston des Kammermyokards zu Beginn der Kammersystole. Der zweite Herzton entsteht als Klappenschlusston der beiden Taschenklappen, der Aorten- und Pulmonalklappe. Er leitet die Kammerdiastole ein.
Frage 5
Wo sind die beiden Herztöne am deutlichsten zu hören?
Der erste Herzton ist mittels der Auskultation am deutlichsten über der Herzspitze zu hören. Diese liegt im 5. ICR innerhalb der Medioklavikularlinie.
Der zweite Herzton ist mittels der Auskultation am deutlichsten über der Herzbasis zu hören. Diese liegt an der Oberseite des Herzens.
Frage 6
Was sind essenzielle Fettsäuren?
Essenzielle Fettsäuren sind lebensnotwendige Fette, die vom Körper nicht hergestellt werden können und daher von außen zugeführt werden müssen. Sie sind in hoher Konzentration in pflanzlichen Ölen zu finden, z.B. in Sonnenblumenöl, Leinöl oder Sojaöl.
Es handelt sich um mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Gesättigte und einfach ungesättigte Fettsäuren können von der Leber selbst hergestellt werden.
Frage 7
Warum werden Fette im Körper als Energiespeicher benutzt?
Die Fette werden als Energiespeicher benutzt, weil der Körper aus den Fettsäuren doppelt so viel Energie gewinnen kann wie aus den Glukosemolekülen.
Frage 8
Wo befindet sich das Zungenbein?
Das Zungenbein (mit dem lat. Namen Os hyoideum) ist eine relativ kleine U-förmige Knochenspange, die sich im oberen Halsbereich zwischen Unterkiefer und Kehlkopf befindet und den Gesichtsknochen zugeordnet wird. Das Zungenbein besitzt keine gelenkige Verbindung mit den anderen Knochen und ist nur durch Muskeln und Bänder mit Unterkiefer und Kehlkopf verbunden.
Frage 9
Welche Aufgabe übernimmt das Zungenbein?
Das Zungenbein dient als Ansatz und Ursprung vieler kleiner Muskeln, die das Zungenbein mit Kehlkopf, Unterkiefer, Schläfenbein (Griffelfortsatz), Schulterblatt und Brustbein verbinden. Daraus ergibt sich eine Mitwirkung am Schluck- und Kauakt und beim Sprechen.
Frage 10
Wo befindet sich die Hypophyse?
Die Hypophyse, auf Deutsch Hirnanhangsdrüse, ist eine im Zwischenhirn befindliche Hormondrüse, die zusammen mit dem Hypothalamus das Hypothalamus-Hypophysen-System bildet und so Hormondrüsen steuert. Sie liegt in einer knöchernen Grube des Keilbeinknochens im Zentrum der Schädelbasis, dem sog. Türkensattel. Sie wird unterteilt in einen Hypophysenvorderlappen und in einen Hypophysenhinterlappen.
Frage 11
Welche Hormone werden im Hypophysenvorderlappen produziert? Schildern Sie deren Funktion im Körper!
Im Hypophysenvorderlappen werden die folgenden Hormone gebildet:
TSH (thyreoideastimulierendes Hormon), welches die Produktion und Freisetzung von Schilddrüsenhormonen (T3, T4) und das Follikelwachstum in der Schilddrüse stimuliert.
ACTH (adrenokortikotropes Hormon), welches zur Produktion und Freisetzung von Hormonen in der Nebennierenrinde, im Wesentlichen der Glukokortikoide (Kortison, Kortisol) führt.
STH (somatotropes Hormon), das Wachstumshormon, welches für das Körperwachstum verantwortlich ist.
MSH (melanozytenstimulierendes Hormon), welches eine Produktion von Melanin bewirkt und so zur verstärkten Pigmentierung der Haut führt.
Prolaktin, welches bei Schwangeren das Brustdrüsenwachstum und die Milchproduktion bewirkt.
FSH (follikelstimulierendes Hormon), welches in den Eierstöcken auf die Östrogenbildung und die Follikelreifung und in den Hoden auf die Spermatogenese wirkt.
LH (luteinisierendes Hormon), welches bei der Frau v.a. auf den Eisprung und die Bildung des Gelbkörpers und beim Mann auf die Leydig-Zwischenzellen zur Androgenproduktion wirkt.
Frage 12
Was sind Eigen- und Fremdreflexe? Unterscheiden Sie!
Ein Reflex ist eine unwillkürliche und automatische Reaktion eines Muskels oder einer Drüse auf einen Reiz hin.
Es werden Eigenreflexe und Fremdreflexe unterschieden.
Beim Eigenreflex erfolgen die Reizaufnahme und die Reizantwort am selben Muskel. Der Reflexbogen eines Eigenreflexes besteht aus nur einer Nervenschaltstelle, daher auch der Name „monosynaptischer Reflex“. Er besitzt eine kurze Reflexzeit, funktioniert unabhängig von der Reizintensität und zeigt keine Ermüdbarkeit, d.h. er ist beliebig oft wiederholbar.
Beim Fremdreflex erfolgt die Reizaufnahme und Reizantwort in unterschiedlichen Organen. Der Reflexbogen eines Fremdreflexes besteht aus vielen verschiedenen Nervenschaltstellen, daher auch der Name „polysynaptischer Reflex“. Er besitzt eine lange Reflexzeit, funktioniert abhängig von der Reizintensität (je stärker der Reiz, desto stärker der Fremdreflex) und zeigt eine Ermüdbarkeit, d.h. je öfter er wiederholt wird, desto schwächer wird der Reflex.
Frage 13
Welche Eigenreflexe kennen Sie?
Den Achillessehnenreflex, den Patellarsehnenreflex, den Bizepssehnenreflex und den Trizepssehnenreflex, den Radius-Periost-Reflex und den Bauchdeckenreflex.
Frage 14
Finden Sie Natrium außerhalb oder innerhalb der Zelle? Was hat das mit der Spannung an der Zellmembran zu tun?
Natrium-Ionen befinden sich größtenteils außerhalb der Zelle. Durch den Konzentrationsunterschied von Natrium-Ionen außerhalb der Zelle und Kalium-Ionen innerhalb der Zelle wird das Ruhemembranpotenzial von ca. –90 mV geschaffen. Dieses wird durch Ionenpumpen in der Zellmembran aufrechterhalten. Diese negative Spannung wird bei Nervenzellen durch einen plötzlichen Einstrom von Natrium in die Zellen depolarisiert, d.h. das Ruhepotenzial kehrt sich kurzfristig um und wird so zum Aktionspotenzial. Dadurch wird ein Reiz geschaffen, der als elektrischer Impuls an der Membran der Nervenzelle entlang läuft und so dem Körper als Weiterleitung einer Information dient.
Frage 15
Wo wird Erythropoetin hergestellt und welche Bedeutung hat es?
Das Hormon Erythropoetin wird größtenteils in der Niere gebildet. Es steuert die Bildung der roten Blutkörperchen im Knochenmark, wobei ein Mangel an Sauerstoff im Blut die Produktion von Erythropoetin fördert und ein Überschuss von Sauerstoff die Produktion hemmt.
(Pathologie siehe ▶ Frage Nr. 358)
Frage 16
Erklären Sie die Begriffe Osteoklasten und Osteoblasten!
Osteoblasten sind spezialisierte Zellen im Knochengewebe, die die Aufgabe haben, neues Knochengewebe zu bilden. Sie stehen im Gleichgewicht mit den Osteoklasten, sog. Knochenfresszellen, welche bestimmtes Knochengewebe abbauen.
Ein Ungleichgewicht von Osteoblasten zu Osteoklasten führt zu der Erkrankung Osteoporose (siehe ▶ Frage Nr. 359).
Frage 17
Was zählt zu den primären Geschlechtsorganen?
Zu den primären weiblichen Geschlechtsorganen zählen Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter, Scheide, Schamlippen, Scheidenvorhof, Schamberg und Kitzler.
Zu den primären männlichen Geschlechtsorganen zählen Hoden, Nebenhoden, Samenleiter, Spritzgänge, Penis, Bläschendrüse und Prostata.
Frage 18
Dürfen Sie die Geschlechtsorgane untersuchen?
Ja. Seit das Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten am 01.01.2001 außer Kraft getreten ist, darf der Heilpraktiker Geschlechtsorgane untersuchen. Behandeln darf er eine Geschlechtskrankheit nur, wenn diese nicht durch eine sexuelle Übertragung entstanden ist.
Frage 19
Was zählt zu den sekundären Geschlechtsmerkmalen?
Die sekundären Geschlechtsmerkmale dienen nicht direkt der Fortpflanzung, sondern sie prägen das männliche und weibliche Erscheinungsbild eines Menschen. Beim Mann sind dies z.B. der männliche Körperbau, die Körperbehaarung, der Bartwuchs und die tiefe Stimme, bei der Frau der weibliche Körperbau, die Brüste und die hohe Stimme.
Die sekundären Geschlechtsmerkmale entwickeln sich erst in der Pubertät.
Frage 20
Wo liegt die Leber? Welche Organe grenzen an sie?
Die Leber ist das größte Organ im Körper und liegt mit der Hauptmasse im rechten Oberbauch unter der rechten Zwerchfellkuppe. Mit ihr ist die Leber teilweise verwachsen, so dass sie den Atembewegungen folgen muss. Mit dem linken Leberlappen reicht sie weit über die Mittellinie des Körpers hinaus und bedeckt dort teilweise den Magen. Auf der rechten Seite ist die Leber nach unten hin konkav gewölbt und steht in Berührung mit der rechten Nierenkapsel und der rechten Dickdarmkrümmung. Der untere Leberrand verläuft in etwa entlang dem Rippenbogen und ist an der Medioklavikularlinie während der Einatmung vor allem bei schlanken Personen als weich elastischer Rand gut zu tasten. Die Leber liegt intraperitoneal, d.h. innerhalb des Bauchfells.
(Untersuchung der Leber siehe ▶ Frage Nr. 441)
Frage 21
Welche Aufgaben hat die Leber?
Die Leber ist das zentrale Stoffwechselorgan des Körpers und vollbringt eine Vielzahl von chemischen Reaktionen, die sich in vier Hauptaufgaben unterteilen lässt:
Stoffwechselfunktionen: Die Leber ist am Eiweißstoffwechsel beteiligt, indem sie die körpereigenen Eiweiße aus den Eiweißbausteinen, den Aminosäuren, unter Mithilfe von Transaminasen aufbaut. Beim Zerfall von Aminosäuren wird das Eiweißabbauprodukt Harnstoff gebildet. Die Leber ist am Kohlenhydratstoffwechsel beteiligt, indem sie den Kohlenhydratbaustein Glukose in Glykogen unter Mitwirkung von Insulin speichert. Der Abbau des Glykogens erfolgt durch Glukagon und Adrenalin. Die Leber ist am Fettstoffwechsel beteiligt, Fettsäuren werden auf- und abgebaut und können auch in den Leberzellen gespeichert werden. Cholesterine werden größtenteils synthetisiert und zusammen mit Fettsäuren in bestimmte Transportpartikel, den VLDL (Very Low Density Lipoprotein) eingebaut.
Entgiftungsfunktion: Die Leber baut körpereigene und körperfremde Stoffe ab und überführt sie entweder in eine wasserlösliche Form, die über die Niere ausgeschieden wird oder in eine nicht wasserlösliche Form, die über die Galle ausgeschieden wird.
Gallenproduktion: Die Leberzellen produzieren die Galle. Diese hat die Aufgabe die Fette im Darm zu emulgieren und ihren Transport zu den Resorptionszellen zu ermöglichen.
Speicherfunktion: Die Leber besitzt die Fähigkeit, verschiedene Stoffe und Substanzen zu speichern, z.B. Vitamin K, Glykogen, Fettsäuren, Eisen, Blut.
Als weitere Aufgabe der Leber sind die Blutbildung in der Fetalzeit und die Phagozytose durch die Kupffer-Sternzellen zu nennen.(Feinstofflicher Aufbau der Leber: siehe ▶ Frage Nr. 83)
Frage 22
Was können Sie über den Bilirubinkreislauf erzählen?
Bilirubin entsteht als Abbauprodukt bei der Auflösung der roten Blutkörperchen, der Hämolyse. Da es wasserunlöslich ist, wird es im Blut an Albumine gebunden. Man nennt es das unkonjugierte bzw. indirekte Bilirubin. Erst in der Leber wird es durch Verbindung mit der Glukuronsäure wasserlöslich gemacht. Jetzt trägt es die Bezeichnung konjugiertes bzw. direktes Bilirubin. Das Wort Konjugation bedeutet Verbindung. Dieses konjugierte Bilirubin wird als Gallenfarbstoff über die Galle in den Zwölffingerdarm eingebracht. Im Darm verändert sich das Bilirubin durch Bakterienspaltung zu Urobilinogen und Sterkobilin. Urobilinogen wird im Endstück des Krummdarms, des Ileums, in das Pfortadersystem resorbiert und gelangt so wieder in die Leber. Ein Teil des resorbierten Urobilinogens wird über die Niere ausgeschieden, der größte Teil wird in der Leber abgebaut und erneut für den Aufbau der Galle verwendet.
Das Sterkobilin wird mit dem Stuhl ausgeschieden. Es ist verantwortlich für die braune Färbung des Stuhls.
Frage 23
Welche Sterilisationsmöglichkeiten sind für Sie als Heilpraktiker relevant?Beschreiben Sie bitte diese Techniken!
Die hygienische Sterilisation bedeutet die Entfernung aller Keime, auch die der sporenbildenden Keime.
Für den Heilpraktiker ist das thermische Verfahren, der Druckluftsterilisator, der sog. Autoklav, von Bedeutung. Dieser arbeitet mit feuchter Hitze unter Druckluft. Seine Betriebsdauer beträgt 20 Minuten bei 120°C und einem atü oder 5 Minuten bei 134°C und zwei atü.
(Fünf Schritte der Sterilisation siehe ▶ Frage Nr. 41)
Frage 24
Welche Verfahren der Sterilisation außer den Sterilisatoren sind Ihnen noch bekannt?
Außer den Sterilisatoren sind noch die chemischen Verfahren, wie z.B. Formaldehyd, die physikalischen Verfahren anhand energiereicher Strahlung und die Sterilfiltration zur Herbeiführung der Keimfreiheit bei Flüssigkeiten und Gasen zu nennen.
Frage 25
Wie wird die Funktion des Sterilisators überprüft?
Der Sterilisator muss mindestens einmal im Jahr geprüft werden, ob er einwandfrei funktioniert. Dies kann mit Sporenpäckchen oder Indikatorpapier kontrolliert werden.
Frage 26
Was verstehen Sie unter Desinfektion?
Desinfektion bedeutet die Entfernung bzw. Verminderung von Mikroorganismen, so dass eine Infektion nicht mehr stattfinden kann. Sporenbildende Keime können jedoch damit nicht entfernt werden, sie vermögen durch Bildung der Sporenform zu überleben.
Frage 27
Welche Formen der Desinfektion kennen Sie?
Zu nennen ist die Hautdesinfektion beim Patienten, welche notwendig für jeglichen Eingriff in den Körper ist, die Händedesinfektion des Untersuchenden, die chirurgische Händedesinfektion und die Flächendesinfektion, die bei verunreinigten Arbeitsplatten und Fußböden eingesetzt wird.
Frage 28
Wie wird bei den jeweiligen Desinfektionsformen desinfiziert?
Desinfiziert wird mit 80%igem Äthylalkohol oder 70%igem Isopropylalkohol oder mit anderen vom Robert-Koch-Institut zugelassenen Desinfektionsmitteln.
Bei der Hautdesinfektion des Patienten wird bei sichtbarer Verschmutzung zuerst eine Reinigung mit Wasser und Seife vorgenommen. Dann wird entweder die Wisch- bzw. Tupfermethode oder die Sprühmethode angewandt. Bei der Wischmethode wird ein mit entsprechendem Alkohol oder einer handelsüblichen Lösung getränktem Tupfer in konzentrischen Kreisen um die Punktionsstelle von innen nach außen ca. 30 Sekunden lang gewischt. Bei der Sprühmethode wird die entsprechende Sprühlösung für ca. zwei Minuten aufgetragen.
Die Händedesinfektion wird durchgeführt, indem die Hände mit dem entsprechenden Alkohol für ca. 30 Sekunden oder mit einer zugelassenen Desinfektionslösung für ca. zwei Minuten eingerieben werden. Die Einwirkzeit wird immer auf dem jeweiligen Desinfektionsmittel genannt. Besondere Sorgfalt ist auf die Desinfektion des Nagelfalzes und der Fingerkuppen zu verwenden. Verschmutzte Hände dürfen erst nach ihrer Desinfektion mit Wasser und Seife gereinigt werden.
Bei der chirurgischen Händedesinfektion werden die Hände und Unterarme zuerst zwei Minuten mit Seife und Wasser gründlich gewaschen und dann zweimal zweieinhalb Minuten mit dem entsprechenden Desinfektionsmittel eingerieben.
Bei der Flächendesinfektion wird das entsprechende Flächendesinfektionsmittel aufgesprüht und dann mit einem Haushaltstuch bzw. einem Mopp abgewischt. Dabei wird die „2-Eimer-Methode“ benutzt.
Frage 29
Was sagt Ihnen der Begriff kolloidosmotischer Druck?
Der kolloidosmotische Druck wird bestimmt durch die in der Blutflüssigkeit befindlichen Eiweißpartikel, die Albumine. Man könnte auch sagen, es ist die Kraft, mit der Albumine die Wassermoleküle an sich ziehen. Dieser Druck spielt für die Wasserrückresorption im venösen Kapillarschenkel eine wichtige Rolle.
Frage 30
Erklären Sie die Systole bzw. Diastole des Herzens! Welche Herzklappen sind dabei geöffnet?
Die Systole ist die Arbeitsphase des Herzens. Man unterscheidet die Anspannungsphase, in der alle Klappen geschlossen sind, und die Austreibungsphase, in der die Taschenklappen, also die Aortenklappe und die Pulmonalklappe durch den Blutstrom geöffnet werden.
Die Diastole ist die Erschlaffung des Herzmuskels nach der Systole. Man unterscheidet die Erschlaffungsphase, in der alle Klappen geschlossen sind und die Füllungsphase, in der sich die Segelklappen, also die Mitralklappe und die Trikuspidalklappe, durch das aus den Vorhöfen strömende Blut öffnen.
Frage 31
In welcher Arbeitsphase des Herzens fließt Blut in die Koronararterien?
In der Diastole fließt das Blut in die beiden Koronararterien, deren Abgang direkt hinter der Aortenklappe liegt. Während der Systole ist die Taschenklappe geöffnet und verschließt so die Eingänge in die Koronararterien. Außerdem kontrahiert sich der Herzmuskel während der Systole und verhindert somit ein Einströmen in die beiden Koronararterien. Erst in der Erschlaffungsphase des Herzens drückt die Blutsäule in der Aorta das Blut in die Koronararterien.
Frage 32
Wie wirkt der Sympathikus und wie der Parasympathikus?Nennen Sie ein paar Beispiele!
Sympathikus und Parasympathikus sind die Nerven des Hypothalamus und repräsentieren das vegetative Nervensystem. Sie haben meist entgegengerichtete Wirkungen.
Der Sympathikus mobilisiert Energie bei physischen und psychischen Stressreaktionen, er wirkt erregend auf alle Organe, die er zur Stressbewältigung benötigt und hemmend auf die Verdauungsorgane.
Der Parasympathikus wirkt entgegengesetzt des Sympathikus und vor allem in Ruhe. Er wirkt steigernd auf die Verdauungsorgane und abschwächend auf die Herz- und Atemfrequenz. Ein paar Beispiele:
Sympathikus erhöht die Herzfrequenz und die Kontraktionskraft des Herzmuskels, Parasympathikus erniedrigt sie.
Sympathikus erhöht den Blutdruck, Parasympathikus führt zur Senkung.
Sympathikus erweitert die Gefäße der Skelettmuskulatur, Parasympathikus erweitert die Gefäße der Verdauungsorgane.
Sympathikus führt zur Erweiterung der Bronchien, Parasympathikus zur Verengung.
Sympathikus führt zur Erweiterung der Pupillen, Parasympathikus zur Verengung.
Sympathikus führt zur Hemmung der Magen-Darm-Motorik, Parasympathikus zur Steigerung.
Sympathikus führt zur vermehrten Schweißdrüsensekretion.
Frage 33
Wie ist das Rückenmark aufgebaut? Geben Sie uns einen groben Überblick!
Am Rückenmark ist, wie im Gehirn auch, die graue und weiße Substanz zu unterscheiden. Jedoch ist die weiße Substanz des Rückenmarks außen und die graue Substanz innen zu finden. Beim Gehirn ist das genau umgekehrt.
Die graue Substanz besteht aus den Zellkörpern der Nervenzellen, während die weiße Substanz aus den markhaltigen Nervenfasern aufgebaut ist.
Die graue Substanz des Rückenmarks weist im Querschnitt eine schmetterlingsförmige Gestalt auf. Die hinteren Flügel dieser Gestalt werden als Hinterhörner bezeichnet, hier münden die sensiblen Nervenfasern aus der Peripherie in das Rückenmark; die vorderen Flügel der Gestalt werden als Vorderhörner bezeichnet, hier entspringen die motorischen Nervenfasern zur Peripherie.
In den Seitenfortsätzen einiger Spinalsegmente befinden sich die vegetativen Neurone des Sympathikus (C8–L2) und Parasympathikus (S2–S4).
Die äußere weiße Substanz um die schmetterlingsähnliche Figur herum besteht aus markhaltigen auf- und absteigenden Nervenfasern und wird in drei Stränge unterteilt: den Vorderstrang, Seitenstrang und Hinterstrang.
Frage 34
Bis wohin erstreckt sich das Rückenmark?
Das Rückenmark beginnt direkt hinter dem Hinterhauptsloch und endet ungefähr am ersten bis zweiten Lendenwirbel. Darunter ziehen die restlichen Spinalnerven zu ihrem jeweiligen Zwischenwirbelloch. Man nennt das Bündel dieser Spinalnerven Cauda equina, zu Deutsch „Pferdeschwanz“.
Frage 35
Welche Aufgabe hat das Rückenmark?
Das Rückenmark leitet die Nervenimpulse vom Gehirn zur Peripherie und umgekehrt. Außerdem ist es in der Lage, Reflexe zu vermitteln.
Frage 36
Was ist ein Spinalnerv und wie viele gibt es davon?
Ein Spinalnerv bezeichnet die Ansammlung von motorischen, sensiblen und vegetativen Nervenfasern, welche von einem Rückenmarkssegment stammen und gemeinsam durch ein Zwischenwirbelloch bzw. einer Öffnung im Kreuzbein austreten bzw. eintreten. Es gibt 31 Spinalnervenpaare, 8 zervikale, 12 thorakale, 5 lumbale, 5 sakrale und 1 kokzygeales Spinalnervenpaar.
Frage 37
Können Sie die 12 Hirnnerven nennen?
Hirnnerven sind Nervenstränge, die nicht über das Rückenmark zur Peripherie verlaufen, sondern direkt aus dem Gehirn entspringen.
Der erste Hirnnerv ist der Riechnerv, der Nervus olfactorius, ein rein sensibler Nerv.
Der zweite Hirnnerv ist der Sehnerv, der Nervus opticus, auch ein rein sensibler Nerv.
Der dritte Hirnnerv ist ein Augenmuskelnerv, der Nervus oculomotorius, ein hauptsächlich motorischer Nerv mit parasympathischen Anteilen.
Der vierte Hirnnerv ist wieder ein Augenmuskelnerv, der Nervus trochlearis, ein rein motorischer Nerv.
Der fünfte Hirnnerv ist der sog. Drillingsnerv, besser bekannt unter den Namen Trigeminus. Er teilt sich in drei Hauptäste, den Nervus ophthalmicus, den sog. Augenhöhlennerv, den Nervus maxillaris, den sog. Oberkiefernerv und den Nervus mandibularis, auf Deutsch den Unterkiefernerv.
Der sechste Hirnnerv ist der dritte Augenbewegungsnerv, der Nervus abducens, ein rein motorischer Nerv.
Der siebte Hirnnerv ist der Gesichtsnerv, auch besser bekannt unter den Namen Fazialis bzw. Nervus facialis, ein gemischter Hirnnerv.
Der achte Hirnnerv ist der Hör- und Gleichgewichtsnerv, der Nervus vestibulocochlearis, ein rein sensibler Hirnnerv.
Der neunte Hirnnerv ist der Zungenrachennerv, der Nervus glossopharyngeus, ein gemischter Hirnnerv.
Der zehnte Hirnnerv ist der „berühmte“ Vagus bzw. Nervus vagus, der Hauptnerv des Parasympathikus. Vagus bedeutet „der Umherschweifende“. Er innerviert fast den gesamten Rumpf.
Der elfte Hirnnerv ist der Halsnerv oder auch Beinerv genannt, der Nervus accessorius, ein rein motorischer Nerv, der zwei Halsmuskeln innerviert.
Der zwölfte Hirnnerv ist der Zungennerv, der Nervus hypoglossus, ein rein motorischer Hirnnerv, welcher die Zungenbewegungen und die Bewegungen des Kehlkopfes innerviert.
Frage 38
Nennen Sie uns die Abschnitte der Wirbelsäule und deren normale Biegungen!
Die Wirbelsäule unterteilt sich in die Halswirbelsäule mit sieben Halswirbeln, die Brustwirbelsäule mit zwölf Brustwirbeln und die Lendenwirbelsäule mit fünf Lendenwirbeln. Dann folgen das Kreuzbein, welches aus fünf miteinander verschmolzenen Wirbeln besteht, und das Steißbein, welches sich aus 3–6 verkümmerten, ineinander verschmolzenen Wirbeln zusammensetzt.
Bei den physiologischen Wirbelsäulenkrümmungen wird die Kyphose von der Lordose unterschieden. Diese Krümmungen sind am deutlichsten von der Seite zu erkennen. Die Kyphose stellt den normalen Krümmungsverlauf der Wirbelsäule nach hinten dar, so bei den Brustwirbeln als Brustkyphose und beim Steißbein als Sakralkyphose. Die Lordose stellt die Krümmung nach vorne dar, so bei den Lendenwirbeln als Lendenlordose und bei den Halswirbeln als Halslordose.
Frage 39
Welche Besonderheiten kennen Sie an der Halswirbelsäule?
Der erste Halswirbel, der Atlas, und der zweite Halswirbel, der Axis, bilden zusammen ein zapfenartiges Gelenk, das dem Kopf eine Drehung und eine Vor- und Rückbewegung ermöglicht.
Eine Besonderheit der Halswirbel ist, dass sie in ihren Querfortsätzen ein Loch enthalten, in denen die Wirbelschlagader, die Arteria vertebralis verläuft.
Zu nennen ist noch der siebte Halswirbel, der Prominens. Er besitzt einen besonders ausgeprägten Dornfortsatz, der bei gebeugtem Kopf gut fühlbar ist, und an dem die Schultermuskulatur aufgehängt ist.
(Siehe auch Wirbelaufbau ▶ Frage Nr. 108)
Frage 40
Was ist das Besondere an den Lendenwirbeln?
Im Vergleich zu anderen Wirbeln besitzen die Lendenwirbel einen größeren Wirbelkörper, denn diese Wirbel müssen ja die ganze Last der oberen Körperpartien tragen. Der Wirbelkanal ist im Vergleich wesentlich kleiner. Der Grund liegt darin, dass das Rückenmark ausläuft und nur noch die restlichen Spinalnerven hier entlang laufen. Der Dornfortsatz ragt wie bei den Halswirbeln horizontal nach hinten, ist aber wesentlich plumper und flacher.
Frage 41
Nennen Sie die fünf Zeitphasen eines Sterilisators!
Zur Inbetriebnahme eines Sterilisators müssen mehrere Schritte beachtet werden.
Direkt nach dem Gebrauch werden die benutzten Instrumente für mindestens zwei Stunden in eine 10%ige Desinfektionslösung eingelegt, man nennt dies Grobdesinfektion.
Die Feindesinfektion erfolgt mit Bürsten und Waschen der Instrumente unter fließendem Wasser.
Abtrocknen der Instrumente und Einlegen in den Sterilisator.
Die Aufwärmzeit von ca. einer halben Stunde ist zu beachten, bevor dann
die Inbetriebnahme des Sterilisators erfolgt.
(Dauer der Inbetriebnahme siehe ▶ Frage Nr. 23)
Frage 42
Erklären Sie den Wandaufbau des Dünndarms!
Der Wandaufbau des Verdauungskanals, egal ob Magen, Dünndarm oder Dickdarm, ist immer gleich und wird in vier Schichten unterteilt. Je nach Spezifikation des Organs sind die einzelnen Schichten unterschiedlich aufgebaut, vor allem die Schleimhaut.
Innen befindet sich die Mukosa, die Schleimhautschicht. Beim Dünndarm besteht diese aus Dünndarmzotten, welche die Aufnahme der Nahrungsbausteine zur Aufgabe haben. Dann folgt die Submukosa, eine Verschiebeschicht aus Bindegewebe, die der Wand die Anpassungsfähigkeit gegenüber Volumenveränderungen verleiht. Die Muskularis, die Muskelschicht, besteht im Dünndarm aus einer inneren ringförmig verlaufenden Faserschicht und einer äußeren längs verlaufenden Schicht. Die Serosa stellt die äußere Bindegewebshülle dar, sie ist das viszerale Blatt des Bauchfells.
Frage 43
Beschreiben Sie, wo die Nieren liegen!
Die Nieren befinden sich rechts und links neben der Wirbelsäule am Übergang der Brustwirbelsäule zur Lendenwirbelsäule, ungefähr zwischen dem 11. Brustwirbel und dem 3. Lendenwirbel. Der Nierenhilus ist dabei der Wirbelsäule zugewandt. Die linke Niere liegt unterhalb der Milz, wobei sie sich etwas höher befindet als die rechte Niere. Diese wird im rechten Oberbauch durch die Leber nach unten verdrängt.
Die Nieren sind zur besseren Fixierung in einer Fett- und Bindegewebskapsel eingelagert. Die Lage der Nieren im Bauchraum wird als retroperitoneal bezeichnet, d.h. sie liegen hinter der vom Bauchfell umschlossenen Bauchhöhle.
Frage 44
Welche Aufgaben der Nieren kennen Sie?
Die Nieren dienen dem Körper als Filter zum „Reinigen“ des Blutes. Hier werden harnpflichtige Stoffe und von der Leber abgebaute körperfremde Substanzen filtriert und mit dem Harn ausgeschieden. Durch diese Fähigkeit der Niere, Stoffe zu filtrieren und dann wieder in das Blut zu resorbieren, besitzt die Niere die Aufgabe den Wasser-Salz-Haushalt zu regulieren, vor allem um die Bilanz von Natrium und Kalium auszugleichen. So wirkt sie auch an der Regulierung des Säuren-Basen-Gleichgewichts mit. Außerdem wird im Nierengewebe Renin und Erythropoetin produziert. Renin bewirkt über das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System eine Erhöhung des Blutdrucks und Erythropoetin führt im roten Knochenmark zur vermehrten Bildung der roten Blutkörperchen. Letzlich ist die Niere auch am Knochenstoffwechsel beteiligt, weil sie am Aufbau des Vitamin-D-Hormons mitwirkt.
(Aufbau der Nieren siehe ▶ Frage Nr. 78)
Frage 45
Was verstehen Sie unter dem Renin-Angiotensin-Aldosteron-System?
Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, kurz auch RAA-System oder RAAS genannt, erhöht den Blutdruck, um den effektiven Filtrationsdruck bei der glomerulären Filtration zu gewährleisten. Aus Angiotensinogen entsteht durch die Wirkung von Renin Angiotensin I, welches durch das Angiotensin-Converting-Enzym, auch kurz ACE genannt, in das aktive Angiotensin II überführt wird. Dieses Angiotensin wirkt stark gefäßverengend, zudem kommt es zur Ausschüttung von Aldosteron in der Nebennierenrinde.
Frage 46
Geben Sie einen kurzen Überblick über die Abschnitte des Gehirns.
Zu unterscheiden sind:
Das Großhirn, das durch eine Längsfurche in zwei sog. Hemisphären unterteilt wird,
das Zwischenhirn mit Thalamus, Hypothalamus und Hypophyse,
das Mittelhirn mit größtenteils weißer Substanz und einigen Anteilen der grauen Substanz,
die Brücke, auch genannt Pons, die die Verbindung zwischen Kleinhirn und Großhirn darstellt,
das verlängerte Rückenmark, die Medulla oblongata, in der sich wichtige Reflex- und Schaltzentren befinden,
und schließlich das Kleinhirn.
Frage 47
Welche Funktion besitzt das Kleinhirn?
Das Kleinhirn hat die Koordination von Bewegung, Muskeltonus und Gleichgewicht zur Aufgabe. Damit der Mensch bei größeren Bewegungen sein Gleichgewicht nicht verliert, muss der Bewegungsablauf so kontrolliert bzw. koordiniert werden, dass gegenläufige automatische Bewegungen anderer Körperteile das Gleichgewicht ausbalancieren.
Frage 48
Zeigen Sie den Weg des Blutes durch das Herz auf!
Von der unteren und oberen Hohlvene gelangt das Blut in den rechten Vorhof. Während der Füllungsphase der Diastole öffnet sich unter dem Druck des Blutes die Trikuspidalklappe. Das Blut füllt die rechte Kammer. Die Trikuspidalklappe wird durch die Anspannungsphase der Systole geschlossen. Während der Austreibungsphase öffnet sich die Pulmonalklappe, das Blut gelangt in den Truncus pulmonalis, von dort in die rechte und linke Pulmonalarterie. In den Lungenkapillaren wird das Blut mit Sauerstoff angereichert. Von dort gelangt es über die Lungenvenen in den linken Vorhof. Während der Füllungsphase der Diastole öffnet sich unter dem Druck des Blutes die Mitralklappe. Das Blut füllt die linke Kammer. Die Mitralklappe wird durch die Anspannungsphase der Systole geschlossen. Während der Austreibungsphase öffnet sich die Aortenklappe, das Blut gelangt unter hohem Druck in die Aorta.
Frage 49
Wie sind die Arterien und Venen aufgebaut?
Arterien sind Gefäße, die vom Herzen wegführen. Sie sind Hochdruckgefäße, außer den Pulmonalarterien im Lungenkreislauf. Venen sind Gefäße, die zum Herzen hinführen. Sie sind sog. Kapazitätsgefäße. Grundsätzlich ist der Schichtaufbau der Arterien und Venen gleich: an der Innenseite die Intima, ein einschichtiges Plattenepithel mit einer kleinen Schicht elastischen Bindegewebes, dann die Media, die aus glatter Muskulatur und elastischem Bindegewebe besteht und schließlich die Adventitia, die als äußere Schicht das Gefäß umschließt und abgrenzt.
Bei den Arterien lassen sich zwei Arten unterscheiden:
Die Arterien vom „elastischen Typ“, die in der Media eine große Anzahl von elastischen Fasern besitzen. Sie befinden sich in der Nähe des Herzens und sind für die Windkesselfunktion geeignet.
Die Arterien vom „muskulären Typ“, die in der Media überwiegend ringförmige Muskelfasern aufweisen. Sie dienen vor allem der Blutdruckregulation bzw. der Regelung der Durchblutung der einzelnen Organe.
Die Media der Venen ist wesentlich dünner als die der Arterien und besitzt auch weniger elastische Fasern, denn in diesen Gefäßen befinden sich 70–80% des gesamten Blutvolumens. Um eine Fortbewegung des Blutstroms zu gewährleisten, befinden sich in den venösen Gefäßen Venenklappen.
Frage 50
Was verstehen Sie unter Windkesselfunktion?
Unter Windkesselfunktion versteht man die Eigenschaft der Aorta und der in der Nähe des Herzens befindlichen großen Arterien, einen fortlaufenden Blutstrom zu erzeugen. Dieser gleichmäßige Blutfluss geschieht durch die starke Dehnbarkeit der großen Arterien infolge der zahlreichen elastischen Fasern in der Arterienwand. Die Arterien nehmen während der Systole einen Teil des Herzschlagvolumens auf und drücken das Blut in der Diastole weiter in die Peripherie.
Frage 51
Was ist ein Dermatom?
Ein Dermatom ist ein von einem Spinalnerv sensibel innervierter Hautbezirk.
Frage 52
Erklären Sie uns grob, wie das Ohr aufgebaut ist!
Das Ohr kann unterteilt werden in äußeres Ohr, Mittelohr und Innenohr.
Das äußere Ohr beinhaltet die Ohrmuschel und den äußeren Gehörgang und ist für das Auffangen und die Weiterleitung des Schalls zuständig.
Das Trommelfell stellt die Begrenzung zwischen äußerem Ohr und Mittelohr dar. Es überträgt die Schwingungen auf die im Mittelohr liegenden Gehörknöchelchen, den Hammer, den Amboss und letztlich den Steigbügel, welcher mit dem ovalen Fenster verwachsen ist. Der Raum im Mittelohr nennt sich Paukenhöhle. Dieser ist mit lufthaltigen Zellen im Warzenfortsatz des Schläfenbeins verbunden und besitzt über die Ohrtrompete, auch Eustachi'sche Röhre genannt, eine Verbindung zum oberen Rachenraum, dem Nasenrachenraum. Diese Verbindung dient als Druckausgleich.
Das innere Ohr liegt in einer Höhlung im Felsenbein, einem Teil des Schläfenbeins und beinhaltet das Hörorgan in Form einer Schnecke und das Gleichgewichtsorgan in Form von Vorhof und Bogengangsapparat.
Frage 53
Welchen normalen Inspektionsbefund erhalten Sie, wenn Sie das Trommelfell mittels eines Otoskops untersuchen?
Bei einem normalen Befund ist die Farbe des Trommelfells perlmuttgrau. Die Membran ist vollständig geschlossen, weist eine leichte Wölbung nach innen auf und zeigt sonst keine weiteren Veränderungen, z.B. eine Rötung oder Fibrinauflagerungen. Außerdem lässt sich der durchscheinende Griff des Hammers in der Mitte des Trommelfells erkennen.
Frage 54
Geben Sie uns eine kurze Beschreibung über den Aufbau des Auges!
Das Auge besteht aus dem Augapfel. Außen lassen sich drei Augenhäute unterscheiden: Die Lederhaut, die vorne in die Hornhaut übergeht, dann die Aderhaut, die nach vorne in die Regenbogenhaut, genannt Iris, übergeht, und schließlich innen die Netzhaut, die für die optische Sinneswahrnehmung zuständig ist.
Die innere Struktur wird durch den Glaskörper und die Augenlinse bestimmt. Der mit Kammerwasser gefüllte Hohlraum zwischen Linse und Hornhaut wird durch die Regenbogenhaut in die vordere und hintere Augenkammer unterteilt. In der hinteren Augenkammer wird das Kammerwasser vom Ziliarkörper produziert, in der vorderen Kammer fließt das Wasser im Kammerwinkel über den Schlemm’schen Kanal in das venöse System ab.
Frage 55
Wie ist das Blut aufgebaut?
Das Blut ist ein flüssiges Körpergewebe. Es besteht aus den Blutzellen, den Erythrozyten, Thrombozyten und Leukozyten und aus dem Blutplasma. Das Blutplasma stellt die Flüssigkeit außerhalb der Blutzellen dar. Es besteht zu 90% aus Wasser, der Rest enthält Bluteiweiße, Nährstoffe, Elektrolyte, Vitamine, Spurenelemente, Abbauprodukte und andere Stoffwechselprodukte.
Frage 56
Nennen Sie den Unterschied zwischen Blutplasma und Blutserum!
Das Blutplasma ist der extrazelluläre Anteil des Blutes, also die Flüssigkeit außerhalb der Blutzellen. Das Blutserum stellt das Blutplasma ohne Fibrinogen dar. Fibrinogen spielt eine Rolle bei der Blutgerinnung.
Frage 57
Welche Bluteiweiße kennen Sie?
Zu unterscheiden sind die Albumine, die eine Transportfunktion ausüben und eine wichtige Rolle in der Erzeugung des kolloidosmotischen Druckes spielen. Die Globuline, die sich noch weiter in α-1- und α-2-, β- und γ-Globuline unterteilen, üben eine Trägerfunktion aus, außer den Gammaglobulinen, die als Antikörper benutzt werden.
Unterschieden werden die Bluteiweiße in der klinischen Medizin mit der Hilfe der Elektrophorese.
Frage 58
Was ist der Hämatokritwert?
Der Hämatokritwert ist der prozentuale Anteil der zellulären Bestandteile des Blutes am Gesamtblutvolumen. Er beträgt bei Frauen ca. 37–48% und bei Männern ca. 40–52%. Der Hämatokritwert ist stark abhängig von der körperlichen Tätigkeit eines Menschen.
Frage 59
Wie ist das Kniegelenk aufgebaut?
Das Kniegelenk ist ein Drehscharniergelenk. Daran beteiligt sind der Oberschenkelknochen, das Schienbein und die Kniescheibe.
Im Kniegelenk befinden sich zwei sichelförmige Faserknorpelscheiben, der Innenmeniskus und der Außenmeniskus. Sie sind mit dem Schienbein und der Gelenkkapsel verwachsen, sind jedoch so beweglich, dass sie dem Oberschenkelknochen eine der jeweiligen Gelenkstellung angepasste Gelenkpfanne bieten. Außerdem dämpfen und verteilen sie die Druckkräfte bei gestrecktem Kniegelenk. Die Kniegelenkbänder bestimmen den Bewegungsumfang des Kniegelenks und garantieren die Stabilität. Die Seitenbänder verlaufen außerhalb der Gelenkkapsel und verhindern eine Drehbewegung der beiden großen Knochen im gestreckten Knie. Vorderes und hinteres Kreuzband befinden sich im Gelenkinneren und verhindern eine Verschiebung der beiden Knochen im gebeugten Knie.
(Untersuchung der Kreuzbänder siehe ▶ Frage Nr. 456)
Frage 60
Nennen Sie Größe, Lage und die angrenzenden Organe der Bauchspeicheldrüse!
Die Bauchspeicheldrüse liegt quer im Oberbauch und ist ca. 15–20 cm lang. Sie kreuzt die Wirbelsäule in Höhe des ersten und zweiten Lendenwirbels. Sie wird unterschieden in Kopf, Körper und Schwanz. Der Verlauf vom Kopf zum Schwanz erfolgt schräg nach oben links. Der Kopf der Bauchspeicheldrüse liegt in der sog. C-Schlinge des Zwölffingerdarms. Davor liegt die Leber. Der Körper der Bauchspeicheldrüse liegt hinter dem Magen, der Schwanz reicht bis zum Milzhilus, die Ein- und Austrittspforte an der Innenseite der Milz. Hinter der Bauchspeicheldrüse befindet sich die Bauchwand, mit der sie fest verwachsen ist. Sie liegt daher retroperitoneal, d.h. sie liegt hinter dem Bauchfell.
Frage 61
Was sind die Aufgaben der Bauchspeicheldrüse?
Die Bauchspeicheldrüse hat zwei Funktionen:
Die Produktion des bikarbonatreichen Bauchspeichels. Er hat die Aufgabe, den sauren Magenbrei im Zwölffingerdarm auf einen pH-Wert von 7–8 zu führen und zum anderen durch Enzyme die Aufspaltung der Nährstoffe zu beschleunigen.
Das Organ auch eine endokrine Funktion. In den sog. Langerhans-Inseln werden die Hormone Insulin und Glukagon produziert. Diese sind an der Regulation des Blutzuckerhaushaltes beteiligt, wobei Insulin zu einer Senkung des Zuckergehalts des Blutes führt und Glukagon zu einer Erhöhung.
Frage 62
Welche Fermente (Enzyme) werden von der Bauchspeicheldrüse produziert?
Im Bauchspeichel werden drei Enzymgruppen unterschieden: die Proteasen, welche Eiweißmoleküle in ihre molekularen Bausteine, die Aminosäuren aufspalten, die Amylasen, die Kohlenhydrate in Monosaccharide (Glukose) aufspalten und die Lipasen, welche Triglyzeride in Fettsäuren und Glyzerin aufspalten.
Frage 63
Unterteilen Sie das Nervensystem!
Unter Nervensystem versteht man die Gesamtheit des Nervengewebes, das in der Lage ist, Reize aufzunehmen und weiterzuleiten. Man kann das Nervensystem nach der anatomischen Lage in Zentralnervensystem und peripheres Nervensystem unterteilen, wobei das ZNS aus Gehirn und Rückenmark und das periphere Nervensystem aus 31 Spinalnerven- und 12 Gehirnnervenpaaren bestehen. Eine weitere Unterteilung des Nervensystems wird durch die Funktion bestimmt, nämlich in willkürliches bzw. animales und in unwillkürliches bzw. vegetatives Nervensystem.
Frage 64
Welche Organe befinden sich im Mediastinum?
Das Mediastinum, auf Deutsch Mittelfellraum, bezeichnet den Raum innerhalb des Brustkorbs zwischen den beiden Lungenflügeln. Nach vorn wird es begrenzt durch das Brustbein, nach hinten durch die Wirbelkörper und nach unten durch das Zwerchfell. Folgende Organe befinden sich in diesem Raum: Herz, Thymus, Luftröhre, Stammbronchien, Speiseröhre, Milchbrustgang, Brustaorta, untere Hohlvene und andere Gefäße, Nerven, Lymphgefäße und Lymphknoten.
Frage 65
Wie funktioniert das Reizleitungssystem des Herzens?