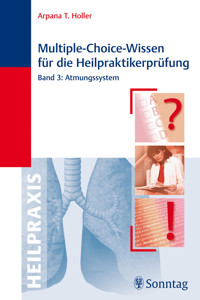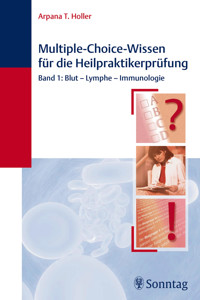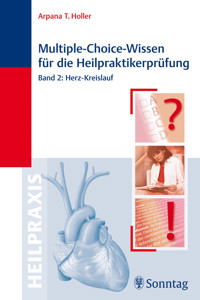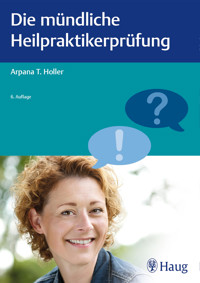69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haug Fachbuch
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Prüfungstrainer für die schriftliche Heilpraktikerprüfung Trainieren Sie alle Themengebiete und Fragestellungen, die in einer Heilpraktikerprüfung vorkommen können. Über 500 sorgfältig ausgewählte und aktuelle Originalfragen aus schriftlichen Prüfungen schaffen die optimale Grundlage dafür, Ihr Fachwissen intensiv zu testen und zu üben. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von leicht bis "exotisch" und eine Gliederung nach den wichtigsten medizinischen Prüfungssegmenten erleichtern Ihnen die gezielte Vorbereitung und das Ausmerzen von Wissenslücken. Die kommentierten Antworten liefern die wichtigsten Begründungen und helfen Ihnen, den Sachverhalt besser zu verstehen und sich zu merken. Ihr Plus: Über 100 neue Fragen aus Prüfungen der letzten zwei Jahre. So gelingt die optimale Prüfungsvorbereitung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Arpana Tjard Holler
Original-Multiple-Choice-Fragen für die Heilpraktikerprüfung
5., überarbeitete Auflage
4 Abbildungen
Vorwort zur 5. Auflage
Nach zwölf Jahren Multiple-Choice-Prüfungsfragen war es an der Zeit, die Fragen vollständig zu überarbeiten. Ungefähr ein Drittel der Fragen sind durch „neue“ ersetzt worden. Die Kommentare der Aussagen sind verbessert und teilweise erweitert worden. Die Fragen sind dem Stil der bundesweiten Prüfung angepasst worden.
Die MC-Fragen der bundesweiten Prüfungen sind in den letzten Jahren fairer geworden, die exotischen und teilweise nicht zu lösenden Fragen kommen dagegen seltener vor. Trotzdem ist es unerlässlich, sich einem ausgedehnten Training im Umgang mit MC-Fragen zu unterziehen, um die Prüfung im ersten Anlauf zu bestehen.
Ich empfehle Ihnen, in den letzten vier Wochen vor dem Prüfungstermin 30–40 Prüfungen (gesamte Prüfung à 60 Multiple-Choice-Fragen) durchzuarbeiten. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn Sie das Wissen aus allen Prüfungsthemen kennen und fleißig geübt haben.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lernen und viel Glück für Ihre Prüfung.
Gummersbach, Juni 2013
Arpana Tjard Holler
Einleitung
Die Prüfung – der Weg zum Heilpraktiker
Immer mehr Menschen interessieren sich heute mit einem größeren Bewusstsein für das Heil-Werden.
Ausschließlich schulmedizinische Wege zur Gesundung werden mehr und mehr angezweifelt. Vielseitige alternative Heilmethoden − kombiniert mit alten Hausmitteln und der Schulmedizin − sind hingegen ein erstrebenswertes Ziel.
Der Ansatz des Heilpraktikers ist die Gesinnung, wobei die unerlässliche Voraussetzung zum Heilen eine fundierte medizinische Ausbildung ist, nicht nur für die Überprüfung vor dem Amtsarzt, sondern auch für die Sorgfaltspflicht: Krankheiten auf der körperlichen Ebene zu erkennen und fachgerecht zu entscheiden, ob eine alternative Heilmethode im Moment angebracht ist oder ob als Erstversorgung bei einem Notfall der Patient in die Hände eines Arztes gehört. Ein verantwortungsvoller Heilpraktiker verneint die Allopathie nicht grundsätzlich. Um den Menschen ganzheitlich auf allen Ebenen − der körperlichen, geistigen und seelischen Ebene − zu helfen, bedarf es einer intensiven Eigenentwicklung. Das Erkennen der eigenen Stärken und Schwächen sowie das liebevolle Akzeptieren der eigenen Person ist der Weg zum guten Heilpraktiker.
Die steigenden Anforderungen der amtsärztlichen Prüfung lehren den angehenden Heilpraktiker selbst seinen Weg zu gehen, der entspannte Ausdauer, positive Einstellung, Glaube an sich selbst, Selbstdisziplin und absolute Fokussierung beinhaltet. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Lernphase auf die Prüfung eine der wichtigsten Erfahrungen für mich war. Viele Ängste, Zweifel wechselten mit lebendiger Freude an der Sache. Nach jeder zähen Phase kamen eine noch stärkere Lust und eine Klarheit über den Weg, den ich gehen wollte. Im Nachhinein sehe ich diese Wegstrecke als positive Erfahrung, denn die Verantwortung und der Umgang mit den Patienten werden im Alltag viele Prüfungen und Anforderungen an uns stellen. Diesen Anforderungen können wir nur dann gewachsen sein, wenn wir selbst auf allen Ebenen unseren Weg gegangen sind.
Die Ausbildung wird von den meisten HP-Anwärtern berufsbegleitend gewählt, ein schwieriger Weg, der eine kontinuierliche Eigenarbeit des breiten Lehrstoffes bedeutet. Nach Beendigung der schulischen Ausbildung erfolgt die Vorbereitung auf die Prüfung, erst jetzt können alle Zusammenhänge erfasst werden. Bei der momentanen Prüfungssituation empfiehlt es sich, zum Ende hauptsächlich mit MC-Fragen zu lernen. Der Umgang mit MC-Fragen kann durch häufiges Üben erlernt werden, es erfolgt eine gewissen Routine. In den letzten Jahren wurde der Schwierigkeitsgrad der Prüfungsfragen stetig angehoben, der Heilpraktiker erlangt so ein immer höheres Niveau. Wahrscheinlich aus politischen Gründen finden sich in jeder Prüfung so genannte Exotenfragen, die über das Stoffgebiet hinausgehen. Zu empfehlen ist das Lesen von Auslagebroschüren aus Apotheken, Gesundheitsämtern und Arztpraxen. Themen aus der Kinderheilkunde und der Krankengymnastik waren ebenfalls in den letzten Prüfungen zu finden. Der richtige Weg ist in diesem Fall die Akzeptanz und nicht die Frage „Was soll das?“. Der Heilpraktiker von heute hat ein breites und tiefes Wissen, das führt gesellschaftlich zu einem höheren Status. Die Unbedenklichkeitserklärung (keine Gefahr für die Bevölkerung) nach Bestehen der Prüfung wird der Anforderung sicherlich nicht gerecht.
Voraussetzung für einen erfolgreichen Weg sind die richtige individuelle Schule, Ausdauer, Lust an der Thematik und ein großer privater Freiraum während der Ausbildung. Partner und Familie sollten ebenfalls auf die Belastung vorbereitet sein. Vor allem in der Vorbereitung auf die Prüfung sind die Unterstützung und das Verständnis der Mitmenschen von großer Notwendigkeit. Bitte gehen Sie nur zur Prüfung, wenn Ihr Umfeld und die familiäre Situation gefestigt und belastbar sind. Ein Aufschieben der Prüfung ist immer möglich und in verschiedenen Situationen empfehlenswert. Ich selber habe von meinem Partner und meinen Kindern absolute Rückendeckung bekommen und konnte mich fokussiert vorbereiten.
Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, die schriftliche sowie die mündliche Prüfung beim ersten Anlauf zu bestehen. Sehr hilfreich sind Lerngruppen; gegenseitige Hilfestellung im Lernstoff sowie psychische Unterstützung erleichtern die Vorbereitung. Ebenfalls ist am Ende der Ausbildungszeit eine Prüfungsvorbereitung (Repetitorium) zu empfehlen. Erkennen von Stofflücken sowie eine mündliche Wiedergabe vor einer fremden Gruppe helfen die Prüfungsangst zu meistern. Durch die meist monatelange sitzende Haltung ist ein Ausgleich für den Körper sehr wichtig. Sport, Yoga und Autogenes Training helfen dem Lernenden im Gleichgewicht zu bleiben. Ein klarer Geist und Kraft kann auch durch stille und/oder dynamische Meditationen gewonnen werden. Zur Unterstützung biete ich im Folgenden einige homöopathische Mittel und Bachblüten an. Ich wünsche allen Anwärtern eine schöne Lernzeit und eine erfolgreiche Prüfung – und vergessen Sie nicht, auch diese harte Zeit zu genießen und zu würdigen. Fokussierung hat etwas Meditatives.
Gyata Ulrike Ohletz
HP-Praxis
Fleiner Straße 7
74388 Talheim
Einige Hilfsmittel für die Prüfung(svorbereitung)
Homöopathische Mittel (D 30/C 200)
Anacardium orientale
Das anerzogene Versagen.
Der Anacardium-Patient hat gut gelernt, aber seine Nerven flattern vor der Prüfung, weil er im tiefen Inneren davon überzeugt ist, nichts Gutes schaffen zu können.
Argentum nitricum
Kurz vor der Prüfung: „Ich gehe heute nicht zur Prüfung“ − nichts kann ihn umstimmen, außer eine Gabe Argentum nitricum C 1000.
Gelsemium
Dem Gelsemium-Patienten geht es bei der Prüfung um Leben und Tod, er ist gut vorbereitet und möchte die Prüfung gerne bewältigen. In der Prüfung hat er auf einmal eine dunkle Leere in seinem Gehirn.
Ignatia
Die Angst vor dem Versagen wird immer größer, bis er fast hysterisch wird. Der Ignatia-Patient will es gut machen, will Anerkennung (Vater). Ignatia befürchtet, dass genau das in der Prüfung vorkommt, was er nicht gelernt hat. Das Schicksal kann zuschlagen und seine Befürchtungen bewahrheiten, und so ist Ignatia für die nächste Prüfung noch negativer vorprogrammiert.
Silicea
Geringes Durchhaltevermögen, geistige Erschöpfung. Silicea flüchtet sich in eine weinerliche, selbstmitleidige Stimmung und braucht Schutz und Unterstützung von anderen.
Lycopodium
Lycopodium ist geistig sehr aktiv, doch im Moment sehr verwirrt. Lycopodium hat die Tendenz, Schwäche zu überspielen und sich souverän zu geben. Lycopodium ist reizbar und starrköpfig.
Bach-Blütenmittel
White Chestnut (Nr. 35)
White Chestnut ist verbunden mit den Seelenqualitäten der geistigen Ruhe und der Unterscheidungsfähigkeit. Negativer Zustand: Opfer falsch verstandener, unpassender Gedankenkonzepte. Nachts: ständiges Gedankenkarussell, ständige innere Dialoge. White Chestnut hilft von der Gedankenwelt in die Realität zu kommen und Wichtiges vom Unwichtigen zu trennen. White Chestnut wird gebraucht, wenn das Interesse der gegenwärtigen Situation nicht stark genug ist, um die ganze Kraft zu konzentrieren.
Gentian (Nr. 12)
Unsicherheit durch Mangel an Glauben, der ewige Skeptiker; er scheint seinen Pessimismus fast zu genießen. Unvorhergesehene Schwierigkeiten entmutigen leicht. Gentian bringt Zuversicht, den Glauben an sich selbst und die Gewissheit, dass sich Schwierigkeiten meistern lassen und zum Leben gehören.
Clematis (Nr. 9)
Die Realität ist nicht sonderlich attraktiv, daher zieht sich der Clematis-Patient in seine Luftschlösser zurück. Er wirkt gedankenverloren, ist zerstreut und unaufmerksam, träumt mit offenen Augen und ist selten ganz da. Auf der körperlichen Ebene ist meist wenig Energie vorhanden: kalte Extremitäten und leerer Kopf, die lebhafte Innenwelt lässt nicht viel Konzentrationskraft übrig.
Larch (Nr. 19)
Seelenqualität des Selbstvertrauens. Larch ist von seiner Unfähigkeit überzeugt, haftet sehr an negativen Erfahrungen. Der Larch-Patient hat Minderwertigkeitsgefühle und die Erwartung zu versagen, obwohl er meist fähiger ist als andere. Larch hilft, ungenutzte Fähigkeiten zu nutzen und die Dinge lockerer zu sehen.
Elm (Nr. 11)
Elm berührt das Prinzip der Verantwortlichkeit. Elm-Patienten haben in Erschöpfungszuständen das Gefühl, den Anforderungen nicht mehr gerecht zu werden. Bei Elm ist der Zustand der totalen Überforderung immer ein Momentzustand. Elm gibt den Starken Kraft in den Momenten ihrer Schwäche, das homöopathische Riechsalz.
Erläuterungen der Fragentypen
Zurzeit gibt es drei Fragentypen: Einfachauswahl, Aussagenkombination und Mehrfachauswahl.
Bei der Einfachauswahl darf unter fünf Aussagen nur ein Buchstabe angekreuzt werden. Beispiel:
Einfachauswahl
Welches der folgenden Vitamine ist notwendig für die Bildung von Gerinnungsfaktoren in der Leber?
Vitamin D
Vitamin K
Vitamin B12
Vitamin A
Vitamin B1
Hier darf nur ein Buchstabe angekreuzt werden (b ist richtig). Kreuzen Sie mehr an, gilt die Frage als falsch.
Bei der Aussagenkombination müssen fünf Aussagen zu einem bestimmten Thema nach ihrer Richtigkeit beurteilt werden. In den darauf folgenden Kombinationen A–E werden Lösungsvorschläge angeboten, von denen Sie eine richtig wählen müssen. Beispiel:
Aussagenkombination
Welche der folgenden Aussagen zum Lungenemphysem treffen zu?
Das Lungenemphysem kann das rechte Herz belasten.
Das Lungenemphysem ist eine irreversible Erweiterung der Bronchien.
Das Lungenemphysem hat als Hauptursache das Rauchen.
Das Lungenemphysem kann häufig zu akuten Atemwegsinfekten führen.
Das Lungenemphysem ist heilbar.
Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig.
Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig.
Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig.
Alle Aussagen sind richtig.
Auch hier darf nur ein Buchstabe gewählt werden (b ist richtig).
Bei dem Fragentyp Mehrfachauswahl dürfen Sie unter fünf Aussagen zwei richtige wählen.
Die Aufgabe wird dann als richtig beantwortet gewertet, wenn Sie die zwei zutreffenden Antworten ausgewählt haben und keine der nicht zutreffenden Antworten angekreuzt wurden. Beispiel:
Mehrfachauswahl
Welche der folgenden Aussagen zum Gehirnschlag treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten!
Ein blutiger Insult lässt sich anhand der Symptome von einem ischämischen Insult unterscheiden.
Die meisten der Patienten sterben an einem Gehirnschlag.
Vorhofflimmern ist ein gefährlicher Risikofaktor für einen Schlaganfall.
Ein Schlaganfall ist eine plötzliche Minderversorgung des Gehirns mit Blut.
Diabetes gilt nicht als Risikofaktor für einen Gehirnschlag.
Wenn Sie nur eine Antwort gewählt haben, wird die Aufgabe als falsch bewertet. Wenn Sie eine Antwort richtig und eine falsch gewählt haben, wird die Aufgabe als falsch bewertet (c und d sind richtig).
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 5. Auflage
Einleitung
Die Prüfung – der Weg zum Heilpraktiker
Einige Hilfsmittel für die Prüfung(svorbereitung)
Homöopathische Mittel (D 30/C 200)
Bach-Blütenmittel
Erläuterungen der Fragentypen
1 Bewegungsapparat
2 Blut und Lymphe
3 Herz und Kreislauf
4 Respirationstrakt
5 Gastroenterologie
6 Stoffwechsel
7 Harnapparat
8 Neurologie
9 Endokrinologie
10 Sinnesorgane (Auge/Ohr/Haut)
11 Geschlechtsorgane
12 Infektionen
13 Notfall
14 Psychiatrie und Neurosenlehre
15 Differenzialdiagnose
16 Gesetze und Sonstiges
Autorenvorstellung
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
1Bewegungsapparat
1
Aussagenkombination
Welche der folgenden Aussagen zur Wirbelsäule in Bezug zu Wirbelsäulenabschnitt und Anzahl der Wirbel treffen zu?
Die physiologische Krümmung der 5 Halswirbel ist die Lordose.
Die physiologische Krümmung der Brustwirbelsäule ist die Kyphose.
Die 5 miteinander verschmolzenen Kreuzbeinwirbel zeigen auch eine physiologische Krümmung auf.
Die physiologische Krümmung der 5 Lendenwirbel ist die Lordose.
Die Brustwirbelsäule besitzt 11 Wirbel.
Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig.
Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig.
Alle Aussagen sind richtig.
Die Lösung B ist richtig.
Folgende physiologische Krümmungen der Wirbelsäule gibt es: Halslordose – Brustkyphose – Lendenlordose – Sakralkyphose.
Zu 1: Die physiologische Krümmung der Halswirbel ist die Lordose, jedoch zeigt die HWS 7 Wirbel und nicht 5.
Zu 2: Die Wirbel der Brustwirbelsäule sind nach dorsal verschoben und zeigen so eine Kyphose.
Zu 3: Hier handelt es sich um die Sakralkyphose.
Zu 4: Die Wirbel der Lendenwirbelsäule sind nach ventral (in Richtung Bauch) verschoben und zeigen so eine Lordose.
Zu 5: Die Brustwirbelsäule besitzt 12 Wirbel und nicht 11.
2
Aussagenkombination
Welche der folgenden Aussagen zur Patella treffen zu?
Die Patella ist das größte Sesambein des Körpers.
Die Patella ist am Kniegelenk mit beteiligt.
Die Patella ist von der Rückseite her mit hyalinen Knorpeln überzogen.
Die Innenbänder des Kniegelenks sind teilweise mit der Patella verwachsen.
Die Kreuzbänder des Kniegelenks sind teilweise mit der Patella verwachsen.
Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig.
Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig.
Alle Aussagen sind richtig.
Die Lösung B ist richtig.
Zu 1: Ein Sesambein ist ein sog. Schaltknochen, ein in eine Sehne eingebauter Knochen. Die Patella ist sicherlich das größte Sesambein im Körper. Sie befindet sich in der Sehne des M. quadriceps und hat die Aufgabe, das Kniegelenk in der Beugestellung zu schützen. Kleinere Sesambeine finden sich in den Sehnen der Hand und des Fußes.
Zu 2: Am Kniegelenk ist neben Femur und Tibia auch die Patella beteiligt.
Zu 3: Alle an einem echten Gelenk beteiligten Knochenteile sind mit einem Gelenkknorpel ausgestattet.
Zu 4: Die Seitenbänder verbinden den Oberschenkelknochen mit dem Schienbein und stabilisieren die beiden Knochen im gestreckten Zustand.
Zu 5: Die Kreuzbänder sind mit den Menisken verwachsen. Sie verhindern ein Auseinanderschieben der beiden am Gelenk beteiligten Knochen im gebeugten Zustand.
3
Aussagenkombination
Welche der folgenden Aussagen zur Ausführung und Dokumentation des Lasègue-Zeichens treffen zu?
Das Lasègue-Zeichen wird in Winkelgrad-Einheiten dokumentiert.
Das Knie bleibt während der Ausführung gebeugt.
Der Patient sitzt während der Überprüfung und stützt sich mit den Händen auf.
Das Lasègue-Zeichen ist ein Zeichen des Dehnungsschmerzes.
Das Lasègue-Zeichen ist positiv bei manifester Meningitis.
Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig.
Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig.
Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig.
Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig.
Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig.
Die Lösung D ist richtig.
Zu 1: Das Lasègue-Zeichen wird in Winkelgrad-Einheiten gemessen, und zwar von der Liege bis zum gebeugten Bein. Je kleiner der Winkelgrad ist, desto größer ist die Einklemmung des Ischiasnervs.
Zu 2: Der Patient soll das gestreckte Bein aktiv anheben, beim gebeugten Knie wird die Dehnung des Nervs bzw. der Meningen nicht erreicht.
Zu 3: Die Untersuchung erfolgt am liegenden Patienten.
Zu 4: Beim aktiven Heben eines gestreckten Beins werden Nerven sowie die Meningen gedehnt. Bei bestehender Kompression eines Spinalnervs oder bei entzündeten Hirnhäuten entstehen infolge der Anhebung des gestreckten Beins heftige Schmerzen. Die Muskulatur verhindert eine weitere Streckung.
Zu 5: Das Lasègue-Zeichen kann neben dem lumbalen Bandscheibenvorfall bzw. Ischiassyndrom auch bei Reizung der Meningen (Meningismus) Auskunft geben. Allerdings ist dann das Lasègue-Zeichen beidseits positiv.
4
Einfachauswahl
Wie ist die Funktion des M. iliopsoas?
Streckung des Kniegelenks
Kippen des Beckens nach vorne
Abduktion des Oberschenkels
Beugung des Knies
Die Lösung B ist richtig.
Zu A: Die Streckung des Kniegelenks erfolgt durch den M. quadriceps (vierköpfiger Oberschenkelmuskel).
Zu B: Der M. iliopsoas führt zur Beugung und Drehung im Hüftgelenk.
Zu C: Die bekanntesten Abduktoren des Oberschenkels sind die Glutealmuskeln (M. glutaeus maximus, M. glutaeus minimus, M. glutaeus medius).
Zu D: Die Beugung im Kniegelenk wird von verschiedenen Muskeln erzielt: z.B. M. biceps femoris, M. sartorius und M. semitendinosus.
5
Mehrfachauswahl
Welche Knochen sind am oberen Sprunggelenk beteiligt? Wählen Sie drei Antworten!
Talus (Sprungbein)
Kalkaneus (Fersenbein)
Tibia (Schienbein)
Fibula (Wadenbein)
Os naviculare (Kahnbein)
Die Lösungen A, C und D sind richtig.
Zu A: Das Sprungbein sitzt oberhalb des Fersenbeins und lässt zusammen mit dem Schien- und Wadenbein ein Scharniergelenk entstehen.
Zu B: Das Fersenbein ist am unteren Sprunggelenk beteiligt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!