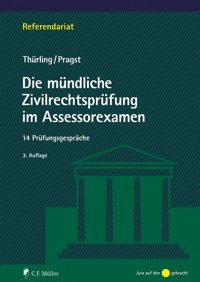
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch wendet sich an Rechtsreferendare, die sich effektiv auf die bevorstehende mündliche Examensprüfung im Zivilrecht vorbereiten wollen. 14 Prüfungsgespräche simulieren eine Gesprächssituation zwischen Prüfer und Kandidaten und informieren anschaulich über den typischen Verlauf des mündlichen Assessorexamens. Der Einstieg in die Prüfung wird jedes Mal neu gewählt, damit die Falllösung aus Sicht eines Anwalts oder Richters und die Verknüpfung von materiellem und Verfahrensrecht geübt werden kann. Die (teils) examenserprobten Fälle vermitteln einen guten Einblick in die Prüfungswirklichkeit. Themenübersichten sind den Fällen vorangestellt und bieten Orientierung; angefügte Vertiefungshinweise eignen sich zur raschen Wiederholung und Festigung des Wissens. Julia Thürling und Robert Pragst sind Richter in Berlin. Robert Pragst leitet Referendar-Arbeitsgemeinschaften im Zivilrecht und verfügt über langjährige Erfahrung als Prüfer im Zweiten juristischen Staatsexamen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die mündliche Zivilrechtsprüfung im Assessorexamen
14 Prüfungsgespräche
von
Julia ThürlingRichterin am Amtsgericht, Berlin
und
Robert PragstVizepräsident des AG Lichtenberg, Berlin
3., überarbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Herausgeber
Thürling/Pragst · Die mündliche Zivilrechtsprüfung im Assessorexamen
Autoren
Julia Thürling ist seit Anfang 2015 Richterin in Berlin. Beide Staatsprüfungen bestand sie mit der Note „gut“; das Zweite Staatsexamen schloss sie als Beste ihrer Prüfungskampagne der Länder Berlin und Brandenburg ab.
Robert Pragst ist Vizepräsident des Amtsgerichts Lichtenberg. Zuvor war er dort war jahrelang als aufsichtsführender Richter u.a. für die Aus- und Fortbildung zuständig. Er war lange Jahre Prüfer im Mündlichen Zweiten Staatsexamen. Herr Pragst ist außerdem Referendararbeitsgemeinschaftsleiter seit mehr als 10 Jahren. Zum Thema Berufseinstieg für Staatsanwälte bzw. Richter hat er die Bücher „Verurteilt“ und „Auf Bewährung“ geschrieben.
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-6860-3
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 6221 1859 599Telefax: +49 6221 1859 598
www.cfmueller.de
© 2025 C.F. Müller GmbH, Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des e-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine e-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
Das vorliegende Buch enthält 14 Prüfungsgespräche aus dem Bereich des Zivilrechts, die eine mündliche Prüfung realitätsnah simulieren, allerdings mit der Besonderheit, dass der fiktive Kandidat sich häufig durch überdurchschnittlich gute Antworten auszeichnet. Dies ist allein didaktischen Erwägungen geschuldet. Der fiktive Kandidat ist jedoch keineswegs allwissend. Ist er unsicher oder auf der falschen Fährte, gibt der Prüfer Hilfestellungen – so wie in der tatsächlichen mündlichen Prüfung. Die weit überwiegende Zahl der Prüfer wird den Prüflingen in der Realität sehr wohlwollend gegenübertreten.
Die Gespräche vermitteln vor allem einen Eindruck von typischen Gesprächssituationen. In der Praxis können Prüfungsgespräche im Einzelfall ganz unterschiedlich verlaufen, je nach den persönlichen Vorlieben des Prüfers. Im Regelfall wird jedoch zum Einstieg ein Fall geschildert, der dem Prüfer zum Beispiel in seiner Praxis oder beim Korrigieren von Klausuren aus der aktuellen Kampagne begegnet ist (erkundigen Sie sich deshalb bei Kollegen, welche Themen in den Examensklausuren behandelt wurden, als Sie in Ihrer Wahlstation waren). Im Laufe des Gesprächs wird dann der Fall weiterentwickelt oder abgewandelt. Aus dem Gespräch ergeben sich häufig weitere Fragen des Prüfers.
Deshalb dienen die Gespräche nicht primär der Wissensvermittlung, solide Grundkenntnisse werden vielmehr vorausgesetzt. Ein erwünschter Nebeneffekt ist jedoch die Wiederholung und Vertiefung von Wissen; vielleicht werden Sie angeregt, sich mit bestimmten Themen noch einmal auseinander zu setzen. Der optimale Zeitpunkt zum Durcharbeiten des Buches ist deshalb die direkte Vorbereitung auf die schriftliche oder mündliche Prüfung, wenn Sie sich auf Ihrem „Wissenshöhepunkt“ befinden.
Die Gespräche decken die – aus Sicht der Autoren – wichtigsten Themen aus den Bereichen des materiellen Rechts und des Prozessrechts ab, die in mündlichen Prüfungen im Zweiten Staatsexamen immer wieder vorkommen. Die Themen wurden dabei nach Examensrelevanz ausgesucht, d.h. es ist gewollt, dass manche Themen mehrfach auftauchen und andere fast gänzlich ausgespart werden, wie etwa Sachenrecht und Zwangsvollstreckungsrecht. Fälle aus diesen Rechtsgebieten beinhalten regelmäßig komplexe Sachverhalte, die sich nicht für eine mündliche Prüfung eignen.
Die Fälle behandeln zum Teil Probleme aus der jüngeren Rechtsprechung bzw. Literatur und zum Teil klassische, immer wiederkehrende juristische Fragestellungen. Alle Fälle sind so gewählt, dass juristisches Argumentationsvermögen, Methodik und solide Grundlagenkenntnis geprüft werden können. Jedes der Prüfungsgespräche enthält sowohl leichtere als auch schwierigere Fragen. Letztere sind oftmals daran zu erkennen, dass auch unser fiktiver Kandidat nicht weiter weiß und der Prüfer Hilfestellungen gibt.
Das Buch kann auf zwei Arten durchgearbeitet werden:
•
In einer privaten Lerngruppe werden die Gespräche simuliert, wobei jeder mal die Rolle des Prüfers und die des Kandidaten einnimmt. Alternative Lösungen können hier direkt gemeinsam diskutiert werden.
•
Wer lieber allein lernt, dem sei geraten, zunächst die Antworten abzudecken und selbst zu versuchen, die Fragen zu beantworten. Dies ist wesentlich effektiver, als direkt die Antworten zu lesen.
Die Fälle bauen in gewisser Weise aufeinander auf. Fragen aus früheren Gesprächen tauchen in späteren Fällen nicht mehr auf, auch wenn sie sich thematisch angeboten hätten. Deswegen wird empfohlen, die Gespräche möglichst der Reihe nach durchzuarbeiten. Es ist aber auch möglich, zielgerichtet einen Fall zu einem bestimmten Thema herauszugreifen, da die einzelnen Fälle selbstständig und in sich geschlossen sind.
Wenn Sie bei bestimmten Themen noch Unsicherheiten zeigen, sollten Sie die Vertiefungshinweise zur Nacharbeit nutzen. In jedem Fall sollten Sie genannte Rechtsnormen aufschlagen und lesen. Zur Vertiefung sind vor allem Aufsätze angeführt, da diese in ihrer komprimierten Form bestens zur schnellen Wiederholung eines Themas geeignet sind und eine abwechslungsreiche Alternative zum klassischen Lehrbuch darstellen.
Berlin, im März 2025
Julia ThürlingRobert Pragst
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Fall 1
Die verlorene Handtasche
Fall 2
„Feindliches Grün“
Fall 3
Der australische Zwillingsbruder
Fall 4
Der Vorschaden
Fall 5
Der schnelle Prozess
Fall 6
Kein Parkett für flotte Sohlen
Fall 7
Schlüsselerlebnis
Fall 8
Kein Anschluss unter dieser Nummer
Fall 9
Angebot ohne Nachfrage
Fall 10
Werkvertragliche Leistungskette
Fall 11
Hundeelend
Fall 12
Doppelte Enttäuschung
Fall 13
Aus für den Hundesalon?
Fall 14
Wo ist der Grabstein?
Fall 1Die verlorene Handtasche
Materielles Recht:
Gesetzliche Schuldverhältnisse (Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, Fund, Deliktsrecht, Anwartschaftsrecht, Haftungsmaßstab)
Prozessrecht:
Streitgenossenschaft, Zuständigkeit, prozesstaktische Erwägungen aus Klägersicht
Prüfer:
Sie sind zugelassener Rechtsanwalt.
Wimmer betritt aufgeregt ihre Kanzleiräume anlässlich einer Erstberatung und berichtet von folgendem Vorgang:
Vor drei Monaten hatte er im Gesundbrunnen-Center in Berlin-Wedding in der Tiefgarage geparkt. Im Erdgeschoss kaufte er sich bei der „Asia-Imbiss-GmbH“ etwas zu essen, bezahlte und ließ dabei seine schwarze Handtasche am Tresen liegen. Darin befand sich neben dem Personalausweis sein iPhone, das er vor zwei Jahren neu für 600 € von der Deutschen Telekom AG unter Eigentumsvorbehalt erworben hatte. Von den 36 Monatsraten sind noch 12 Raten offen.
5 Minuten nach Verlassen des Imbiss bemerkte Herr Wimmer in der Tiefgarage das Fehlen der Tasche und erinnerte sich sofort daran, dass er sie auf dem Tresen liegen gelassen hatte. Er eilte sofort zurück. Die Angestellte Frau Ming erklärte ihm auf Nachfrage, dass sie die Tasche gefunden und dann hochgehalten habe. Dabei habe sie gefragt, wem die Tasche gehöre. Zwei Frauen hätten sich daraufhin gemeldet, die Tasche genommen und seien verschwunden. Herr Wimmer holte einen Polizeibeamten, demgegenüber Frau Ming ihre Aussage wiederholte. Konkrete Einzelheiten zum Aussehen der Frauen konnte sie nicht machen.
Nachdem das Strafverfahren gegen die unbekannten Frauen und gegen Frau Ming (Letzteres mangels Vorsatz) eingestellt wurden, begab sich Herr Wimmer in den Asia-Imbiss und verlangte von Frau Ming Schadensersatz. Diese stritt nunmehr ab, eine Handtasche gefunden zu haben. Herr Wimmer ist von Frau Ming (die im Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts Charlottenburg wohnt) schwer enttäuscht und findet, dass sie Schadenersatz leisten müsste. Er wünscht erstmal nur eine umfassende Beratung bzgl. des weiteren Vorgehens. Das Gesundbrunnen-Center befindet sich im Sprengel des Amtsgerichts Wedding.
Wie gehen Sie den Fall an?
Kandidat 1:
Zunächst ist das Mandantenziel zu ermitteln. Dabei sind nicht nur Schadensersatzansprüche gegen Frau Ming, sondern auch solche gegen die „Asia-Imbiss“ GmbH zu prüfen. Der Mandant ist zwar insbesondere über Frau Ming verärgert, hat jedoch Ansprüche gegen die GmbH nicht ausgeschlossen.
Prüfer:
Richtig.[1] Warum ist auch die Prüfung von Ansprüchen gegen die Asia GmbH von besonderer Bedeutung?
Kandidat 2:
Die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die GmbH könnte insbesondere den wirtschaftlichen Vorteil bieten, dass diese Ansprüche eher realisiert werden können, als gegen eine einfache Angestellte, deren Einkommen die Pfändungsfreigrenzen nicht überschreitet.
Prüfer:
Ganz genau. Gut gesehen.[2] Fangen wir mit Ansprüchen gegen Frau Ming an. Wie sieht es denn da aus?
Kandidat 3:
Es könnte ein deliktischer Anspruch bestehen …
Prüfer:
Das ist zutreffend, jedoch würde ich gern in der Prüfungsreihenfolge Vertrag, Vertrauen, Gesetz bleiben. Gibt es vertragliche Ansprüche?[3]
Kandidat 3:
Ein vertraglicher Anspruch gegen Frau Ming dürfte ausscheiden, da Herr Wimmer lediglich einen Bewirtungsvertrag mit der „Asia-Imbiss“ GmbH geschlossen hat. Der Arbeitsvertrag von Frau Ming dürfte keinen Vertrag mit Schutzwirkung zu Gunsten der jeweiligen Kunden darstellen, zumal diese eigene vertragliche Ansprüche gegen die GmbH haben können. Auch Ansprüche aus Vertrauenstatbeständen sind nicht ersichtlich.
Prüfer:
Das stimmt. Wie sieht es mit gesetzlichen Ansprüchen aus?
Kandidat 4:
Hier wäre nun ein Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB zu prüfen …
Prüfer:
Sehen Sie noch speziellere Schuldverhältnisse, die vorrangig geprüft werde könnten?
Kandidat 4:
Es könnte über einen Anspruch aus §§ 989, 990 BGB nachgedacht werden. Ein solcher Anspruch dürfte mangels Vorliegen eines Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses ebenfalls ausscheiden. Die Angestellte Frau Ming stellt lediglich eine Besitzdienerin gemäß § 855 BGB dar. Als Besitzer kommt somit nur die GmbH in Betracht.
Prüfer:
Sehr gut. Kommt noch ein weiteres gesetzliches Schuldverhältnis in Betracht? Frau Ming hat die Tasche doch irgendwie „gefunden“.
Kandidat 1:
Vielleicht das Fundverhältnis nach §§ 965 ff. BGB?
Prüfer:
Sehr richtig. Und?
Kandidat 1:
Ansprüche aus §§ 965 ff. i.V.m. § 280 Abs. 1 BGB scheiden ebenfalls aus, da kein gesetzliches Fundverhältnis entstanden ist. Die Handtasche war nicht herrenlos. Hinsichtlich der Gewahrsamsverhältnisse ist auf die tatsächliche Sachherrschaft nach den Anschauungen des täglichen Lebens abzustellen. Danach war der Imbissinhaber (Asia GmbH) mit seinem generellen Herrschaftswillen oder sogar noch Herr Wimmer, der sich nur kurz entfernt hatte und dem der Ort der Handtasche sogleich erinnerlich war, Gewahrsamsinhaber.
Prüfer:
Das sehe ich ganz genauso. Bleibt also der § 823 Abs. 1 BGB. Besteht denn danach ein Anspruch gegen Frau Ming?
Kandidat 2:
Als sonstiges Recht ist das Anwartschaftsrecht an dem iPhone im Rahmen des § 823 Abs. 1 BGB allgemein anerkannt. Mit der Herausgabe an die unbekannten Frauen dürfte Frau Ming eine zurechenbare rechtswidrige Ursache für den Schaden gesetzt haben. Zwar bestreitet sie den Vorwurf, jedoch dürfte im Rahmen der Beweisprognose der Polizeibeamte als neutraler Zeuge eine Überzeugung beim Gericht vermitteln können. Das Handeln dürfte fahrlässig und damit schuldhaft erfolgt sein. Irgendeine Art Legitimationsprüfung hätte durchgeführt werden müssen.
Prüfer:
Haftet Frau Ming denn für jede Form der Fahrlässigkeit?[4]
Kandidat 4:
Zwar liegt kein Fundverhältnis vor. Aufgrund der altruistischen Handlungsweise der Frau Ming könnte jedoch der gemilderte Haftungsmaßstab des § 968 BGB für den „Scheinfinder“ analog geltend.
Prüfer:
Sehr guter Einfall. Was versteht man denn unter grober Fahrlässigkeit?
Kandidat 3:[5]
Wenn Sorgfaltspflichten verletzt werden, die jedermann einleuchten müssen.
Prüfer:
Und liegt grobe Fahrlässigkeit vor?
Kandidat 3:
Irgendeine Art Legitimationsprüfung durchzuführen und dazu mal nach dem Inhalt der Tasche zu fragen, muss jedem einleuchten.
Prüfer:
Gut. Könnte dem Anspruch sonst noch etwas entgegenstehen?
Kandidat 1:
Es steht auch ein Mitverschulden des Herrn Wimmer gem. § 254 BGB im Raum, der durch das Liegenlassen eine Mitursache gesetzt hat.
Prüfer:
Und würden Sie den Anspruch kürzen?
Kandidat 1:
Vielleicht um 50 %?
Prüfer:
Halte ich für gut vertretbar. Wie sieht es denn mit Ansprüchen gegen die Asia GmbH aus?
Kandidat 2:
Ein vertraglicher Anspruch dürfte sich aus dem Bewirtungsvertrag als gemischtem Vertrag mit Schwerpunkt im Werklieferungsvertrag gem. §§ 241, 651a, 280 Abs. 1 BGB wegen Nebenpflichtverletzung ergeben. Zumindest beim Auffinden entstehen besondere Obhutspflichten.
Prüfer:
Gut vertretbar. Kommen noch weitere Anspruchsgrundlagen in Betracht?
Kandidat 2:
Darüber hinaus kommt ein Anspruch aus § 831 BGB wegen fehlender Belehrung der Verrichtungsgehilfin in Betracht.
Prüfer:
Gut, dann gibt es also nach unserer Lösung gegen Frau Ming und die Asia GmbH Ansprüche. Bei Frau Ming ist vielleicht wirtschaftlich nichts zu holen und möglicherweise ist der Anspruch ihr gegenüber nach Ansicht des zuständigen Gerichts analog § 968 BGB ausgeschlossen. Das Gericht kann das mit der groben Fahrlässigkeit schließlich auch anders beurteilen. Beide Ansprüche könnten gem. § 254 BGB hälftig zu kürzen sein. Welche Schritte leiten Sie ein?
Kandidat 3:
Es sollte aufgrund der wirtschaftlichen Prognose in jedem Falle die Asia-Imbiss GmbH verklagt werden. Ein Abzug von Mitverschulden sollte nicht erfolgen, da insofern gute Chancen bestehen, dass das Gericht keine Kürzung gem. § 254 BGB vornimmt.
Prüfer:
Finde ich vom Ausgangspunkt her richtig. Ob und inwieweit das Gericht eine Kürzung vornimmt, kann letztlich nicht genau vorausgesagt werden. Der Mandant kann über das Kostenrisiko bei höherem Streitwert und einer drohenden Verlustquote belehrt werden. Aber sollte nicht auch Frau Ming verklagt werden?
Kandidat 4:
Ja. Es könnte zwar zu einer Klageabweisung wegen § 968 BGB analog kommen. Auch ist insofern die wirtschaftliche Realisierung der Forderung fraglich und es entstehen weitere Kostenrisiken, insbesondere wenn sie einen weiteren Rechtsanwalt mandatiert. Jedoch können beide Beklagte beim Amtsgericht Wedding im Gerichtsstand des § 32 ZPO verklagt werden. Vertragliche Ansprüche sind aufgrund des einheitlichen Streitgegenstandes insofern mit zu prüfen. Das ergibt sich aus § 17 Abs. 2 S. 1 GVG. Daher entstehen die Gerichtsgebühren auf Klägerseite nur einmal und es kommt nicht zu einer Erhöhung des Gebührenstreitwertes.
Prüfer:
Die Klage gegen beide als Gesamtschuldner scheint tatsächlich der beste Weg zu sein. Sieht jemand noch einen weiteren Vorteil?
Kandidat 4:
Außerdem kann so verhindert werden, dass Frau Ming als Zeugin im Prozess mit der GmbH aussagt, wodurch sich die Prozessrisiken bzgl. der Beweisaufnahme verbessern könnten. Daher stellt die Klage gegen beide Beklagte den deutlich sicheren Weg dar. Das leicht erhöhte Prozesskostenrisiko muss demgegenüber zurücktreten.
Prüfer:
Das lässt sich hören. Letzte Frage: Von den Raten an die Telekom AG sind erst 2/3 gezahlt. Kann der Mandant trotzdem den gesamten Schaden einklagen?
Kandidat 1:
Solange der Mandant seine Raten zahlt, sollte er den Schaden von Sinn und Zweck des Schadensrechts her voll geltend machen können.[6]
Prüfer:
Das ist sehr gut vertretbar. Angenommen, die Rechtslage ist in diesem Punkt unklar. Vielleicht muss auch die Telekom AG klagen oder Leistung an die Telekom AG verlangt werden. Was könnte dem Mandanten geraten werden?
Kandidat 2:
Er könnte sich den Anspruch der Telekom AG vorsorglich abtreten lassen.
Prüfer:
Das ist eine überzeugende Antwort.[7] Vielen Dank an alle Kandidaten.[8]
Vertiefungshinweise
EBV beim Besitzdiener:
BGHZ 8, 130 – Platzanweiserin im Kino
Haftungsmaßstab beim „Scheinfinder“:
LG Frankfurt NJW 1956, 873 f.; Oechsler in Mü/Ko, 9. Aufl., 2023, § 968 Rn. 2
Gewahrsamsverhältnisse im Einkaufscenter:
KG Berlin NJW-RR 2007, 239–241
Fall 2„Feindliches Grün“
Materielles Recht:
StVG (Verkehrsunfall mit Halter- und Fahrerhaftung, §§ 9 und 17 StVG, Helmtragungspflicht für Fahrradfahrer, Beweislast)
Prozessrecht:
Streitgenössische Drittwiderklage, Zeugenstellung, prozesstaktische Erwägungen aus Beklagtensicht
Prüfer:
Sie sind zugelassener Rechtsanwalt. Herr A betritt aufgeregt Ihre Kanzleiräume, legt eine Klageschrift vor und berichtet von folgendem Vorgang:
A sei mit seinem Fahrzeug (BMW) mit einem von B gefahrenen Mercedes auf der Kreuzung X zusammengestoßen. Er hatte einen Kollegen D als Beifahrer und wollte an der Kreuzung links abbiegen (es existiert eine Linksabbiegerampel). B befand sich im Gegenverkehr und sein Beifahrer war C, der Autoeigentümer. Die Versicherung von A regulierte 50 % gegenüber C. C klagt jedoch den restlichen Sachschaden ein und geht von 100 % Haftung des A aus. C benennt seine Ehefrau B (die Fahrerin) als Zeugin dafür, dass der Mercedes Grün gehabt habe, als er in die Kreuzung eingefahren sei. Neutrale Zeugen gibt es (außer dem Kollegen D – Beifahrer von A) nicht. Auch ein Unfallrekonstruktionsgutachten kann keinen Aufschluss über die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben. A hat von der Gegenseite für den Schaden an seinem Fahrzeug noch nichts erhalten und fragt, wie er nun auf die Klage des B reagieren soll.
Kandidat 1:
Zunächst ist das Mandantenziel zu ermitteln. Es geht um die Abwehr der (weiteren) gegnerischen Ansprüche sowie die möglichst weitgehende Durchsetzung der eigenen Ansprüche.
Prüfer:
Das ist richtig. Fangen wir mit der Klage des C an. Kann A sich erfolgreich verteidigen?
Kandidat 2:
Der Anspruch des C besteht dem Grunde nach gemäß § 7 StVG.[1] Wenn er jedoch gem. § 17 Abs. 1 StVG[2] um 50 % gekürzt ist, dürften keine weiteren Ansprüche des C bestehen. Dabei muss sich C das Verhalten des Fahrers B gem. § 9 StVG zurechnen lassen. Sollte der Abbiegepfeil tatsächlich auf „Grün“ gestanden haben, müsste der Mercedes des C beim Befahren der Kreuzung „Rot“ gehabt haben.[3]
Prüfer:
Sehr gut. Die Frage der Ampelschaltung ist aber streitig. Was bedeutet das für den Mandanten A?
Kandidat 3:
Dem C dürfte der Beweis nicht gelingen, dass er bei Grün auf die Kreuzung eingefahren ist. Soweit er sich auf das Zeugnis seiner Ehefrau B beruft, ist deren persönliche Nähe zum Kläger und ihr wirtschaftliches Eigeninteresse zu berücksichtigen. Sie haftet als Fahrerin gemäß § 18 StVG. Zudem hat A einen recht neutralen Zeugen, nämlich seinen Beifahrer und wirtschaftlich unbeteiligten Arbeitskollegen D. Die Angaben der Parteien A und C sind nur im Rahmen der Parteianhörung zu berücksichtigen.





























