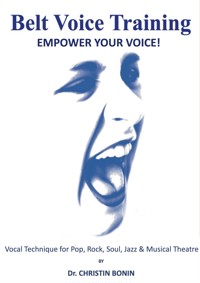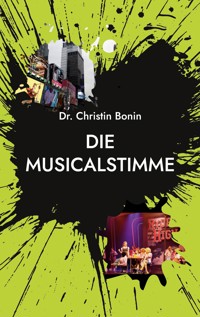
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Musicalstimme ist trotz Mikrofonverstärkung immer noch vorrangig ein Originalprodukt des Musicaldarstellers. Im Gegensatz dazu spielt die Popstimme mit stimmlichen Effekten, die meist stark von den Möglichkeiten der Tontechnik abhängen, und die klassische Stimme stellt den tragfähigen musikalischen Gesangston in den Vordergrund, der auch ohne Mikrofon in einem Theater gut hörbar ist. Der Balanceakt zwischen einer Gesangstimme, die vom Zuhörer als schön empfunden werden soll, und einem adäquaten emotionalen Ausdruck zugunsten der Rolle, die verkörpert wird, ist eine große Herausforderung an jeden Musicaldarsteller. Deshalb hat sich die Gesangstimme im Broadway Musical im Laufe des 20. Jahrhunderts von einer eher klassischen Tonproduktion entfernt. Dieses Buch beschäftigt sich mit der typischen Musicalstimme im Broadway Musical und ihrer klanglichen Entwicklung zur sogenannten Beltstimme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im folgenden Text werden Begriffe wie Schauspieler, Sänger, Tänzer, Darsteller, Chorist etc. aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit als geschlechtsneutral zu verstehende Begriffe, gültig für männlich, weiblich und divers, in ihrer maskulinen Form verwendet, sofern sie sich nicht explizit auf weibliche oder diverse Personen oder Rollenprofile beziehen.
Über die Autorin
Dr. phil. Christin Bonin hat zum Thema Broadway Belt, Belt Sound und Belting Gesangstechnik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München im Jahr 2020 promoviert, nachdem sie zuvor im Jahr 2016 ihren Master of Arts in Musikwissenschaft zum Thema Broadway Musical, ebenfalls an der LMU, absolviert hatte. Vor ihrem akademischen Weg stand Christin Bonin als Sängerin auf der Bühne. Auf ihre Preisträgerschaft im Bundeswettbewerb Musical, Chanson und Song in Berlin im Jahr 1985, folgte der staatliche Studienabschluss als Gesangspädagogin mit zusätzlicher Opernausbildung. Daraufhin war Christin Bonin mehrere Jahre auf Tournee durch Europa. Sie wirkte in dieser Zeit vor allem in Operetten und Musicals mit und sang populäre Musik, u.a. zusammen mit Roland Kaiser und Udo Jürgens, mit denen sie auch CDs aufgenommen hat. Im Anschluss daran war sie Mitglied des Badischen Staatstheater in Karlsruhe und der Bayerischen Staatsoper in München, mit der sie auch auf Japan-Tournee war. Sie hat in über 40 verschiedenen Opern in fünf Sprachen mitgewirkt. Im Jahr 2004 gründete sie ihre Gesangschule "Star me up" in München, um ihrer Freude am Unterrichten von Pop, Rock, Soul, Musical, Jazz und Klassik zu folgen. Über 30 jugendliche Preisträger bei Jugend musiziert Musical und Pop sprechen für sich.
Christin Bonin ist die Autorin der methodischen Fachbücher "Belting" und "Singen macht glücklich", sowie der englischsprachigen Ausgaben „Belt Voice Training - Singing with a Belting Voice“ und „Singing makes you happy“.
Ihre Dissertation ist unter dem Titel „The Broadway Belt: The Musical Diva and Her Belt Voice from Technical, Ethnic, and Feminist Perspectives“ im Olms Verlag erschienen. Ihre Bücher sind überall erhältlich. Sie produzierte im Jahr 2009 außerdem ihre Solo-CD "Single Well" mit eigenen Songs, die sie als One-Woman-Show mehrfach in München und Umgebung aufführte. Sie textet und komponiert weiterhin Songs, die als Download und Streaming erhältlich sind.
INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung
Die Goldenen 1920er und 1930er Jahre
Musicalgesang bis 1943
Oklahoma! ‒ Das Cowboy-Musical
4.1 Die Entstehung des Book-Musicals
4.2 Rollenprofile und Stimmtypen in Oklahoma!
4.3 Die stimmlichen Anforderungen an die Besetzung
4.4 Konsequenzen für das Book-Musical
Die Blütezeit des Musicals bis 1957
5.1 Operettenklang und Jazzelemente
5.2 Die Gesangstimmen im Golden Age of Broadway
West Side Story ‒ Ein Crossover-Oeuvre
6.1 Das neue „Creative Team“: Robbins, Bernstein, Laurents und Sondheim
6.2 Rollenprofile und Stimmtypen
6.3 Stimmliche Besonderheiten in West Side Story
6.4 Stilistische Änderungen und Konsequenzen für die Singstimmen
Der Weg in die Postmoderne: 1960-1990
7.1 Die Stimmen der 1960er Jahre: Generationswechsel und Diversität versus Stagnation
7.2 Der Musicalgesang der 1970er und 1980er Jahre: Regietheater, Tanzmusicals, Sondheims Kunstwerke und Lloyd-Webbers Hits
Sondheims Konzept-Musical Into the Woods: Intellektuell statt kommerziell, Stimmeffekt statt Klangvolumen
8.1 Sondheim in den Fußstapfen Hammersteins und Bernsteins
8.2 Die Rollenprofile und ihre besonderen stimmlichen Anforderungen
8.3 Stimmtypen in Into the Woods
8.4 Konzept-Musicals und ihre Konsequenzen für Musicaldarsteller
Das Broadway Musical der 1990er Jahre auf dem Weg in das 21. Jahrhundert
9.1 Die Subgenres des Broadway Musicals auf Identitätssuche
9.2 Der Einfluss technischer und wirtschaftlicher Entwicklungen
Musical als Film und Live-Mitschnitt
Stimmtypologische Besetzungsfragen
Gegenwart und Zukunft des Broadway Musicals
Nachwort
Weitere Bücher von Christin Bonin
Bibliografie
1. Einleitung
Die Musicalstimme unterliegt anderen Bedingungen als die Popstimme und die klassische Stimme. Während die klassische Stimme den perfekten musikalischen Ton in den Vordergrund stellt, spielt die Popstimme mit stimmlichen Effekten und hängt stark von den Möglichkeiten der Tontechnik ab. Im Gegensatz dazu ist die Musicalstimme trotz Mikrofonverstärkung vorrangig ein Original-Produkt des Musicaldarstellers, dessen gesangliche Interpretation vor allem der Rolle gerecht werden muss, weshalb optimale Tonproduktion und Klangschönheit häufig in den Hintergrund treten. Der Balanceakt zwischen einer Gesangstimme, die vom Zuhörer als „schön“ empfunden werden soll, und einem adäquaten emotionalen Ausdruck zugunsten der Rolle, die verkörpert wird, ist eine große Herausforderung an die Musicalstimme. Deshalb hat sich die Gesangstimme im Broadway Musical im Laufe des 20. Jahrhunderts von einer eher klassischen Tonproduktion weg-entwickelt und sich als sogenannte Beltstimme etabliert. Dieses Buch beschäftigt sich mit der typischen Musicalstimme und deren klanglicher Veränderung im Laufe der Geschichte des Broadway Musicals im 20. Jahrhundert.
Vom Ursprung des Begriffs „musical theatre“, also „Musiktheater“ ausgehend, gehören zu Beginn des 20. Jahrhunderts in diese Kategorie die Bühnenwerke der Avantgarde, die weder Oper noch kommerzielles Entertainment sind, wie zum Beispiel Igor Stravinskys The Soldier's Tale. Die im 17. und 18. Jahrhundert vorrangig in der italienischen Oper benutzte Bezeichnung des dramma musicale wird im 20. Jahrhundert für jedes musikalische Werk mit einer ernsthaften Geschichte als Grundlage benutzt, wie dies zum Beispiel auch bei Gian Carlo Menottis The Consul der Fall ist. Im Kontrast dazu wird der deutschsprachige Begriff „Musikdrama" eher auf ein Gesamtkunstwerk wie Richard Wagners Oper Tristan und Isolde angewandt. Der Unterschied liegt hier vor allem in nationalen und kulturellen Traditionen: Der Begriff „Broadway Musical" bezieht sich an der Basis auf einen Straßennamen in New York City und meint ein Musical, das in einem Theater am Broadway aufgeführt wird. Als Bezeichnung für ein musikalisches Genre distinguiert sich „Broadway Musical" von den bisherigen Kategorien musikalischer Bühnenwerke vor allem im Ethos des neu entstehenden US-amerikanischen Musiktheaters.1 Die ästhetische und künstlerische Entwicklung, und somit auch im Besonderen die stimmtypologische Entwicklung der Rollenprofile, prägen seit Ende des 19. Jahrhunderts den Begriff Broadway Musical als neue, eigenständige Kunstform im sogenannten melting pot New York, wo sich von diesem Zeitpunkt an musikalische Talente aus aller Welt zusammenfinden. Wird Show Boat im Jahre 1929 auch als Meilenstein in der Entstehungsgeschichte des Genres Musical betrachtet,2 ist bereits 1874 für die Extravaganza Evangeline die Bezeichnung musical comedy zu finden.3Uncle Tom's Cabin war das bekannteste Theaterstück des 19. Jahrhunderts und The Black Crook im Jahre 1866 mit dem Showstopper „You Naughty, Naughty Men“ bereits ein eher unabsichtlicher Vorläufer des Musicals.4 Erst 1890 geht A Trip to Chinatown den Weg, einem Bühnenstück eine US-amerikanische Geschichte zugrunde zu legen, woraus dann auch Songs wie „The Bowery“ von Percy Grant hervorgehen.5 Dennoch besitzt die frühe Entstehungsgeschichte des US-amerikanischen Musicals vor allem europäische Wurzeln, die traditionellen Werte und das musikalische Wissen aus der Alten Welt. Werke wie Franz Lehars Die lustige Witwe, Jacques Offenbachs Die Großherzogin von Gerolstein und viele andere Operetten beeinflussen die Entwicklung des US-amerikanischen Musiktheaters noch weit in das 20. Jahrhundert hinein.6 Mit Arthur Sullivans und William Schwenck Gilberts englischsprachigem, aus London importiertem H.M.S. Pinaforewird der Grundstein des US-amerikanischen Musiktheaters in seiner heutigen Form gelegt. Gerald Bordman konstatiert sogar, dass ohne H.M.S. Pinafore Werke von Victor Herbert, George Michael Cohan, Jerome Kern, George Gershwin und Richard Rodgers nicht vorstellbar seien.7 So tritt George M. Cohan, der irischer und somit europäischer Abstammung ist, im Jahre 1901 gegen die Vorherrschaft der europäischen Operette am Broadway an. Mit The Governor's Son trägt Cohan dazu bei, dass das Broadway Musical eine ur-amerikanische Gattung des US-amerikanischen Musiktheaters wird.8
Auch der Einfluss des Jazz kann in dem neuen Genre Broadway Musical Schritt für Schritt seinen Siegeszug verzeichnen: So dringen schnell jazzige Rhythmen und der Sound typischer Jazzinstrumente in die Orchestrierung ein, doch die stimmlichen Anforderungen entwickeln sich erst langsam von der klassisch ausgebildeten Stimme hin zur sogenannten Beltstimme.
Der Gesangstil des Beltens wird bereits Ende des 19. Jahrhunderts in Vaudeville Shows und Extravaganzas benutzt. Belting ist ein Fachbegriff des Musicalgesangs, der ursprünglich von dem umgangssprachlichen Ausdruck to belt out stammt, was ohne jede weitere Präzisierung an der Basis „laut und temperamentvoll singen“9 bedeutet. Im Gegensatz zur klassisch ausgebildeten Gesangstimme handelt es sich zu Beginn des US-amerikanischen Musicals bei Beltstimmen in der Regel um unausgebildete, kräftige Naturstimmen, die einen Song problemlos so laut schmettern konnten, dass dieser ohne jede Verstärkung auch noch im letzten Winkel des Theaters hörbar war. Sophie Tucker, Fanny Brice, Ethel Merman und einige andere Sängerinnen machten diesen Gesangstil bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Broadway-Produktionen populär. Nur besonders laute Gesangstimmen besaßen genügend Tragfähigkeit und Kraft, um über ein Orchester zu reichen und das Publikum zu begeistern. Deshalb war die dafür notwendige, intensive Nutzung des Bruststimmenregisters auf gesunde und natürliche Art und Weise vor Einführung des Bühnenmikrofons zuerst nur bestimmten Stimmtypen, eher dunkleren Mezzosopranen und Altstimmen, Vorbehalten. Belting wurde zu Beginn des Broadway Musicals vor allem für weniger elegante, häufig vulgäre Rollen eingesetzt, deren Grundcharakter zu stimmlich kräftigen und eher dunkel klingenden Musicalstimmen passte. Diese Stimmtypen führten dazu, dass der Musicaldarsteller stilistisch eingeordnet werden konnte und sich von den Musical-singenden Operettensängern abgrenzte.
Doch die Einführung des Schlagzeugs und in Folge auch weiterer, elektronisch verstärkter Instrumente im Musicalorchester machte es im Laufe des 20. Jahrhunderts den Darstellern immer schwerer, über den Orchestergraben hinaus hörbar zu sein, wodurch Mikrofonverstärkung notwendig wurde. Dadurch ergab sich im Gegenzug wiederum die Möglichkeit, andere, interessante stimmliche Effekte zu nutzen, die ohne Mikrofon nicht über die Bühnenrampe tragen könnten. In Folge konnte deshalb viel bewusster rollenspezifisch gecastet werden und die Stimmgröße war nicht mehr vorrangiger Gesichtspunkt einer Besetzung. Das neu entstehende Filmmusical eröffnete schließlich sogar Schauspielern, die gar nicht richtig singen konnten, die Möglichkeit, ein Musicalstar zu werden. Diese Tatsache dient sogar als Grundidee für die Story des Musikfilms Singing in the Rain. Ironischerweise synchronisiert gerade in diesem Film die stimmlich versiertere Jean Hagen, die die gesanglich untalentierte Lina Lamont verkörpert, Debbie Reynolds, die in der Rolle der gesanglich versierten Kathy zu sehen ist.10
Es gibt Musicaltitel, die vielen am Genre interessierten Menschen in irgendeiner Hinsicht ein Begriff sind, wie zum Beispiel The King and I, My Fair Lady, Hair, Cabaret, Cats und zahlreiche andere, die international bekannt geworden sind. Dazu hat auch häufig die Premieren-Besetzung mit mittlerweile zu Weltstars gewordenen Sängern beigetragen. Einige dieser Musicals sind kommerziell erfolgreiche Einzelwerke heute kaum noch bekannter Komponisten mit Songs, die es sogar in die Hitparaden der Radios geschafft haben. So sind zum Beispiel „Aquarius” und „Let the Sunshine In“ weltbekannte Songs, doch wer hat den Namen des Komponisten des Musicals Hair, Galt MacDermot, sofort parat? Solche Werke haben vor allem einen wichtigen Anteil an der Popularisierung des Musicals, doch für die Entwicklungsgeschichte des Broadway Musicals ist das Gesamtwerk der Komponisten, die das Genre Musical überhaupt erst erschaffen und nachhaltig geprägt haben, besonders bedeutend. Deshalb werden hier ausgewählte Werke einiger Komponisten im Rahmen ihres musik-historischen Kontextes besonders beleuchtet, die für die künstlerische Entwicklungsgeschichte des Broadway Musicals als hauptverantwortlich betrachtet werden können. Dadurch soll die Leistung anderer Komponisten der gleichen Epoche und deren Anteil am Zeitgeschehen jedoch weder ignoriert noch geschmälert werden.
Es ist das Anliegen dieses Buches, die stimmtypologische Entwicklung der Musicalstimme zur Beltstimme hin aufzuzeigen, weshalb Oklahoma!, West Side Story und Into the Woods, als zentrale Werke des Broadway Musicals im 20. Jahrhundert bewusst zu diesem Zweck ausgewählt wurden. Auch wenn es bereits vor 1943 (Oklahoma!) und nach 1986/87 (Into the Woods) Beltstimmen und Musicals mit besonders herausragenden Beltsongs gab, repräsentieren gerade diese drei Werke in der historischen Weiterentwicklung des Genres die Entwicklung der Musicalstimme als tragendes Element. Das besondere Augenmerk richtet sich hier auf die Besetzung der Gesangspartien der Solisten, um die sich verändernden stimmlichen Anforderungen an Musicaldarsteller im Laufe des 20. Jahrhunderts zu demonstrieren. Konsequenterweise ergeben sich dadurch die stimmtypologischen Voraussetzungen für das Broadway Musical und seine Darsteller im 21. Jahrhundert. Diese Erkenntnisse können Musicaldarsteller bei der Songauswahl und Theater bei Besetzungsfragen unterstützen.
Die Epochen vor und nach den drei ausgewählten Musicals werden zuerst historisch betrachtet und die dazugehörige Stimmtypologie im Anschluss daran anhand einzelner Beispiele dargestellt. Auch das Filmmusical wird bezüglich seiner Gesangstimmen kurz angesprochen. Diese musicalhistorische Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung der Gesangstimme demonstriert die Entwicklung der Musicalstimme von der klassisch ausgebildeten Gesangstimme zur Beltstimme.
1 Larry Stempel, Showtime ‒ A History of the Broadway Musical Theater (New York: W.W. Norton & Company Ltd, 2010). 6.
2 Günther Bartosch, Die ganze Welt des Musicals (Wiesbaden: F. Englisch, 1981). 36.
3 Rüdiger Bering, Musical, DuMont ed. (Köln: DuMont, 20 062). 27.
4 Stempel, Showtime ‒ A History of the Broadway Musical Theater. 35.
5 Leonard Bernstein, The Joy of Music (New York: Simon & Schuster Inc., 19596). 157-164.
6 Gerald Bordman, American Operetta From H.M.S. Pinafore to Sweeney Todd (New York: Oxford University Press, 1981). 10, 75.
7 Ibid. 16.
8 Bering, Musical. 21.
9 Richard A. Spears, NTC's American Idioms Dictionary The Most Practical Reference for the Everyday Expressions of Contemporary American English (Lincolnwood, IL: National Textbook Company, 19942). 34.
10 Bering, Musical. 58.
2. Die Goldenen 1920er und 1930er Jahre
Die 1920er Jahre werden gerne auch als Jazz Age bezeichnet, denn in dieser Zeit war Jazz die wohl erfolgreichste Musikgattung, besonders in den USA. Mark Tucker beschreibt Jazz in der zweiten Edition des The New Grove Dictionary of Music and Musicians als eine in den Praktiken der Afro-Amerikaner verwurzelte, musikalische Tradition, deren Stil sich durch Synkopierung, Blues-Elemente und ein rhythmisches Gefühl für eine Phrasierung, die Swing genannt wird, charakterisiert.11 Doch der Jazz des Broadway ist nicht die raue, spannungsreiche, afro-amerikanische Musik, sondern eher eine Art ausgiebig vermarktete, synkopische Popularmusik. Ihr Stil und ihre Struktur stammen mehr von den Songs der Tin Pan Alley ab, als sie Blues und Ragtime in sich tragen. Tin Pan Alley wurde der Straßenabschnitt der 28th Street West zwischen Fifth und Sixth Avenue im sogenannten Flower District von Manhattan genannt. In dieser Allee stand die berufliche Wiege einiger der wichtigsten Musical Komponisten der 1920er und 1930er Jahre und es wurden dort viele ihrer Musicals geboren. Eine Erinnerungstafel sorgt auch heute noch dafür, dass die historisch so wichtige Glanzzeit der Musikpublizisten und Songschreiber in New York nicht in Vergessenheit gerät. George Gershwin ist einer der bekanntesten Komponisten, deren Karriere als Songplugger in der Tin Pan Alley begonnen hatte. Songplugger waren hervorragende Pianisten, die die Kompositionen bereits anerkannter Komponisten ohne vorheriges Üben interessierten Musikproduzenten vorspielen konnten. Mit diesem „Vom-Blatt-Spielen" verdiente auch Gershwin als Songplugger sein erstes Geld und sammelte umfangreiche Erfahrung, bevor er selbst zu einem berühmten Komponisten wurde. Die jazzlastige Musik der Tin Pan Alley ‒ und damit des Broadway Musicals ‒ wird quasi zur Popmusik dieser Ära und Gershwin nennt diese Art populärer Musik mit ihren Wurzeln in der afro-amerikanischen Musikkultur „not Negro", „but American."12
Während die Operette lange Melodiebögen, großen Tonumfang und eine ausgebildete, klassische Gesangstimme mit Vibrato und einer gesangstechnisch korrekt geführten Atmung verlangt, genügen für die meisten Musical-Songs dieser Zeit mit kürzeren Phrasen in kleinerem Tonumfang eine eher punktuelle, kräftige Atemstütze und eine Naturstimme mit korrektem Stimmsitz. Die Gesangstimme des Jazzmusicals ‒ also das Sub-Genre des Broadway Musicals mit jazziger Musik im Gegensatz zum klassischen Musical, das die Tradition der Operette weiterführt ‒ verlangt demnach auch jazzigere Stimmen. Diese lassen sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Bars und Clubs wie Harlems berühmtem Cotton Club problemlos finden. Der Cotton Club wurde 1923 eröffnet und von dem bekannten, New Yorker Gangster Owney Madden geführt. Der Club war das musikalische Zuhause historischer Jazz-Größen wie Duke Ellington, Ethel Waters und Cab Calloway. Doch Blues Gesang und Broadway Musical Gesang sind nicht das Gleiche und so entstand bereits zu diesem Zeitpunkt eine eigene Stimmkultur des Broadway Musicals. Das typische Publikum des Broadway Musicals wollte jazzigere Klänge hören, doch die Gesangstimmen sollten nicht zu sehr an den afro-amerikanischen Ursprung dieses Musikstils erinnern. Der Komponist Vincent Youmans reagiert auf den neuen Zeitgeschmack und verwandelt seinen operettenartigen Walzer „My Boy and I“ aus Mary Jane McKane aus dem Jahre 1923 kurzerhand in eine jazzige Zweiertakt-Melodie mit durchgehender, punktierter Viertel- und Achtelnoten-Rhythmik. Damit erschuf er den Titelsong zu No, No, Nanette, seinem ersten großen Musical-Comedy-Hit im Jahr 1925.13
Neben George Gershwin ist Cole Porter ein anderer bedeutender Komponist dieser Zeit und dieses Stils. Beide sind rasch keine Unbekannten mehr auf dem Great White Way, dem Theater-Bezirk am Broadway zwischen der 42sten und 53sten Straße, und sie dominieren das Broadway Musical der 1930er Jahre. Der Begriff Great White Way bezieht sich zwar ausschließlich auf die helle Beleuchtung dieses berühmten Straßenabschnittes des Broadways, doch man kann den Begriff durchaus auch als Synonym für den Weg des Broadway Musicals dieser Zeit betrachten, das vorrangig von weißen Amerikanern bestimmt wird. Dennoch wird Jazz nach der Great Depression zu einer neuen musikalischen, typischen US-amerikanischen Ausdrucksform, der lingua franca of American popular music, dem Swing.14
Die Storys der Musicals der 1930er Jahre sind inhaltlich meist sehr simpel, denn im Gegensatz zur komischen Oper dienen diese Bühnenwerke vor allem dazu, die Musik der Tin Pan Alley zu verkaufen.15 Die Songs dieser Musicals bieten eine größere Vermarktungsmöglichkeit, sind das wichtigste Zentrum der Popularmusik dieser Ära und werden außerhalb des Musicalkontextes in Nachtclubs, Tanzsälen und in Swing-Arrangements im Radio gesungen und gespielt.16 Die Musikverlage der Tin Pan Alley und die Shows am Broadway arbeiten Hand in Hand. So hilft ein Hit der Tin Pan Alley dem dazugehörigen Broadway Musical erfolgreich zu werden und umgekehrt.17
Um den Verkauf der Notenausgabe neuer Hits anzukurbeln oder Songs sogar erst zu Hits zu machen, spielten die Songplugger diese den ganzen Tag am