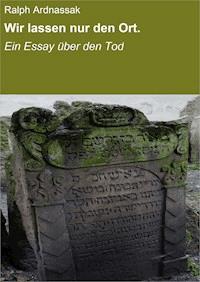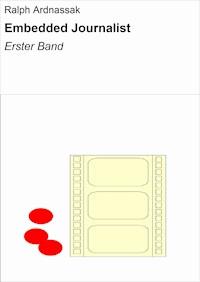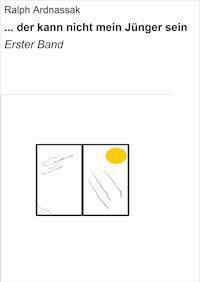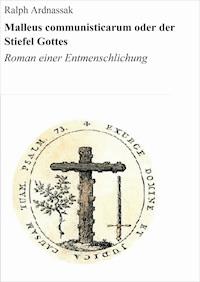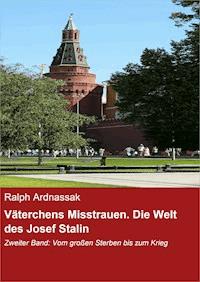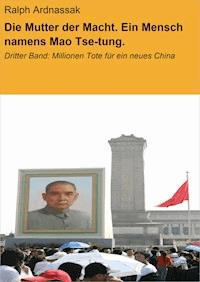
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Der Daoismus des Laozi brachte hingegen die These vom Leben des Menschen im Einklang mit der ihn umgebenden Natur ein. Von weitreichenden Folgen, auch für die Ansichten Mao Tse-tungs, war allerdings der kurz vor der Zeitenwende durch Han Feizi propagierte Legalismus, der die Ansicht vertrat, das Zusammenleben der Menschen ließe sich rein mechanisch durch ein ausgefeiltes System von Kontrollen und Strafen organisieren. Belohnung und Strafe sieht Han Feizi als den ausschließlichen Schlüssel zur Macht im Umgang mit der an sich schlechten und verderbten Natur des Menschen. Erziehung, so der Legalismus, kann den schlechten Menschen niemals verbessern, sondern lediglich die Gewissheit von schwersten Strafen. Hinrichtungen und schwerste Strafen sind allerdings nicht nur für den Schuldigen selbst bestimmt, sondern vor allem auch für dessen nächste Verwandte. Diese Gewissheit verstärkt die abschreckende Wirkung der drakonischen Strafen zusätzlich. Auch ist das Studium sinnlos, denn je mehr Menschen sich in einem Land der Wissenschaft zuwenden, desto weniger Boden wird bebaut und kultiviert. Auch der Gelehrte hat deshalb sinnvolle Arbeit zu verrichten, deren Ergebnis mess- und sichtbar zu sein hat und der Gesellschaft dienen muss. Der Herrscher muss stets drei Aspekte berücksichtigen. Zunächst muss er die wirkliche Macht besitzen, die sich nicht allein aus einem abstrakten Titel oder aus einer Ahnenfolge herleiten lässt. Schließlich muss er die richtige Methode des Herrschens finden und anwenden, denn mit eigener Tugend allein, lässt sich kein Volk der Welt dauerhaft beherrschen. Außerdem sind Gesetze notwendig, um das Zusammenleben der Menschen zu organisieren, ihre Rechte und Pflichten festzuschreiben. Später kam noch aus Indien der Buddhismus hinzu, der für die Gepflogenheiten der chinesischen Kultur und Gesellschaft zunächst angepasst werden musste, sie dann aber entscheidend prägte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 115
Ähnliche
Ralph Ardnassak
Die Mutter der Macht. Ein Mensch namens Mao Tse-tung.
Dritter Band: Millionen Tote für ein neues China
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Impressum neobooks
I
„Die Toten sind nützlich. Sie können den Boden düngen.“
Mao Tse-tung
Der Schamanismus bildet den Ursprung jener chinesischen Kultur, die über viele Jahrhunderte als die fortschrittlichste Kultur der Menschheit galt.
Im chinesischen Altertum stellten die Fangshi, jene sagen haften Männer der Technik und zugleich Zauberpriester, das Zentrum der Gesellschaft.
Die Fangshi, deren Existenz bereits seit den Tagen der Shang- und der Zhou-Dynastie als verbürgt gilt, waren die Träger der uralten Überlieferungen.
Die Fangshi hielten sich an den zahlreichen Höfen der Herrscher und der Warlords auf. Kein noch so kleiner und bescheidener Adelshof wäre je ohne diese Würdenträger denkbar gewesen.
Während der Zeit des ersten Kaisers Qin Shihuangdi wurden sie zu einer festen gesellschaftlichen Institution bei Hofe. Sie erhielten vom Kaiser die Aufgabe, unablässig den Frieden des Reiches zu erhalten und zu vervollkommnen und gleichzeitig eine Wunderdroge zu finden, die geeignet war, die Unsterblichkeit des Kaisers herzustellen. Ebenso waren sie für die Kontakte zu den Göttern zuständig.
Also hatten die Fangshi, aufgrund der Breite, der ihnen vom Kaiser zugewiesenen Aufgaben, eine Vielzahl von Disziplinen zu erlernen und unablässig zu praktizieren: Astrologie und Schamanismus, Exorzismus, Medizin und Divination, Geomantik, Magie, Medizin und Techniken zur Erzielung eines möglichst langen Lebens.
Die Schule des Taiji, die sich mit dem Yin und dem Yang befasste und die Fünf Wandlungsphasen übten erheblichen Einfluss auf die Fangshi aus.
Das Taiji erkennt den Polarstern als die Achse des Himmels an, um den sich alles Seiende, welches sich stets in Gegensätzen ausdrückt, unermesslich dreht.
Die Fünf Wandlungsphasen beschreiben Werden, Wandlung und Vergehen aller Elemente, die sich direkt aus der Natur ableiten lassen, wie Holz, Feuer, Metall, Wasser und Erde.
Aus ihren Beziehungen lassen sich die Beziehungen zwischen Mensch, Erde und Himmel abstrahieren, so wie sich die Essenz der Rose, ihr Duft, durch Auskochen der Rosenblätter im Wasser gewinnen lässt.
Unter den Fangshi schwand die Bedeutung des Himmels als Gottheit dahin und die Bedeutung der Omen wuchs.
Die Fangshi bildeten die Quellen sämtlicher Schulen des Daoismus, der von ihnen die Studien zur Langlebigkeit, die Suche nach der Unsterblichkeit durch die Einnahme von Drogen, das Taijiquan und das Qigong, die Sexualpraktiken und Atemübungen und die unterschiedlichen Techniken der inneren und der äußeren Alchimie übernahm.
Zou Yan, einer ihrer wichtigsten Denker, veröffentlichte verschiedene Ansätze zur Beherrschung von Göttern, Dämonen und Geistern.
Zu den Fangshi hinzu traten die Ahnenverehrung und die traditionelle chinesische Naturphilosophie.
Tief prägte die chinesische Kultur und Gesellschaft jedoch der ab etwa dem 5. Jahrhundert aufkommende Konfuzianismus mit seinen Lehren und Ansichten zu den Beziehungen der Menschen untereinander.
Der Daoismus des Laozi brachte hingegen die These vom Leben des Menschen im Einklang mit der ihn umgebenden Natur ein.
Von weitreichenden Folgen, auch für die Ansichten Mao Tse-tungs, war allerdings der kurz vor der Zeitenwende durch Han Feizi propagierte Legalismus, der die Ansicht vertrat, das Zusammenleben der Menschen ließe sich rein mechanisch durch ein ausgefeiltes System von Kontrollen und Strafen organisieren.
Belohnung und Strafe sieht Han Feizi als den ausschließlichen Schlüssel zur Macht im Umgang mit der an sich schlechten und verderbten Natur des Menschen.
Erziehung, so der Legalismus, kann den schlechten Menschen niemals verbessern, sondern lediglich die Gewissheit von schwersten Strafen. Hinrichtungen und schwerste Strafen sind allerdings nicht nur für den Schuldigen selbst bestimmt, sondern vor allem auch für dessen nächste Verwandte. Diese Gewissheit verstärkt die abschreckende Wirkung der drakonischen Strafen zusätzlich.
Auch ist das Studium sinnlos, denn je mehr Menschen sich in einem Land der Wissenschaft zuwenden, desto weniger Boden wird bebaut und kultiviert. Auch der Gelehrte hat deshalb sinnvolle Arbeit zu verrichten, deren Ergebnis mess- und sichtbar zu sein hat und der Gesellschaft dienen muss.
Der Herrscher muss stets drei Aspekte berücksichtigen. Zunächst muss er die wirkliche Macht besitzen, die sich nicht allein aus einem abstrakten Titel oder aus einer Ahnenfolge herleiten lässt.
Schließlich muss er die richtige Methode des Herrschens finden und anwenden, denn mit eigener Tugend allein, lässt sich kein Volk der Welt dauerhaft beherrschen.
Außerdem sind Gesetze notwendig, um das Zusammenleben der Menschen zu organisieren, ihre Rechte und Pflichten festzuschreiben.
Später kam noch aus Indien der Buddhismus hinzu, der für die Gepflogenheiten der chinesischen Kultur und Gesellschaft zunächst angepasst werden musste, sie dann aber entscheidend prägte.
Dann allerdings lag die chinesische Kultur beinahe zweitausend Jahre brach und wurde nicht von weiteren Einflüssen befruchtet.
Man beschränkte sich darauf, in unterschiedlichsten philosophischen Schulen das bis dahin akkumulierte Gut an Kultur und Philosophie Chinas stets immer wieder neu zu interpretieren.
Die etwa seit dem 16. Jahrhundert anhaltenden Bemühungen christlicher Missionare, den christlichen Glauben in seinen unterschiedlichen Ausprägungen in die chinesische Gesellschaft hinein zu tragen, blieben jedoch ohne tiefgreifenden Einfluss auf den Kulturraum.
Die Situation änderte sich, als zu Anfang des 20. Jahrhunderts, aus dem benachbarten Russland kommend, die Idee des Kommunismus nach China gelangte. Von 1949 bis etwa 1980 wurde sie hier zur absolut alles beherrschenden Staats- und Gesellschaftsdoktrin, dank Mao Tse-tung, die das bisherige jahrtausendealte Kulturgut teilweise mit brachialer Entschlossenheit zertrümmerte, andererseits aber auch weite Teile davon einfach kritiklos auflas und übernahm.
Neun entscheidende Wesenszüge des Chinesen und der chinesischen Kultur sind es jedoch, die den Menschen und den Kulturraum entscheidend prägen und die den Siegeszug des Kommunismus in diesem gewaltigen Maßstab in China erst ermöglicht haben:
Gruppendenken, Harmoniestreben, Gesichtsorientierung, Indirektheit, Kollektivität, Hierarchieakzeptanz, Ritualisierung, Diesseitigkeit und Sinozentrismus.
Eine traditionell hohe Bedeutung hat in China der Clan, die Familie. Der Chinese unterscheidet dabei strikt in Clanmitglieder und in Nicht-Mitglieder seines Familienclans.
Dies lässt sich auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Region und Provinz und auf die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Arbeitsplatz ohne weiteres übertragen.
Der Chinese stellt eine deutlich wahrnehmbare Demarkationslinie auf, zwischen denjenigen Mitgliedern, die zu einer bestimmten Gruppe dazu gehören und den Menschen, die außerhalb dieser Gruppe stehen. Sehr deutlich ausgeprägt ist dieses Gruppendenken besonders bei den Han-Chinesen, die sich als ethnische Elite innerhalb Chinas begreifen.
Die chinesische Vorstellungswelt wird stark von der Annahme bestimmt, dass im Kosmos zwischen allen Dingen eine geradezu universelle Harmonie bestehen müsse.
Dies kann auf alle Farben, auf die vier Jahreszeiten, auf die Stimmungen der Menschen und der Tiere, auf Stoffe, auf Planeten und auf Körperteile bezogen werden.
Auch zwischen Menschen, Himmel und Erde besteht im traditionellen Verständnis der Chinesen Harmonie, wobei dem Kaiser als dem Himmelssohn stets eine besondere Bedeutung zukommt.
Daher streben Chinesen in allen menschlichen Beziehungen die universelle Harmonie an und vermeiden Konflikte.
So gilt es in China als absolut unmoralisch, ganz gleich, ob berechtigt oder nicht, rücksichtslos die eigenen Interessen durchzusetzen. Im Gegenteil, solches Verhalten wird allgemein sanktioniert, während man stattdessen bestrebt ist, in möglichst langwierigen Prozessen zu einem für alle Seiten befriedigenden Ausgleich zu gelangen.
Schroffe Ablehnung verbietet sich daher im zwischenmenschlichen Umgang bereits von vornherein und selbst eine Bejahung, ganz gleich, wie ernst gemeint sie auch erscheinen mag, trägt keinesfalls den Charakter von Verbindlichkeit.
Jede Art von Kritik und heftiger Emotion, von Wut, Trauer, Freude oder das Preisgeben von Intimitäten und persönlichen Informationen, gelten als strikte Verletzungen des Prinzips der universellen Harmonie und sollten daher unterbleiben.
Leises, dezentes Auftreten, ruhiges Sprechen, stets würdige Gesten und äußerste Gelassenheit gegenüber allen Ärgernissen des täglichen Lebens, gelten hingegen als Ausdruck der universellen Harmonie.
Grundsätzlich gilt das Streben nach Harmonie jedoch nur innerhalb der jeweiligen Danwei, also in der Familie oder am Arbeitsplatz, keinesfalls jedoch in der Öffentlichkeit.
Unter dem Gesicht versteht der Chinese sein physisches Antlitz, aber auch die öffentliche Meinung, die mit einer bestimmten Person allgemein eng verbunden ist. Das physische Antlitz gilt daher als Teil des menschlichen Körpers, welchem elementare Bedeutung zukommt.
Wer in der Öffentlichkeit den Erwartungen an seine jeweilige soziale Rolle nicht genügt, der verliert damit auch sein Gesicht.
Kritik, Zurechtweisung durch andere in der Öffentlichkeit, Bloßstellungen in der Gegenwart von Dritten, bewirken Gesichtsverlust sowohl beim Adressaten der Kritik, wie auch bei ihrem Absender, was zu gesellschaftlicher Ausgrenzung und sozialer Isolation beider Seiten führt.
Tief sitzt in jedem Chinesen bereits von Kindheit an die Furcht, ausgegrenzt und isoliert zu werden. Dies führt zu einer maximalen Konformität und einer beinahe absoluten Anpassung der Chinesen an die Erwartungen der allgemeinen Öffentlichkeit.
Der Chinese fühlt sich nicht schuldig, er schämt sich beispielsweise, in der Öffentlichkeit Trauer oder Wut gezeigt zu haben und dadurch sein Gesicht zu verlieren und sozial ausgegrenzt zu werden.
Die Angst, das Gesicht zu verlieren, bestimmt das Leben und die Handlungen der meisten Chinesen. Sie sind daher extrem vorsichtig und scheuen sich, Risiken einzugehen oder Verantwortung zu übernehmen.
Aus dem Streben nach Harmonie und Wahrung des Gesichts resultiert die hohe Indirektheit der chinesischen Menschen.
Man vermeidet es, direkt sein Anliegen vorzutragen oder schmerzhafte Dinge zu thematisieren.
In endlosen Allgemeinplätzen und quälenden Windungen bewegen sich Gesprächspartner quälend langsam und umständlich auf ihr eigentliches Anliegen zu.
Zentrale Aussagen finden sich daher oft in Nebensätzen, der nonverbalen Kommunikation, dem Minenspiel und der Gestik sowie den Gleichnissen und Allegorien, kommen zentrale Bedeutung innerhalb der Kommunikation mit Chinesen zu.
Kritik lässt sich hervorragend anbringen, wenn man nicht die eigentlich gemeinte Person anspricht, sondern stattdessen einen unbeteiligten Dritten, beispielsweise eine historische Persönlichkeit, welche längst verstorben ist, kritisiert.
Einfache Menschen bringen jedoch Kritik am besten dadurch zum Ausdruck, indem sie subtil und vorsichtig lediglich die eigenen Lebensumstände schildern, ohne dabei auch nur im Ansatz auf die eigentlich zu kritisierende Person einzugehen.
Das Kollektiv, als unterschiedlich dimensionierte Gemeinschaft mehrerer Menschen, genießt im Selbstverständnis der chinesischen Kultur seit je her einen weitaus höheren Stellenwert, als dies das einzelne Individuum tut.
Ihren sprachlichen Ausdruck findet die chinesische Kollektivität im Begriff des Danwei, welcher für Familie, Dorfgemeinschaft, Semester oder Armeeeinheit gleichermaßen stehen kann.
Der Danwei versorgt dabei alle seine Mitglieder, leitet aus dieser oft lebenslangen Versorgung jedoch gleichzeitig auch das Recht ab, sich in jegliche Privatangelegenheiten einmischen zu dürfen.
So weist der Danwei beispielsweise Wohnung und Arbeit zu, er verteilt Löhne, Prämien und Bezugsscheine.
Der Danwei stellt lokale Infrastruktur bereit, indem er die Erlaubnis zur Heirat, zur Scheidung, zum Besuch der Schule, zum Dienst beim Militär, zur Gestaltung der Freizeit, zur Ausübung der Zensur oder zur politischen Schulung erteilt. Der Danwei schlichtet Streit unter seinen Mitgliedern und übernimmt damit bereits einfachste und elementarste Aufgaben von Justiz und Rechtsprechung.
Der Danwei kontrolliert aber nicht nur, er ermöglicht auch bescheidene Ansätze von Demokratie, Mitbestimmung und Partizipation.
Jede Mitgliedschaft in einem Danwei besteht lebenslang und ein Wechsel in einen anderen Danwei ist nicht vorgesehen.
Der Danwei erwartet Loyalität und Solidarität und bildet den uneingeschränkten Geltungsbereich sämtlicher sittlicher konfuzianischer Pflichten.
Leid, Unglück und Freude aller Personen, die außerhalb des eigenen Danweis stehen, berühren den Chinesen traditionell nicht, so dass er weder helfend eingreift, noch Mitleid oder ähnliches empfindet.
Besonders stark ausgeprägt ist das Danwei-Denken auf dem Lande und unter den Bauern.
Unter Mao Tse-tung erreichte die Bedeutung des Danweis für die Chinesen bezeichnenderweise ihren Höhepunkt.
Gruppenaktivitäten und Gruppenereignisse werden daher dem Individualismus deutlich vorgezogen. Einzelgänger sind ausgegrenzt und sozial geächtet.
Bereits seit Konfuzius ist sich der Chinese bewusst, dass seine Lebensumstände asymmetrisch organisiert sind und er akzeptiert diese Tatsache vorbehaltlos.
Diese Über- und Unterordnungsverhältnissen bestehen beispielsweise in den Kategorien Vater und Sohn, Ehemann und Ehefrau, Herr und Diener sowie Meister und Schüler.
Spätestens seit der frühen Kaiserzeit wird allgemein akzeptiert, dass die chinesische Gesellschaft ein komplexes hierarchisches Gebäude bilden muss.
Während der Kaiserzeit war die Familie des Himmelssohnes in 18 unterschiedliche Ränge mit jeweils eigenständigen Privilegien unterteilt.
In den einfachen Familien orientierte sich die Wertigkeit der Kinder zunächst am Geschlecht. Zuerst kamen die Söhne, jeweils gestaffelt nach dem Alter, vom Ältesten bis zum Jüngsten, anschließend kamen, wiederum nach dem Alter unterteilt, die Töchter einer Familie.
Der in der Hierarchie Höhergestellte gewährt dem Rangniederen Schutz und Belehrung und kann im Gegenzug von diesem Gehorsam, Respekt und jegliche Form der Unterstützung einfordern.
Im Danwei ist jedem Mitglied innerhalb der Hierarchie ein fester Platz zugewiesen.
Platz und Rang, die durch Statussymbole zum Ausdruck gebracht werden, sind von den anderen Mitgliedern eines Danweis, aber auch von allen Außenstehenden, strikt zu beachten.
Sämtliche Sitz-, Steh- und Marschordnungen der Chinesen bringen die jeweils interne Hierarchie anschaulich zur Geltung.
Erst Maos Kulturrevolution verkehrte das Hierarchieprinzip in sein krasses Gegenteil, indem nämlich Rangniedere, beispielsweise Studenten und Schüler, durch Mao offiziell dazu aufgefordert wurden, notfalls gewaltsam gegen die Autorität der Ranghöheren zu rebellieren.
Das Ergebnis waren Horden von Schülern und Studenten, die sich zu den Roten Garden zusammenschlossen, um ihre Lehrer zu demütigen, zu verhöhnen, zu verprügeln, in der Öffentlichkeit mit kochendem Wasser zu übergießen oder ganz einfach totzuschlagen oder totzutreten.
Viele Handlungen der Chinesen, selbst die aller banalsten Verrichtungen des Tages, unterliegen strengen Vorschriften und damit einer rigiden Ritualisierung.
Dutzende von Vorschriften, die sich aus uralten Traditionen herleiten, sind zu beachten.
Hierbei lernt man die Vorschriften und Riten in der Regel von seinem Vorgesetzten oder Meister.
Spontanität und Improvisation sind in der chinesischen Gesellschaft traditionell eher verpönt, da sie meist zu dem gefürchteten Gesichtsverlust führen.
So gibt es Regelungen für alle Grußformeln und Verbeugungen voreinander, die wiederum von der Hierarchisierung der chinesischen Gesellschaft bestimmt werden.
Die Riten setzen sich fort über die Gepflogenheiten der kaiserlichen Beamtenprüfungen bis hin zu der Art und Weise, in welcher jeweils der Tee einer Person eingeschenkt oder ihr das Essen serviert wird.
Beim Tode eines Angehörigen schreiben die Riten strikt eine dreijährige Trauerzeit vor.
Viele machen die durch die Riten bedingte Starrheit der chinesischen Gesellschaft jedoch für ihren Niedergang unter dem Druck des modernen Westens ab der Mitte des 19. Jahrhunderts verantwortlich.
Spätestens seit dem Konfuzianismus ist die gesamte chinesische Kultur überaus stark am Diesseits ausgerichtet und orientiert.
Der Kosmos und seine Struktur, die Fragen des Weiterlebens der menschlichen Seele nach dem Tode sowie nach Sünde und Erlösung, haben daher im gesamten Kanon des Konfuzius keinerlei Raum.