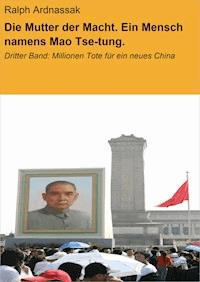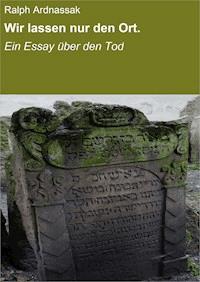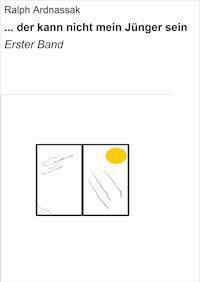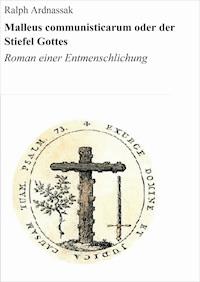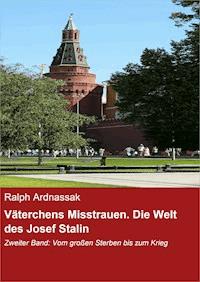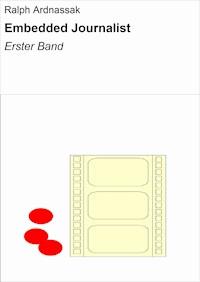
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er hat seinen Namen, seine Adresse und seine Telefonnummer eingetragen und geschrieben, dass er in Auschwitz als Besucher war und tief beeindruckt wurde vom Schicksal des jüdischen Volkes und daher den Überlebenskampf des israelischen Staates unterstützen möchte, indem er sich dem Mossad, den er überaus bewundert und für den besten Geheimdienst auf der Welt hält, zur Verfügung stellt. Es wäre ihm eine große Ehre, für den Mossad und damit für die von aller Welt verfolgten Kinder des Volkes Israel tätig werden zu dürfen." "Und der Mossad hat darauf geantwortet?" "Natürlich! Es sind wohl nun ein paar Tage vergangen und schon hat sich ein Mann bei ihm gemeldet, den er Shmuel nennen sollte. Die Konversation lief auf Englisch und der Mann hat ihn gefragt, warum er für den Mossad arbeiten wolle, Deutschland sei doch so ein friedvolles Land, das ihm jede Menge an Perspektiven und vor allem Frieden bieten könne. Er, Shmuel, habe keine Ahnung davon, was in Deutschland los sei, hat mein Vater gesagt und nochmals von seinen Erlebnissen vom Auschwitz-Besuch als Student berichtet. Der Mann, also dieser Shmuel, der wohl ein sogenannter Katza war, also ein Führungsoffizier vom Mossad, hat ihm dann eine E-Mail-Adresse gegeben, an die er seinen Lebenslauf schicken sollte. Er hat ihn zu strengster Verschwiegenheit über die Kontakte zum Mossad ermahnt. Auch gegenüber seiner Frau, meiner Mutter. Die Anrufe sind immer von einer Nummer in Stockholm aus erfolgt. Dieser Shmuel kannte aber wohl einige deutsche Städte sehr gut. Darunter auch Berlin und Leipzig. Er hatte allerdings irgendeine Scheu davor, nach Deutschland zu kommen, denn er wich immer aus und vertröstete meinen Vater.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralph Ardnassak
Embedded Journalist
Erster Band
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
I
II
III
IV
V
Impressum neobooks
I
Embedded Journalists, zu Deutsch: Eingebetteter Journalist, heißen die zivilen und kontrollierten Kriegsberichterstatter, die in der Regel einer regulären, im Krieg kämpfenden Einheit, zugewiesen wurden.
Meist wird von den Embedded Journalists, die auch kurz als Embeds bezeichnet werden, verlangt, dass sie zunächst ein kurzes, aber intensives militärisches Spezialtraining absolvieren.
Die Todeswahrscheinlich für Embeds ist in den modernen Kriegen seit dem Irakkrieg des Jahres 2003 erstaunlich hoch. Die Möglichkeit, als Embed während der Kampfhandlungen sein Leben zu verlieren ist 45mal höher, als die Todeswahrscheinlichkeit eines regulären Soldaten.
Quelle: Wikipedia
Auf den ersten Blick ist es ein in Lebensgröße ausgeführtes bronzenes Denkmal eines Soldaten, wie es auf dem kleinen Hügel nahe beim Ausgang des Dorfes steht und die staubige schmale Dorfstraße hinab zu blicken scheint, die zwischen den Häusern hindurch und den Berg hinab führt.
Ein in Lebensgröße ausgeführtes bronzenes Denkmal eines Soldaten, der den Kampfanzug der amerikanischen Armee und einen Stahlhelm lässig auf dem Kopf trägt. Ein offensichtlich vollbärtiger Soldat, der eine Brille trägt und entschlossen, ja optimistisch, unter seinem Stahlhelm hervor und die Straße hinab zu blicken scheint. Die Taschen an der Hose seiner Kampfmontur beulen sich und er trägt ein Koppel, aber keine Waffe. Stattdessen jedoch hängt an seiner Schulter eine gewaltige Kamera mit unförmigem Teleobjektiv, wie sie Kriegsberichterstatter oft zu tragen pflegen. An seine linke Schulter aber presst er, behutsam mit seinen beiden Händen und Armen, ein kleines Mädchen.
Das Denkmal des bärtigen Soldaten, der ein Mädchen auf seinem Arm trägt, steht am Hang einer grünen Wiese, umgeben von den letzten Häusern des Dorfes und einigen offensichtlich schon sehr alten und knorrigen Kirschbäumen, durch deren streifig sich abschälende Rinde dicke bernsteinfarbene Tropfen von Harz austreten. Die Straße, die vorbei führt, ist mit hellem grobkörnigem Kies belegt. Und jedesmal, wenn ein Fahrzeug vorüber fährt, was oft geschieht, wird weißer Staub aufgewirbelt, der sich in den bronzenen Falten des Soldatendenkmals fest setzt und ihm bis zum nächsten Regenguss ein geradezu beklemmend realistisches Aussehen verleiht.
Das Denkmal steht auf einem flachen Granitsockel, an dem ein schmales Schild angebracht wurde, welches Auskunft über das Denkmal gibt. Dort steht: „Henry Armand, 1964 – 2001. Schriftsteller, Journalist, Ehemann und Vater. Einwohner von Klein Ehringen.“
Am Fuße des Denkmals: eine einzige verwitternde rote Rose, deren welke Blütenblätter vom Wind Stück um Stück hinweg getragen werden, bis nur noch der verwelkte grüne Stiel übrig bleibt, über den ganze Heere kleiner rotleibiger Ameisen emsig dahin laufen, ihre Eier auf den Rücken balancierend.
Unberührt von alledem, steht das Denkmal, blickt der bronzene Soldat, der das kleine Mädchen auf dem Arm trägt und die Kamera mit dem Teleobjektiv geschultert hat, unter seinem Stahlhelm hervor und die staubige Dorfstraße hinab, als ginge ihn die Szenerie nichts an und als würde er teilnahmslos auf etwas warten.
Dicht bei dem Denkmal jedoch, arbeitet eine junge Frau in kurzen Hosen mit einer durchdringend lärmenden Motorsense. Ihr dunkler Teint und ihr langes tiefschwarzes Haar verraten ihre offenbar ausländische Herkunft. Nur selten hält sie inne, um sich eine Strähne ihres langen Haares aus dem verschwitzten Gesicht zu wischen.
Unablässig schwingt sie die lärmende Motorsense, um das Gras, welches rund um das Denkmal des bronzenen Soldaten wuchert, der an dieser Stelle des kleinen thüringischen Dorfes irgendwie deplatziert wirkt, zu bändigen und kurz und gepflegt zu halten.
In der Redaktion der Mansfelder Zeitung herrscht hektische Betriebsamkeit. Die Mitarbeiter wissen, dass der neue Investor aus Süddeutschland, der das Blatt noch einmal vor der drohenden Insolvenz gerettet hat, dies nicht aus Barmherzigkeit tat. Der Chef vom Dienst wies die Belegschaft darauf hin, wo das Problem lag und was nun künftig von ihnen erwartet würde. Steigende Werbeeinnahmen und dies in einer strukturschwachen Gegend und ebenso eine deutliche Erhöhung der Zahlen von verkaufter Auflage und Abonnenten. Keine leichte Aufgabe in einer Region mit fast fünfundzwanzig Prozent Arbeitslosigkeit, in der Resignation und Abwanderung in den Westen der Republik zum trostlosen Alltag gehörten.
Auch fiel es schwer, die meist chronisch finanziell klammen kleinen Unternehmen und Handwerksfirmen, die das wirtschaftliche Rückgrat der Region darstellten, von der Sinnhaftigkeit teurer Zeitungsannoncen zu überzeugen.
Der redaktionelle Teil orientierte an der Zusammenarbeit mit den großen Nachrichtenagenturen, deren News beinahe in unveränderter Form abgedruckt werden. Im Lokalteil fanden sich die üblichen Mitteilungen: Artikel über Unfälle, Einbrüche und Brände im Einzugsgebiet. Ein wenig Sport und ein eher eintöniger Veranstaltungskalender mit Berichten von Wochenmärkten und Geflügel- sowie Kaninchenausstellungen.
Insgesamt unspektakuläre Themen und somit eher ungeeignet, um die berühmte Leser-Blatt-Bindung zu stärken, geschweige denn, um neue Abonnenten zu gewinnen, deren Zahl bereits seit Jahren absolut rückläufig war.
Der Chef vom Dienst kämpfte jedoch seit Jahren um den Erhalt des Blattes und der damit verbundenen Arbeitsplätze. Er tat dies vor allem auch aus Eigennutz. In fünf Jahren würde er in Rente gehen und bis dahin wollte er seinen Arbeitsplatz in der Region behaupten und nicht noch als Lohnschreiberling, wie er es zu nennen pflegte, bei einer der vielen und erfolgreicheren Zeitungen im Westen der Republik arbeiten müssen.
Ein Kracher musste her. Am besten eine Fortsetzungsgeschichte mit möglichst rührseligem Inhalt. Etwas über Heldenmut in trostlosen Zeiten. Eine Story, wie die des amerikanischen Flugkapitäns Chesley Burnett Sullenberger, der es fertig gebracht hatte, den vom doppelten Triebwerksausfall infolge Vogelschlages betroffenen US-Airways-Flug 1549 inmitten des Häusermeeres von New York sicher auf dem Hudson River zu landen, ohne dabei auch nur einen einzigen Menschen zu verlieren.
Diese Meldung hatte das in der Finanzkrise taumelnde Amerika nicht nur aufgerichtet, sondern den entsprechenden Nachrichtenagenturen auch Millionenumsätze beschert, da jeder begierig war, die Geschichte dieses Mannes, der als Vorbild für ein ganzes Land taugte, das gerade dabei war, sein Selbstvertrauen flächendeckend zu verlieren, möglichst aus erster Hand zu erfahren.
Der Chef vom Dienst pflegte daher bereits seit Wochen jede Redaktionssitzung mit der Mahnung zu beenden „Meine Damen und Herren: wenn Sie hier noch eine Weile arbeiten möchten, wovon ich doch aus gehen, dann machen Sie sich endlich Gedanken! Ich wiederhole es noch einmal: Machen Sie sich endlich Gedanken!“
Die Redakteure und Volontäre, die Praktikanten und Fotoreporter hatten es begriffen, eine Story musste her, die allen ans Herz ging und über die die kleine Mansfelder Zeitung möglichst exklusiv berichten würde. Etwas wahrhaft Herzzerreißendes.
Rainer Matthes, ein junger Journalist aus er Region, der seinen Abschluss vor noch nicht allzu langer Zeit an der Leipziger Universität gemacht hatte, war sich der Aufgabenstellung bewußt. Während andere Kollegen längst aufgegeben hatten, saß er jeden Freitag, nach der Redaktionssitzung, an seinem Schreibtisch, um zu grübeln.
Eine Story musste her. Aber welche?
Jeden Tag geschahen Familientragödien im Einzugsgebiet des Blattes. Es gab Selbstmorde und gelegentlich sogar Morde. Es gab Brände, Einbrüche in Gartenlauben, Verkehrsdelikte, Wahlkämpfe um den Posten des Landrats oder irgendeines ehrenamtlichen Bürgermeisters. Es gab Geschäftseröffnungen und Konkurse. Nichts jedoch, dass geeignet war, die Herzen der Menschen derartig anzurühren, dass es als allgemeines Lehrstück von Heldenmut und Selbstlosigkeit dienen konnte und zudem noch geeignet war, die wirtschaftliche Situation derjenigen Zeitung, die es schließlich bringen würde, nachhaltig zu verbessern.
Immer wieder tauchte Rainer Matthes in die Tiefen des Internets ab. Immer wieder versenkte er sich in die Geschichte der Region, forschte er nach Personen, Ereignissen und Zusammenhängen.
Immer wieder aufs Neue hatte er schließlich mit diversen Vorschlägen, von denen er allerdings auch nur halbherzig überzeugt war, vor dem Schreibtisch des Chefs vom Dienst gestanden.
Immer hatte er abschlägigen Bescheid erhalten: kein Neuigkeitswert, bereits ein alter Hut, nicht von allgemeinem Interesse und so weiter.
Als er schließlich dabei war, aufzugeben und sich in der Region nach einem neuen Arbeitsplatz als Journalist oder Redakteur umzusehen, war er schließlich in einem kleinen Anzeigenblatt auf die Mitteilung gestoßen, dass in Klein Ehringen, einem geradezu winzigen thüringischen Dorf mit knapp 300 Seelen, das Denkmal eines Embedded Journalists, eines Kriegsberichterstatters, eingeweiht worden war.
Matthes war sofort wie elektrisiert. Ein Kollege also! Wie kam ein junger Mann aus einem winzigen westthüringischen Dorf dazu, Kriegsberichterstatter zu werden und mit den amerikanischen Truppen nach Afghanistan zu ziehen?
Die Story wurde noch mysteriöser, als er erfuhr, dass jener Kriegsberichterstatter in Afghanistan bei der Rettung eines kleinen Mädchens ums Leben gekommen war, welches seine Familie schließlich adoptiert hatte. Was war dort, in Afghanistan geschehen? Und warum war es geschehen?
Der Chef vom Dienst brütete lange über der E-Mail, die Matthes ihm geschickt hatte. Er kaute an seinem Bleistift, während er auf den Bildschirm seines Computers starrte. Und Matthes, der vor dem Schreibtisch seines Vorgesetzten stand, fand Zeit, die Familienfotos in der Ecke des Schreibtisches zu studieren, das Bild, welches sein Enkelkind für den Chef vom Dienst gemalt hatte und welches nun an der Wand des Büros hing, den abgegriffenen Duden auf dem Tisch und die Batterie der Kugelschreiber und Filzstifte, der Bleistifte, Scheren und Textmarker, die ihre bunten Hinterteile in die Luft streckten, wie kleine startbereite Raketen.
Matthes fiel plötzlich auf, wie dick der Chef vom Dienst in der letzten Zeit geworden war.
„Hm, hm!“, machte der Chef vom Dienst jetzt: „Zweifellos ganz interessant! Zweifellos ganz interessant! Und ungewöhnlich!“
Schließlich musterte er Matthes von unten herauf misstrauisch: „Und es hat wirklich noch niemand über diese Ereignisse berichtet? Ganz sicher?“
Matthes schüttelte den Kopf. Er hatte gründlich recherchiert: „Noch niemand!“
„Ganz sicher?“, bohrte der Chef vom Dienst weiter, kaute dabei an seinem Bleistift und schlug sich mit dem Stift sacht gegen die vorgewölbte Unterlippe.
„Ganz sicher!“, bestätigte Matthes.
„Ok!“, seufzte der Chef vom Dienst, klopfte mit dem Bleistift auf die Tischplatte des Schreibtisches und nickte dabei: „Viel zu verlieren haben wir ja nicht!“
Als Matthes das Büro des Chefs vom Dienst verließ, fühlte er sich wie ein Sieger. Er klatschte in die Hände. Dann begann er, seine Sachen zusammen zu suchen.
Klein Ehringen: das waren etwa 60 Kilometer Fahrt von hier aus.
Der Weg nach Klein Ehringen führte Matthes durch die Landschaft der Goldenen Aue. Jene fruchtbare Auenlandschaft zwischen dem Südrand des Harzes und den Höhenzügen der Windleite und des Kyffhäusers, deren satte Böden und Wiesen von dem kleinen Fluss der Helme durchzogen wurden, wie ein schwerer Brokatstoff von einem kostbaren Silberfaden.
Der Name der Landschaft, Goldene Aue, gemeinhin für das gesamte Tal der Helme im Gebrauch, geht auf eine Überlieferung Martin Luthers zurück, wonach der von seiner Pilgerreise nach Jerusalem heim kehrende Graf Botho zu Stolberg einst verkündet haben soll, er bevorzuge sein eigenes Land, welches er die Güldene Aue nenne und sei dafür sogar bereit, das gelobte Land, aus dem er just heim kehrte, einem anderen zu überlassen.
Matthes fuhr entlang der alten Heerstraße, welche von Nordhausen bis nach Merseburg führte. Heute längst ersetzt durch die Bundesstraße 80 und die Autobahn A 38.
Er fuhr durch die einzigartige Gipskarstlandschaft, bekannt auch als Rastplatz für die Vogelzüge. Bekannt für die Schlossanlagen von Auleben, von Heringen, von Roßla und Wallhausen.
Bereits fast am Ende seiner Fahrt, erreicht Matthes bei Nordhausen die Hainleite.
Einen überwiegend bewaldeten Höhenzug aus Muschelkalk, der sich fast fünfhundert Meter über Normalhöhennull erhebt. Und er ertappt sich dabei, wie er sich fragt, was ein Kind dieser Region dazu bringt, nach Afghanistan zu gehen. Aber zugleich und beinahe noch im selben Augenblick, findet er auch selbst die Antwort. Es ist der Entdeckerdrang des Menschen, der unbändige Wunsch, unsterblich zu werden. Und hatten nicht auch in früheren Zeiten Einwohner dieser abgeschiedenen und einsamen ländlichen Gegend, wie jener Graf Botho von Stolberg, ihr Bündel geschnürt und waren in die Fremde aufgebrochen? Letzterer sogar bis nach Jerusalem und in das Heilige Land?
Und war nicht auch das ferne Afghanistan, von dem man beinahe täglich in den Zeitungen las und im Fernsehen sah und hörte, für seine Bewohner heiliges Land? War es nicht derjenige Boden, um welchen nach dem Einmarsch der Sowjets im Jahre 1979 die Mudschaheddin bis zur Selbstaufgabe ihren sogenannten asymmetrischen Krieg geführt hatten, in dem sie doch am Ende siegreich blieben?
War es nicht, der wörtlichen Bedeutung nach, das Land der Afghanen? Das Land jenes Volkes und jener Stämme, die sich Paschtunen nannten und die Regionen vom indischen Subkontinent bis in jenes Afghanistan seit alter Zeit bewohnten?
War es nicht für die Paschtunen schon im 16. Jahrhundert heiliges und gelobtes Land gewesen, als es in den tschagataischsprachigen Memoiren eines gewissen Zahir ad-Din Muhammad Babur, des Begründers des Mogulreiches, zum ersten Mal offiziell erwähnt wurde?
War es seinen Bewohnern nicht heilig, ob es die fremdländischen Kartographen aus Schottland oder aus anderen Ländern, die es bereist und vermessen, die seine Berge bestiegen hatten, gierig auf der Suche nach den Bodenschätzen, nun Afghanistan oder Kabulistan genannt wurde? Für die Paschtunen blieb es heiliger Boden, den sie schlicht und über die Jahrhunderte hinweg und durch die islamische Blütezeit unter den Persern hindurch, stets nur schlicht Chorasan genannt hatten.
Das Land Chorasan, jenes Gebiet im Norden und im Westen des heutigen Afghanistan, welches bei den Arabern Hurasan wa-Ma wara‘ an-nahr hieß und wörtlich Land der aufgehenden Sonne bedeutete, was wiederum auf den Osten eines Gebietes verwies.
Unter Kyros dem Großen hatte die Region zum Perserreich gehört. Unterteilt in die vier Satrapien von Baktrien, von Sogdien, von Choresmien und Parthien.
Alexander der Große hatte das Land schließlich zur makedonischen Kolonie gemacht, welche von Mazedonien aus verwalte wurde.
Unter den Kalifaten der Umayyaden und der Abbasiden war das Land schließlich um 651 arabisch geworden.
1220 überrannten die Mongolenhorden, die wilden Reiter der Steppe unter Dschingis Khan, die im Sattel lebten, das Land Chorasan und sie führten es zu einer neuen Blüte, die über Jahrhunderte hindurch anhalten sollte.
1598 kam es zum großen Teil unter den Safawiden in iranischen Besitz. Seit 1748 jedoch beherrschten es stets die paschtunischen Emire aus der Dynastie der Nachkommen von Ahmad Schah Durrani, die zahlreiche berühmte Mitglieder der königlichen Familie Afghanistans stellte. Aber auch bekannte Kaufleute, Bürokraten, Händler und Angestellte, die ihren starken persischen Einfluß nie verleugnet hatten und die dennoch ein ehrenwerter und würdiger Stamm waren.
Aber bereits 1884 streckte der gierige Vater des später ermordeten letzten russischen Zaren Nikolaus, seine Hand nach dem Lande Chorasan aus, in dem sich zu dieser Zeit die Völker, ihr Wissen, ihre Traditionen, ihre Ehrbegriffe und ihre Leidenschaften und Kulturen miteinander mischten, wie die Sandkörner in der Ebene und wie das Geröll der Flüsse im Frühjahr nach der Schneeschmelze.
Die Paschtunen aber, sie blieben Muslime. Wie schon seit je her. Und besonders jene unter ihnen, welche der hanafitischen Richtung anhingen, die eine der vier großen Madhahib, der Rechtsschulen des sunnitischen Islams darstellte, befolgten stets den Ehrenkodex des Paschtunwali.
Das Paschtunwali, das ist nicht weniger, als die Summe ihrer überlieferten Stammesgesetze, wie sie nicht nur ideell, religiös und kulturell von essentieller Bedeutung ist, sondern auch, nach dem Glauben der hanafitischen Paschtunen, eine regelrechte Schutzfunktion im täglichen Leben ausübt. Eine Schutzfunktion, die sich auf de Familie, auf den Stamm, auf die gesamte Nation und vor allem auf die Ehre des Einzelnen und der Gemeinschaft erstreckt.
Paschtunwali, Paschtu oder Afghanyat: Das ist die uralte und bereits vorislamische Summe jener Traditionen und Gebräuche, die seit der Antike vieles vom einzelnen Stammesmitglied verlangen. Dazu gehört die Vergeltung, der Badal, wie sie es nennen. Der Badal, der für Austausch steht. Für den Austausch nach einer Kränkung, was nicht zwingend die Tötung eines Widersachers bedeutet, sondern auch für Austausch oder Wiedergutmachung steht, die ebenso gut in Gestalt von Geld, von Waren oder von Heirat erfolgen kann.
Dazu gehört die Gastfreundschaft, die Melmastya, die im Paschtunischen über allen Werten rangiert. Die Melmastya schließt das uralte Asylrecht ebenso in sich ein, wie den Nanawati, den Einlass oder die Vergebung. Absolut jedem und damit auch dem ärgsten Feind, muss der Nanawati gewährt werden. So schreibt es das Paschtunwali vor.