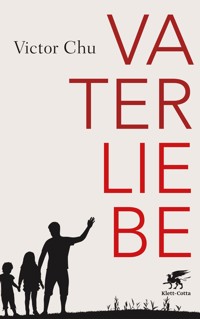24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was macht für eine Mutter die Beziehung zu einem Sohn so besonders? Und was macht für einen Mann die Beziehung zur Mutter so einzigartig? Victor Chus Buch ist geschrieben im Geiste von Liebe und Versöhnung. Es regt Männer dazu an, den Einfluss ihrer Mutterbeziehung auf ihr Mannsein, ihr Verhältnis zu Frauen, ihre Sexualität und ihre Stellung in der aktuellen Familie zu überdenken, und es sensibilisiert wiederum Mütter für die Bedürfnisse ihrer Söhne. In diesem sehr persönlichen Buch arbeitet Victor Chu die Merkmale einer (zu) engen Mutter-Sohn-Beziehung heraus mit all ihren Schattierungen wie Leidenschaft, Scham, Treue, Verrat, Sehnsucht, Erwachsenwerden und Familiengeheimnisse. Der Autor schildert die möglichen psychischen Auswirkungen der engen Symbiose für Mutter und Sohn und ihre Beziehung von der Geburt bis zum Tode. Unter anderem geht es dabei um: - Unterschiede zwischen Mutter-Tochter- und Mutter-Sohn-Beziehungen - den Einfluss der Liebesbeziehung zwischen Vater und Mutter auf deren Beziehung zum Sohn - eine Wiederannäherung im Alter: Versöhnung und Rollenumkehr zwischen Müttern und Söhnen - den Einfluss der Mutterbeziehung auf die späteren Liebesbeziehungen eines Mannes - die Mutter-Sohn-Beziehung im therapeutischen Kontext Dieses Buch richtet sich an: - Mütter, Söhne und vor allem deren Ehefrauen oder PartnerInnen - PsychotherapeutInnen und FamilienberaterInnen - Coaches
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
»Mutter, Sohn« Kalligraphie von Martina Geßner
Victor Chu
Die Mutter im Leben eines Mannes
Eine lebenslange Bindung
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2020 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Illustrationen: S. 2, »Mutter, Sohn«, Kalligraphie von Martina Geßner
S. 242 © Shutterstock/siridhata
Cover: Bettina Herrmann, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von © Shutterstock/Maria Sbytova
Datenkonvertierung: Tropen Studios, Leipzig
Printausgabe: ISBN978-3-608-96334-2
E-Book: ISBN978-3-608-11619-9
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20461-2
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Persönliche Einleitung
Für wen ist dieses Buch gedacht?
Teil I
Meine Geschichte
Der Wendepunkt
Umbruch, Einbruch, Zusammenbruch
Die unsichtbare Bindung
Das Leben meiner Mutter
Welche Beziehung hatte ich zu meiner Mutter?
Welche Funktionen hatte ich für meine Mutter zu erfüllen?
Wie hat sich meine Mutterbeziehung auf mein Leben ausgewirkt?
TEIL II
Die gestörte Mutter-Sohn-Beziehung
Ursachen und Auswirkungen einer überstarken Mutterbindung
Formen elterlichen Missbrauchs
Wenn der Vater fehlt oder abwesend ist, oder: Warum ist der Vater wichtig?
Der Vater als Liebespartner der Mutter
Schwangerschaft und die Zeit danach
Die »Gorilla-Funktion«
Triangulierung
Geschlechtsidentität
Die ödipale Phase: Die Mutter als die erste Frau im Leben des Sohnes, der Vater als der erste Mann im Leben der Tochter
Pubertät
Der Vater als stützender Hintergrund in allen Lebenslagen
Die frühkindliche symbiotische Bindung an die Mutter
Die narzisstische Besetzung des Sohnes durch die Mutter
Die Familie und das Verhältnis zwischen den Geschlechtern in einem gleichberechtigten Gesellschaftssystem im Vergleich zu einem patriarchalischen Gesellschaftssystem
Das Verhältnis zwischen den Familienmitgliedern in einem gleichberechtigten Familiensystem im Vergleich zu einem patriarchalischen Familiensystem
Narzisstische Abwertung der Tochter in einer patriarchalischen Gesellschaft
Narzisstische Partnerwahl
Enttäuschung in der Partnerschaft
Die Besetzung des Sohnes als narzisstisches Selbstobjekt
Die Anfälligkeit von männlichen Säuglingen und Jungen
Der höhere Stellenwert von Jungen in einer patriarchalischen Gesellschaft
Der Sohn als narzisstisches Selbstobjekt der Mutter
Mütterliche Macht und Potenz: Große Frau – kleiner Mann
Temporäre oder permanente Mutter-Sohn-Symbiose
Die Fixierung des Sohnes in der Mutter-Sohn-Symbiose: Entwicklungsstillstand
Der Extremfall: Die Verschmelzung von Mutter und Kind zu
einem
Wesen
Der Ausschluss des Vaters: Wenn eine Triangulierung nicht stattfindet
Die Benachteiligung der Töchter
Das Bedürfnis der Tochter nach väterlicher Bestätigung
Ödipus
Revisited:
Die Befreiung aus der narzisstischen Bindung an die Mutter
Die Liebesfähigkeit eines muttergebundenen Mannes
Vom bindungsunfähigen Sohn zum beziehungsfähigen Mann
Sexueller Missbrauch durch die Mutter
Reaktionen des Kindes auf den sexuellen Missbrauch
Heilung des sexuellen Missbrauchs durch die Mutter
Kinder psychisch kranker Mütter
Wie wachsen Kinder psychisch kranker Mütter auf?
Hilfen für psychisch kranke Mütter
Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern
Exkurs: Von Therapeuten, die selbst Kinder psychisch kranker Mütter sind
TEIL III
Heilung und Versöhnung
Von der Schwierigkeit, heute Mutter zu sein
Muttersein ist Schicksal, Vatersein eine Wahl
Der Unterschied zwischen Müttern und Vätern
Gender versus Sexus – von der Ausblendung des Mutterseins
Vom Stress, heute Mutter zu sein
Vom Verschwinden der Mütter aus der Gender-Debatte
Ein »maskuliner Feminismus«
Für eine Neubelebung der Mütterlichkeit und Väterlichkeit
Was braucht eine Mutter an Unterstützung?
Die Rolle der eigenen Mutter und der Großmutter
Die Partnerbeziehung zwischen den Eltern
Zur Versöhnung der Geschlechter
Abschied nehmen von der Mutter
Versöhnung mit meiner Mutter
Die Erlösung der Mutter und die Rückkehr des Vaters
Mich von meiner Mutter »entkoppeln«
Exkurs: Zwei Meditationen
Vision einer befreiten Mutter und eines befreiten Vaters
Vision von Deinen Eltern und Dir als fünfjährige Kinder
Nachgedanken: Was könnte eine gute Grundlage für die Familie sein?
Mutter und Vater ent-binden und das eigene Leben in die Hand nehmen
Der Fluss des Lebens
Von der persönlichen zu einer politischen Versöhnung
Anmerkungen
Literatur
Dies Buch widme ich
meinen Schwestern, die Mutter und Vater mit mir teilten
allen Tibetern und Uiguren,meinen Landsleuten im In- und Ausland,besonders den Hongkongern
und
meinem japanischen FreundKazuaki Tanahashi,der mir beibrachte,meine Feinde zu lieben
Der Glanz in den Augen der Mutter beim Anblick ihres Sohnes mag schmeichelhaft, aber nicht immer gut für den Jungen sein.
Victor Chu
Selbstgeständnis
Ich bin meiner Mutter einzig Kind,
Und weil die andern ausblieben sind,
Was weiß ich wie viel, die sechs oder sieben,
So ist eben Alles an mir hängen blieben;
Ich hab’ müssen die Liebe, die Treue, die Güte
Für ein ganzes halb Dutzend allein aufessen,
Ich will’s mein Lebtag nicht vergessen.
Es hätte mir aber noch wohl mögen frommen,
Hätte ich nur auch Schläg’ für Sechse bekommen.
Eduard Mörike (1804–1875)
Vorwort
Erlauben Sie mir gleich zu Beginn eine Vorbemerkung: Es geht in diesem Buch nicht um eine allgemeine Abhandlung über die Beziehung zwischen Müttern und Söhnen. Vielmehr geht es um das Verhältnis zwischen schwierigen Müttern und ihren Söhnen. Mich hat als Psychotherapeut interessiert, welche Konflikte entstehen können, wenn eine Mutter persönliche Probleme hat, die sie unbewusst auf den Sohn überträgt und die ihr gegenseitiges Verhältnis belasten.
In vielen Gesprächen mit Männern habe ich erfahren, wie ein Zuviel oder Zuwenig an Mutterliebe ihnen Schwierigkeiten in ihrem erwachsenen Leben bereiten können. Frauen beklagen sich darüber, dass ihre Partner mehr an der Mutter hängen als an ihnen, dies aber vehement ableugnen. Und Töchter sind darauf eifersüchtig, dass ihre Mütter den Bruder selbst im Erwachsenenalter bevorzugen. Schließlich sind manche Mütter darüber verzweifelt, dass sie ihre erwachsenen Söhne nicht verstehen, dass sie keinen Zugang mehr zu ihnen finden und sie sich deshalb Sorgen um sie machen. Ihnen allen möchte ich Erklärungen für das komplexe Geflecht in der Beziehung zwischen Müttern und Söhnen an die Hand geben, damit sie ihr gegenseitiges Verhältnis klären und besser gestalten können.
Es ist unmöglich, objektiv über Mütter nachzudenken und zu schreiben. Jeder Mensch, egal Frau oder Mann, den man nach seinem Verhältnis zur Mutter fragt, kommt mit persönlichen Erinnerungen und Geschichten, die mit positiven oder negativen Gefühlen besetzt sind. Das Verhältnis zur Mutter ist immer subjektiv und immer emotional, ist sie doch die erste und die prägendste Beziehung in unserem Leben. Selbst ein Mensch, der gleich nach der Geburt von seiner Mutter zur Adoption freigegeben wurde, hat die ersten neun Monate seines Lebens in ihrem Uterus erlebt, war mit ihr über die Nabelschnur aufs Innigste verbunden, hat alles miterlebt, was ihr während der Schwangerschaft widerfuhr. Mit der Mutter ist er gemeinsam durch die Geburt gegangen, einen Prozess, in dem es für beide um Leben und Tod geht.
Wieviel stärker und persönlicher ist das Verhältnis zur Mutter für Menschen, die mit ihr nicht nur Schwangerschaft und Geburt erlebt haben, sondern jahrelang von ihr genährt und großgezogen worden sind. Die Mutter ist schlichtweg die prägendste Person in unserem Leben.
Umgekehrt ist es für eine Mutter unmöglich, neutral über ihr Verhältnis zu ihren Kindern zu berichten. Zum einen ist die Fähigkeit, ein Kind zu bekommen und auf die Welt zu bringen, ausschließlich dem weiblichen Geschlecht vorbehalten. Sie gehört zum Schicksal einer Frau, von manchen als Geschenk, von anderen als Fluch empfunden, mit all den Nuancen dazwischen. Diese Tatsache führt dazu, dass keine Frau neutral über Mutterschaft und Muttersein sprechen kann. Zudem berührt dieses Thema auch ihre Geschichte mit ihrer Mutter. Muttersein ist ein Fluss, der von Großmutter zur Mutter zur Tochter und weiter fließt. Therapeutinnen berichten, dass es nicht selten vorkommt, dass eine Frau bei der Geburt ihres Kindes ihre eigene Geburt durchlebt, diesmal in der Doppelrolle als Gebärende und als (einstiges) Kind. Vor diesem Hintergrund nimmt es nicht wunder, dass die meisten Mütter ihre Kinder mit vielschichtigen Gefühlen betrachten. Eine Mutter erzählt, dass es unmöglich sei, sich nicht in Extremen zu sehen: Entweder tue sie als Mutter zu viel oder zu wenig. Sie sei ihre schärfste Kritikerin. Aus diesem Grund hat eine Mutter fast nie das Gefühl, ihre Kinder richtig zu behandeln. Es ist schier unmöglich, eine »ideale Mutter« zu sein.
Es ist also weder aus der Perspektive des Kindes noch aus der der Mutter möglich, objektiv über Mütter und Muttersein zu denken und zu sprechen. Vielleicht ist dies der Grund, warum das Thema Mutter in der öffentlichen Diskussion oft nur mit Samthandschuhen angefasst wird. In der psychologischen Literatur finden wir zwar eine Menge Ratgeber dafür, wie man Kinder richtig erziehen soll. Aber über die Probleme, die Kinder mit ihren Müttern haben, ihre Ängste, ihre Schmerzen, ihr Leid – das Kind als Opfer seiner Mutter –, darüber wird kaum etwas geschrieben. Es ist, als betrete man eine Tabuzone, wenn man sich über Mütter beklagt. Darüber darf zwar unter vier Augen erzählt werden, aber in der Öffentlichkeit? Da wird die Mutter verehrt und auf einen Sockel gestellt. Das größte Vorbild dafür ist die Mutter Gottes.
Ich habe nur ein einziges Madonnenbild gesehen, auf dem die Madonna das Jesuskind verprügelt. Es ist 1926 von Max Ernst gemalt worden, mit dem Titel »Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind vor drei Zeugen: André Breton, Paul Éluard und dem Maler«. Auf dem Bild sieht man, wie Maria mit einem starren, ausdruckslosen Blick das nackte Jesuskind auf ihrem Schoß mit der linken Hand festhält und mit der rechten ihm auf den bereits geröteten Po schlägt. Dabei trägt sie den Heiligenschein. Seiner ist jedoch auf den Boden gefallen. In den gefallenen Heiligenschein hat der Maler seine Signatur gesetzt. Im Hintergrund schauen drei Männer durch ein winziges Fenster zu. Man könnte das Bild so deuten, dass Max Ernst seinen beiden Freunden über seine einstige Züchtigung durch die Mutter erzählt. Das Bild löste 1926 ein Skandal aus. Als es im Kölnischen Kunstverein ausgestellt wurde, soll der damalige Erzbischof gefordert haben, es abzuhängen.
Wie sehr unsere Idealvorstellung der Familie von der Realität abweicht, zeigt folgendes Zitat aus den Federn eines führenden Traumatherapeuten:
»(…) denn Menschen seien nun einmal Virtuosen des Wunschdenkens und des Verschleierns der Wahrheit (…) Wir wollen im Grunde nicht wissen, was Soldaten im Kampf durchmachen. Wir wollen auch nicht wissen, wie viele Kinder in unserer Gesellschaft sexuell belästigt, missbraucht oder misshandelt werden, und auch nicht, wie viele Paare – es ist fast ein Drittel – irgendwann in ihrer Beziehung gewalttätig werden. Wir möchten uns die Familie als einen sicheren Hafen in einer herzlosen Welt vorstellen und unser eigenes Land als von aufgeklärten und zivilisierten Menschen bewohnt. Wir ziehen es vor zu glauben, dass Grausamkeiten nur an fernen Orten wie in Darfur oder im Kongo stattfinden (…).« (Van der Kolk 2015, S. 20)
Über das zwiespältige Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern hat Nancy Friday 1977 zum ersten Mal in ihrem Buch My Mother Myself geschrieben. Über Mütter und Söhne wurde jedoch kaum etwas Kritisches geschrieben. Das Buch von Karl Haag, Wenn Mütter zu sehr lieben. Verstrickung und Missbrauch in der Mutter-Sohn-Beziehung (2015), bildet eine große Ausnahme, ebenso das erschütternde autobiographische Buch Das wahre »Drama des begabten Kindes« (2016) von Martin Miller, dem Sohn von Alice Miller. Er beschreibt darin, wie seine weltberühmte Mutter, die in ihren Büchern stets die Psyche des Kindes gegen den Machtmissbrauch der Eltern verteidigt, aufgrund ihrer erlittenen kriegs- und holocaustbedingten Traumata ihre eigenen Kinder abgeschoben, vernachlässigt und den Misshandlungen durch deren Vater tatenlos überlassen hat.
Gerade Männern scheint es schwerzufallen, über die schmerzlichen Seiten ihrer Mutter-Beziehung nachzudenken und zu schreiben. Zu tief sitzt die Wunde. Zu sehr wehrt sich die männliche Seele dagegen, zugeben zu müssen, einst als hilfloser Junge von der Mutter abhängig gewesen zu sein, vielleicht sogar von ihr gedemütigt, misshandelt oder missbraucht worden zu sein. Zu sehr steht dies dem gewohnten stereotypen Bild des starken Mannes entgegen, der ein Mann in der Gesellschaft zu sein hat.
Es ist jedoch gerade die Umkehrung des Klischees von dem starken Mann hier und der schwachen Frau dort, die das Verhältnis zwischen Müttern und Söhnen so interessant macht. Wir vergessen zu oft, dass jeder Mann, egal ob Macho oder Softie, einmal ganz klein und hilflos gewesen ist und seiner Mutter ausgeliefert war. Damit beginnt das Leben eines jeden Mannes. Hier beginnt auch seine Geschichte mit der Frau. Die Mutter ist die erste Frau im Leben eines Mannes. Sie prägt sein Verhältnis zu sich selbst, indem sie ihm zum ersten Mal das Gefühl dafür gibt, wie es ist, ein Mann zu sein. Vor allem aber prägt sie sein Verhältnis zu allen Frauen, die er später antreffen wird. Mit ihr macht er seine ersten Erfahrungen mit der weiblichen Stimme, dem weiblichen Duft und der weiblichen Haut. Hier spürt er Wärme und Kälte, Liebe und Schmerz.
Umgekehrt begegnet eine Mutter in ihrem Sohn zum ersten Mal ein männliches Wesen, das klein, ja winzig ist, ein Wesen, das total von ihr abhängig ist, dessen Wohl und Weh von ihrem guten (oder schlechten) Willen abhängt. Hier erlebt sie die Umkehrung des Mann-Frau-Verhältnisses, das sie sonst in ihrem Leben antrifft. Wie wird ihr eigenes Verhältnis zu Männern – zu ihrem Vater, zu ihren Brüdern, zu ihren Vorgesetzten, zu ihren Liebespartnern und zum Vater des Kindes – sich auf die Beziehung zu ihrem kleinen Sohn abfärben? Welche Botschaften gibt sie ihm auf den Weg, wie er später als Mann zu sein hat? Wie stark bestimmt sie ihn in seinem Mannsein?
Jeder Mann, mit dem ich über sein Verhältnis zur Mutter spreche, berichtet von schwierigen, manchmal von schrecklichen Erfahrungen, die er mit ihr gemacht hat. Viele möchten dieses Kapitel für immer hinter sich lassen und nichts mehr davon wissen. Viele haben eher ein »mechanisches« Verhältnis zu ihrer Mutter entwickelt: Man besucht sie nach einem bestimmten Ritual. Dabei wechselt man immer die gleichen nichtssagenden Worte, man trinkt Kaffee miteinander, dann gibt man sich die Hand oder ein flüchtiges Küsschen, um dann erleichtert ins eigene Leben zu flüchten, bis zum nächsten Mal. Dabei vergisst man, dass die Mutter einen unsichtbar begleitet, bei jedem Schritt. Sie haust im Herzen jedes noch so erwachsenen Sohnes und beeinflusst alles, was er tut, bis in seine Liebesbeziehungen hinein.
Männer fühlen nicht gerne, vor allem fühlen Männer sich nicht gerne. Männer tun lieber etwas. Im Tun blenden Männer aus, was sie lieber nicht fühlen wollen. Und doch wird ihr Tun durch ihr Fühlen bestimmt, auch durch das Fühlen, das sie ausblenden. Das ist das Vertrackte am Unbewussten. Je mehr wir von ihm weglaufen, desto hartnäckiger verfolgt es uns, desto stärker bestimmt es unser Tun. Zu fühlen, was ein Mann von seiner Mutter mitbekommen und mit ihr erlebt hat, bringt ihn zurück an die Quelle seines Seins. Wenn er den Weg zurückfindet, findet er auch zu sich selbst zurück. Stück für Stück eignet er sich sich selbst wieder an: seine Kindheit, seine Jugend, seine Männlichkeit. Wenn er mit seiner Mutter aufgeräumt hat, kann er sein Leben endlich neu in die Hand nehmen und nun selbst bestimmen, wohin es weitergehen soll in seinem zukünftigen Leben. So habe ich es auch beim Schreiben dieses Buchs erfahren.
Die Bedeutung der Mutter-Sohn-Beziehung geht dabei weit über das individuelle Leben eines Mannes hinaus. Sie ist ein entscheidendes Glied in der Kette von Männer-Frauen-Beziehungen in unserer Gesellschaft. Wenn wir das Gewalt- und Herrschaftsverhältnis zwischen Männern und Frauen überwinden wollen, müssen wir zunächst schauen, wie in unserer Gesellschaft Frauen von Männern behandelt werden. Viele erfahren von ihren Partnern sexuelle und körperliche Gewalt und werden von ihnen gedemütigt.[1] Danach können wir verfolgen, wie die betroffenen Frauen später selbst ihre Söhne behandeln: Entweder verwöhnen sie diese grenzenlos (narzisstische Überhöhung), machen sie zu ihrem Ersatzpartner (ödipaler oder inzestuöser Missbrauch), oder sie lassen sie ihre Ablehnung des männlichen Geschlechts spüren (narzisstische Abwertung). Diese Söhne wachsen unter dem Einfluss ihrer Mütter zu erwachsenen Männern heran, die ihrerseits mit den Frauen in ihrem Leben so umgehen, wie sie es am Beispiel der Eltern erlernt haben. Diese Frauen bekommen wiederum Söhne und der Teufelskreis beginnt von Neuem. Das eine geht nahtlos ins andere über. Innerhalb dieser Kette spielt die Mutter-Sohn-Beziehung eine entscheidende Rolle in der Formung des Verhältnisses zwischen den Geschlechtern. Wir müssen das Ganze als einen durch die Generationen fortlaufenden Prozess anschauen, wo Positives wie Negatives transgenerational weitergegeben und weiterentwickelt wird.
Von all den genannten Gliedern in der Kette konzentriere ich mich in diesem Buch auf die Mutter-Sohn-Beziehung. Damit vervollständige ich meine Betrachtung der Eltern-Kind-Beziehung, die mit dem letzten Buch Vaterliebe begonnen hat. Dabei arbeite ich gleichzeitig meine eigene Beziehung mit meinen Eltern auf. Es ist nur ein Versuch, aber ich glaube, es ist diesen Versuch wert.
Persönliche Einleitung
Dies ist ein persönliches Buch. Persönlich, weil das Thema Mutter jeden Menschen an seinen frühesten und tiefsten Erfahrungen berührt. Daher wäre es illusorisch, ein objektives Buch über die Mutterbeziehung schreiben zu wollen. Jeder, der darüber nachdenkt, tut dies aufgrund seiner ureigenen Erlebnisse und Erinnerungen. Daher bitte ich die Leser, dieses Buch weniger als eine Quelle objektiver Tatsachen oder Erkenntnisse zu betrachten, sondern es als Anregung zur Reflexion über die eigene Mutterbeziehung zu nutzen.
Ich schreibe über ein Thema, wahrscheinlich das Thema, das mich mein Leben lang beschäftigt hat: die Beziehung zu meiner Mutter. Ich glaube, dass alle meine bisherigen Bücher um dieses Thema gekreist sind. Natürlich schreibt jeder Autor über für ihn Wesentliches. Nur versuchen die meisten, das Persönliche auf irgendeine Weise zu verkleiden oder zu verschleiern. Doch als Leser spürt man, welche Stellen authentisch und welche bloß ausgedacht sind. Das Fesselndste ist das, was aus dem persönlichen Erleben des Autors stammt.
Meine persönliche Geschichte habe ich in meinen bisherigen Büchern mehr oder weniger verdeckt gehalten, um mich und die Menschen, die mir nahestehen zu schützen. Mit zunehmendem Alter kann ich mehr zu mir stehen. Dies ist eines der wenigen Privilegien des Alters.
Das Mutterthema berührt jeden Menschen tief in seinem Inneren. Wenn ich darüber schreibe, begebe ich mich an die prägendsten Erlebnisse meines Lebens. Davor habe ich mich bislang gescheut. Auch wollte ich meine Mutter in ihrer Privatsphäre schützen, gehört doch das Muttersein zu den intimsten Lebenserfahrungen einer Frau. Mit ihrem Tod haben sich nun viele äußere und innere Fesseln gelöst. Zumindest sind sie lockerer geworden. Ich fühle mich endlich frei genug, um über dieses persönlichste Kapitel meines Lebens nachzudenken und es aufs Papier zu bringen.
Ich schreibe, weil dies mein Weg ist, etwas, das ich zunächst nur gefühlsmäßig erahne, zu präzisieren und fassbar zu machen. Ich schreibe, um das Knäuel an Liebe, Schmerz, Angst und Verzweiflung, das ich mit meiner Mutter verbinde, zu entwirren und zu verstehen.
Ich werde die Beziehung zur Mutter aus meiner Sicht als Sohn wiedergeben. Gleichzeitig möchte ich versuchen, das, was meine Mutter in ihrem Leben als Tochter, als Heranwachsende, als Frau und Ehefrau, als Mutter und Schwiegermutter, als Großmutter und Urgroßmutter, zuletzt als Demente und Siechende durchgemacht hat, mitfühlend zu verstehen, so wie ich es auch mit einer Klientin machen würde.
Der gravierende Unterschied zu einer Klientin besteht jedoch darin, dass es meine Mutter ist, ein Mensch, dem ich so nahe gestanden bin wie sonst keinem – mein Leben begann buchstäblich in ihr. Meine Perspektive ist dadurch stets eine subjektive. Alles, was ich über sie schreibe, betrifft mich selbst auf irgendeine Weise.
Es war eine 71 Jahre lange Beziehung, sie umfasst beinahe mein ganzes Leben. Nur langsam entferne ich mich von dem Punkt, an dem wir uns trennten. Das war, als meine Mutter starb. Seither lebe ich wirklich für mich. Ich lebe, ich bin, ohne dass meine Mutter sich irgendwo auf der Welt befindet und an mich denkt oder auf mich wartet. Es ist eine erstaunliche, eine kostbare Freiheit, die ich seither gewonnen habe. Ich wundere mich immer noch darüber, dass ich ihr keine Grußkarte mehr aus dem Urlaub zu schreiben brauche. Jetzt, wo ich es nicht mehr tun muss, vermisse ich es sogar ein wenig! Ihr Haus ist leer, heute wohnen andere Menschen darin. Wir werden nie mehr zu zweit an ihrem Esstisch sitzen und chinesisch essen. Die Freiheit von meiner Mutter fühlt sich auch wie eine große Leere an.
Nun, endlich, kann ich in Ruhe über sie nachdenken und schreiben, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ohne Rücksicht nehmen zu müssen, ohne sie schützen zu müssen. Es ist eine Befreiung von einer Riesenlast, einer, von der ich dachte, ich würde sie niemals loswerden können. Nun bin ich frei. Ich hoffe, meine Mutter ist es ebenfalls.
Liebe und Leid, Leid und Liebe
Ich schreibe dieses Buch, um das Leid, das meine Geschwister und ich durch unsere Mutter erlitten haben, zu verarbeiten. Ich erzähle aus meiner Perspektive. Meine Schwestern würden ihre Geschichte ganz bestimmt anders erzählen, aus ihrer Perspektive als Töchter. Dennoch kann man aus meiner Geschichte vieles erahnen, was sie als Töchter durchgemacht haben.
Ich erzähle diese Geschichte gleichzeitig als Liebesgeschichte. Weil wir unsere Mutter liebten und lieben. Und umgekehrt bin ich sicher, dass unsere Mutter uns ebenfalls geliebt hat und uns ihre Liebe, so gut sie konnte, geschenkt hat. Manchmal ist das Zurückhalten eines Fluches bereits ein Liebesbeweis. Ich erzähle davon, wie innig Liebe und Leid ineinander verwoben sein können, dass Liebe und das Geliebtwerden sich gelegentlich belastend, ja bitter anfühlen können, auf der anderen Seite im Leid immer noch ein Hauch von Liebe spürbar sein kann.
Es gibt für alles, was wir im Leben erfahren, gute und schlechte Seiten. Der Zenmeister Thich Nhat Hanh hat den Satz geprägt: »Keine Lotusblüte ohne Schlamm«. In unserer Mutterbeziehung, der ersten unseres Lebens, hat jeder Mensch wohl Gutes und Böses erfahren – Liebe und Ablehnung, Liebkosungen und Schläge, Lob und Abwertungen.
Das Gute können wir dankbar annehmen und weiterpflegen. Das Böse können wir als Herausforderung annehmen. Misshandlungen und Missbrauch können uns gedemütigt haben, sie können uns aber auch zu mehr Bewusstheit, Widerstandskraft, Sensibilität und Mitgefühl verhelfen, wenn wir die erfahrenen Verletzungen durcharbeiten und überwinden. Es liegt an uns, uns zu heilen. Es verlangt Mut und Ausdauer, uns mit den Verletzungen von früher zu konfrontieren, den Schmerz durchzugehen, um ans andere Ufer zu gelangen.
Die Mutterbeziehung ist nicht nur die Älteste, sie ist auch die Prägendste unseres ganzen Lebens. Es lohnt sich, sie durchzuarbeiten und ihr Zeit zu widmen. Wir können unsere Geschichte mit unserer Mutter, unser gegenseitiges Verhältnis damals wie heute und die Gefühle, die wir damit verbinden, genauer anschauen, um sie schließlich zu begreifen und in uns zu integrieren. Denn wir haben unsere Mutter und unseren Vater in uns, als genetisches Erbe, als Erinnerungsspur, als Grunderfahrung, auch wenn wir unsere eigene Persönlichkeit entwickeln und unseren Weg gehen. Hier hat die Lotusblüte ihre Wurzeln, auch wenn diese im Schlamm stecken.
In diesem Buch werde ich über viel Leidvolles berichten. Gleichzeitig werde ich versuchen, die Essenz von Beziehungen herauszuarbeiten, und diese erweist sich fast immer als die Liebe. In meinen Familienaufstellungen hat sich wieder und wieder gezeigt, wie Krieg, Gewalt, Missbrauch, Hass und Selbsthass angesichts der Liebe und der Selbstliebe ihre Macht verlieren. Im Tao Te King, einer der ältesten Schriften der Welt, steht: Wasser ist stärker als Stein, das Weiche überwindet das Harte.
Dieses Buch schreibe ich, um mich von meiner Mutter zu verabschieden, die vor eineinhalb Jahren 95-jährig verstorben ist. Ich schreibe, um mich von ihr zu befreien. Ich schreibe, um mich ihr zu nähern. Ich schreibe, um unsere Beziehung, die längste, die ich je hatte, und die schwerste, an der ich je zu tragen hatte, zu begreifen, um sie endlich loszulassen. Ich werde meiner Mutter vermutlich niemals gänzlich gerecht werden können. Ich kann nur versuchen, mich in sie zu versetzen und unsere Beziehung aus ihrer Perspektive zu betrachten.
Mich als Mann in eine Frau, noch dazu eine Mutter hineinzufühlen, ist eigentlich ein unmögliches Unterfangen. So unterschiedlich sind Mann und Frau. Das allererste Mal, dass ich diesen Unterschied spürte, war gegen Ende meiner Studienzeit, als eine Kommilitonin in unserer studentischen Selbsterfahrungsgruppe von ihrer Regelblutung erzählte. Ich spürte auf einmal tief in meinem Schoß eine Blume aufblühen, so etwas wie eine Lotosblume. Es war ein mir bis dahin völlig unbekanntes Gefühl. Ich war überwältigt. Wow, dachte ich, was für ein Wunder, so etwas wie eine Gebärmutter mitten im Körper zu haben und zu fühlen!
Mich in eine Frau hineinzuversetzen kommt mir verwegen, ja ungeheuerlich vor. Und doch muss ich es tun, wenn ich meine Mutter, wenn ich Mütter in ihrem Wesen verstehen will. Sonst bliebe ich auf meinen männlichen Blickwinkel beschränkt. Wir blieben als Männer und Frauen für immer getrennt, ohne uns je die Hand reichen zu können.
Meine Geschlechtsorgane hängen außerhalb meines Körpers. Eine Frau hat ihre Geschlechtsorgane tief in ihrem Körper. Darin entsteht neues Leben. Dort beherbergt sie ihre Kinder, bis diese lebensfähig sind, um sie dann, unter größten Schmerzen, in einem unglaublichen animalischen Akt, zur Welt zu bringen.
Dies ist der Anfang eines jeden Menschen. Jeder Mann kommt aus dem Schoß einer Frau. Das ist der Grund, weshalb Männer Frauen verehren. Das ist ebenfalls der Grund, warum Männer Frauen verachten und hassen. Darunter liegt meistens Furcht. Denn jeder Mann ist einmal Kind seiner Mutter gewesen. Er ganz klein und hilflos. Sie riesengroß und allmächtig. Jeder Mann ist zu Beginn seines Lebens seiner Mutter auf Gedeih und Verderb ausgeliefert gewesen, für eine ganz, ganz lange Zeit. Wenn die Mutter gut und liebevoll war, hat er allen Grund, sie zu verehren und ihr dankbar zu sein. War sie dagegen böse, abweisend, kalt oder missbrauchend, hat er allen Grund, sie zu fürchten, vor ihr zu fliehen oder lebenslang zu hassen. Die Unterdrückung der Frau ist ein Versuch, diese Lebensschmach zu vergessen, zu rächen und umzukehren.
Und doch, so sehr ein Mann auch vor seiner Mutter zu fliehen versucht, er wird sie niemals loswerden können. Sie wird immer der Ursprung seines Lebens sein, die Ursache seines tiefsten Schmerzes und seiner tiefsten Sehnsucht. Wenn ich also über meine Mutter schreibe, versuche ich eine Brücke zwischen Verehrung und Verachtung, zwischen Schmerz und Sehnsucht zu bauen. Ich will endlich Frieden finden.
Im Laufe dieser inneren Reise bin ich auf auf folgende Erkenntnis gestoßen:
Die Geschichte der Mutter-Sohn-Beziehung ist die Geschichte der Frau. In der Geschichte der Mutter-Sohn-Beziehung spiegelt sich die Geschichte der Beziehung zwischen Frau und Mann.
Das Besondere an der Mutter-Sohn-Beziehung ist, dass hier die Frau die Große, die Dominierende und Bestimmende ist, während der Mann klein, ausgeliefert und abhängig ist. Dies ist eine Umkehrung des Geschlechterverhältnisses, wie wir es sonst im patriarchalischen Gesellschaftssystem vorfinden.
Das Aufregende an dieser Umkehrung des Machtverhältnisses liegt darin, dass jeder Mann sein Leben als kleines, hilfloses männliches Wesen in der Beziehung zu einer großen und (all-)mächtigen Frau beginnt, die ihm das Leben schenkt, ihn am Leben hält, ihn nährt und großzieht. Auf der anderen Seite erlebt die Mutter eines Sohnes vielleicht zum ersten Mal, dass sie Macht über das Leben und die Zukunft eines Mannes in Händen hält. Wie beide dieses dynamische Verhältnis gestalten, ist höchst aufregend und von größter Bedeutung für das spätere Verhältnis der Männer zu Frauen, wie auch umgekehrt für das Verhältnis der Frauen zu Männern.
Um meine persönliche Geschichte von meinen allgemeinen Aussagen zu trennen, werde ich erst über meine Mutter und meine Beziehung zu ihr schreiben. Der erste Teil des Buches ist also autobiographisch.
In den nachfolgenden Teilen werde ich versuchen, allgemeine Aussagen zu formulieren über die Rolle, die eine Mutter im Leben eines Sohnes spielt. Ich gehe der Frage nach, weshalb die Geburt eines Sohnes meistens eine andere Bedeutung für eine Mutter hat als die einer Tochter; was dies für Folgen und Auswirkungen auf ihre Beziehung zum Kindesvater und das spätere Leben des Sohnes hat. Dabei werden auch die gesellschaftlichen Bedingungen zur Sprache kommen, unter denen Mütter und Väter in der Vergangenheit Söhne und Töchter bekommen haben und unter denen sie heute ihre Kinder bekommen. Unsere Geschlechtsidentität und das Verhältnis der Geschlechter zueinander haben unmittelbaren Einfluss auf die Art und Weise, wie wir Mutterschaft und Vaterschaft gestalten, persönlich wie gesellschaftlich. Wir werden sehen, wie soziale und politische Brüche, die im letzten Jahrhundert stattgefunden haben, ihre Spuren bis zu den Eltern und Kindern von heute hinterlassen haben.
Für wen ist dieses Buch gedacht?
Dieses Buch richtet sich zunächst an Männer – die alle Söhne ihrer Mütter sind. Wir können uns fragen, wie sich unsere Mutterbeziehung auf unser Leben ausgewirkt hat, positiv wie negativ. Wir werden ebenfalls unser Verhältnis zum Vater anschauen. Wenn wir über unsere Kindheit nachdenken, gehören Vater und Mutter untrennbar zusammen, egal ob der Vater an- oder abwesend gewesen ist.
Für Väter dürfte das Thema ebenfalls wichtig sein, um ihre Rolle in der Familie wertzuschätzen. Wir haben eine Tradition von abwesenden Vätern. Dadurch wird die Wichtigkeit des Vaters in der Familie häufig unterschätzt, bis hin zur Negierung jeglicher Bedeutung des Vaters für das Aufziehen von Kindern. Dies hat gravierende Folgen für die betroffenen Kinder wie für die Gesamtgesellschaft.
Das Buch richtet sich selbstverständlich an Frauen. Zuallererst an Mütter, die ihre Beziehung zu ihren Söhnen besser verstehen möchten. Dann an Frauen als Töchter, die vielleicht von ihren Müttern und Vätern anders behandelt worden sind als ihre Brüder. Drittens dürften sich wohl auch Schwiegertöchter für das besondere Verhältnis ihres Partners zu dessen Mutter interessieren.
Dieses Buch ist eine Fortsetzung und Vertiefung meines letzten Buches Vaterliebe. Beide Bücher ergänzen sich. In Vaterliebe habe ich über die Gründe für den Vatermangel und die Vaterlosigkeit in unserer Zeit nachgedacht und Wege zur Rehabilitierung des Vaters aufgezeigt. Das vorliegende Buch wendet den Blick auf die andere, mütterliche Seite. Beides gehört zusammen.
Statt eine allgemeine Abhandlung über die Mutter-Sohn-Beziehung zu schreiben, habe ich mich entschieden, meine persönliche Geschichte als Ausgangspunkt zu nehmen, um Licht in einige der dunkelsten Seiten der Mutter-Sohn-Beziehung zu bringen. Ich hoffe, dass die Lektüre Leser und Leserinnen dazu anregt, über ihre eigene Geschichte mit ihrer Mutter beziehungsweise mit ihren Söhnen nachzudenken. Dann hätte dies Buch seinen Zweck erfüllt.
Teil I
Meine Geschichte
Der Wendepunkt
Es war ein Tag vor Silvester. Meine Frau und ich hatten vor, über den Jahreswechsel wegzufahren. Eine Erkältung machte mir zwar zu schaffen, aber es ging mir schon besser. Alles war gepackt. Wir würden am nächsten Morgen losfahren.
Dann der Anruf aus heiterem Himmel. Es meldet sich die orthopädische Klinik: Meine Mutter sei am Nachmittag gestürzt, habe einen Oberschenkelbruch erlitten. Sie solle gleich operiert werden. Ob ich denn noch vor der OP kommen könne, um zu dolmetschen.
Ich setze mich sofort ins Auto und fahre hin. Es ist nicht weit, 20 Minuten. Beim Einbiegen in die Klinikeinfahrt nehme ich die Kurve zu scharf – mein hinterer Reifen rasiert fast den Bordstein ab. Oh, fährt es mir durch den Kopf, hoffentlich ist der Reifen noch ganz. Ich scheine doch ziemlich nervös zu sein.
Am nächsten Tag wird mir meine Autowerkstatt bescheinigen, dass mein Reifen den heftigen Aufprall heil überstanden hat. Aber der Oberschenkelknochen meiner Mutter ist glatt durchgebrochen. Zum Glück sei es nur der Kopf des Oberschenkelknochens, nicht der Schenkelhals, erklärt mir die diensthabende Ärztin. Der Bruch ließe sich gut nageln. Ich finde meine Mutter in ihrer Straßenkleidung auf der Trage liegend. Sie freut sich, mich zu sehen.
Die Operation gelang tatsächlich. Doch sollte sich das Leben meiner Mutter – und mit ihr mein Leben – seit diesem Ereignis grundlegend verändern. Sie erholte sich zwar körperlich recht schnell von der OP, wurde für vier Wochen in eine Rehaklinik verlegt, wo sie wieder gehen lernte. Aber als sie nach Hause kam, zeigte sich, dass sie zunehmend desorientiert war.
Wir hatten in der Zwischenzeit eine Ganztagspflegerin aus Osteuropa organisiert, die meine Mutter bekochte und versorgte. Vom äußeren Rahmen her war alles perfekt eingerichtet. Doch meine Mutter baute geistig ab. Sie wusste zum Beispiel nicht mehr, welchen Wochentag wir hatten. Manchmal war sie gut orientiert. An anderen Tagen erinnerte sie sich an nichts mehr. Sie verlegte Sachen und wusste nicht mehr, wo sie diese deponiert hatte. Richtig beunruhigt wurden wir, als die Pflegerin uns den verschmorten Wasserkocher zeigte, den meine Mutter auf die heiße Herdplatte gestellt hatte.
Einige Tage danach erlitt sie einen Schlaganfall. Wir fanden sie auf dem Boden neben ihrem Bett liegen. Diesmal war der Befund gravierender. Nach der Entlassung aus der neurologischen Klinik musste sie für viele Wochen in ein Altenheim in die Kurzzeitpflege, weil sie täglich 24 Stunden lang überwacht werden musste. Jeden Tag sprach sie, nunmehr in ihrer reduzierten Sprache, dass sie nach Hause möchte. Als sie nach zwei Monaten endlich in ihr Haus zurückehren durfte, war sie geistig auf den Stand eines Kindes zurückgefallen.
Während dieser Monate beobachtete ich bei mir selbst eine große Veränderung. Äußerlich hatte ich schnell auf die neue Situation reagiert. Zusammen mit meiner Schwester hatte ich alles gut organisiert: die engmaschige Betreuung durch das Pflegeheim, die Hausärztin, die Krankengymnastin, die Ergotherapeutin und die Masseurin. Selbst eine Friseurin kam nun regelmäßig zu ihr nach Hause. Äußerlich schien alles zufriedenstellend zu sein. Aber tief in mir fand ein gewaltiger Umbruch statt.
Umbruch, Einbruch, Zusammenbruch
Meine Erkältung, die ich bereits vor Silvester hatte, verwandelte sich nach dem Unfall meiner Mutter zu einer schweren Grippe. Sie wurde so schlimm, dass ich von Hustenanfällen regelrecht durchgeschüttelt wurde. Mein Rücken schmerzte so, dass ich kaum noch aus dem Bett kam. Endlich ließ ich eine Kernspinnaufnahme machen. Der Röntgenarzt schaute sich die Bilder an und fragte, wann mein Unfall gewesen sei – bei mir seien drei Lendenwirbel zusammengebrochen. Ich stand vor den Aufnahmen und war wie vom Donner gerührt: Mir war kein Unfall wie meiner Mutter zugestoßen. Aber mein Rücken war, genau wie ihr Bein, zusammengebrochen. Die Synchronizität beider Zusammenbrüche erschütterte mich zutiefst.
Ich hatte bis dahin gedacht, ich hätte mich längst von meiner Mutter abgenabelt. Seit ich nach dem Abitur das Elternhaus verlassen habe, führe ich ein selbständiges Leben. Ich lebte mit meiner eigenen Familie, meiner Frau und unseren Kindern zwar in der Nähe meiner Mutter. Sie passte auf die Kinder auf, wenn wir verhindert waren. Dafür waren wir dankbar. Aber inzwischen waren sie alle flügge geworden. Wir sahen uns nicht mehr oft.
Das Leben meiner Mutter und meines verliefen auf unterschiedlichen Bahnen. Ich ging meiner Arbeit nach, sorgte für meine Familie, fuhr in Urlaub. Sie ging einkaufen, schaute fern, telefonierte mit ihren Freundinnen und ihrem Bruder in Shanghai. Die Zeit floss dahin, als würde es ewig so bleiben.
Nun war dieser ruhige Fluss jäh unterbrochen. Nach den Jahrzehnten stetiger Gleichförmigkeit ging es mit dem Leben meiner Mutter abwärts, unerbittlich dem Ende entgegen. Und ich, der immerhin 24 Jahre jünger war, brach mit ihr zusammen. Wie war das nur möglich, wo ich doch jahrzehntelang so unabhängig von ihr gelebt hatte?
Die unsichtbare Bindung
Meine Mutter war keine einfache Person. Deshalb hielt ich immer Abstand zu ihr. Meine Besuche bei ihr waren eher Pflichtbesuche. Nun kümmerte ich mich auf einmal peinlichst um ihr Befinden und Wohlergehen, wie ein treuer Sohn, der nie von ihrer Seite gewichen war. Zuerst erklärte ich mir, dies gehöre zur konfuzianischen Tradition: Es ist Kindespflicht, für die Eltern zu sorgen, solange sie leben. Selbst nach deren Ableben verehrt man sie auf dem Familienaltar. Man geht jährlich zu ihrem Grab und opfert ihnen Papiergeld und ihre Lieblingsspeisen, damit es ihnen im Jenseits an nichts fehle.
Aber dies erklärt nicht die unerwartete emotionale Nähe, die ich zu meiner Mutter nach ihrem Unfall empfand: Als sie im Pflegeheim jeden Tag darum bat, nach Hause gehen zu dürfen, ging es mir immer schlechter. Eine Freundin sagte mir, ich sähe so traurig aus. Tatsächlich wurde ich mit jedem Tag depressiver. Ich fühlte die innere Verzweiflung meiner Mutter über die Tatsache, dass sie mit wildfremden Heimbewohnern zusammen sein musste, als sei ihre Verzweiflung meine eigene. Noch schlimmer war die Verantwortung, über ihr Wohl und Weh entscheiden zu müssen. Ich war zwar froh darüber, dass sie mir drei Jahre vorher eine Vollmacht erteilt hatte. So konnte ich alles Notwendige für sie veranlassen. Aber diese Verantwortung, ja die Macht, die ich auf einmal über meine eigene Mutter hatte, bedrückte mich sehr.
Ich erinnere mich an eine frühere Klientin: Sie hatte eine psychisch gestörte Mutter, die sie und ihren Bruder allein aufzog. Der Vater hatte die Familie längst im Stich gelassen. Als Kind war sie eigentlich die Erwachsene im Haus. Sie kümmerte sich um die Mutter, den Haushalt und den jüngeren Bruder. Nachdem sie endlich erwachsen war, floh sie aus dem Mutterhaus. Sie ergriff einen helfenden Beruf, war aber innerlich so erschöpft, dass sie mit Vierzig pensioniert werden musste. Sie war froh, allein zu leben. Aber als sie erfuhr, dass ihre Mutter sterbenskrank war, brach sie ihre Zelte ab und zog zur Mutter, um diese bis zu ihrem Tod zu pflegen.
Damals war ich erstaunt über die unsichtbare Bindung meiner Klientin zu ihrer Mutter, die offenbar ihr ganzes Erwachsenenleben hindurch im Untergrund geschlummert hatte, bis die Mutter pflegebedürftig wurde. Dann eilte die Tochter zurück, um bei der Mutter zu sein, die sie brauchte. (Dieser letzte Satz ist zwiespältig formuliert: »Dann eilte die Tochter zurück, um bei der Mutter zu sein, die sie brauchte«. Wer brauchte wen? Brauchte die Mutter die Tochter, oder brauchte die Tochter die Mutter, oder brauchten sich beide gegenseitig?) Im Kinderlied Hänschen klein heißt es: »Aber Mama weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Da besinnt sich das Kind, kommt nach Haus geschwind«.
Auch ich habe scheinbar mein Erwachsenenleben unabhängig von meiner Mutter geführt. Im Gegensatz zu der Klientin habe ich eine eigene Familie gründen können. Aber kaum, dass meine Mutter mich dringend brauchte, war ich zur Stelle. Anscheinend war auch bei mir die Bindung zur Mutter nie abgebrochen. Sie hatte nur geschlummert, um dann hellwach aufzuspringen, als meine Mutter wirklich Hilfe benötigte.
Ich begann mich zu fragen, worin diese unsichtbare Bindung besteht. Was macht sie aus? Wieso ist sie so unglaublich stark? Ausgehend von meiner Mutterbeziehung begann ich, mir über die Beziehung zwischen Müttern und Söhnen generell Gedanken zu machen. Dies Buch ist das Ergebnis dieser inneren Reise.
Das Leben meiner Mutter
Meine Mutter wurde 1922 in China geboren, in einer Stadt namens Jiaxing in der Nähe von Shanghai – die Menschen aus Shanghai sind ein stolzes Volk. Sie wurde Gu Wen-Hui genannt. Gu war ihr väterlicher Familienname – in China stellt man den Familiennamen vor den Rufnamen. Wen bedeutet Kultur, Literatur, Schrift. Hui bedeutet klug, intelligent, scharfsinnig. Tatsächlich war meine Mutter hoch gebildet. Sie hatte eine wunderschöne Schrift (von ihr habe ich Kalligraphie gelernt) und war außerordentlich scharfsinnig. Sie war eine gute Menschenkennerin und hatte ein untrügerisches Gespür dafür, ob sie einem Menschen trauen konnte oder nicht. Außerdem war sie eine sehr schöne Frau. Schön zu sein war für meine Mutter äußerst wichtig. Selbst im Alter pflegte sie ihren Teint und ihre Haare auf das Sorgfältigste.
Ihre Mutter stammte aus einer angesehenen Kaufmannsfamilie, die mit Seide, Gold und Silber handelte. Meine Mutter war stolz darauf, dass ihre Mutter aus einer der angesehensten Familien ihrer Heimatstadt stammte (auch wenn sie leider nur die zweitangesehenste in der Rangliste war). Ihr Vater kam ebenfalls aus einer vornehmen Familie. Die beiden wurden traditionsgemäß miteinander verheiratet. Sie hatten sieben Kinder. Die Familie hatte umfangreiche Ländereien. Meine Großmutter hatte die Abgabe von Reis durch die Pächter überwacht, während mein Großvater als Rechtsanwalt in Shanghai arbeitete, einige Stunden von Jiaxing entfernt. Dort lebte er mit einer zweiten Frau zusammen, mit der er vier Kinder hatte. Das kam damals recht häufig vor, obwohl das Konkubinat (die Vielehe) nach der chinesischen Revolution offiziell verboten war: Mit der offiziellen Ehefrau wurde ein Mann verheiratet, die zweite Frau war die Eigentliche, mit der er sein Leben teilte. So lebte mein Großvater während der Woche mit seiner zweiten Familie zusammen, die Wochenenden verbrachte er zuhause bei seiner Erstfrau, meiner Großmutter.
Darüber, so berichtete meine Mutter, sei ihre Mutter sehr unglücklich gewesen. Sie war eine sehr hübsche Frau, konnte jedoch nur trippelnd gehen. Denn ihr wurden als Kind die Füße zusammengebunden. Es gehörte zum Schönheitsideal der Manchus, jenes Volksstamms, das als Qing-Dynastie ganz China vier Jahrhunderte lange beherrschte, dass Männer bei Strafe Zöpfe zu tragen hatten und Frauen die Füße gebunden bekamen. (Zumindest genossen Frauen aus vornehmen Familien dieses »Privileg«. Bäuerinnen, die auf dem Feld arbeiten mussten, blieben davon verschont). Zu diesem Zweck wurden Mädchen ab dem sechsten Lebensjahr die Füße so fest zusammengeschnürt, dass die Zehen und Mittelfußknochen der Heranwachsenden brachen und verkrümmt unter den Fußsohlen lagen. So verkrüppelt, konnten die Frauen aus vornehmem Haus nur noch trippelnd gehen, aber nicht weglaufen. Auf die damaligen Männer schien dieser Gang im höchsten Maße sexuell erregend gewirkt zu haben. Sie nannten solche missgebildeten Frauenfüße Lotusfüße. Erst 1911, nach der Chinesischen Revolution, durften Männer endlich ihre verhassten Zöpfe abschneiden (von daher kommt die deutsche Redewendung die alten Zöpfe abschneiden) und Frauen ihre Füße aufschnüren. Aber meine Mutter sagte, ihrer Mutter hätte das Gehen zeitlebens wehgetan.
Meine Mutter war die Fünfte von sieben Kindern ihrer Eltern. Sie war erst 12 Jahre alt, als ihre Mutter mit nur 42 Jahren an Krebs verstarb. Sie bekam die Anweisung, auf den im Schlafzimmer aufgebahrten Leichnam ihrer Mutter aufzupassen. Voller Panik floh sie aus dem Raum. Zeitlebens sollte sie eine furchtbare Angst vor dem Tod behalten. Ihr Vater aber beanspruchte die Hinterlassenschaften seiner verstorbenen Frau und lag lange mit seiner Schwiegerfamilie im Erbstreit.
Kurz danach fielen die Japaner in China ein. Ähnlich wie die Nationalsozialisten in Deutschland beanspruchte das damals zur asiatischen Großmacht aufgestiegene japanische Kaiserreich mehr Lebensraum für die Versorgung mit Erzen und Lebensmitteln. Ende 1937 fiel die damalige chinesische Hauptstadt Nanjing. Den siegreichen japanischen Soldaten wurde erlaubt, drei Tage zu plündern, zu töten und zu vergewaltigen. 300 000 Menschen fielen dem Massaker zum Opfer. Dieses Massaker begründete die tiefsitzende Angst und den unversöhnlichen Hass vieler Chinesen auf »die Japaner« bis zum heutigen Tag. Die Angst meiner Mutter vor den japanischen Invasoren war so groß, dass ich als Nachgeborener, der ein gutes Jahr nach Kriegsende geboren wurde, im ersten Traum, an den ich mich erinnern kann, erlebte, wie ich mit meiner Mutter an einem Bahnsteig stand und von japanischen Tieffliegern bombardiert wurde. Ich bin damals in Panik aufgewacht.
Vor den herannahenden japanischen Truppen floh meine Mutter mit ihren Geschwistern nach Westen zu ihrer Großmutter, der Mutter ihrer Mutter, die ein Anwesen auf einem hohen Berg besaß. Dort erlebte sie, wie sie immer sagte, die glücklichste Zeit ihres Lebens. Die Großmutter passte auf die Enkelschar auf. Sie hatten alles, was das Herz begehrte: freie Natur, gesunde Luft, gutes Essen und Dienstpersonal. Die Japaner waren weit weg. Sie waren in Sicherheit. Von dieser Zeit gibt es ein Foto meiner Mutter, wie sie mitten unter ihren Geschwistern und ihrer Großmutter saß, mit beiden Beinen quer über einen Sessel hängend und einem spitzbübischen Lächeln auf dem Gesicht – so, wie ich sie später nie mehr erlebt habe.
Aber diese schöne Zeit ging zu schnell vorbei. Die Großmutter starb. Die älteren Schwestern meiner Mutter heirateten. Sie wurde mit den beiden jüngsten Geschwistern zurückgelassen, einem Bruder und einer noch sehr jungen Schwester. Für diese zwei war sie fortan verantwortlich, als Mutterersatz.
Mit ihnen zog sie zu ihrem Vater nach Shanghai. Shanghai war damals eine internationale Stadt. Sie war von den europäischen Kolonialmächten in verschiedene internationale Schutzzonen oder Konzessionen aufgeteilt, die von den Japanern in Ruhe gelassen wurden. Dort war man als Chinese vor ihnen sicher. Meine Mutter ging hier zur höheren Schule. Sie war ausgezeichnet im Sport. Noch im Alter erzählte sie, wie sie, ohne jemals zuvor etwas von Hürdenlauf gehört zu haben, von ihrer Schule in dieser Disziplin in den Wettkampf geschickt worden sei und den zweiten Platz errungen habe. Gerne hätte sie Klavier gespielt, aber sie konnte sich keines leisten. Nach der Schule studierte sie einige Semester Jura, um in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Aber dieser lehnte sie als Mädchen ab. Meine Mutter hasste ihren Vater dafür bis zu ihrem Lebensende. Sie meinte, er sei daran schuld, dass ihre Mutter so früh gestorben war. Wenn meine Mutter jemanden hasste, hatte er keine Chance, sich je zu rehabilitieren.
Weil sie trotz Jurastudiums die Anerkennung ihres Vaters nicht erlangen konnte, brach sie das Studium ab und begann, im Büro zu jobben. Dort befreundete sie sich mit einer Kollegin, die ihr ihren Bruder vorstellte – meinen Vater[1].
Vor meinem Vater hatte meine Mutter einen ersten Freund aus der Schule gehabt. Er war Künstler und wollte mit ihr nach Paris auswandern. Aber meine Mutter lehnte ab, weil sie sich verantwortlich für ihre jüngeren Geschwister fühlte. Wäre sie mitgegangen, hätte sie wahrscheinlich ein ganz anderes Leben geführt. Ein Künstlerleben in Frankreich, das hätte gut zu ihr gepasst. Denn sie liebte Musik und Tanz.
Mein Vater tanzte nicht, aber er sah gut aus. Meiner Mutter gefielen besonders seine großen runden Augen, recht ungewöhnlich für einen Chinesen. Sie hatte schon immer die großen Augen der Europäer bewundert. Sie ging fast wöchentlich ins Kino und kannte alle amerikanischen Filmstars aus dieser Zeit: Vivian Leigh, Clark Gable, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman … In ihrer Liebe für den westlichen Way of life trafen sich meine Eltern.
Mein Vater hatte das Apotheker-Handwerk von seinem Vater gelernt. Er wurde 1920 in Hangzhou geboren, einer Stadt unweit von Shanghai. Mein Vater war das dritte von vier Kindern. Sein älterer Bruder war der Augapfel seiner Eltern, während mein Vater eher ein Lausbub war, der lieber fischen ging als zur Schule.
Bei der japanischen Invasion befand sich die nationalchinesische Armee auf dem Rückzug. Sie kam auch an Hangzhou vorbei und suchte dringend neue Rekruten. Gegen den Willen seiner Eltern meldete sich mein Vater 17-jährig freiwillig zur Armee. Als Apotheker wurde er sofort als Sanitätsoffizier aufgenommen. Aber seine Eltern waren besorgt. Daher befahl ihm der Vater, zu seinem älteren Bruder nach Shanghai zu gehen, wo dieser bereits im Handel tätig war. Widerwillig beendete mein Vater seine militärische Laufbahn und schloss sich seinem Bruder an. Nach einer Apotheke eröffnete er ein Uhrengeschäft (seither trug er nur noch Rolex-Armbanduhren – Originale, keine Imitate!). Nach Kriegsende vertrieb er westliche Antibiotika und machte damit gutes Geld.