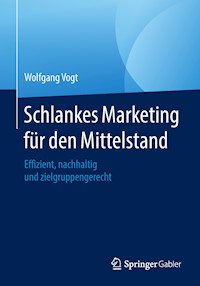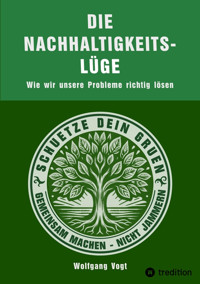
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Revolution des nachhaltigen Wohlstands Wolfgang Vogt enthüllt in „Die Nachhaltigkeitslüge – wie wir unsere Probleme richtig lösen“, warum viele Nachhaltigkeitsmaßnahmen scheitern. Er zeigt auf, wie wir wirklich nachhaltige Lösungen erreichen können, die gleichzeitig dem Klima- und Gesundheitsschutz dienen. Vogt deckt auf, dass wirtschaftliche und populistische Interessen die heutigen Ansätze dominieren, und fordert ein Umdenken in Produktgestaltung, Konsumverhalten und politischer Planung. Entdecken Sie, wie wir durch intelligente, umweltfreundliche Innovationen und eine unabhängige Organisation, die sich auf nachhaltige Standards fokussiert, unseren Wohlstand im Einklang mit der Natur sichern und ausbauen können. Die aufkommende Robotik und künstliche Intelligenz eröffnen dabei völlig neue Wege. Klingt das interessant? Greifen Sie zu „Die Nachhaltigkeitslüge“ und werden Sie Teil der Bewegung, die unsere Welt zum Besseren verändert. Lassen Sie sich von tiefgehenden Analysen und revolutionären Ideen inspirieren! Besuchen Sie: www.nachhaltigkeitsluege.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
DIE NACHHALTIGKEITSLÜGE
Wie wir unsere Probleme richtig lösen
Wolfgang Vogt
© 2025 Wolfgang Vogt
Website: https://www.nachhaltigkeitsluege.de/
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
ISBN
Softcover
ISBN 978-3-384-51620-6
Hardcover
ISBN 978-3-384-51621-3
e-Book
ISBN 978-3-384-51622-0
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die in diesem Buch enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen vom Autor erstellt. Der Autor übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der Informationen entstehen, wird ausgeschlossen. Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Verantwortung des Lesers.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt der Autor keine Haftung für die im Literaturverzeichnis aufgeführten Inhalte und externen Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice",
Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Einführende Worte
Wolfgang Vogt ist es gelungen, mit diesem Buch „Die Nachhaltigkeitslüge – wie wir unsere Probleme richtig lösen“, das Nachhaltigkeitsständnis von heute auf eine entlarvend einfache Art und in unterschiedlichen Facetten zu demaskieren. Dabei ist es alles andere als selbstverständlich, das Thema nachhaltig sinnvoll zu interpretieren.
Geschickt lässt er den Leser als Betrachter agieren, lädt ihn gewissermaßen ein, die unterschiedlichen Seiten eines immer wichtiger werdenden Themas zu entpolitisieren. Dabei wählt er einen Standpunkt, der nicht belehrt, sondern aufzeigt, der ihn anhand neutraler Beispiele zum Verbündeten des Lesers macht und der geradezu ermuntert, eingefahrene Praktiken kritisch zu betrachten. Geschickt inszeniert Wolfgang Vogt die Wissenschaft und namhafte Forscher zur Veranschaulichung seiner Erkenntnisse. Er macht sie damit gleichfalls zu Zeugen seiner Thesen und führt damit politisches und wirtschaftliches Kalkül handelnder Protagonisten ad absurdum.
Dabei sind es nicht nur Politiker, sondern auch Entscheider aus der Wirtschaft, die sich der Nachhaltigkeit als wohlfeile Nebelkerze bedienen, um von alternativen Lösungen abzulenken. Der Autor lässt dabei offen, ob es sich um Ignoranz, Profitgier, Ideologie oder Klientelpolitik handelt.
Das Aufzeigen des Themas aus den verschiedenen Blickwinkeln und das Hinterfragen längst selbstverständlich gewordener Lösungsansätze lässt so manchen Irrweg erkennen. Wer immer sich mit den Auswirkungen, mit der ökologischen, der sozialen, der ökonomischen oder der kulturellen Dimension der Nachhaltigkeit auseinandersetzt, kommt an Wolfgang Vogts Erstlingswerk „Die Nachhaltigkeitslüge – wie wir unsere Probleme richtig lösen“ nicht vorbei.
Wolfgang Vogt ist kein Revolutionär, er weiß, dass er die Entwicklungen nicht verändern kann. Er regt allerdings zum Nachdenken an. Und das ist gut so, denn Menschen, die nachdenken, handeln nachhaltiger.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen,
Wolfgang Lichtenegger
Journalist,
Gründer und Inhaber des Pressebüros dTb-medi@
Vorwort des Autors
Warum existiert dieses Buch und was ist die wahre Bedeutung von Nachhaltigkeit?
Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich nicht verstehe, dass Nachhaltigkeitsideen stets ideologisch und politisch motiviert auftreten. Umwelt- und Klimaschutz wird allzu oft mit dem Verlust von Wohlstand in Verbindung gebracht.
Nachhaltigkeit sollte uns helfen, unseren Wohlstand und unsere Gesundheit zu schützen. Es ist wichtig, einen Lebensstil zu entwickeln, der in Harmonie mit der Natur steht und Umwelt- und Klimaschutz integriert.
Lektionen aus der Vergangenheit
Dies ist kein neuer Gedanke. Viele indigene Völker haben uns gezeigt, wie es funktioniert, wenn auch nicht mit den Mitteln und Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen. Als Ingenieur studiere und analysiere ich Patente und Schriften. Ich sehe viele Menschen mit wunderbaren Ideen, die uns voranbringen können. Es gibt massenhaft Informationen, die sich als falsch herausstellen. Darunter gibt es auch einige verborgene „Diamanten“. Sie könnten die Probleme der Zukunft lösen.
Warum nutzen wir diese Ideen nicht?
Viele dieser Ideen stoßen auf Widerstand in der heutigen wissenschaftlichen Gemeinschaft. Beispiel dafür sind die Gebrüder Wright und ihre Vorstellung von Motorflug. Sie hatten keine akademische Ausbildung und bauten Fahrräder. Nebenbei widmeten sie sich dem Studium der Natur, insbesondere der Beobachtung des Vogelflugs. Sie entwickelten einen eigenen Windkanal. Sie versuchten, den Flug der Vögel nachzuahmen und waren erfolgreich. Sie wurden von der Wissenschaft belächelt und die Wirtschaft zeigte kein Interesse an ihnen. Es gibt viele solcher Geschichten. Nur wenige dieser Genies hatten mit bahnbrechenden Erfindungen Erfolg. Viele wurden vergessen. Ein Beispiel ist der Wardenclyffe Tower von Nikola Tesla. Tesla plante, mit diesem Turm drahtlose Energieübertragung zu ermöglichen. Obwohl der Turm teilweise gebaut wurde und einige Tests erfolgreich waren, wurde das Projekt aufgrund finanzieller Probleme und mangelnder Unterstützung nie vollendet. Heute ist der Wardenclyffe Tower ein faszinierendes Stück Geschichte, das oft übersehen wird.
Die Rolle von Erfindungen in unserer Geschichte
Es sind Innovationen, die die Menschheit dahin gebracht haben, wo sie heute ist, und neue Erfindungen werden uns dorthin bringen, wo wir in der Zukunft sein werden. Am Anfang spielen Wissenschaft und Wirtschaft meist nur eine Nebenrolle, ebenso wie die Politik, die von beiden beeinflusst wird.
Die Notwendigkeit von Veränderungen
So wie heute darf es nicht ewig weitergehen. Wenn Sie, liebe Leserin und lieber Leser, etwas essen, dann nehmen Sie wahrscheinlich auch Mikroplastik zu sich. Dies ist ein Ergebnis unserer Plastikabfälle, zum Beispiel von Plastiktüten oder dem Abrieb von Autoreifen. Luft, die Sie atmen, ist oft mit giftigen Substanzen durchsetzt; ein Ergebnis von Energiegewinnungsprozessen. Es gibt viele ungenutzte Erfindungen, die in der Lage wären, diese Probleme zu lösen.
Die Zukunft der Energiegewinnung
Es gibt viel mehr Möglichkeiten zur ökologischen Energiegewinnung als Windräder und Solarzellen. In Deutschland gibt es sogar die Erfindung eines einfachen Atomreaktors, der zugleich das Atommüllproblem weitgehend lösen würde.
Die Herausforderung der Nachhaltigkeit
Vielleicht ändert dieses Buch Ihre Sichtweise auf vieles grundlegend. Wenn wir Nachhaltigkeit anstreben ist es unverzichtbar, etliches zu ändern und neu zu erfinden. Leider gibt es weltweit kein ideales politisches System dafür. Der Grund sind wir Menschen. Weil wir Ideologie, Macht, Ehrgeiz, Mainstream-Wissen und wirtschaftliche Einzelinteressen über vernünftiges Handeln stellen. Obendrein gibt es Menschen auf dieser Welt, die Kriege anzetteln. Menschen, die ohne Gewissen andere in den Tod schicken.
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Es ist also schwierig, hier weiterzukommen. Aber weil die Hoffnung zuletzt stirbt und ich solche habe, schrieb ich dieses Buch. Sie liebe Leserin und lieber Leser soll es vor Irrwegen bewahren und dafür gewinnen, Teil einer neuen Welt zu sein. Nicht um eine Ideologie zu verbreiten, sondern weil es die wirkliche Zukunftsfrage von uns Menschen ist. Wenn es Veränderungen gibt, werden sie langsam sein, aber besser in kleinen Schritten als nie. Einige Anregungen finden Sie in diesem Werk. Ich wünsche viel Freude beim Lesen.
Danke
Ich möchte allen danken, die mich bei diesem Buch unterstützt und mir den Mut gegeben haben, es zu veröffentlichen. Leider würde es den Rahmen sprengen, sie alle zu nennen. Mein besonderer Dank gilt Wolfgang Lichtenegger, Journalist und ehemaliger Geschäftsführer des Donaukurier in Ingolstadt, und Ellen Dietrich-Gleich, der langjährigen Fotochefin der ZEIT, für Lektorat und Beratung. Danke sage ich auch meinem Cousin Markus Gutmann für die Prüfung historischer Aussagen und dem Filmregisseur Jürgen Stumpfhaus für das Foto von mir.
Wolfgang Vogt 2025
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1 Was ist Nachhaltigkeit?
1.1 Ein Leitfaden aus der Vergangenheit
1.2 Verbrauch mit Bedacht
1.3 Die Praxis der Nachhaltigkeit
1.4 Unsere Rolle in der Nachhaltigkeit
2 Recycling, Downcycling und Lügen
2.1 Recycling?
2.2 Wir sind selbst Deponie
2.3 Was ist Recycling, Downcycling, Upcycling?
3 Ein Fest für den Mülleimer
3.1 Mein gutes Gefühl
3.2 Recycling-Codes mit System
3.2.1 Das Einmaleins der Verwertung
3.3 Gute Konserven- und Bierdosen
4 Hommage für Gelben Sack?
4.1 Besser machen beginnt mit Wissen
4.2 Vom Abfall zum Wertstoff
5 Recycling-Star: Eierkarton
5.1 Warum der Eierkarton?
5.2 Papierrecycling – wie gut ist das denn?
6 Der Glaskelch des Pharaos
6.1 Weil Glas grundsätzlich nachhaltig ist!
6.2 Wiederverwendung statt Recycling
6.3 So wird Neuglas aus Abfallglas
6.4 Was wir von Glas lernen
7 Wie geht Nachhaltigkeit?
7.1 Ist Langlebigkeit die Königsdisziplin?
7.2 Der Nutzen definiert die Nachhaltigkeit
8 Nachhaltigkeitsplus kostenlos
8.1 Nachhaltigkeitsplus geht kostenlos
8.2 Nachhaltigkeit beginnt mit Produktgestaltung!
9 Bestehendes verbessern
9.1 Ein Mühsamer und langer Weg
9.2 Ideal trifft Realität
10 Die Industrie wird es richten
10.1 Wie die Politik agiert
10.2 Wie die Welt tickt
11 Der Öko-Supermarkt
11.1 Anstoß für eine Reise
11.2 Papier mal neu erfunden
11.3 Kunststoff und doch keiner?
12 Wie wir es besser machen
12.1 Vorschlag für ein Kochrezept
12.2 Eine kleine Idee ganz groß
12.3 Lösungen benötigen eine Institution.
12.4 Schlüsselidee Nachhaltigkeitszentren
13 So erobern wir die Zukunft
13.1 Deutschland ist Bismarck-Land
13.2 Der industrielle Aufstieg Englands
13.3 Deutschlands Weg zur Industrienation
13.4 Die Lehren der Veränderung
14 Wohlstand durch Marktführerschaft
14.1 Die Gefahr aus Fernost
14.2 Schlüsselindustrie und Innovation
15 Wie Politik agiert
15.1 Durchdachte Ansätze aus der Politik?
15.2 Was ist Wasserstoff?
15.3 Wasserstoff und doch keiner?
15.4 Wie gebrauchsfähig ist Methanol?
15.4.1 Lässt sich ein heutiges Automobil mit Methanol betreiben?
15.4.2 Kann man mit Methanol heizen?
15.5 Die Gefahr des Wissens
15.6 Unwissenheit und Lobbyismus?
16 Politisch unerwünschte Erfindungen
16.1 Was ist das?
16.2 Kann ein Auto mit Wasser fahren?
16.2.1 Die große Lösung
16.2.2 Die kleine Lösung
16.2.3 Welche Chance bietet ein HHO Kit für die Politik?
16.3 Zukunft Raumenergie
16.4 Eine Welt voller Ideen!
17 Das „besser machen“ Konzept
17.1 Das deutsche Erfinderhaus
17.2 Vision: Haus der Nachhaltigkeit
18 Von anderen Lernen
18.1 Datsun Cherry
18.2 Tesla Automobile
18.3 Erfolg braucht Strategie
18.4 Erfolgsfaktor Internationalität
19 Kreativ in die Zukunft
19.1 Mit Pilotbereichen in eine neue Ära
19.2 Revolution in der Maschinenwelt nutzen
19.3 Out of the box: mobile Technik!
20 Wirtschaftskiller Nachhaltigkeit
20.1 Wir leben vom Verbrauch
20.2 Der Teufel heißt Marktsättigung
21 Utopie nachhaltige Gesellschaft?
21.1 Nachhaltigkeit und das Ich
21.2 Menschengerechte Nachhaltigkeit
21.3 Terminator Nachhaltigkeit!
22 Funktionsmodell Nachhaltigkeit
22.1 So verändert sich die Wirtschaft
22.1.1 Güter im Wandel: Nachhaltigkeit und Recycling im Fokus
22.1.2 Güterproduktion im Wandel: Mensch und künstliche Intelligenz als dynamisches Duo
22.1.3 Gerät die Wirtschaft aus den Fugen?
22.2 Wirtschaftsmotor Nachhaltigkeit
22.2.1 Nachhaltige Forschung: Der Schlüssel zur Zukunft!
22.2.2 Wettbewerbsfähige, nachhaltige Produktion
22.2.3 Ernährung: Schlüssel zum langen Leben!
22.2.4 Wirtschaftsfaktor Gesundheit
22.2.5 Pflege: Eine Aufgabe mit Sinn und Zukunft
22.2.6 Wohnraum: Mehr als nur Baumaterialien!
22.2.7 Revolution im Verkehr!
23 Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit
23.1 Warum dieses Thema jetzt? Die Wahrheit über Künstliche Intelligenz!
23.2 Was macht den Unterschied zum Menschen?
23.3 Der Zaubertrick: Die dunklen Seiten der KI!
24 Das Spiel: Guter Bürger, schlechter Bürger
24.1 Können wir Menschen für nachhaltiges Handeln begeistern?
24.2 Warum ist die Schaffung von Emotionen so wichtig?
25 Bürger zum Mitmachen gewinnen
25.1 Die Basis – das Rezept muss stimmen
25.2 Trend: Wer gewinnen will, muss ein Menschenversteher sein
25.3 Nudging: Das Menschenfänger-Werkzeug
26 Leben im Einklang mit der Natur
26.1 Fazit aus allem
26.2 „Die Natur kapieren und kopieren“
26.3 Gibt es Hoffnung?
27 Was kann ich für mehr Nachhaltigkeit selbst tun?
27.1 Warum diese Frage?
27.2 Ein wenig das eigene Verhalten ändern!
27.3 Ein „Ehrenamt“ für alle!
27.4 Die Krönung: Selbst einsteigen und erfinden!
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Die Nachhaltigkeitslüge
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1 Was ist Nachhaltigkeit?
Stichwortverzeichnis
Die Nachhaltigkeitslüge
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
1 Was ist Nachhaltigkeit?
1.1 Ein Leitfaden aus der Vergangenheit
Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Wort, es ist eine Reise, die uns alle betrifft. Die Ursprünge der Nachhaltigkeit gehen im deutschen Raum bis in das 14. Jahrhundert zurück. Die „Industrie“ von damals bestand aus Handwerksbetrieben. Sie waren weitgehend in den Städten präsent und in Zünften organisiert. Die Zünfte arrangierten nicht nur Ausbildung, Produktion und Verkauf, sie hatten auch ein Sozialsystem. Holz war einer der wichtigsten Rohstoffe. Das führte dazu, dass der Baumbestand dramatisch abnahm. Als der Rohstoff Holz knapp wurde, entstanden Gesetze und Regeln, die streng überwacht wurden. Es durfte zeitweise nur noch ‚liegend Holz‘ gesammelt werden. Das Fällen von Bäumen war verboten. In den deutschen Wäldern, die vorher Laubwälder waren, fand ein Aufforsten mit Fichten und Tannen statt. Mit diesen schnell wachsenden Baumarten wurde auch ihr Weichholz im Bauwesen zugelassen, das bis dahin nicht als Bauholz Verwendung fand. Interessant ist, dass die Shogune in Japan ein ganz ähnliches Programm zur Verhinderung der vollständigen Abholzung umsetzten. Nicht überall waren die Menschen so umsichtig. Auf den Südseeinseln zum Beispiel fand eine vollständige Abholzung statt.
Einen wunderbaren Einblick in diese frühe Art der Nachhaltigkeit liefert uns Hans Carl von Carlowitz [1], der 1713 das Prinzip prägte, dass wir nur so viel von allem nutzen sollten, wie nachwachsen kann. Diese Weisheit ist heute aktueller denn je. Wir leben in einer Welt, in der Ressourcen endlich sind und unser Handeln Konsequenzen hat. Nachhaltige Rohstoffe, seien sie erneuerbar oder recycelt, sind der Schlüssel zu einer besseren Zukunft. In seinem Werk „Sylvicultura oeconomica“ [2] formulierte der Oberberghauptmann Carl von Carlowitz, dass immer nur so viel Holz geschlagen werden sollte wie durch planmäßige Aufforstung wieder nachwachsen kann. Von Carlowitz schrieb sein Buch in einer Zeit der Energiekrise [3]. Die Erzgruben und Schmelzhütten des Erzgebirges (damals eines der größten Montanreviere Europas) mussten mit viel Holz als Energiequelle versorgt werden. Zudem trugen das Bevölkerungs- und Städtewachstum stark zur „Holznot“ bei. Ein geregelter Waldbau sowie Gesetze, Ökostandards oder Zertifizierungen zur Aufforstung existierten nicht.
Abbildung 1.1.1: Carl von Carlowitz und „Sylvicultura oeconomica
Porträt und Titelseite gemeinfrei auf Wikipedia
1.2 Verbrauch mit Bedacht
Ein Leitsatz für Nachhaltigkeit könnte lauten: „Nachhaltige Rohstoffe sind erneuerbar.“ Dabei ist es unerheblich, ob die Rohstoffe nachwachsen oder aus recycelten Abfallprodukten stammen. Bei vielen Produkten wird bereits heute darauf geachtet, dass sie aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellt werden. Es ist erfreulich zu sehen, dass dies für immer mehr Hersteller und Kunden an Bedeutung gewinnt.
Deshalb rücken wir gleich eine weniger dominante Art von Nachhaltigkeit in unser Blickfeld: den Verbrauch. Er definiert sich aus der Verwendungszeit und seiner Häufigkeit. Große Bedeutung hat dabei die Kurz- oder Langlebigkeit von Produkten in Verbindung mit den Rohstoffen, aus denen sie bestehen. Zeit für einen kleinen Ausflug in die Werbegeschichte. Am 13. Januar wird in Schweden der Sankt Knut Tag gefeiert. Traditionell wird an diesem Tag der Schmuck von den Weihnachtsbäumen entfernt. Der Möbelhersteller IKEA hat diese Tradition erstmals 1996 in einem Werbespot aufgegriffen, indem er Weihnachtsbäume aus dem Fenster werfen ließ, um Platz für neue Möbel zu schaffen. In einer Parodie auf diesen Spot von den Möbelwerken Hartmann1 fliegen statt Weihnachtsbäumen „billige Möbel“ aus dem Fenster. Die Intention dahinter ist, die langlebigen Massivholzmöbel von Hartmann zu bewerben. Schnell neigen wir mahnend dazu, den Finger für die Nachhaltigkeit zu heben, doch so simpel ist das leider nicht. IKEA [4] bemüht sich um Nachhaltigkeit. Durch Wiederverkauf gebrauchter Möbel und durch die zunehmende Verbesserung der Recyclingfähigkeit seiner Kollektion. IKEA beschäftigte nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2022 weltweit rund 231.000 Mitarbeiter. Die Möbelwerke Hartmann 135. Es ist wichtig zu beachten, dass viele Menschen aus sozialen Schichten stammen, die sich nur die preiswertesten Möbel leisten können.
Schon dieses Beispiel zeigt, wie falsch es ist, Nachhaltigkeit isoliert zu betrachten. Da gibt es den Verbraucher mit seinen Einstellungen und Möglichkeiten, den Hersteller, der gesellschaftlich so wichtig ist, weil er Arbeitsplätze schafft und das Produkt selbst, das in diesem Umfeld mehr oder weniger nachhaltig konzipiert ist. Und dann gibt es noch die Politik, die den Rahmen beeinflusst, in dem sich Verbrauch, Herstellung und Nachhaltigkeit abspielen. Für jeden Einzelnen von uns bedeutet Nachhaltigkeit unseren Verbrauch zu überdenken. Wir haben schon heute die Möglichkeit, Produkte zu wählen, die langlebig sind und aus nachhaltigen Rohstoffen bestehen.
1.3 Die Praxis der Nachhaltigkeit
In der Praxis ist Nachhaltigkeit vielschichtig. Während einige Produkte uns lange begleiten, wie Möbel, gibt es andere, wie Mobiltelefone, die wir fast schon jährlich austauschen. Hier zeigt sich die Herausforderung, Fortschritt und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Das Mobiltelefon wechseln wir so schnell, weil der Fortschritt bei diesem Produkt viel schneller ist wie seine eigentliche Lebensdauer. Diese kleine Einführung zeigt, wie schwierig es ist, unsere Vorstellungen, Möglichkeiten und Wünsche mit Nachhaltigkeit zu verbinden.
1.4 Unsere Rolle in der Nachhaltigkeit
Jeder von uns spielt eine Rolle in dieser nachhaltigen Reise. Es ist wichtig zu beachten, dass wir Menschen nicht vernunftbegabt sind. Jeder auf seine individuelle Art. Wenn das anders wäre, gäbe es keine Kriege. Wir haben nur uns und es bleibt allein, trickreich unsere Unvernunft in positive Bahnen zu lenken. Der Plan kann nur sein, im Einklang mit unserer Umwelt zu leben und naturverträglich zu handeln, ohne auf Fortschritt zu verzichten. Dazu gehört, den Menschen eine sinnvolle Arbeit zu bieten. Dies gelingt, wenn wir die Lebensfreude des Einzelnen im Fokus halten. Lasst uns gemeinsam an einer neuen Zukunft arbeiten, in der Nachhaltigkeit nicht nur ein Ideal, sondern eine gelebte Realität ist. Denn wir haben nur diese eine Welt und die Verantwortung, sie für kommende Generationen zu bewahren.
1https://www.youtube.com/watch?v=NYN0JhWQsrs
2 Recycling, Downcycling und Lügen
2.1 Recycling?
Abbildung 2.1.1: Müllinsel im Meer
Foto lizenziert bei iStock
Es ist einfach, über Recycling zu sprechen, denn es ist machbar, wiederverwertbare Produkte zu erstellen. Doch die wahre Herausforderung liegt darin, sicherzustellen, dass die Wiederverwertung tatsächlich stattfindet.
Das Bild einer Müllinsel im Meer hat maßgeblich diesen Buchtitel geprägt. Was wir auf dem Foto sehen, sind viele Rohstoffe, die zu einem erheblichen Teil recycelt werden könnten. Laut Naturschutzbund NABU [5] gelangen jährlich mehr als zwölf Millionen Tonnen Abfälle in die Ozeane. Sie kosten unzähligen Meerestieren das Leben. Seevögel verwechseln Plastik mit natürlicher Nahrung, Delfine verfangen sich in alten Fischernetzen. Plastik ist im Meer nahezu unvergänglich. Es zerfällt nur langsam durch Salzwasser und Sonne und gibt nach und nach kleinere Bruchstücke an die Umgebung ab. Diese werden als Mikroplastik bezeichnet, wenn die Teilchen kleiner als 5 Millimeter sind.
Nach Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) [6] treiben inzwischen auf jedem Quadratkilometer Meeresoberfläche bis zu 18.000 Plastikteile unterschiedlichster Größe. Die Quelle für diese Verunreinigung erzeugen wir Menschen an Land, immer durch den Verbrauch von Produkten. So führt der Bund für Umwelt und Naturschutz aus, dass der Abrieb unserer Autoreifen die mit Abstand größte Erzeugungsquelle für Mikroplastik ist. Studien, so die Organisation, gehen von etwa 100.000 bis über 140.000 Tonnen Reifenabrieb aus, die jedes Jahr in Deutschland abgefahren werden. Und da gibt es derzeit keine Chance auf ein Recycling. Immerhin wird an anderen Reifen geforscht. In Deutschland hören wir gerne, wie recyclingfähig unsere Produkte sind und was Politik und Industrie Gutes für die Umwelt tun. Stellen wir uns der Realität. Im Jahr 2021 exportierte Deutschland rund 4,6 Millionen Tonnen zustimmungspflichtige Abfälle in verschiedene Regionen weltweit [7]. Davon waren gut 766.200 Tonnen Kunststoffabfälle. Dies war ein Viertel weniger (-25,2 %) als im Jahr 2020 [8]. Damals wurde rund eine Million Tonnen ausgeführt. Auch wenn das ehrliche Bemühen nach Besserung ersichtlich ist, geht mir doch die leere Plastiktüte „Bernbacher Nudeln“ nicht aus dem Kopf, die ich auf einem Bild von einer brasilianischen Mülldeponie gesehen habe. Denn eines ist sicher. Die Länder, die unseren Müll abnehmen, nehmen Geld dafür und verschmutzen im Gegenzug ihre eigene Umwelt. Dass etwas davon wiederverwertet wird, sind positive Einzelfälle.
2.2 Wir sind selbst Deponie
Es ist sicher, dass Mikroplastik in unseren Körper gelangt. Wie gesundheitsschädlich das ist, ist nicht ausreichend erforscht [9]. Erste Studien deuten darauf hin, dass Mikroplastik sich im Körper einlagert und Entzündungen in Darm- oder im Lebergewebe auslöst und sogar Krebs begünstigt. Forschende der Uni Amsterdam haben in einer Studie von 2022 [10] in 17 von 22 Blutspenden anonymer Spender Mikroplastik gefunden. Die Hälfte der Proben enthielt PET-Kunststoff, den man von herkömmlichen Plastikflaschen kennt. Ein Drittel der Blutproben erhielt Polystyrol, das in Lebensmittelverpackungen vorkommt. Und in einem Viertel fanden die niederländischen Forscher Polyethylen. Aus diesem Material bestehen etwa die Plastik-Tragetaschen, die mittlerweile in der EU verboten sind. Das sind erste, klare Hinweise, dass wir Polymerpartikel in unserem Blut haben.
Vieles ist zu erforschen. Aber es gibt Hoffnung! Wenn wir gemeinsam eine ökologisch nachhaltige Welt anstreben, ist das wichtigste Ziel, gemeinsam Strategien zu entwickeln und diese mit Leben zu erfüllen. Recycling ist der Prozess der Gewinnung oder Umwandlung von Abfallmaterialien in neue Materialien und Objekte. Die entstehenden Produkte oder Wertstoffe sind dann ebenso wiederverwertbar.
2.3 Was ist Recycling, Downcycling, Upcycling?
Recycling [11] ist, wenn neue Materialien (Wertstoffe) und Objekte (Produkte) aus der Umwandlung von Abfallmaterialien entstehen. Sie werden nach der Nutzung wieder recycelt und für ihren ursprünglichen Zweck erneut eingesetzt. Meist verwenden Hersteller energieintensive Schmelzverfahren, zur Rohstoffrückgewinnung. Beispiele sind Lebensmittelverpackungen, Glas- und Plastikflaschen sowie Aluminiumdosen.
Downcycling bezeichnet den Prozess, bei dem das recycelte Material in ein Produkt von geringerer Qualität umgewandelt wird. Hierzu zählt etwa das Recycling von Papier, bei dem die Fasern mit jedem Zyklus kürzer und schwächer werden. Das führt dazu, dass das recycelte Material letztendlich nur noch für minderwertigere Produkte geeignet ist. Die Weiterverarbeitung endet schließlich an dem Punkt, an dem der Energieaufwand zu groß wird, um diesen für ein Endprodukt zu rechtfertigen.
Es gibt positive Nachrichten. Deutschland war 2021 in der Lage, 100 % der Elektroaltgeräte sowie des angefallenen Glasabfalls und Papiers zu recyceln [12]. Es ist wichtig, zu verstehen, dass hier sowohl Downcycling und echtes Recycling zusammengefasst sind. Jeder von uns, der davon ausgeht, dass alle Stoffe wieder die ursprüngliche Verwendung finden, der irrt, und sitzt einer „Lüge“ auf. Wir lernen daraus, dass Recycling und seine Stufen wesentlich differenzierter zu betrachten sind. Und um die Verwirrung komplett werden zu lassen, gibt es Upcycling, in dem aus Abfall gewonnene Stoffe in höherwertige Rohstoffe umgewandelt werden. Dies alles ist der Ist-Zustand, an dem wir mit unserer Betrachtung beginnen. Wir sehen uns zunächst immer ein Ursprungsprodukt an, das verbraucht wird. Denn es ist die Quelle für die Wiederverwertung.
3 Ein Fest für den Mülleimer
3.1 Mein gutes Gefühl
Abbildung 3.1.1: Unser Essen
Foto „fish-3287443“ von Monika auf pixabay
Täglich benötigen wir Nahrungsmittel, die wir im Supermarkt einkaufen. Alles ist hygienisch verpackt, so wie es von uns und vom Gesetzgeber gewünscht wird. Kaum haben wir den leckeren Käse gegessen, die Milch aus dem Tetra Pak getrunken und dabei unser Salamibrot vertilgt oder den Fisch aus der Dose genascht, wandern die Verpackungen in den Gelben Sack. Es beruhigt mich zu wissen, dass ich meinen Teil beitrage, auch wenn ich verschiedene Kunststoffarten zusammen entsorge. Die politischen Bemühungen sind lobenswert und führen in die richtige Richtung. Die Einführung von Kennzeichnungen (Recyclingcodes) auf Verpackungen zeigen nachvollziehbar, aus welchem Material diese bestehen.
3.2 Recycling-Codes mit System
Abbildung 3.2.1: Recyclingcodes für Kunststoffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Recycling-Code
Es ist kein Aufwand, Recyclingcodes als zusätzliches Symbol auf eine Verpackung zu drucken. Die Zigarettenindustrie ist verpflichtet, auf ihren Verpackungen wahre Horrorbilder zu zeigen. Dagegen sind die Recyclingcodes unauffällig. Die Hersteller würde ein Aufdruck kaum stören; eine Pflicht zum Aufdruck dieser kleinen Symbole gibt es leider bisher nicht.
3.2.1 Das Einmaleins der Verwertung
Wenn mein Gelber Sack abgeholt wird, was ereignet sich dann? Der Inhalt landet auf der Sortieranlage des Entsorgers. In Deutschland fielen im Jahr 2021 insgesamt 19,7 Millionen Tonnen an Verpackungsabfällen [13] an, von denen 67,9 % recycelt1 wurden. Pro Kopf entstand dabei ein Verpackungsmüllaufkommen von 237 Kilogramm. Etwa 3,2 Millionen Tonnen waren Kunststoffverpackungen2