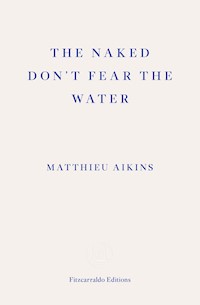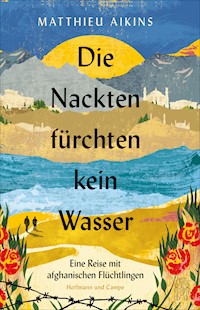
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von der Flucht eines jungen Mannes aus Afghanistan in eine ungewisse Zukunft in Europa, von größten Gefahren und einer alles überragenden Freundschaft: Kabul, 2016. Während unablässig Flüchtlinge nach Europa drängen, trifft Omar, ein junger afghanischer Fahrer und Übersetzer, die mutigste und schwerste Entscheidung seines Lebens. Er beschließt, die Heimat zu verlassen und Abschied zu nehmen von seiner Laila, ohne zu wissen, ob er sie je wiedersehen wird. Omar ist einer von Millionen, die in diesem Jahr flüchten, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Matthieu Aikins, ein vielfach ausgezeichneter Kriegsreporter, wirft seinen Reisepass weg und begleitet seinen Freund Omar auf der Flucht. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine Odyssee ohne Garantie auf ein Überleben, die sie mitten ins Herz der Migrationskrise führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Matthieu Aikins
Die Nackten fürchten kein Wasser
Eine Reise mit afghanischen Flüchtlingen
Aus dem amerikanischen Englisch von Barbara Schaden
Hoffmann und Campe
»Der Nackte fürchtet kein Wasser.«
Dari-persisches Sprichwort
Teil 1Der Krieg
1
Als sich das erste Tageslicht zeigte, beugte ich mich zum Fenster und schaute hinunter. Unter uns Gebirge. Wir flogen der aufgehenden Sonne entgegen, und die schrägen Strahlen ließen die Konturen des kargen, zerklüfteten Lands unter uns in scharfen Kontrasten hervortreten: gefurchtes Braun mit grünen Taleinschnitten, gesprenkelt von Weilern, die nach wie vor nur mit dem Esel erreichbar waren. Wir befanden uns nicht weit von der Stelle, wo Afghanistan, Iran und Turkmenistan zusammentreffen, aber auf welches der drei Länder ich hinunterblickte, konnte ich nicht sagen. An meinem Fenster hatte sich Reif gebildet, der im Morgenlicht rosig leuchtete, wie sicher auch unsere Kondensstreifen für die Menschen unten am Boden.
Ich lehnte mich wieder zurück. Bis Kabul, wo mein Freund Omar mich erwartete, lagen noch ein paar Stunden vor uns. Wenn ich die Augen schloss, konnte ich ihn vor mir sehen, letzten Sommer, als er mich am Flughafen abgesetzt und plötzlich flehentlich meine Hand gepackt hatte: »Komm wieder, Bruder. Lass mich nicht allein. Alle gehen weg.«
Es war still im Flugzeug. Die wenigen Passagiere, die ich sehen konnte, schliefen vornübergesackt oder über die jeweilige Reihe gestreckt. Auf dem Rückflug nach Istanbul wären die jetzt leeren Sitze von afghanischen Kriegsflüchtlingen besetzt. Vielleicht säße auch auf meinem Platz jemand, der in einem der kleinen Schlauchboote, die sich von der Türkei nach Europa aufmachten, das Meer überqueren wollte. Inzwischen landeten täglich Tausende Flüchtlinge auf den griechischen Inseln, und viele weitere waren unterwegs.[1]Wir hatten Ende Oktober 2015, und es geschah Wundersames in diesem Herbst, ein ehernes Gesetz wurde gebrochen: Unter dem Gewicht von Menschen hatte sich die Grenze geöffnet.
Seit Jahren, seitdem im Nahen Osten Krieg um sich griff und Millionen Menschen obdachlos machte, war der Druck gegen Europas Grenzen gestiegen. Die Bootsflüchtlinge kamen in der Mehrheit aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Es waren viele Frauen und Kinder unter ihnen, und sie hätten sich eher erschießen als von der Flucht abhalten lassen. Von Griechenland machten sie sich auf den Weg nach Norden durch den Balkan, sammelten sich auf den Plätzen der Innenstädte und an den Grenzübergängen, waren ein Spektakel in den Nachrichten, eine Krise. Um das Auseinanderdriften der EU zu verhindern, hob Deutschland die Regeln auf und ließ die Migranten herein und durch; andere Länder folgten dem Beispiel, und jetzt waren die fünf Grenzen zwischen Athen und Berlin offen. Rund um die Welt zeigten die Medien, wie Massen von Menschen die offenen Grenzen überquerten, ein Beweis für das Unmögliche, eine Fanfare der ungehinderten Bewegungsfreiheit – für manche ein Traum, für andere ein Albtraum.
Niemand wusste, wie lang dieses Wunder anhalten würde. Jetzt gingen täglich Tausende Menschen von den kleinen Booten an Land. Am Ende kam eine Million nach Europa.
Und Omar und ich würden uns ihnen anschließen.
Die Entscheidung war im August gefallen, als ich nach einem Einsatz im Jemen nach Kabul zurückgekehrt war. Ich kannte Omar, seitdem ich beruflich in Afghanistan stationiert war. Er hatte schon immer vom Westen geträumt, doch seitdem der Bürgerkrieg immer heftiger tobte und Bomben seine Heimatstadt verwüsteten, wuchs seine Sehnsucht ins Unermessliche. Amerikanische Soldaten zogen aus Afghanistan ab, und auch mich zog es fort – nach sieben Jahren Berichterstattung aus Kabul war ich ausgebrannt –, aber ich konnte Omar nicht zurücklassen. Auf dem Rückflug nach Kabul in jenem Sommer hatte ich immer wieder an meinen Freund denken müssen. Einen Plan hatte ich noch nicht, doch immerhin eine Idee, die allmählich Gestalt annahm. Omar und ich mussten reden.
WILLKOMMEN IM HAMID KARZAI INTERNATIONAL AIRPORT. An der Einreisekontrolle händigte ich meinen Reisepass aus und legte die Fingerspitzen auf den grün leuchtenden Scanner, ging weiter zum Gepäckförderband und holte meinen Koffer, zog ihn dann hinter mir her zur Sicherheitskontrolle, um ihn durchleuchten zu lassen. Der Polizist, der vor dem Monitor saß, suchte nach Waffen und Flaschen. In der Islamischen Republik Afghanistan ist Alkohol verboten, außer in den Botschaften und internationalen Organisationen, aber ausländische Besucher durften pro Person zwei kostbare Flaschen einführen. Ich hievte meinen Koffer auf das Förderband, stellte die Plastiktüte mit Scotch und Gin vom Duty-free-Shop in Istanbul daneben, ging zum anderen Ende des Bands und probte währenddessen im Geist meinen Text.
Meine Vorfahren stammen aus Japan und Europa, aber mit meinen Mandelaugen, dem schwarzen Haar, dem drahtigen Bart sehe ich tatsächlich befremdlich afghanisch aus. Daher gingen unweigerlich sämtliche Grenzwächter davon aus, dass ich Einheimischer mit haram-Schmuggelware sei und folglich ein lukrativer Fang, denn der beschlagnahmte Schnaps ließ sich auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Im Lauf der Jahre war mein Persisch zwar besser geworden, die Grenzgespräche aber dadurch leider verfänglicher.
»Bruder, willst du mir weismachen, dass du kein Afghane bist?«
»Ich bin keiner«, sagte ich dann. »Schauen Sie sich meinen Namen an. Ich bin nicht mal Muslim – sorry.« Und ich sprintete mit dem Pass in der Hand zum Förderband, bevor sich der Polizist meine Flaschen schnappen konnte.
Draußen vor dem Terminal atmete ich tief die trockene Sommerluft ein. Ich hatte seit Sanaa nicht viel geschlafen, doch der Anblick ringsum ließ die Müdigkeit schlagartig weichen: in der Ferne die schneebedeckten Gipfel des Hindukusch, am Berghang die Slums, vor dem Tor der Humvee, den Geschützturm himmelwärts gerichtet. Auf dem Parkplatz erspähte ich einen goldenen Toyota Corolla und darin, mit aufgedrehtem Radio und offenem Fenster, rauchend, meinen Freund Omar. Er stieg aus und ging mir entgegen: größer als ich, breite Schultern und ebenso breites Grinsen. Als wir uns umarmten, stachen mich seine Bartstoppeln in die Wange, er roch nach Kölnischwasser und Rauch. Er entwand mir meinen Koffer und hievte ihn in den Kofferraum. Wir fädelten uns in den Kreisverkehr vor dem Flughafen ein, einen Strom aus Taxis, gepanzerten SUVs, Bussen, dazwischen schreiende Polizisten, an Scheiben klopfende Bettler, wandernde Händler, die Gestelle mit Telefonkarten und Zierrat fürs Armaturenbrett schwenkten. Wir krochen dahin, Omar leise fluchend, eine Hand am Steuer, in der anderen eine Pine, die er von Zeit zu Zeit zwischen den Lippen stecken ließ, um sich mit der Hand durch seinen dunklen Haarschopf zu fahren. Erst als wir draußen auf dem Flughafenzubringer waren und an den aneinandergereihten höhlenartigen Trauungssälen entlangfuhren, konnten wir durchatmen und uns auf den neuesten Stand bringen.
»Gut, dass du wieder da bist, baradar«, sagte er auf Dari. Er lächelte, ohne den Blick von der Straße zu wenden.
»Ich freu mich auch, Bruder«, sagte ich.
Er wusste, dass mein Mietvertrag auslief und ich zurückgekommen war, um das Haus zu räumen. Die halbe Stadt schien zu flüchten in diesem Sommer des raftan, raftan – weggehen, weggehen. Die Afghanen verloren den Glauben an eine hoffnungsvolle Zukunft ihres Landes. Der Mittelstand investierte seine Ersparnisse in Türkeiflüge und Einreisevisa; junge Männer stürmten Busse, die in die Wüste im Süden des Landes fuhren, wo der Iran beginnt. Auch Omars Familie strebte fort. Vier seiner Geschwister waren schon in Europa, und seine Mutter und eine Schwester bereiteten sich auf ihre Ausreise mit Hilfe von Schleusern vor. Omar selbst hatte lange den Plan gehabt, nach Amerika auszuwandern, mit einem Special Immigrant Visa,[2] mit dem der US-Kongress seine loyalen afghanischen und irakischen Angestellten belohnte – Happy End für ein paar und Beruhigung des amerikanischen Gewissens. Omar wäre für das Programm infrage gekommen; er hatte als Dolmetscher für die Spezialkräfte im Gefecht gedient und bei USAID und Minenräumtrupps gearbeitet. Doch als er mir seinen Antrag zuschickte, sah ich sofort, dass es aussichtslos war. Er sollte alle möglichen Unterlagen einreichen, die er über die Jahre hätte sammeln sollen, aber nicht gesammelt hatte: Zeugnisse und Bestätigungen von Dienstvorgesetzten, Kopien seiner Arbeitsverträge mit der US-Regierung. Wie sollte er jetzt einen Green Beret Captain ausfindig machen, von dem er nur den Vornamen wusste? Oder Unterlagen von einem Minenräumunternehmen beschaffen, das es inzwischen gar nicht mehr gab? Hallo mein lieber und guter Bruder, mailte er mir, während ich außer Landes war. Hoffentlich geht es dir gut und alles ist in Ordnung. Bitte wünsche mir viel Glück und finde die Chance, das US-Visum zu bekommen und dorthin zu ziehen. Ich habe das Leben hier wirklich satt.
Wir reichten alles ein, was wir hatten. Die Antwort ließ zwei Jahre auf sich warten. Dann hieß es: Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Ersuchen um Genehmigung des Chief of Mission (COM), einen Antrag für das SQ-Special-Immigrant-Visa (SIV)-Programm einzureichen, aus folgendem Grund/folgenden Gründen abgelehnt wurde: Fehlen ausreichender Dokumentation als Entscheidungsgrundlage …
Nachdem sich sein amerikanischer Traum zerschlagen hatte, blieb Omar nur die Option, die seine Mutter und Schwester nutzen wollten: die Schleuserroute nach Europa, eine lange und gefährliche Reise über Gebirge und Meer. Das war der Moment, in dem meine Idee entstand. Wenn Omar sich tatsächlich auf diesen Weg machen wollte, würde ich ihn begleiten und darüber schreiben. Angesichts der Gefahr, unterwegs gekidnappt oder verhaftet zu werden, müsste ich mich als sein afghanischer Landsmann ausgeben, aber nach den vielen gefährlichen Einsätzen, die wir gemeinsam gemeistert hatten, hätte ich Omar mein Leben anvertraut. Auf diese Weise würde ich den Flüchtlingsuntergrund aus eigener Anschauung erleben. Und ich müsste meinen Freund nicht zurücklassen. Wir würden einander helfen. Und ich würde alle Kosten tragen.
Omar war erst einmal still, nachdem ich ihm, damals im August, vor meinem Haus im Auto sitzend alles auseinandergesetzt hatte. Er sah, dass es mir ernst war. Dann grinste er. »Natürlich können wir zusammen gehen.«
»Bist du sicher?«
»Ich bin sicher, Bruder.«
»Gut«, sagte ich. »Wann können wir aufbrechen?«
Er seufzte. »Noch nicht«, sagte er. Ich war davon ausgegangen, dass er jederzeit bereit wäre, aber so einfach war es dann doch nicht. Zuerst musste er seine Eltern außer Landes schaffen.
»Natürlich«, sagte ich.
Und es gab noch eine Person, die ihn hier in Kabul hielt: Laila. Sie war die Tochter seines Vermieters und wohnte zwei Häuser weiter. Seit einigen Jahren trafen sie einander heimlich, aber mir war nicht klar gewesen, wie ernst die Sache geworden war. Sie sei die Liebe seines Lebens, sagte er. Sie wollten heiraten. Aber sie stammte aus einer wohlhabenden Schia-Familie; Omar war Sunnit, und sein Besitz beschränkte sich auf den Corolla. Hätte er das Visum für Amerika bekommen, so hätte er ihrer Familie etwas anzubieten gehabt. Er hätte Laila legal mitnehmen können. Jetzt musste er zuerst in Europa Asyl erhalten und dann zurückkommen und sie holen. Aber ihr Vater konnte während seiner Abwesenheit auf die Idee kommen, sie anderweitig zu verheiraten; sie könne die Entscheidung des Patriarchen zwar hinauszögern, sich aber nicht widersetzen, hatte Laila gesagt.
Das war sein Dilemma: Um Laila zu gewinnen, musste Omar das Land verlassen und das Risiko eingehen, sie zu verlieren.
Nachdem ich ihm an jenem Augusttag mein Angebot gemacht hatte, stellten wir mein Gepäck im Haus ab und zogen wieder los, um einiges zu erledigen. Erst spät abends kamen wir zurück, und das Viertel war, wie immer, ohne Strom. Es gab zwar einen Generator, aber als wir vorfuhren, sah ich kein Licht hinter den oberen Fenstern über der Hofmauer und dachte, es sei niemand zu Hause, doch auf Omars Hupen hin tauchte unser alter chowkidar Turabaz auf, unser Wächter, und öffnete uns das knarzende Tor. Wir fuhren hinein, und die Hündin bellte wild und warf sich in ihre Kette.
Ich hatte während der Jahre, die ich als freier Journalist hier gelebt hatte, in mehreren Kabuler Häusern gewohnt, aber dieses war das erste, das ich zu meinem gemacht hatte. Ein paar Jahre zuvor war ich mit drei anderen Ausländern dort eingezogen. Wir renovierten, pflanzten Rosen im Garten, veranstalteten Partys, und dann verließen meine Freunde einer nach dem anderen das Land. Es folgten andere, immer flüchtigere Mitbewohner. Die meisten Ausländer, die nach Afghanistan kamen, blieben nicht lang. Für sie war es entweder ein Abenteuer, oder sie kamen, um Geld zu machen.
Ich stieg aus dem Auto und beleuchtete den ungepflegten gelben Rasen. Ich war monatelang fort gewesen. Der Schuppen, in dem wir mal Wodka destilliert hatten, war voller Müll. Jemand hatte, aus Sicherheitsgründen, ziemlich dilettantisch eine der Türen zur Straße vermauert. Und die Hündin, die bestenfalls wild war, hatte ein schmutzverfilztes Fell und flippte aus vor Begeisterung, als ich mich vor ihr niederkauerte. Sie leckte mir stürmisch die Hände. »Hat sich denn überhaupt niemand um sie gekümmert?«, fuhr ich Turabaz an.
Omar hockte neben unserem alten Gasgenerator. Wir hantierten daran herum, fluchten, aber er wollte nicht. Also gingen wir mit der Taschenlampe von einem Raum zum anderen, um die Einrichtung zu inspizieren. Ich wollte sie verkaufen und den Erlös Turabaz überlassen, weil er bald arbeitslos wäre. Allerdings hatten die Auswanderungswilligen mit ihren Haushaltsauflösungen längst die Kabuler Secondhandmärkte überschwemmt. Omar, der uns beim Einzug geholfen hatte, wusste noch genau, wie viel wir für jedes Möbelstück (zu viel) bezahlt hatten.
»Dafür hast du hundert Dollar ausgegeben«, sagte er und ließ den Lichtstrahl über ein verstaubtes Pressspanregal wandern. »Jetzt ist es vielleicht noch fünf Dollar wert.«
Während Omar die Küche in Augenschein nahm, setzte ich mich im Wohnzimmer an einen Schreibtisch. Allmählich machte sich mein Jetlag bemerkbar. Wir hatten diesen Raum als Gemeinschaftsbüro genutzt, viele meiner Storys waren hier entstanden, im Winter beim Zischen eines Gasofens, im Sommer bei offener Gartentür. Die Flecken im Teppich waren bei der Düsternis kaum zu sehen. Mit der Fußspitze fuhr ich darüber – Rotwein. Wir hatten bei unseren Partys die Schreibtische zu einer Bar zusammengeschoben, die vom selbst gebrauten Punsch schnell klebrig wurde. Leute aus aller Welt hatten hier miteinander getanzt. Eine Zeit lang war dieses Land unser Zuhause gewesen. Jetzt zogen wir weiter, ließen es zurück wie eine zu eng gewordene Muschelschale.
Als Omar und ich mit der Inventur fertig waren, gingen wir mit der Hündin Gassi. Turabaz hatte sie Bād genannt, was das persische Wort für »Wind« ist. Hauptsächlich, meine ich, war sie ein Deutscher Schäferhund, und ich führte sie gern draußen vor, weil Hauseinbrüche zunehmend zum Problem wurden. Wenn ich mit ihr spazieren ging, schrien die Kinder auf der Straße beim Anblick ihrer dolchartigen Zähne gorg, Wolf. Sie war anhänglich, aber schwer erziehbar, weil sie als Welpe offensichtlich ein Trauma erlebt hatte. Beim geringsten Druck auf ihr Hinterteil begann sie knurrend dem eigenen Schwanz hinterherzujagen, und ich musste an Uroboros denken, die sich selbst verzehrende Schlange. Einer meiner längst ausgezogenen Mitbewohner hatte sie aus einer Laune heraus in meiner Abwesenheit zu uns geholt. Was aus ihr werden sollte, war noch völlig unklar.
Nachts waren die Straßen von Kabul menschenleer. Wir gingen hinüber nach Kolola Puschta, dem Doppelhügel – der eine ein Friedhof, der andere Sitz einer Festung hinter Lehmmauern, die im neunzehnten Jahrhundert von den Briten gebaut wurde und heute eine afghanische Militäreinheit beherbergt. Während Bād in der Gosse allerlei zu beschnüffeln hatte, marschierte Omar voraus, in sein Telefon flüsternd. Er ließ Laila wissen, was er mir auf der Autofahrt mitgeteilt hatte: Er habe sich entschlossen, das Land zu verlassen, Flüchtling zu werden, aber nicht ehe er und Laila verlobt wären. In der Gewissheit, dass er in Europa Asyl bekomme und seine Braut nachholen könne, werde er bei ihrem Vater um ihre Hand anhalten. Mich hatte er schon vorgewarnt, dass es dauern werde, den Patriarchen zu überzeugen. Es habe keine Eile, hatte ich geantwortet. Ich müsse ohnehin in die USA zurück, um einen Auftrag abzuschließen, hätte aber vor, im Oktober wiederzukommen; bis dahin sei Omar bestimmt so weit.
Der Weg schlängelte sich hügelaufwärts zwischen Grabmälern, schartigen Steinen mit Stöcken und daran befestigten Fetzen. Gegenüber zeichneten sich die Umrisse der Festung ab, eine schwarze Silhouette vor dem Licht der Straßenlampen. Aus dem Friedhofsdunkel drang ein trockenes Husten, gefolgt von einem Schwall Haschischgeruch. Ich packte Bāds Leine fester. Lass Omar versuchen, seine Liebste zu gewinnen, dachte ich. Wenn wir uns tatsächlich miteinander auf die Flucht begaben, brauchte auch ich noch Zeit; ich musste mich darauf vorbereiten, mich für einen Afghanen auszugeben, denn wenn wir erst unterwegs wären, gäbe es kein Zurück mehr – nicht, ohne meinen Freund im Stich zu lassen. Weil wir jederzeit durchsucht werden konnten, musste ich meine beiden Pässe zurücklassen, den amerikanischen und den kanadischen, mit denen ich mich jetzt so mühelos in dieser Welt vieler Grenzen bewegen konnte. Und es waren nicht nur Grenzübergänge und Zäune, die unsere Bewegungsfreiheit einschränkten, es gab auch Gesetze und Überwachungsnetze und weitere, unsichtbare Grenzen des Eigeninteresses – die Gleise, in denen unsere Leben liefen, die Scheuklappen unserer Phantasie. Die Mauer ist auch in jedem von uns, hat John Berger geschrieben.[3]
Auf dem Hügel war eine von Bäumen umsäumte leere Fläche. Von dort blickte ich hinaus nach Norden, wo ich klar und scharf bis hinter Qasaba sehen konnte, wo die Armenviertel die steilen Hügel rings um die Hauptstadt hinaufkrochen. Der Strom war wieder da; viele der primitiven Hütten sind heute ans Netz angeschlossen. Omar, der sein Telefongespräch beendet hatte, kam zu mir herüber.
»Als wir zum ersten Mal hier waren, gab es kein Licht«, sagte er.
Wie so viele Afghanen seiner Generation war Omar als Flüchtling im Iran und in Pakistan aufgewachsen. 2002 war seine Familie aus dem Exil in die schwer angeschlagene afghanische Hauptstadt zurückgekehrt. Schutt türmte sich entlang der Straßen, und die Granateneinschläge in den Häuserfassaden waren mit zerschlissenen Fetzen verhängt. Aber die Menschen hatten Hoffnung. Kabul wuchs sprunghaft, in Schwallen von Beton schossen Einkaufszentren und neonfarben leuchtende Tankstellen aus dem Boden, doch das Friedensversprechen war eine Lüge. Der Krieg, der draußen auf dem Land tobte, kam der Hauptstadt näher. Die Taliban rückten heran. Aber nachts sah man nichts von den zerschossenen Mauern unter Stacheldrahtrollen, auch nichts von den ungeteerten Straßen, wo die Witwen von Tagesanbruch an bettelten. Die Stadt, die vor uns lag, war ein Lichtermeer.
»Wunderschön«, sagte ich.
»Das stimmt. Und wenn Gott will, wird es eines Tages besser.«
»Aber du bist bereit zu gehen?«
Er drehte sich zu mir, und ich sah, wie müde er war.
»Für mich gibt es hier keine Zukunft. Du hast einen guten Job, du hast Papiere, du kannst reisen, wohin du willst.« Er blickte auf seine Stadt hinaus. »Das Einzige, was ich habe, ist mein Glück.«
2
Kurze Zeit danach flog ich nach New York, und als ich drei Monate später, Ende Oktober, mit dem fast leeren Flugzeug aus Istanbul zurückkam, war die Gepäckausgabe in Kabul umdrängt von Männern in weißen Gewändern, die ihre aus Mekka mitgebrachten Behälter mit heiligem Zemzem-Wasser vom Förderband luden. Der Hadsch des Jahres 2015 war ein Desaster gewesen, über zweitausend Menschen waren bei einer Massenpanik umgekommen, weitere hundert durch einen umgestürzten Baukran der Saudi Binladin Group.
Ich brachte meinen Schnaps sicher durch den Scanner und machte mich auf die Suche nach Omar, der mich auf dem Parkplatz erwartete. Die Wachleute im Flughafen wirkten nervös; ein paar Wochen zuvor hatten die Taliban die Stadt Kunduz nahe der tadschikischen Grenze eingenommen. Die Verteidigung der Regierungstruppen war unter dem unerwarteten Angriff rasch zusammengebrochen, und zum ersten Mal seit 2001 hissten die Taliban wieder ihre weißen Fahnen in einer Provinzhauptstadt. Ein Strom heimatlos gewordener Menschen machte sich Richtung Süden auf den Weg nach Kabul und verbreitete Panik entlang der Strecke. Nach dem Fall von Kunduz nahm der Exodus aus Afghanistan, der seit der Grenzöffnung nach Europa in diesem Herbst ohnehin hysterische Züge hatte, noch einmal Fahrt auf.
Auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt wollte ich Omar von dem sogenannten humanitären Korridor für Geflüchtete durch den Balkan berichten, aber er wusste schon alles aus den Nachrichten. Ein Wunder hatte uns den Weg freigemacht, dennoch hatte er, wie er mir gestand, weder Lailas Familie seinen Antrag gemacht noch die Ausreise seiner Eltern in die Wege geleitet. Es sei kompliziert, sagte er; er brauche mehr Zeit. Schon okay, sagte ich, denn ich wollte noch eine letzte Story in Afghanistan mit ihm machen. Bei der Einnahme von Kunduz hatte sich ein schockierender Zwischenfall ereignet:[4] Ein Team der amerikanischen Spezialkräfte, die an der Seite afghanischer Truppen versuchten, Kunduz zurückzuerobern, hatte eine Klinik der Ärzte ohne Grenzen bombardiert und zweiundvierzig Menschen getötet. Das Militär bezeichnete den Luftangriff als tragischen Unfall, aber ich wusste, dass die lokalen Behörden dieses Krankenhaus schon lange im Visier hatten, weil dort verwundete Aufständische behandelt wurden. Ich wollte der Sache nachgehen und brauchte Omar als Fahrer. Wir würden, so mein Plan, gemeinsam nach Kunduz fahren, und während ich meinen Artikel schrieb, würde er seine Angelegenheiten mit Laila klären. Wir mussten nichts überstürzen. Ich war zuversichtlich, dass wir Afghanistan in jedem Fall gemeinsam verlassen würden. Und mit unserer Flucht würde sich ein Kreis schließen, denn seitdem wir uns kannten, meinte ich eine Parallelität im Verlauf unseres jeweiligen Lebens zu erkennen.
Mit Omar hatte ich seit meiner ersten Magazinstory über Afghanistan, sechseinhalb Jahre zuvor, zusammengearbeitet. Das war im Frühjahr 2009, ich war vierundzwanzig und von Harper’s Magazine beauftragt, einen Artikel über Oberst Abdul Raziq zu schreiben, einen Kommandeur der Grenzpolizei, der ein wichtiger Verbündeter des US-Militärs war, aber auch, Gerüchten zufolge, mit Drogenhändlern im Bund stand.[5] Ich wollte in Raziqs Provinz Kandahar reisen, wo die Taliban ihren Stützpunkt hatten, aber die Zeitschrift konnte sich keinen der etablierten Mittler aus der Hauptstadt leisten, die für einen Trip in den gefährlichen Süden – falls sie überhaupt dazu bereit waren – Hunderte Dollar am Tag berechneten.
Ich wohnte im Mustafa Hotel in der Kabuler Innenstadt, und als ich Abdullah, dem schwermütigen Geschäftsführer, meine Zwangslage darlegte, wusste er gleich den richtigen Mann für mich, einen ehemaligen Militärdolmetscher, der sich ebenfalls erste Sporen im Journalismus verdiente. So kam es, dass eines Tages, als ich die Lobby betrat, ein junger Mann meines Alters auf mich wartete: Omar. Er sprang sofort auf und nahm meine Hand zwischen seine rauen Handflächen: »Schön, dich zu sehen, Bruder«, sagte er. »Klar fahr ich mit dir nach Kandahar, kein Problem.«
Es war Mittag, und er fragte, ob ich hungrig sei. Wir traten auf die abgesperrte Straße hinaus, die sich das Mustafa mit der indischen Botschaft teilte, ein Ort, an dem Besucher zwar vor Entführungen sicher waren, aber nicht vor gelegentlichen Autobomben. Omars Corolla stand ganz in der Nähe. Es war eine kurze Fahrt zum Restaurant, doch ein langsames Dahinkriechen im dichten Verkehr auf tief gefurchten, staubigen Straßen entlang des Schahr-e-Nou-Parks.
»Kandahar ist im Arsch«, sagte Omar. Sein nahezu fließendes Englisch war gespickt mit den Kraftausdrücken, die er von den Soldaten gelernt hatte. »Ich war mit den Koalitionstruppen dort.« Während der vergangenen Jahre hatte er im Süden des Landes auf Vertragsbasis für die Amerikaner, Kanadier und Briten gearbeitet, war die gefährlichen Patrouillen und das öde Leben auf dem Stützpunkt aber zunehmend leid und wollte in eigener Regie in Kabul, wo es damals von Ausländern wimmelte, als Ortskraft arbeiten.
Der Krieg gegen den Terror begleitete Omars Leben, seitdem er erwachsen war; wie bei mir. Er war im Exil aufgewachsen, und als er kurz nach dem Einmarsch der Amerikaner mit seiner Familie nach Afghanistan zurückkehrte, freute er sich auf die verheißene neue Zeit, eine Ära des Friedens und Wiederaufbaus. Doch das Land lag in Trümmern, und Jobs gab es so gut wie nicht. Und weil ihm zu Ohren gekommen war, dass die ausländischen Truppen für die gefährliche Arbeit unten in Kandahar gut zahlten, stieg er 2006 in den Bus, ohne seiner Mutter zu sagen, wohin er wollte.
Paschto, die Sprache des Südens, konnte er kaum, aber Englisch sprechende Einheimische wurden händeringend gesucht, und daher engagierte ihn auf der Stelle eines der Unternehmen, die den Ausländern Dolmetscher zur Verfügung stellten. Omars erster Einsatz war bei den Kanadiern; sein Einstiegsgehalt betrug sechshundert Dollar im Monat, sechsmal so viel, wie ein gewöhnlicher afghanischer Soldat verdiente.[6] Er und die anderen Dolmetscher lebten auf dem riesigen Stützpunkt, der neben dem Flughafen aus dem Boden gestampft worden war, hinter Wällen aus erdgefüllten Schanzkörben und Stacheldrahtverhau, in einem Gitternetz aus Wohncontainern zwischen staubigen Kiesflächen, die das grelle Sonnenlicht reflektierten. Gewaltige Panzerfahrzeuge, ohrenbetäubender Lärm der landenden Jets, Generatoren, die Tag und Nacht Benzin fraßen, um klimatisierte Zelte mit Strom zu versorgen, ungezählte Paletten mit Getränkekisten und gefrorenen Steaks, die glöckchengeschmückte Lastwagen von pakistanischen Häfen herbeischafften – Omar war überwältigt.
Seit früher Kindheit hatte er Menschen aus dem Westen im Fernsehen gesehen, aber hier begegnete er ihnen zum ersten Mal aus der Nähe. Wie die anderen Terps, die Dolmetscher, übernahm er ihr vertrauenswürdiges Image, indem er sich den Soldatenslang, die glatt rasierten Wangen, die Sonnenbrillen aneignete, ihren Respekt vor Regeln und ihre Einstellung gegenüber den Bad Guys. Das fiel ihm ganz leicht, denn er mochte die Kanadier. Er wusste, dass sie aus einem Land der Fülle kamen, aber sie erschienen ihm noch viel großzügiger und ehrlicher als die Menschen, zwischen denen er als Flüchtling im Iran und in Pakistan aufgewachsen war, wo materielle Not und Angst selbst Freunde und Verwandte gegeneinander aufbrachte. Die Canucks teilten ihre stummeligen Zigaretten mit ihm und schenkten ihm Winterjacken und Stiefel aus synthetischen Materialien, mit denen er nie zuvor in Berührung gekommen war. »Ihre Augen waren voll«, wie die persische Redewendung besagt. Die Ausländer sagten, sie seien gekommen, um den Terrorismus zu bekämpfen und seinem Land zu helfen. Omar glaubte ihnen.
Doch in den ländlichen Gegenden rings um die Stadt waren die Taliban auf dem Vormarsch. Vom Hubschrauber aus sah das Pandschwai-Tal im Vergleich mit der Wüste saftig grün aus, und entlang der schlammfarbenen Kanäle wuchsen Maulbeerbäume. Granatapfelgärten reihten sich aneinander, auf jeder Parzelle gab es hinter den Erdwällen, die sie einfassten, eine Kuh und ein paar Schafe und einen Wachhund, und bestellt wurde das Land von Subsistenzbauern, vorwiegend Pächtern. Die unter Helm und Panzerweste schwitzenden Kanadier marschierten Dämme entlang, in deren weichem Boden sich auch Kanister mit selbst gebasteltem Sprengstoff verbergen konnten, Beinlotterie nannten sie das. Die Hunde mussten sie manchmal erschießen, wenn sie in diesen kleinen Siedlungen Razzien durchführten, Blechkisten und Bettzeug durchsuchten und im Innenhof mit Bajonetten und Metalldetektoren in den Boden stachen. Die Bewohner standen daneben, Frauen und Kinder leise weinend, die halbwüchsigen Söhne mit verdächtig weichen Händen und mürrischen Mienen, die alten Männern mit demselben argwöhnischen Blick, mit dem sie zuvor die Sowjets beäugt hatten.
Bei Tag patrouillierte die kanadische Infanterie in Truppenstärke, begleitet von afghanischer Armee und Polizei, die Nacht aber gehörte den Aufständischen und den Ausländern, die sie jagten, bärtigen Männern, die Omar manchmal mit Gefangenen sah, denen die Augen verbunden waren – eines der Dinge, nach denen er, das wusste er, nicht fragen durfte. Die Taliban nahmen ebenfalls Gefangene, die von mobilen Schariagerichten verurteilt wurden; gegen Kollaborateure wie Omar verhängten sie das Todesurteil. Drei seiner Dolmetscherkollegen wurden draußen vor der Stadt erschossen, weitere fünf kamen ums Leben, als ihr Bus auf dem Weg zum Stützpunkt von einer Bombe getroffen wurde.[7] Omars Mutter flehte ihn an zu kündigen, aber er brauchte das Geld und kehrte immer wieder nach Kandahar und Helmand zurück, um eine Zeit lang für die Royal Marines oder für die Green Berets zu arbeiten. Die Terps erhielten keine Gefechtsausbildung und waren dennoch Teil des Kriegs. Kurz nachdem er angefangen hatte, erlebte er seine ersten Kampfhandlungen, als die Kanadier eine Offensive im Tal westlich der Stadt Kandahar führten.[8] Sein Zug wurde losgeschickt, um ein paar Erdwälle inmitten von Weingärten zu verteidigen. In seiner zweiten Nacht, die Omar frierend in einem Panzerfahrzeug verbrachte, holte ein Soldat ihn heraus und reichte ihm ein Gewehr.
»Kannst du damit umgehen?«, fragte der Kanadier. Er klang beunruhigt. »Es sind jede Menge Bad Guys unterwegs.«
Omar umfasste das kalte Plastik des C7. Im Iran hatten er und seine Klassenkameraden für den Fall eines amerikanischen Einmarsches gelernt, mit Kalaschnikows zu schießen. Dieses neue Sturmgewehr unterschied sich nicht sehr davon.
Sie postierten ihn mit dem übrigen Zug, etwas mehr als dreißig Männern und einer Sanitäterin, im Umkreis. Dort draußen in der Nacht war eine unbekannte Zahl Taliban, die sich sammelten, um diesen isolierten Stützpunkt zu überrennen. Omar duckte sich hinter einen Erdwall. Jemand schrie, die Aufständischen versuchten von der Seite anzugreifen, und sofort begann die Schießerei, ein ohrenbetäubendes Inferno aus hereinkommenden Gewehrsalven und kanadischer Erwiderung, die Fünfundzwanzig-Millimeter-Einschläge im Fahrzeugblech krachend wie Pfahlrammen.
Omar feuerte in die Dunkelheit, bis das Magazin leer war. Seine Ohren dröhnten, und er schmeckte Schießpulver. Endlich hörten sie das lang gezogene Donnern der herannahenden Jets. Ein Bombeneinschlag erhellte die Nacht und beleuchtete die Gesichter ringsum. Im Morgengrauen rückten die kanadischen Panzer an und ließen die Erde erbeben. Als das Gefecht vorbei war, rückte der Zug aus und fand die Leichen in den Weingärten und zerschossenen Bauernhäusern, junge Männer mit blutgetränkten Gewändern und Patronengurten. Seine Landsleute.
Es fällt mir schwer, mich an Omar als den Fremden zu erinnern, der er an jenem Tag im Frühling 2009 war, als wir uns zum ersten Mal trafen und er mir beim Mittagessen von seiner Zeit in Kandahar erzählte. Deutlich in Erinnerung ist mir hingegen, wie üppig grün der Restaurantgarten war, in dem wir saßen und Hammelspieße aßen. Omar wollte wissen, ob ich zum ersten Mal in Afghanistan sei. Im vergangenen Herbst sei ich schon einmal hier gewesen, sagte ich, als Rucksackreisender durch Zentralasien.
Nach dem Collegeabschluss 2006 war ich wieder zu meinen Eltern nach Nova Scotia gezogen. Ich wollte Schriftsteller werden und dachte, ich fände draußen in der Welt das Material, das ich in meinem Inneren nicht fand. Nach zwei Jahren Jobben hatte ich genug Geld für ein Flugticket nach Paris im Frühjahr 2008. Von dort trampte ich in den Balkan, kopierte Straßenkarten in mein Notizbuch und schrieb Städtenamen dazu, in Blockbuchstaben, damit ich vom Straßenrand den Vorbeifahrenden aufgeschlagene Seiten hinhalten konnte: TRENTO, LJUBLJANA, NOVI SAD. Den Sommer verbrachte ich in Kroatien, schwamm in trüben Flüssen und trank Slibowitz mit einer Gruppe Punks, die mich auf einem Musikfestival aufgelesen hatten. Ich schlief auf Sofas und sagte zu allem ja, was mir begegnete. Als der Herbst kam, beschloss ich, über Land nach Indien zu reisen, und legte mir eine Route durch Zentralasien zurecht, was bedeutete, dass ich entweder durch Turkmenistan oder durch Afghanistan musste. In Taschkent stellte sich heraus, dass ein afghanisches Visum leichter zu kriegen war, und so kam es, dass ich im Oktober die Freundschaftsbrücke, über die zwei Jahrzehnte früher die letzten sowjetischen Panzer abgezogen waren, Richtung Süden überquerte.
Darunter floss breit und schlammig der Amudarja dahin. Etwa auf der Mitte der Brücke hielt neben mir ein Fahrer, ein Händler auf dem Rückweg nach Mazar-e Scharif, wohin auch ich unterwegs war. In Nordafghanistan wird hauptsächlich Dari gesprochen, ein persischer Dialekt, und ich probierte gleich das erste Dutzend Wörter aus meinem mitgebrachten Sprachführer aus.
Die Straße führte an endlosen grauen Dünen entlang. Hin und wieder tauchten in der Ferne Zeltlager und Kamelherden aus dem Dunst auf und verschwanden wieder. Als wir die Dörfer im Umkreis von Mazar erreichten, starrte ich durchs Fenster auf die Lehmhäuser, auf die Männer mit langem Bart und Turban. In den ehemals sowjetischen Betonstädten, durch die ich zuletzt gekommen war, hatten die Leute Wodka trinkend in den Cafés gesessen, auch im Ramadan. Besonders überrascht war ich vom Anblick der Frauen in bodenlanger Komplettverhüllung: War die Burka nicht zusammen mit den Taliban überwunden?
Herzstück von Mazar ist die Blaue Moschee, deren Tore und prächtige Kuppeln mit Tausenden türkisfarbenen Kacheln verkleidet sind. Der Legende zufolge soll hier Mohammeds Schwiegersohn Ali begraben sein. Ich fand ein Hotel an der Südseite des Platzes, das Aamo hieß. Es war ein dreistöckiges heruntergekommenes Gebäude, Absteige für Fernfahrer und Pilger, die Flure übersät mit Teeblättern und Zigarettenkippen. Für zehn Dollar bekam ich ein eigenes Zimmer mit vier zerschlissenen Betten und Blick auf die Blaue Moschee. In dieser Nacht saß ich am Fenster und versuchte alles zu erfassen: Der Platz war zwar neonfarben beleuchtet wie ein Casino in Las Vegas, blinkende Palmen inklusive, aber vollkommen menschenleer, und es beschlich mich eine gewisse Melancholie bei dem Gedanken an die bittere Armut, die ich an diesem Tag zum ersten Mal gesehen hatte, an die Kleinkinder, die aus dem Abwasser Lumpen fischten.
Für die Gruppe junger Männer, die im Hotel arbeiteten, war meine Ankunft Quell der Unterhaltung. Einer war Dschawed, der seine hennagefärbte Hand in die meine legte, als wir auf Socken den marmornen Innenhof der Moschee durchquerten. Kamran, der Durchtrainierte, ging mit mir Eis und Pommes frites essen und kniff mich ins Handgelenk, nachdem er auf einem Wettkampf im Armdrücken mit mir bestanden hatte. Ibrahim mit seinen Haselnussaugen und seinem Bürstenbart sprach am besten Englisch von allen und war der Empfangschef.
»Kennst du Brian Tracy? Ich denke, er ist sehr berühmt in deinem Land«, sagte er. Dessen Selbsthilferatgeber mit dem Titel Eat that Frog beschäftigte Ibrahim zu der Zeit. »Da lernst du, keine Zeit zu vergeuden.« In seiner Freizeit studierte er Betriebswirtschaft und Computerprogramme und wollte von mir wissen, wie er es anstellte, nach Kanada auszuwandern. Ich hatte keine Ahnung. Ging das überhaupt? Ibrahim wusste schon, wie: Er sparte, um einen Schleuser bezahlen zu können. Es ist ganz simpel, schrieb ich später in mein Tagebuch. Ich komme aus einem Land, in das sie reisen wollen, aber nicht können. Mich würde es wahnsinnig machen, aber für sie ist es einfach Fakt.
Zu Hause hatte ich, selbst als Kellner im Restaurant oder ungelernter Bauarbeiter, an einem oder zwei Tagen mehr verdient als sie in einem Monat. Es war eine tiefe Kluft zwischen uns, aber ich dachte, wir könnten sie überbrücken, indem wir einander als Menschen begegneten. Trotz der vielen kulturellen Unterschiede zwischen uns fühlte ich mich wohl in ihrer Gesellschaft. Die Nähe, die sie zu mir herstellten, war etwas völlig anderes als die Art von männlichem Körperkontakt, mit der ich aufgewachsen war, betrunkenes Gerangel und raubtierhaftes Geplänkel – hier waren Frauen kaum Thema, an öffentlichen Orten wie dem tschajkhane, dem Teehaus, waren sie unsichtbar. Die afghanischen Männer zeigten einander ihre Zuneigung ganz unverstellt – als gönnten sie sich extra viel Geselligkeit und Gemeinschaft, nachdem sie die Frauen ausgeschlossen hatten. Die Jungs gingen mit mir zum Basar und berieten mich beim Kauf der traditionellen Kleidung afghanischer Männer, pirān wa tunbān, der knielangen Tunika mit Pluderhose. Als ich in meinem Zimmer die Hose auspackte, musste ich schallend lachen, weil wir uns ganz offensichtlich total in der Größe geirrt hatten: Der Hosenbund war etwa so weit wie meine ausgestreckten Arme. Aber es stimmte schon, Dschawed zeigte mir, wie es geht: Man schnürt die Hose in der Taille mit einer Kordel zusammen und lässt diesen ganzen Stoff sich um einen bauschen. Die Jungs waren hell begeistert, als ich in afghanischer Tracht herunterkam. Aus einem schwarz-weiß gemusterten Tuch wickelten sie einen Turban, den sie mir um die Stirn banden, und waren baff, wie afghanisch ich aussah.
Mit meinem schwarzen Haar und den asiatischen Augen hatte ich irgendwo über dem Atlantik eine Farbgrenze überschritten. In Europa gehöre ich nicht mehr zu den Weißen; in England wurde ich Paki genannt, in Frankreich war ich arabe. In Zentralasien aber kam es mir vor, als ginge ich einem Spiegel entgegen, und in Nordafghanistan mit seinem hazarisch-tadschikisch-usbekischen Völkergemisch hatte ich meinen Phänotyp gefunden. Die Leute sahen ihr Gesicht in meinem.
Im Teehaus machten sich die Jungs einen Spaß daraus, einen vorbeikommenden Freund zu sich zu rufen und ihn raten zu lassen, aus welcher Provinz ich käme; mir hatten sie Schweigen auferlegt. »Er ist Ausländer!«, riefen sie schließlich. »Aber warum sieht er so afghanisch aus?«, fragte der Freund verblüfft.
In stockendem Dari erklärte ich, dass mein Vater europäischstämmiger Kanadier sei und meine Mutter zwar in Amerika geboren, ihre Großeltern aber seien Asiaten gewesen. »Japan ist hier, Kanada dort«, sagte ich, hielt zwei Finger mit Abstand nebeneinander, legte sie dann zusammen und grinste. »Und Afghanistan dazwischen.«
Von Mazar nahm ich den Bus nach Kabul, wo ich im Mustafa eincheckte, einem klotzigen Hochhaus aus den sechziger Jahren, das seinerzeit eine beliebte Anlaufstelle entlang des Hippie-Trails gewesen war. Zu Taliban-Zeiten hatte sich das Mustafa in einen gedeckten Basar verwandelt, und nach dem Einmarsch der USA war es eines der ersten wiedereröffneten Hotels, und wer sich das Intercontinental nicht leisten konnte, wohnte hier. Als ich herkam, Ende 2008, hätte es etliche feinere Lösungen gegeben, aber mit zwanzig Dollar pro Nacht war das Mustafa unter den für Ausländer sicheren Unterkünften die billigste. Die Klientel setzte sich zusammen aus der untersten Stufe der Expats, unverwendbaren Ortskräften, freischaffenden Humanitären und Möchtegernschriftstellern wie mir. An der rosafarbenen Onyxbar lernte ich einen wettergegerbten Glücksritter kennen, der sich als Rhodesier bezeichnete. Ein anderer Gast, ein traurig dreinblickender Schweizer Korrespondent, hatte die letzten zehn Jahre damit zugebracht, gegen seine Heroinsucht anzukämpfen. Wir saßen in der Lounge, horchten auf das Heulen der Straßenhunde, und als alle im Bett waren, zog er seine Pfeife hervor und zeigte mir, wie man eine Kugel Opium zum Schmelzen bringt und den duftenden Dampf inhaliert, der sich durch meine Gliedmaßen breitete und mich durch Flure verspiegelter Basarstände in mein Bett schweben ließ.
Mein einmonatiges Touristenvisum näherte sich seinem Verfallsdatum, ich wollte als Nächstes in den Iran, hatte mir aber sagen lassen, dass die Hauptroute, die Fernstraße A01, die nach Süden durch Kandahar bis zur Grenze führt, zu gefährlich sei, man könne dort leicht von Taliban entführt werden. Fliegen wiederum war nur etwas für Touristen. Es gab eine wenig benutzte Route über den Hauptkamm des Hindukusch; man musste jedoch lokale Transportmittel nutzen und übernachtete in Teehäusern entlang der Strecke, die zugleich als Herberge dienten. Seit Mazar hatte ich mich, wenn ich mich nicht ganz sicher fühlte, als Kasache ausgegeben; von nun an, beschloss ich, wäre ich Wanderarbeiter auf Arbeitssuche im Iran.[9]
Mir war nicht wohl bei dieser Lüge, aber dann saß ich in Bamiyan im Kleinbus, und es gab kein Zurück mehr. Tagelang fuhren wir Schotterstraßen aufwärts bis über die Schneegrenze. Dies war das Dach der Welt, Gebirgsketten reihten sich aneinander bis nach Tibet hinein, und das Panorama war wie ein Traum, den ich nicht deuten konnte. Immer wieder unterliefen mir Patzer, mit denen ich Blicke auf mich zog, wie Pinkeln im Stehen statt in der Hocke oder Beten nach schiitischer Art, obwohl ich behauptet hatte, ich sei Sunnit. Aber so sonderbar ich meinen Mitreisenden als kasachischer Migrant erschienen sein mochte – die Wahrheit war noch viel bizarrer, und die erriet niemand. Die Leute waren ohnehin argwöhnisch gegeneinander, verschwiegen, woher sie kamen und wohin sie wollten, denn auf einer von Banditen und Aufständischen bedrohten Straße konnte immer alles Mögliche passieren. Abends, wenn wir uns einer neben dem anderen auf dem Fußboden eines Teehauses zum Schlafen niederlegten, wurde flüsternd von den Enthauptungen und Entführungen in jüngster Zeit erzählt. Der Tod hatte mich immer fasziniert, wie es ja vielen behütet aufgewachsenen jungen Leuten geht – jetzt war er auf einmal nah, überall ringsum.
Eine Woche nach meinem Aufbruch in Kabul holperte der Kleinbus ein Flusstal hinunter, und dann waren wir in der Grenzstadt Herat. Erleichtert, dass ich lebendig angekommen war, gönnte ich mir den Luxus eines Hotels mit heißem Wasser. Von der Dusche blickte ich durch die offene Tür zum Fernseher in der Ecke des Zimmers. In den USA lag das Wahlergebnis vor, Barack Obama war der neue Präsident und hielt in Chicago seine Siegesrede. Ich drehte die Lautstärke auf, bis seine Stimme das Rauschen des Wassers übertönte:
Denen, die heute Abend aus dem Ausland zusehen, in Parlamenten und Palästen, denen, die sich in den vergessenen Winkeln der Erde um ein Radio versammelt haben, möchte ich sagen, dass unsere Geschichten einzigartig sind, unser Schicksal aber ein gemeinsames ist und der Beginn einer neuen amerikanischen Führungsrolle bevorsteht.[10]
Ich schloss die Augen und ließ mir das Wasser über das Gesicht laufen.
Ein halbes Jahr später, bei dem Mittagessen mit Omar und unserem ersten Kennenlernen, kam ich zu meinem geschäftlichen Anliegen. »Weißt du, wer Abdul Raziq ist?«, fragte ich. Natürlich wusste er das. Raziq war noch keine landesweite Berühmtheit, aber wer in Kandahar zu tun gehabt hatte, kannte den jungenhaften, skrupellosen, dreißigjährigen Beherrscher von Spin Boldak, dem Hauptgrenzübergang nach Pakistan im Süden. Schon damals Oberst bei der Grenzpolizei, war Raziq gefürchtet und bewundert wegen seiner kompromisslosen Haltung gegenüber den Taliban, aber es wurde ihm auch nachgesagt, er handle mit Opium und ermorde seine Stammesgegner. Recherchen über ihn anzustellen konnte riskant sein. Und noch etwas musste ich Omar sagen: Ich war schon einmal in Spin Boldak gewesen, mit Raziqs Männern, quasi undercover.
Im vergangenen Herbst, nach meiner Fahrt über Land nach Herat, hatte ich mit meinem kanadischen Pass die Grenze zum Iran passiert und war dort ein paar Monate herumgereist. Ich hatte zu den Vergnügungen des Rucksacktouristen zurückgefunden, hatte das nahezu menschenleere Persepolis besucht, war zu Weihnachten in der Straße von Hormuz geschwommen, und der Krieg in Afghanistan war in weite Ferne gerückt. Ich überlegte, mich an der Graduiertenschule einzuschreiben, für Journalismus vielleicht, und war immer noch der Meinung, das Ziel meiner Reise liege in Indien. Um auf dem Landweg dorthin zu gelangen, musste ich über die Grenzstadt Quetta nach Pakistan, und Quetta war eine gefährliche Gegend – ein Amerikaner, der für die UN arbeitete, wurde etwa um diese Zeit dort entführt. Frisch aus dem Iran eingereist, ging ich in Quetta eine Straße entlang, wo ich mich in meinen westlichen Klamotten fühlte wie ein bunter Hund. Unversehens hielt neben mir ein Luxus-SUV. Eine getönte Scheibe wurde heruntergelassen, und zwei junge Männer mit orientalischen Gewändern und zotteligem Haarschnitt winkten mich zu sich.
»Bist du Tourist?«, fragte der eine auf Englisch, lächelnd. Er lud mich ein, mit ihnen zu essen. Ich zögerte, aber irgendwie schien mir gerade ihre unverhohlene Neugier ein Beweis, dass sie nicht die Absicht hatten, mich zu kidnappen. Ich stieg ein, und der weitere Verlauf war, dass wir die ganze darauffolgende Woche zusammenblieben, Hasch rauchten und Kanonen abfeuerten. Sie weihten mich in Geheimnisse ein, erzählten von heimlichen Geliebten, von denen ihre Familien nichts wissen durften, und da sie sich in der Unterwelt von Quetta auskannten, zeigten mir meine zwei Freunde das Krankenhaus, in dem verwundete Taliban behandelt wurden. Pakistan galt als Verbündeter der USA, aber das Militär trieb ein doppeltes Spiel und unterstützte gleichzeitig den Aufstand in Afghanistan. Quetta brodelte von Schattenkriegen: von Sektenanhängern, die Schiiten umbrachten, belutschischen Separatisten, die gegen die Regierung vorgingen, von Mafia- und Stammesvendetten.
Meine Gastgeber waren Sprösslinge lokaler Paschtunenclans, die tief ins Schmugglergeschäft verstrickt waren. Vor rund hundert Jahren hatten die Briten mitten durch ihre ausgedehnten Familien eine Grenzlinie gezogen, und jetzt waren ein Teil der Verwandtschaft Taliban; ein Onkel war der stellvertretende Polizeichef von Quetta. Meine neuen Freunde waren stolz auf ihren Erfolg; sie schickten jeden Monat zwei Tonnen Opium von Afghanistan in den Iran und machten jedes Mal eine runde Viertelmillion Dollar Gewinn. Geliefert wurde die Fracht von einem Konvoi schwer bewaffneter Land Cruiser, der durch das steinige Ödland im Schnittpunkt der drei Länder jagte. Die iranischen Grenzposten seien gefährlich und müssten gemieden werden, die Pakistaner hingegen nähmen sehr gern Schmiergelder an, sagten sie. Aber die Afghanistan-Connection sei die allerwichtigste.
»Wer ist das?«, fragte ich.
»Big Boss. Abdul Raziq.«
Ich hatte ihnen gesagt, ich sei Schriftsteller, meine journalistischen Ambitionen hatte ich verschwiegen. Als die beiden mir erklärten, Raziq werde vom amerikanischen Militär unterstützt, roch ich sofort eine Story. Meine Gastgeber hatten ein Tigerjunges als Geschenk für Raziq gekauft, und ich fragte, ob sie mich mitnähmen, wenn sie das nächste Mal nach Spin Boldak fuhren. Sie waren einverstanden; keine Ahnung, warum – einen anderen Grund als Sympathie und Langeweile kann ich mir nicht vorstellen. Sie vertrauten mir wie ich ihnen. Sie kannten die Grenzpolizisten; über Spin Boldak war es leicht, in Afghanistan einzureisen, ohne meinen Pass vorzeigen zu müssen. Wir durchquerten die Mohnfelder rings um die Stadt; der afghanische Mohnanbau deckte praktisch den gesamten weltweiten Bedarf an illegalem Opium.[11] Die Lage an der Grenze generierte Gewinn; in Spin Boldak gab es eine Barackenstadt aus Schiffscontainern, in denen gehandelt und gewohnt wurde; im Schweiß ihres Angesichts luden junge und ältere Männer dort gebrauchte Mikrowellenherde, Gitarren, DVD-Spieler, Fahrräder, Propangasbrenner, motorisierte Rollstühle, Generatoren, Kinderspielsachen aus – und Autos, massenhaft gebrauchte Autos. Die meisten dieser Waren wurden günstig nach Afghanistan importiert und anschließend nach Pakistan, das hohe Zölle erhob, zurückgeschleust. Schmuggler und Polizisten waren oft ein und dieselben Personen, und Raziqs Leute besteuerten alles, Legales und Illegales.
Zehn Tage musste ich dort warten, bis Raziq auftauchte; er kam zur Beerdigung seiner Großmutter mütterlicherseits. Während der Zeremonie deutete mein Freund verstohlen auf einen der Gäste, einen stämmigen bärtigen Mann, und teilte mir flüsternd mit, das sei Rahmatullah Sangaryar. »Er war in Guantánamo.«
Ich näherte mich dem Podium; Raziq sah noch viel jünger aus als dreißig. Er hatte einen kurz geschorenen Bart und einen spitzen Haaransatz, der sich unter dem Kappenrand in die Stirn schob, und trug ein schlichtes weißes Gewand mit gestreifter Weste. Er gab mir die Hand, lächelte höflich und wandte sich dem nächsten Besucher zu. Ich kehrte nach Pakistan zurück.
Ich hatte Beweise für Raziqs Verbindung mit dem Drogenhandel, aber für eine Reportage brauchte ich mehr Material. In Pakistan besorgte ich mir ein Visum für Afghanistan, flog nach Kabul und checkte im Mustafa ein, wo ich Omar kennenlernte.
Ich hätte jedes Verständnis, wenn Omar sich die Sache überlege und nicht nach Kandahar mitkomme, sagte ich am Ende meiner Geschichte; Raziq wäre vielleicht nicht begeistert, mich wiederzusehen. Omar aber ließ sich nicht abschrecken. Wir flogen gemeinsam in den Süden, wo er sich nach Kräften bemühte, aus dem Paschtunischen zu übersetzen, und ich mich meinerseits nach Kräften bemühte, unsere Interviews in einen Artikel für ein Magazin zu gießen. Wenn die Leute aus der Gegend uns miteinander Englisch sprechen hörten, hielten sie Omar mit seinem T-Shirt und seiner Wraparound-Sonnenbrille für den Ausländer und mich in meinem afghanischen Gewand für seinen Dolmetscher, was ihn maßlos amüsierte.
Wir hörten viel über das Geschäft mit Opium, aber auch düstere Geschichten von Leichen mit deutlichen Folterspuren, die Raziqs Männer in der Wüste abgeladen hatten.[12] Als Erklärung für Raziqs jähen Aufstieg kamen meine Gesprächspartner immer wieder auf sein enges Verhältnis zu den Amerikanern und seine häufigen Kontakte mit der CIA und dem Stützpunkt der Spezialkräfte in der Stadt zu sprechen. Amerika brauchte Verbündete, insbesondere auf strategischen Routen wie Spin Boldak. Die ersten Kampfbrigaden, die der neue Präsident Obama geschickt hatte, waren bereits im Süden stationiert; bis zum Ende des folgenden Jahres sollte sich die Zahl der US-Truppen in Afghanistan verdreifachen.[13]Das ist ein Krieg, den wir gewinnen müssen, sagte Obama.[14]
Nachts lagen Omar und ich in unseren Betten im Hotel von Kandahar-Stadt und lauschten dem fernen Geschützlärm. Die Taliban standen vor den Toren der Stadt. Wir versuchten die Geschichten zu entzerren, die wir im Lauf des Tages gehört hatten, von Stämmen und Blutfehden und geschäftlichen Vereinbarungen, was die fraktalen Muster dieses Kriegs besser erklärte als die Gegensatzpaare, mit denen ich angekommen war, Polizei und Kriminelle, Taliban und Regierung, der Westen und der Terrorismus. Wie erklärte man das den Leuten zu Hause, die sich, reichlich spät, für das ferne Land, in das sie einmarschiert waren, interessierten? Wenn wir genug davon hatten, über die Arbeit des Tages zu diskutieren, redeten wir über uns, über Vergangenheit und Zukunft, und in der Ferne donnerten Schüsse.
»Wie ist Kanada, Bruder?«
»Kalt.«
»Das ist okay«, sagte er, und ich stellte mir seine Augen vor, die in die Dunkelheit hinaufstarrten. »Kälte mag ich.«
3
Bei unserer letzten gemeinsamen Berichterstattung im Herbst 2015 aus Kunduz, wo wir dem amerikanischen Luftangriff auf ein Krankenhaus nachgehen wollten, war Omar nicht bei der Sache. Er hing nächtelang am Telefon. Er fuhr vor dem Provinzrat in Kunduz mit dem Auto rückwärts gegen eine Mauer. Und als ich ihn mit Victor, unserem Fotografen, allein ließ, wurden die beiden für kurze Zeit festgenommen, weil sie mitten in ein Kommandounternehmen hineingestolpert waren. Und im Auto spielte er immer wieder sein aktuelles Lieblingslied, das unheimlich traurige »My Heart Will Go On« aus dem Film Titanic, bis Vic und ich es nicht mehr aushielten. Daraufhin wechselte er zu Kopfhörern.
Kunduz war Kampfgebiet, und wir brauchten unsere Konzentration, doch als wir dann wieder auf dem Rückweg nach Kabul waren, fragte ich Omar, was mit ihm los sei. Seine Mutter habe mit Lailas Vater gesprochen, sagte er, sie habe ihm seinen, Omars, Antrag vorgetragen. Der Vater, ihr Vermieter, habe sie höflich angehört, aber abgelehnt: Seine Tochter sei zu jung. »Sie ist schon neunzehn«, schäumte Omar mir gegenüber. »Das ist nur ein Vorwand. Sie wird viele Bewerber haben.«
Was dies für unseren Plan bedeute, wollte ich wissen, und er sagte: »Keine Ahnung.« Er brauche mehr Zeit; er müsse versuchen, ihren Vater von sich zu überzeugen. »Ich kann nicht von hier weg, bevor ich nicht verlobt bin«, sagte er.
In Kabul setzte mich Omar vor dem Haus ab, in dem ich jetzt wohnte, nachdem ich aus meinem ausgezogen war. Ich holte mir etwas zu trinken und ging hinaus in den Rosengarten. Armer Omar. Er war nicht nur Sunnit, sondern auch pleite. Und er wollte die Tochter eines reichen Schiiten heiraten, denn Liebe kennt keine Logik. So wie jetzt hatte ich ihn nie erlebt. Er hatte im Lauf der Jahre eine ganze Reihe Freundinnen gehabt, was an einem so sittenstrengen Ort wie Kabul nicht ganz einfach ist. Damals, als die Hauptstadt in leicht verdientem Geld schwamm, war er ganz versessen darauf, nur ja nichts anbrennen zu lassen. Aber mit Laila hatte sich etwas verändert. Als ich zum ersten Mal von ihr hörte, hatte ich mir keine Gedanken gemacht. Es muss im Herbst 2012 gewesen sein; kurz nachdem ich in mein jetzt aufgegebenes Haus eingezogen war, hatten wir eine Riesenfete veranstaltet – meine Mitbewohnerin Bette und ich sprachen allerdings von einem Empfang: Das war doch etwas ganz anderes als das typische Kabuler Besäufnis.
In den fetten Jahren von Obamas Afghanistanoffensive war die Blase der Expats von der Botschaftssoirée zur Grillparty im UN-Büro, vom Begrüßungs- zum Abschiedsfest gewandert, und die Partys standen unter Motti wie »Tarts and Taliban«. Dagegen sollte unser Fest eine würdige und stilvolle Angelegenheit sein. Schon am Nachmittag hatten Omar und Turabaz farbige Lichterketten aufgehängt und in die Feuergrube Holz geschichtet. Aus Respekt vor den afghanischen Würdenträgern, die wir eingeladen hatten, waren die Alkoholvorräte außer Sicht in der Küche gebunkert, aber unter dem langen Büffet mit frischem Gemüse vom Basar und blutroten Granatäpfeln, deren Saison jetzt war, hatten wir alkoholfreie Getränke in eisgefüllten Wannen stehen.
Bette war Holländerin und freie Journalistin, die mit Burka durch den Süden reiste und Interviews mit Taliban führte.[15] Für diesen Abend hatten wir gesellschaftliche Ambitionen: Wir wollten beweisen, dass wir eine ebenso interessante Gästeschar anziehen konnten wie die Zeitungsbüros; wir hatten Generäle und Minister eingeladen, afghanische Prominenz und ausländische Diplomaten. Aber ob sie auch kamen? Diverse Sicherheitsteams waren im Vorfeld aufgetaucht, um für die VIPs unser Haus zu inspizieren, und hatten das Fehlen von Schutzräumen und bewaffneten Wächtern moniert – wir hatten lediglich den Hund und, unter meinem Bett versteckt, eine Flinte zu bieten. Kabul wurde zu der Zeit von Selbstmordattentaten und Entführungen heimgesucht, und von den Ausländern im Land durften viele ihr umzäuntes Gelände nicht mehr verlassen. Aber falls genügend hohe Tiere kämen, hätte die Party ihre eigene Wachmannschaft.
In diesem Frühjahr war ich mit drei Leuten hier eingezogen: Bette, Elsbeth, die ebenfalls Holländerin war und bei einer NGO arbeitete, und Mischa, einem russischen Fotografen. Wir hatten ein zweistöckiges Haus mit kleinem Innenhof in Qala-e Fatullah gefunden, so nah an der Grünen Zone, dass die Black Hawks beim Landeanflug über uns hinwegknatterten. Die Miete war günstig, aber es bestand auch Renovierungsbedarf, sodass Mischa und ich wochenlang auf dem nackten Teppich kampierten, während Omar Schreiner und Klempner für uns organisierte und der Maurer unter Erzeugung gewaltiger Staubwolken die neue Arbeitsplatte für die Küche flexte, schwarz-weiß gesprenkelten Marmor aus Herat.
Unsere Party fand am 14. November 2012 statt. Obama war soeben wiedergewählt worden, und wir waren im dritten Jahr seiner Afghanistanoffensive: Zur Spitzenzeit waren einhunderttausend US-Soldaten im Land, dazu eine etwa gleiche Zahl von Ortskräften, die alles machten, von Security bis Klempnerei, und vierzigtausend Soldaten der Bündnispartner, insgesamt doppelt so viele wie seinerzeit unter den Sowjets,[16] und die Führung hatten Amerikas Beste und Klügste, Kriegsstrategen, die 3 Tassen Tee gelesen hatten.
Alles in allem hatte man sich General David Petraeus’ Rat, Geld als Waffe einzusetzen, zu Herzen genommen.[17] Inzwischen hatten die USA eine halbe Billion Dollar in diesen Krieg investiert,[18] und um das Geld aus dem Ausland war eine komplette Ökonomie entstanden, deren unterste Stufe die Einheimischen bildeten, die Gräben aushoben und Lastwagen fuhren. Die nächsthöhere Stufe waren diejenigen, die beim Militär Drittlandangehörige[19] hießen – gemeint waren meist Leute, die in Ländern mit geringem und mittlerem Durchschnittseinkommen rekrutiert wurden, etwa philippinische Buchhalterinnen und nepalesische Wachleute. An der Spitze standen die Expats, die dank ihrer Englischkenntnisse, ihrer westlichen Hochschulabschlüsse und persönlichen Verbindungen mit den großen NGOs, Vertragsunternehmen und UN-Behörden internationale Gehälter einfordern konnten. Sie waren diejenigen, die in gepanzerten SUVs kreuz und quer durch die Stadt fuhren, hauptsächlich männlich, hauptsächlich weiß; manche zogen Konflikte und Katastrophen seit Jahrzehnten hinterher, andere kamen frisch vom College, und alle erfreuten sich steuerfreier Einkommen und sprunghafter Beförderung auf Ranghöhen, wie sie nur Jobs in Kampfzonen bieten können. Während zu Hause in den USA die Leute noch unter der Finanzkrise mit zwölf Millionen Arbeitslosen wankten, gab es hier Jobs, die sechsstellige Gehälter, ein Haus ohne irgendwelche Kosten, Chauffeur, Koch, Gärtner, Torwächter und Hausmädchen umfassten.
Als Freiberufler konnten wir mit diesem Lebensstil nicht mithalten. Als die ersten Gäste auftauchten, postierte ich Turabaz, der nicht lesen konnte, am Tor, wo er so tun musste, als hakte er ihre Namen auf der Liste ab. Das nächtliche Dunkel kam dem urigen Charme unseres Innenhofs, den jetzt Fackeln und weihnachtliche Lichterketten erleuchteten, sehr zugute – zumal nachdem Omar den vorbereiteten Scheiterhaufen angezündet hatte. Die lokalen Musiker, die im Schneidersitz auf den Teppichen saßen, spielten klassische persische Stücke. Bette hielt nahe dem Kebabtisch Hof, wo der ustad über glühender Holzkohle, die er mit einem Schilfrohrfächer anfachte, Fleischspieße briet. Omar trat verstohlen an mich heran und murmelte: »Die Musiker wollen Whisky in normalen Tassen. Nicht in Gläsern.«
Ich blickte hinüber zum rubab-Spieler, einem schnauzbärtigen Galan mit bestickter Weste, der mir zuzwinkerte. »Okay, komm mit.«
Um den Kühlschrank scharte sich eine Menschenmenge, durch die ich mir einen Weg bahnen musste, um Kaffeebecher mit Ballantine’s und Cola zu füllen, die ich Omar in die Hand drückte; dann ging ich weiter zu Turabaz, der immer noch am Tor Wache hielt.
»Wie ist es hier draußen?«
»Sieh selbst.«
Ich streckte den Kopf hinaus. Gepanzerte Autos und Pick-ups reihten sich aneinander, und ich schätzte, dass in unserer Straße die Feuerkraft eines ganzen Infanteriezugs versammelt war: Soldaten in Tiger Stripes, ein Sicherheitstrupp der britischen Armee mit geschmückten Hinterschaftladern, Kandaharis mit Glitzerband um den Gewehrschaft.
Ich ging zurück durch den Innenhof, wo die Flammen das Schattenspiel der versammelten Menge an die Wand warfen. Unter den Gästen sah ich Dr. Abdullah, den ewigen Präsidentschaftszweiten, über Nancy Hatch Dupree gebeugt, die mit fünfundachtzig die Grande Dame der afghanischen Wissenschaft war, und freute mich: Unser Empfang war ein Erfolg.
Als die Würdenträger – zumindest diejenigen, die sich hätten gekränkt fühlen können – fort waren, kamen Alkohol und Hasch zum Vorschein, und Bād durfte von der Leine und sich an heruntergefallenem Kebab satt essen. Die Party würde bis zum ersten Muezzinruf dauern. War dies die Nacht, in der wir alle Gäste zum Schuppen führten, um ihnen den Destillierapparat »Katyuscha« zu zeigen, den Mischa aus Moskau mitgebracht hatte? Oder die Nacht, in der der Leiter einer UN-Behörde seine Brieftasche mitsamt Sicherheitsausweis verlor, während er zu »Call Me Maybe« die Hüften kreisen ließ? Wie auch immer – in der Eingangshalle, wo eine Discokugel farbige Lichter warf, wurde getanzt. Wir drehten die Lautstärke auf und versenkten alles, was jenseits der Hofmauer war, in unseren Gläsern – den eskalierenden Krieg, unser kollektives Versagen und die Tatsache, dass wir nicht hier zu Hause waren und vielleicht gar kein Zuhause hatten, jedenfalls kein gemeinsames.
Und wo war Omar? Als die Musiker und Würdenträger gegangen waren, versorgte ich ihn mit Whisky und Schulterklopfen und verordnete ihm Tanzen, Spaß, Aufreißen. Unsere anderen afghanischen Freunde taten genau das, aber Omar kam aus einer anderen Gesellschaftsschicht. Aus dem Gedränge der Tanzenden sah ich ihn an der Wand lehnen, sein Glas in der Hand, ein unbestimmtes Lächeln im Gesicht.
Omar wohnte zehn Minuten von mir entfernt in einem Haus, das seine Familie gemietet hatte. Verwilderte Feigenbäume beherrschten den Garten, doch selbst im Sommer konnte er durch das Laub das Dach des dreistöckigen Hauses ausmachen, in dem sein Vermieter, ein wohlhabender Geschäftsmann, mit Frau und zwei Kindern lebte. Kurz nachdem Omar eingezogen war – 2009, um die Zeit unserer ersten Begegnung im Mustafa –, stieß er auf der Gasse mit der Tochter seines Vermieters zusammen, einem Mädchen mit blassen, zarten Zügen wie eine Porzellanminiatur. Laila war damals noch jung genug, um keinen Skandal auszulösen, wenn sie in der Öffentlichkeit mit ihm redete; sie fragte, ob er sich in dem neuen Haus wohlfühle. Später, als er mit seiner Mutter dem Nachbarn einen Höflichkeitsbesuch abstattete, kam Laila mit einem Tablett herein und servierte Tee und kandierte Nüsse, und Omar spürte ihren Blick.
Es amüsierte ihn, weiter nichts; er wusste ja, dass er zu alt für sie war. Aber es entging ihm nicht, dass sie ihn von dem Tag an beobachtete, heimlich vom Dach ihres Hauses, wenn er im Garten Krafttraining machte, oder zusammen mit einer Freundin durch eine Seitentür des Hauses, die sich sofort schloss, wenn er draußen vorbeiging. Aber das helle Lachen drang bis zu ihm heraus.
Laila, deren strenger Vater sie nirgendwohin ließ außer in die Schule, sah Omar wegfahren und zurückkommen, immer am Steuer seines goldenen Corolla Baujahr 1996 mit Viergangautomatik, der nach zehn Jahren auf kanadischen Straßen nach Afghanistan verschifft worden war. Mit diesem Auto fuhren wir miteinander kreuz und quer durchs Land, schlängelten uns, einen LKW nach dem anderen überholend, die Serpentinen des Mahipar hinunter, umrundeten die Bombenkrater auf der A01 und holperten über die Feldwege rund um die himmelsblaue Seenkette Band-e Amir. Omar war damals völlig versessen aufs Fahren; maraz-e motarrani nannte er seinen Zustand, »Autofahrerkrankheit«. Wenn er unterwegs war und sich eine Welt der Möglichkeiten vor ihm auftat, fühlte er sich frei. Zum Teil war seine Freiheit eine wirtschaftliche: Selbst wenn seine Kurzzeitjobs bei den Ausländern versiegten, was von Zeit zu Zeit der Fall war, hatte er immer noch die Möglichkeit eines Nebenjobs als Taxifahrer.
In seiner Stadt, Kabul dschan, dem geliebten Kabul, fuhr er am liebsten herum. Landkarten waren eine Sprache, die er nie gelernt hatte, aber er wusste immer ganz genau, wie die Straßen sich zusammenfügen, welche bei Wolkenbrüchen unter Wasser stehen und auf welchen der Verkehr sich staut, wenn in der Innenstadt Bomben explodiert sind. Er kannte Abkürzungen durch die Friedhöfe hinter Karte Parwan und entlang des müllübersäten Flussufers von Pul-e Surkh. Mit der einen Hand hielt er das zerschlissene Vinyl des Steuerrads, mit der anderen eine Pine, und mit dem Kinn deutete er auf das Kassettendeck, das den Soundtrack lieferte, eine Mischung aus Alt und Neu – Enrique-Iglesias-Hits wie »Hero« und Klassiker von Ahmad Zahir, dem afghanischen Elvis, der ein jung gestorbener Zeitgenosse von Omars Eltern gewesen war, aber Texte von viel älteren Dichtern gesungen hatte, etwa dem großen Mystiker Hafez aus Schiraz:
Dies Herz fand ins Leben ohne dich,
Kehrtest du nur endlich zurück zu mir.[20]
Die Sehnsucht nach Wiedervereinigung war ein großes Thema für die Sufi-Dichter. Das Leben an sich war Exil, war Entfremdung von der göttlichen Liebe. Um sie wiederzufinden, durchwanderten sie die Erde.
Der Schmerz der Trennung besänftigt mich auf meinem einsamen Lager,
Die Erinnerung an Vereinigung, meine Gefährtin in diesem leeren Winkel.
Die Geliebte des Mystikers war Gott; ein Gott, dessen Wahrheit das ganze Dasein durchdrang, transzendent und doch der Welt und dem Menschen innewohnend. Menschliche Schönheit konnte göttliche Schönheit spiegeln, unsere Liebe zu einem anderen Menschen die Liebe zu Gott entfachen.[21] Die Sufis waren natürlich Muslime, doch existiert diese Vorstellung von Liebe in zahlreichen Religionen; der jüdische Gelehrte Martin Buber schrieb: Das Du ihrer Augen lässt ihn in einen Strahl des ewigen Du schauen.[22]
In einer von Tradition und Geschlecht gefesselten Gesellschaft sah Omar Liebe als Freiheit. Die Sehnsucht aber versklavte ihn. Als zehnjähriges Flüchtlingskind im Iran hatte ihn ein älteres Mädchen aus der Nachbarschaft durch Bestechung zu körperlichen Spielen verführt; das war seine Initiation. Jetzt brannte ein unstillbarer Durst in ihm; es war Sehnsucht, die ihn unermüdlich durch die Stadt trieb. Wenn am Straßenrand eine hübsche Frau stand, die eine Mitfahrgelegenheit suchte, hielt er an und handelte den Fahrpreis aus. Wenn sie wollte, konnten sie während der ganzen Fahrt plaudern. Omar war ein höflicher, unaufdringlicher Mann, witzig und attraktiv – mit seinem gewellten Haar und dem vollen Kinn sah