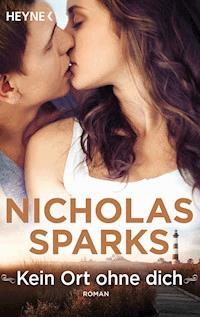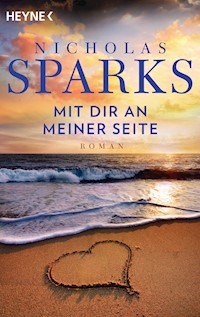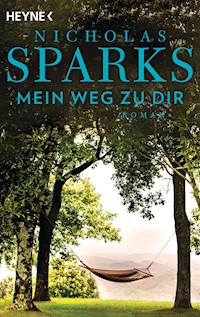3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Wissenschaftsjournalist Jeremy Marsh glaubt nur an Fakten und Beweisbares. Bis er sich hoffnungslos in Lexie verliebt, die Enkelin einer Hellseherin. Um Lexie zu gewinnen, muss er zum ersten Mal in seinem Leben blind seinem Herzen folgen.
Eine ergreifende Geschichte über die Macht der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Jeremy Marsh steht als Wissenschaftsjournalist kurz vor dem großen Durchbruch: Er hat sich auf die Entlarvung angeblich übernatürlicher Phänomene spezialisiert und gerade erst einen Hellseher vor laufender Kamera bloßgestellt. Nun lockt ihn ein neuer Fall nach Boone Creek, North Carolina, wo er herausfinden soll, was hinter den geisterhaften Lichterscheinungen auf dem Friedhof steckt. Entgegen all seiner wohlgeordneten Pläne verliebt er sich jedoch gleich Hals über Kopf in Lexie, die ausgerechnet die Enkelin einer Hellseherin ist.
Lexies Verhalten verstärkt seinen Gefühlstumult nur noch. Sie scheint durchaus etwas für Jeremy zu empfinden, doch dann begegnet sie ihm wieder schroff und abweisend. Was Jeremy nicht weiß: Eine tiefe Verletzung aus der Vergangenheit lässt sie die Liebe mit aller Kraft bekämpfen. Und so bleibt Jeremy nur eines: Um Lexie zu gewinnen, muss er über den eigenen Schatten springen und seine ganze bisherige Lebensplanung umkrempeln. Nur wenn er seinen Verstand ganz den Gefühlen unterordnet, ist er bereit für das wahre Wunder der Liebe.
Der Autor
Nicholas Sparks, 1965 in Nebraska geboren, lebt mit seiner Frau und den fünf Kindern in North Carolina. Mit seinen gefühlvollen Romanen, die ausnahmslos die Bestsellerlisten eroberten und weltweit in 46 Ländern erscheinen, gilt Sparks als einer der meistgelesenen Autoren der Welt. Mehrere seiner Bestseller wurden erfolgreich verfilmt. Alle seine Bücher sind bei Heyne erschienen: Wie ein einziger Tag, Das Schweigen des Glücks, Weg der Träume, Weit wie das Meer, Du bist nie allein, Ein Tag wie ein Leben, Zeit im Wind, Das Lächeln der Sterne, Nah und fern, Die Suche nach dem verborgenen Glück.
Inhaltsverzeichnis
Für Rhett und Valerie Little,wundervolle Menschen,wundervolle Freunde
KAPITEL 1
Jeremy Marsh hatte das Gefühl, dass alle im Fernsehstudio ihn anstarrten. Er saß mitten im Publikum der Liveshow, und an diesem Nachmittag im Dezember waren außer ihm noch höchstens fünf, sechs Männer unter den Zuschauern. Sonst nur Frauen. Wie gewöhnlich trug er Schwarz und sah überhaupt aus wie ein typischer New Yorker – was er ja auch war: dunkle, wellige Haare, hellblaue Augen, lässiger Dreitagebart. Während er den Showgast auf dem Podium beobachtete, warf er hin und wieder verstohlene Blicke auf die attraktive blonde Frau drei Reihen hinter ihm. Sein Beruf hatte ihn gelehrt, ständig auf mehrere Dinge gleichzeitig zu achten. Er arbeitete als investigativer Journalist und war wie immer auf der Jagd nach einer guten Story. Die Blondine schien zwar ohne besonderen Anlass hierher gekommen zu sein, doch der professionelle Beobachter in ihm registrierte sofort, dass sie in ihrem ärmellosen Top und den Jeans extrem anziehend wirkte. Rein journalistisch betrachtet, versteht sich.
Aber er durfte sich nicht ablenken lassen, im Gegenteil, er musste sich ganz auf den Studiogast konzentrieren. Der Typ war im Grund eine Lachnummer! Im Scheinwerferlicht sah dieser Geisterführer aus, als litte er an fürchterlichen Blähungen. Dabei behauptete er, Stimmen aus dem Jenseits zu vernehmen. Geschickt verbreitete er eine Aura der Intimität, indem er seinen Zuhörern vorgaukelte, er wolle sich mit ihnen verbrüdern. Dem Publikum gefiel das offenbar; voller Andacht bestaunten ihn alle wie ein Geschenk das Himmels – die Blondine bildete da keine Ausnahme. Erst recht nicht die Frau, auf die der Herr gerade einredete. Irgendwie konnte man die Leute auch verstehen, fand Jeremy, denn schließlich schien er den Ort zu kennen, an dem sich die geliebten Menschen aufhielten, von denen sie hatten Abschied nehmen müssen. Die Seelen im Jenseits waren nach den Worten dieser Geisterführer immer von strahlendem Himmelslicht umflutet und verströmten Frieden und Ruhe. Noch nie hatte Jeremy von einem gehört, der zu jenem anderen Ort, wo das Feuer loderte, Kontakt aufnahm. Kein einziger der Verstorbenen berichtete je, er werde an einem Pfahl geröstet oder müsse in einem Bottich mit siedendem Motoröl schmoren. Das könnte doch auch sein, oder? Jeremy wusste, dass er ein hoffnungsloser Zyniker war. Eins musste er allerdings zugeben: Die Show war nicht übel. Timothy Clausen machte seine Sache ausgezeichnet – wesentlich besser als die meisten anderen Scharlatane, über die Jeremy im Laufe der Jahre geschrieben hatte.
»Ich weiß, es ist nicht leicht«, flötete Clausen ins Mikrofon, »aber Frank teilt Ihnen mit, dass Sie ihn jetzt gehen lassen müssen.«
Die Frau, die er mit so viel Einfühlungsvermögen behandelte, sah aus, als wollte sie gleich in Ohnmacht fallen. Sie war um die fünfzig, trug eine grün gestreifte Bluse, und ihre rote Dauerwelle stand in alle Richtungen ab. Die Hände hielt sie so verkrampft über der Brust gefaltet, dass die Knöchel schon ganz weiß wurden.
Clausen schwieg und legte die Hand an die Stirn, um noch einmal mit dem »Jenseits«, wie er es formulierte, zu kommunizieren. In stummer Erwartung beugten sich die Zuschauer vor. Alle wussten, was als Nächstes kommen würde. Die Frau war schon die dritte Zuschauerin, die Clausen in dieser Sendung ausgewählt hatte. Da er heute als einziger Gast auftrat, konnte er über die Zeit frei verfügen.
»Erinnern Sie sich an den Brief, den er Ihnen geschrieben hat?«, fragte Clausen. »Kurz vor seinem Tod?«
Die Frau schnappte nach Luft. Der Mann vom Technikteam hielt ihr das Mikro noch dichter vor die Nase, damit die ganze Fernsehwelt sie japsen hören konnte.
»Ja, natürlich, aber woher …«, stammelte sie.
Clausen unterbrach sie. »Wissen Sie noch, was in dem Brief stand?«
»Ja«, krächzte sie.
Clausen nickte wissend, als hätte er den Brief gelesen. »Es ging um Vergebung, nicht wahr?«
Die Gastgeberin der Talkshow, der beliebtesten Nachmittagssendung in den ganzen Vereinigten Staaten, saß auf einem Sofa und ließ ihren Blick von Clausen zu der Frau wandern und wieder zurück. Ihre Miene drückte leises Staunen und große Zufriedenheit aus. Geisterführer waren Balsam für die Quote.
Die Frau auf dem Podium nickte. Schon begann ihre Wimperntusche zu laufen. Die Kamera zoomte auf ihr Gesicht. So etwas brauchte man in Großaufnahme! Tagesfernsehen vom Feinsten.
»Aber woher …?«, wiederholte die Frau.
»Er hat auch von Ihrer Schwester gesprochen«, murmelte Clausen feierlich. »Nicht nur von sich selbst.«
Sie starrte Clausen fassungslos an.
»Von Ihrer Schwester Ellen«, fügte er hinzu.
Die Frau stieß einen spitzen Schrei aus. Inzwischen kullerten ihr die Tränen nur so über die Wangen, als hätte jemand eine automatische Sprinkleranlage angestellt. Clausen – braun gebrannt und schlank, schwarzer Anzug und eine makellose Frisur, bei der kein Härchen aus der Reihe tanzte – nickte immer noch, wie einer dieser Wackelhunde, die man sich aufs Armaturenbrett stellt. Im Publikum war es totenstill. Alle starrten wie gebannt auf die arme Frau.
»Frank hat noch etwas für Sie hinterlassen, stimmt’s? Etwas aus Ihrer gemeinsamen Vergangenheit.«
Trotz der heißen Studioscheinwerfer erblasste das Opfer. In einer Ecke der Kulissen, in die nicht alle Zuschauer Einblick hatten, sah Jeremy den Produzenten, der mit erhobenem Zeigefinger eine Hubschrauberdrehung vollführte. Gleich würde die Werbepause beginnen. Clausen spähte unauffällig in seine Richtung. Niemand außer Jeremy schien diesen Austausch zu bemerken. Er staunte oft darüber, dass sich die Zuschauer nie fragten, weshalb diese Geisterkontakte so exakt zwischen die Werbeblöcke passten.
Unbeirrt fuhr Clausen fort: »Einen Gegenstand, von dem niemand etwas wissen konnte, außer Ihnen beiden. Eine Art Schlüssel. Stimmt das?«
Schluchzend nickte die Frau.
»Sie hätten nicht gedacht, dass er ihn aufbewahrt hat, oder?«
Okay, jetzt sind wir am entscheidenden Punkt, dachte Jeremy. Gleich hat er eine neue gläubige Anhängerin gewonnen.
»Der Schlüssel stammte aus dem Hotel, in dem Sie während der Hochzeitsreise gewohnt haben. Frank hat ihn hingelegt, damit Sie sich, wenn Sie ihn finden, an das Glück an seiner Seite erinnern. Er will nicht, dass Sie nur an sein Leiden denken und sich quälen, denn er liebt Sie.«
»Oooohhhh …« Die Frau konnte sich nicht mehr beherrschen und schluchzte hemmungslos.
Oder stöhnte sie nur? Von seinem Platz aus konnte Jeremy das nicht richtig beurteilen, weil ihr Gejammer plötzlich von enthusiastischem Beifall unterbrochen wurde. Das Mikro verschwand, die Kamera zoomte weg. Ihre fünfzehn Minuten im Scheinwerferlicht waren zu Ende. Sie ließ sich in ihren Stuhl zurückfallen. Wie auf Kommando erhob sich die Showmasterin von ihrem Sofa und sprach in die Kamera.
»Vergessen Sie nicht – alles, was Sie hier sehen, ist authentisch. Von den Besuchern hier hat kein einziger Timothy Clausen je vorher gesehen.« Sie lächelte. »Wir machen jetzt eine kurze Pause, danach erleben Sie eine weitere Begegnung.«
Wieder brandete Beifall auf, und die Sendung wurde unterbrochen. Jeremy lehnte sich entspannt zurück.
Sein Spezialgebiet waren die Naturwissenschaften. Dafür war er bekannt – er hatte sich als investigativer Journalist einen Namen gemacht, nicht zuletzt durch Artikel über Leute wie Clausen. Meistens machte ihm die Arbeit Spaß, und er war stolz, weil er darin einen wichtigen Dienst an der Öffentlichkeit sah. Der Beruf des Journalisten war immerhin so wichtig, dass seine Ausübung indirekt im First Amendment der amerikanischen Verfassung verbrieft war: Die Freiheit der Meinungsäußerung war ein hohes Gut. Für seine regelmäßig erscheinende Kolumne im Scientific American hatte er schon Nobelpreisträger interviewt, er hatte die Theorien von Stephen Hawking und Einstein für Laien erklärt und den Anstoß dafür gegeben, dass ein gefährliches Antidepressivum vom Markt genommen wurde. Er hatte ausführlich über das Cassini-Projekt, die Mission zum Saturn, geschrieben, über den fehlerhaften Hauptspiegel im Hubble-Weltraumteleskop und den Einbau des Linsenkorrektors, und er war der Erste gewesen, der öffentlich das Experiment einer kalten Fusion in Utah als Betrug entlarvte.
Bedauerlicherweise verdiente er mit dieser Kolumne nicht besonders viel Geld, trotz des Renommees. Für die laufenden Lebenshaltungskosten arbeitete er hauptsächlich als freier Journalist, und wie alle Freischaffenden hielt er stets Ausschau nach Themen, die den Redakteuren bei den großen Zeitschriften und Zeitungen gefallen könnten. Er hatte seine Spezialnische ausgebaut und alles integriert, was in die Kategorie »irgendwie ungewöhnlich« fiel. Während der vergangenen fünfzehn Jahre hatte er sich vorrangig mit Hellsehern, Geisterführern, Glaubensheilern und spirituellen Medien beschäftigt. Er hatte Betrügereien, Tricks und Fälschungen aufgedeckt. Er hatte Spukhäuser besucht, nach mystischen Wesen gefahndet und war den Ursprüngen urbaner Legenden nachgegangen. Von Natur aus war er eher skeptisch veranlagt und besaß außerdem die seltene Gabe, komplexe naturwissenschaftliche Zusammenhänge so einfach und verständlich zu erklären, dass auch durchschnittliche Leser sie nachvollziehen konnten. Deshalb waren seine Artikel in hunderten von Zeitungen und Zeitschriften überall auf der Welt abgedruckt worden. Wissenschaftliche Aufklärung war seiner Meinung nach extrem wichtig, selbst wenn die Allgemeinheit sie nicht immer entsprechend zu würdigen wusste. Oft waren die Briefe, die er als Reaktionen auf seine Veröffentlichungen erhielt, mit absurden Beschimpfungen gespickt, er war schon als »Idiot«, »Schwachkopf« und »Regierungsdepp« bezeichnet worden, wobei ihn persönlich der letzte Ausdruck am meisten belustigte.
Investigativer Journalismus war ein undankbares Geschäft. Daran gab es leider nichts zu rütteln.
Während er solchen Gedanken nachhing, spekulierten die anderen Anwesenden lebhaft darüber, wer wohl als Nächster drankommen würde. Jeremy schaute wieder kurz zu der Blondine, die gerade in einem Handspiegel ihre geschminkten Lippen überprüfte.
Es stimmte tatsächlich, dass die Personen, die von Clausen ausgewählt wurden, nicht Teil der Show waren, sie waren nicht vorher eingeweiht worden, obwohl sein Auftritt überall angekündigt wurde und die Leute sich um die Eintrittskarten regelrecht prügelten. Daraus konnte man schließen, dass die meisten Anwesenden ohnehin an ein Leben nach dem Tod glaubten. Für sie war Clausen absolut überzeugend. Dieser Mann konnte doch keine Mogelpackung sein! Wie würde er sonst derart persönliche Fakten über Menschen wissen, die er gar nicht kannte – dafür musste er doch mit den Geistern der Verstorbenen sprechen, das ging gar nicht anders! Doch wie bei jedem guten Zauberer, der sein Metier perfekt beherrscht, war und blieb auch bei ihm eine Illusion nichts als eine Illusion, und kurz vor der Show hatte Jeremy nicht nur herausgefunden, wie er vorging, sondern besaß sogar fotografische Beweise dafür.
Sollte es ihm gelingen, Clausen zu entlarven, wäre das sein bisher größter Coup. Der Typ hatte es verdient, dass man ihn ins Visier nahm. Er gehörte zur schlimmsten Sorte Betrüger. Jeremy wusste, dass er einen Fisch an der Angel hatte, wie man ihn nicht jeden Tag fing, deshalb wollte er möglichst viel aus der Sache herausholen. Clausen stand auf dem Gipfel seines Ruhms, und Berühmtheit zählte in den USA mehr als alles Übrige.
Es war zwar eher unwahrscheinlich, doch Jeremy malte sich aus, wie es wäre, wenn Clausen ihn als Nächsten drannehmen würde. Damit rechnen konnte er nicht, es war fast wie ein Lotteriegewinn. Aber selbst wenn er nicht an die Reihe kam, hatte er trotzdem erstklassiges Material. Andererseits wusste er, dass es oft eine Kleinigkeit war, die darüber entschied, ob ein Artikel nur gut oder wirklich gut war. Ein echter Volltreffer brauchte das sprichwörtliche Sahnehäubchen.
Als die Werbepause zu Ende ging, klammerte er sich deshalb an die kleine, unbegründete Hoffnung, Clausen könnte sich tatsächlich auf ihn stürzen.
Anscheinend war der liebe Gott auf seiner Seite. Hatte er vielleicht auch etwas gegen Clausens Machenschaften einzuwenden? Jedenfalls trat genau das ein, was Jeremy sich ersehnt hatte: Er wurde ausgewählt.
Drei Wochen später. Der Winter hatte Manhattan erbarmungslos im Griff. Eine Kaltfront aus Kanada war bis nach New York vorgedrungen, die Temperaturen lagen bei minus zwanzig Grad Celsius. Aus den Gullyschächten stiegen kleine Dampfwolken auf und sorgten für vereiste Gehwege. Nicht, dass dies die New Yorker besonders gestört hätte. Sie waren hart ihm Nehmen und ließen sich vom Wetter nicht einschüchtern. Einen Freitagabend wegen eines Kälteeinbruchs ungenutzt verstreichen zu lassen schien völlig undenkbar. Man arbeitete die ganze Woche über wie verrückt, deshalb wollte man das Wochenende genießen. Erst recht, wenn es einen Anlass zum Feiern gab! Und einen Anlass hatten Nate Johnson und Alvin Bernstein tatsächlich. Seit einer Stunde feierten sie ausgelassen mit ein paar Dutzend Freunden und Journalisten – unter ihnen mehrere Mitarbeiter des Scientific American. Man hatte sich zu Jeremys Ehren versammelt und amüsierte sich blendend, nicht zuletzt, weil Nate die Zeche übernehmen würde und Journalisten in der Regel sehr aufs Geld achten müssen.
Nate Johnson war Jeremys Agent. Alvin Bernstein arbeitete als freier Kameramann und war Jeremys bester Freund. Man hatte sich in dieser angesagten Bar in der Upper West Side getroffen, um auf Jeremys Auftritt in der Fernsehsendung Primetime Live anzustoßen. Die Werbung für Primetime Live hatte sich diese Woche fast ausschließlich auf Jeremy konzentriert und eine größere Skandalenthüllung angekündigt. Aus dem ganzen Land waren in Nates Büro Interview-Anfragen eingetroffen. Noch am frühen Nachmittag hatte die Redaktion vom People Magazine angerufen und einen Termin für kommenden Montag vereinbart.
Um einen privaten Raum zu organisieren, hatte die Zeit nicht mehr gereicht, doch der Stimmung tat das keinen Abbruch. Mit seinem langen Tresen aus Granit und der dramatischen, effektvollen Beleuchtung war dieses Lokal ein typischer Yuppie-Treffpunkt. Während die Journalisten vom Scientific American größtenteils Sportsakkos aus Tweed trugen und sich in eine Ecke verzogen, um über Photonen zu debattieren, hatte man bei den anderen Gästen den Eindruck, als kämen sie direkt von ihrem Job in der Wall Street oder in der Madison Avenue: italienische Anzüge, die Jacketts lässig über die Stuhllehne gehängt, Krawatten von Hermès, locker gebunden – Männer, die nichts anderes im Sinn zu haben schienen, als die anwesenden Frauen zu begutachten und ihre Rolex-Uhren blitzen zu lassen. Die Frauen, die von ihren Jobs im Verlagswesen oder in der Werbebranche hierher geeilt waren, trugen Designerröcke und unglaublich hochhackige Schuhe, nippten an ihren Martinis und taten so, als würden sie die Männerblicke gar nicht bemerken. Jeremy hatte ein Auge auf eine hochgewachsene Frau mit roten Haaren geworfen, die dauernd in seine Richtung schaute. Ob sie ihn wohl von der Fernsehwerbung her kannte? Oder suchte sie nur Gesellschaft? Zwischendurch wandte sie sich ab, als hätte sie kein Interesse, doch dann fixierte sie ihn wieder. Jeremy hob sein Glas.
»Mensch, Jeremy – hier spielt die Musik!«, ermahnte Nate ihn mit einem freundschaftlichen Rippenstoß. »Du kommst im Fernsehen! Willst du nicht sehen, wie du dich machst?«
Fast widerstrebend überließ Jeremy die Rothaarige ihrem Schicksal und schaute zum Bildschirm. Ja, da saß er, gegenüber von Diane Sawyer. Wie komisch, dachte er, das ist fast so, als könnte ich an zwei Orten gleichzeitig sein — hier in der Bar und auf der Mattscheibe. Irgendwie erschien es ihm unwirklich, aber in den vergangenen drei Wochen war ihm vieles surreal vorgekommen, obwohl er sich doch seit etlichen Jahren in der Medienwelt bewegte.
Diane beschrieb ihn als »Amerikas angesehensten Wissenschaftsjournalisten«. Die Geschichte mit Clausen hatte nicht nur all seine Erwartungen übertroffen – es war sogar so, dass Primetime Live schon mit Nate darüber verhandelt hatte, ob Jeremy vielleicht regelmäßig für sie berichten könnte. Und ob sie ihn denn auch für Beiträge in Good Morning America einplanen dürften? Viele Journalisten hielten das Fernsehen für weniger wichtig als andere, seriösere Formen der Berichterstattung, aber das hinderte sie in der Regel nicht daran, dieses Medium trotzdem insgeheim als den heiligen Gral zu betrachten. Das hieß zuerst und vor allem: als eine fantastische Geldquelle. Trotz aller Glückwünsche waren also manche innerlich grün vor Neid, so viel war sicher. Beneidet zu werden war für Jeremy so ungewohnt und abwegig wie eine Reise zum Mars. Journalisten seines Schlags rangierten schließlich in der Hackordnung nicht besonders weit oben. Und das hatte auch für ihn gegolten – bis heute.
»Hat sie tatsächlich gerade gesagt ›Amerikas angesehenster Wissenschaftsjournalist‹?«, fragte Alvin. »Du schreibst über den Bigfoot und über die Legende von Atlantis!«
»Pssst!«, zischte Nate, der wie gebannt auf den Bildschirm starrte. »Ich will zuhören! Das kann für Jeremys Karriere entscheidend sein!« Als Jeremys Agent suchte Nate permanent nach »Möglichkeiten, die Jeremys Karriere voranbringen« konnten. Vor vielen Jahren, als Nate gerade als Agent einstieg, hatte Jeremy ihm ein Exposé für ein Buch geschickt; seither arbeiteten die beiden zusammen und waren Freunde geworden.
»Ist schon gut.« Alvin war es gewohnt, dass Nate ihn anblaffte.
Jetzt war auf einem Bildschirm, der hinter Diane Sawyer und Jeremy aufgebaut war, ein Ausschnitt von Jeremys Auftritt in der Talkshow zu sehen. Jeremy hatte so getan, als trauerte er um seinen Bruder, der als Kind gestorben war, und Clausen hatte versichert, er werde mit der Seele dieses Bruders in Kontakt treten.
»Er ist bei mir«, hörte man Clausens Stimme. »Er möchte, dass Sie ihn gehen lassen, Thad.« Die Kamera schwenkte auf Jeremys Leidensmiene. Clausen nickte im Hintergrund, und man konnte nicht sagen, ob er Mitleid demonstrieren wollte oder ob er nicht doch an Blähungen litt. Es kam auf die Perspektive an.
»Ihre Mutter wollte, dass das Zimmer, das Sie mit Ihrem Bruder geteilt haben, so blieb wie vor seinem Tod. Man durfte nichts verändern. Und Ihre Mutter hat Sie gezwungen, nach wie vor dort zu schlafen«, fuhr Clausen fort.
»Ja, das stimmt«, flüsterte Jeremy tonlos.
»Aber Sie hatten Angst, und aus lauter Frustration haben Sie etwas genommen, was Ihrem Bruder gehörte, etwas sehr Persönliches, und Sie haben es im Garten vergraben.«
»Ja«, hauchte Jeremy nur, als brächte er kein weiteres Wort über die Lippen.
»Seine Zahnspange!«
»Ooooohhhh«, heulte Jeremy los und schlug die Hände vors Gesicht.
»Ihr Bruder liebt Sie, und Sie müssen wissen, dass er seinen Frieden gefunden hat. Er hegt keine negativen Gefühle Ihnen gegenüber …«
»Ooooohhh!«, jammerte Jeremy mit schmerzverzerrtem Gesicht.
Nate verfolgte die Szene stumm und hochkonzentriert. Alvin hingegen lachte sich halb kaputt. Grinsend hob er sein Bierglas.
»Verleiht diesem Mann einen Oscar!«, rief er.
»Das war bühnenreif, was?«, sagte Jeremy und lachte ebenfalls.
»Ich mein’s ernst, ihr zwei«, knurrte Nate. »Unterhaltet euch gefälligst erst während der Werbung.«
»Ist schon gut«, sagte Alvin wieder. »Ist schon gut« war von jeher seine Lieblingsredensart.
Die Szene aus der Talkshow war nun zu Ende, und man sah wieder Diane Sawyer und Jeremy sich gegenübersitzen.
»Das heißt, nichts von dem, was Timothy Clausen sagte, hat gestimmt?«, fragte Diane.
»Kein einziges Wort«, antwortete Jeremy. »Sie wissen ja – ich heiße nicht Thad, und ich habe zwar fünf Brüder, aber die sind alle gesund und munter.«
Diane hielt Block und Stift in der Hand, als wollte sie sich Notizen machen. »Also – wie geht Clausen vor?«
»Wissen Sie, Diane …«, begann Jeremy.
Alvin zog die gepiercte Augenbraue hoch und beugte sich zu Jeremy. »Hast du ›Diane‹ zu ihr gesagt? Kennt ihr euch etwa näher?«
»Hört doch auf!« Langsam wurde Nate richtig sauer.
Auf dem Bildschirm redete Jeremy währenddessen weiter. »Clausen wendet einfach eine Technik an, die wir Menschen in verschiedenen Spielarten seit hunderten von Jahren praktizieren. Erstens kann er seinem Gegenüber viel vom Gesicht ablesen, zweitens ist er ein Meister der vagen, emotional vielsagenden Bemerkungen, und er reagiert auf minimale Hinweise.«
»Ja, aber seine Aussagen sind so spezifisch, so genau! Nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei den anderen Gästen. Er nennt ja sogar Namen! Wie schafft er das?«
Jeremy zuckte die Achseln. »Er hat zum Beispiel gehört, wie ich vor der Sendung über meinen Bruder Markus geredet habe. Ich hatte mir eine Geschichte ausgedacht und sie laut hinausposaunt.«
»Aber wie hat Clausen diese Geschichte mitbekommen?«
»Betrüger wie Clausen beherrschen alle möglichen Tricks. Sie stellen zum Beispiel heimlich Mikrofone auf, und sie haben bezahlte ›Zuhörer‹, die sich im Warteraum unters Publikum mischen – vor der Sendung. Ehe ich mich hinsetzte, habe ich mit verschiedenen Leuten ein Gespräch angefangen und darauf geachtet, ob sie auffallend großes Interesse zeigen. Und tatsächlich war ein Mann dabei, den mein Fall unglaublich zu faszinieren schien.«
Hinter ihnen erschien jetzt statt der Videoaufnahme ein vergrößertes Foto, das Jeremy mit einer Minikamera aufgenommen hatte. Diese Kamera war in seiner Uhr verborgen: ein Hightech-Spielzeug für Amateurspione, das er selbstverständlich dem Scientific American auf die Rechnung gesetzt hatte. Jeremy liebte solche kleinen Wundergeräte, vor allem, wenn er die Kosten anderen aufs Auge drücken konnte.
»Was sehen wir hier?«, fragte Diane.
Jeremy erklärte: »Der Mann auf dem Foto mischte sich unauffällig unters Studiopublikum und gab sich als Besucher aus Peoria aus. Diese Aufnahme habe ich direkt vor der Sendung gemacht, während wir uns unterhielten. Gehen wir doch mal ein bisschen näher ran.«
Die Kamera zeigte jetzt Gesicht und Oberkörper, und Jeremy deutete auf das Jackett.
»Sehen Sie die kleine USA-Anstecknadel an seinem Revers? Das ist kein harmloses Schmuckstück, sondern ein Minisender, der mit dem Backstage-Bereich verbunden ist.«
Diane runzelte ungläubig die Stirn. »Woher wollen Sie das wissen?«
»Weil ich selbst so ein Ding besitze.«
Er fasste in seine Jacketttasche und beförderte eine identische Anstecknadel hervor, die mit einem langen, fadendünnen Draht und einem Sendegerät verbunden war.
»Dieses spezielle Spielzeug wird in Israel hergestellt« – jetzt war nur Jeremys Stimme zu hören, die Kamera zeigte das »Spielzeug« in Großaufnahme –, »und es ist wirklich erste Sahne. Ich habe gehört, dass unter anderem auch die CIA damit arbeitet, aber das kann ich natürlich nicht beweisen. Was ich Ihnen allerdings mit Sicherheit sagen kann, ist, dass diese Technologie auf dem neuesten Stand ist – das winzige Mikro kann in einem Raum mit vielen Personen Gespräche aufnehmen und sie mit dem entsprechenden Filtersystem voneinander trennen.«
Diane studierte die Nadel fasziniert. »Und Sie sind sich ganz sicher, dass es tatsächlich ein Mikrofon war und keine Anstecknadel?«
»Na ja, Sie wissen, dass ich mich schon lange und sehr intensiv mit Clausens Vergangenheit beschäftige. Und eine Woche nach der Show ist es mir gelungen, noch ein paar zusätzliche Fotos zu schießen.«
Auf der Leinwand erschien ein neues Bild. Es war zwar etwas grobkörnig, doch man konnte immerhin erkennen, dass es derselbe Mann wie zuvor war.
»Diese Aufnahme wurde in Florida gemacht, vor Clausens Büro. Wie Sie sehen, will dieser Herr gerade das Gebäude betreten. Er heißt Rex Moore und ist einer von Clausens Angestellten. Seit zwei Jahren arbeitet er für ihn.«
»Oooohhhh!«, rief Alvin, und der Rest der Sendung, die sowieso fast zu Ende war, ging in allgemeinem Beifallsgetöse unter. Alle stimmten ein, ob neidisch oder nicht. Dass keiner für die Getränke bezahlen musste, war nicht ohne Wirkung geblieben, und Jeremy wurde mit Glückwünschen überschüttet.
»Du warst sagenhaft!«, lobte ihn sein Agent. Nate war dreiundvierzig, klein und bekam schon eine Glatze. Meistens trug er Anzüge, die um die Taille herum etwas spannten. Aber er war ein absolutes Energiebündel und wie alle Agenten ein unverbesserlicher Optimist.
»Vielen Dank«, murmelte Jeremy und leerte sein Bierglas.
»Das ist ein Meilenstein in deiner Karriere«, fuhr Nate fort. »Damit stehen dir Tor und Tür offen, und du kannst regelmäßig fürs Fernsehen arbeiten. Ich glaube, du brauchst dich von jetzt an nicht mehr um irgendwelche Zeitschriftenartikel zu bemühen oder hinter UFO-Geschichten herzurennen. Ich hab’s ja schon immer gesagt: Mit deinem Aussehen musst du auf den Bildschirm.«
»Stimmt, das sagst du schon immer.« Jeremy verdrehte die Augen, als käme ihm der Spruch zu den Ohren heraus.
»Und ich habe Recht behalten. Die Produzenten von Primetime Live und Good Morning America rufen mich ständig an. Sie wollen, dass du in ihren Sendungen auftrittst und irgendwas erzählst, so nach dem Motto ›Was bedeuten die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse für unsere Zuschauer?‹. Für einen Reporter ist das eine irre Chance, ein Riesenschritt nach vorn.«
»Ich bin Journalist, nicht Reporter«, entgegnete Jeremy leicht verärgert.
»Ist schon gut.« Nate machte eine wegwerfende Handbewegung, als wollte er eine lästige Fliege vertreiben. »Wie gesagt – mit deinem Aussehen bist du wie geschaffen fürs Fernsehen.«
»Ich finde, Nate hat Recht«, meldete sich jetzt Alvin zu Wort und zwinkerte Jeremy zu. »Wie wäre es sonst zu erklären, dass du bei den Frauen besser ankommst als ich, obwohl du null Persönlichkeit hast?« Jahrelang waren Alvin und Jeremy gemeinsam durch die Bars gezogen, immer auf der Suche nach neuen Bekanntschaften.
Jeremy lachte. Alvin Bernstein sah nicht aus wie ein typischer Alvin Bernstein – bei seinem Namen stellte man sich einen biederen Steuerberater mit Brille vor, einen braven Büromenschen mit Schuhen von Florsheim und mit einer Aktentasche unterm Arm. Als Teenager hatte Alvin Eddie Murphy in seinem roten Lederanzug in Delirious gesehen und sich daraufhin für den Leder-Look entschieden. Seinen Vater Melvin, der seinerseits mit Vorliebe Florsheim-Schuhe trug und immer eine Aktentasche bei sich hatte, versetzte dieser Kleidungsstil in helles Entsetzen. Zum Glück passte das Leder gut zu Alvins Tattoos. Alvin fand nämlich, dass Tätowierungen sein höchst individuelles ästhetisches Empfinden widerspiegelten, und war auf beiden Armen, bis hinauf zu den Schulterblättern, sehr eigenwillig verschönert. Als stilvolle Ergänzung kamen noch die mehrfach gepiercten Ohrläppchen dazu.
»Hast du immer noch vor, in die Südstaaten zu fahren und diese Geistergeschichte zu recherchieren?«, wollte Nate jetzt wissen. Jeremy konnte richtig vor sich sehen, wie sich die Rädchen in seinem Gehirn unermüdlich drehten. »Nach dem Interview mit People, versteht sich.«
Jeremy strich sich die dunklen Haare aus der Stirn und gab dem Barkeeper zu verstehen, dass er gern noch ein Bier hätte. »Ja, ich denke schon. Primetime hin oder her – ich muss immer noch meine Rechnungen bezahlen. Das Thema würde sich gut für die Kolumne eignen, finde ich.«
»Aber du meldest dich regelmäßig, wenn du weg bist, versprochen? Nicht wie damals, als du undercover bei den ›Rechtgläubigen‹ warst.« Er spielte auf einen Sechstausend-Worte-Text an, den Jeremy für Vanity Fair über einen religiösen Kult geschrieben hatte. Damals hatte er drei Monate lang praktisch jeden Kontakt abgeschnitten.
»Ja, klar melde ich mich«, beruhigte Jeremy ihn. »Die Story ist ja ein ganz anderes Kaliber. Ich nehme an, in einer knappen Woche bin ich damit fertig. ›Geheimnisvolle Lichter auf dem Friedhof‹. Keine große Sache.«
»Hey – du brauchst nicht zufällig einen Kameramann? «, mischte sich Alvin ein.
Jeremy musterte ihn fragend. »Wieso? Hättest du Lust?«
»Ob ich Lust hätte? Dumme Frage! Im Winter in den Süden fahren, vielleicht eine ›Southern Belle‹ kennen lernen, während du sämtliche Spesen übernimmst? Das wär doch was. Ich hab nämlich gehört, die Southern Belles, die Frauen in den Südstaaten, können einen völlig verrückt machen – im posititiven Sinn, natürlich. Wär doch mal ein exotischer Urlaub.«
»Musst du nächste Woche nicht für Law & Order arbeiten?«
Trotz seines eigenwilligen Äußeren genoss Alvin einen erstklassigen Ruf als Kameramann und war meistens ausgebucht.
»Ja, aber damit ist Ende der Woche Schluss«, erklärte er. »Und falls du tatsächlich eine Fernsehkarriere ins Auge fasst – wir wissen ja alle, dass Nate das unbedingt will –, dann schadet es garantiert nichts, wenn du gutes Bildmaterial über diese geheimnisvollen Lichter anbieten kannst.«
»Vorausgesetzt, es gibt überhaupt Lichter, die man filmen kann.«
»Du könntest ja schon mal die Lage sondieren und mir dann Bescheid geben. Ich halte jedenfalls den Termin frei.«
»Aber selbst wenn es die Lichter gibt, wird es trotzdem nur ’ne kleine Story«, warnte Jeremy ihn. »Beim Fernsehen interessiert sich dafür bestimmt kein Mensch.«
»Wenn du das letzten Monat gesagt hättest – dann sicher nicht«, sagte Alvin. »Aber nach der Sendung heute Abend werden sie sich die Finger danach lecken. Du weißt doch, wie das läuft in den Medien – die Produzenten rennen nur hinter dem nächsten großen Ding her. Wenn Good Morning America plötzlich auf etwas scharf ist, dann kommt gleich die Today Show hinterher getrottet, und als Nächstes klopft Dateline an die Tür. Kein Produzent kann es sich leisten, sich so etwas Wichtiges durch die Lappen gehen zu lassen. Sonst ist er seinen Job los. Und wenn jemand seinem Vorgesetzten erst erklären muss, warum er einen Braten nicht gerochen hat, ist alles zu spät. Glaub mir. Ich arbeite in der Branche, ich kenne diese Leute.«
»Alvin hat Recht«, sagte Nate. »Man weiß nie, was als Nächstes passiert. Da empfiehlt es sich, ein bisschen vorzuplanen. Du warst auf dem Bildschirm extrem präsent. Das weißt du doch selbst! Und wenn du gutes Filmmaterial von diesen Lichtern hast, dann könnte das für Good Morning America oder Primetime genau das Zünglein an der Waage sein.«
Jeremy musterte seinen Agenten mit zusammengekniffenen Augen. »Meinst du das ernst? Diese Geschichte taugt doch nicht viel. Ich hab nur beschlossen, sie zu machen, weil ich nach der Sache mit Clausen eine Pause brauche. Diesem Herrn habe ich immerhin vier Monate meines Lebens geopfert.«
»Und du siehst, was es dir gebracht hat.« Nate legte Jeremy die Hand auf die Schulter. »Selbst wenn’s nur heiße Luft sein sollte – wer weiß, was kommt. Mit sensationellen Bildern und einem spannenden Hintergrundtext sind die beim Fernsehen garantiert Feuer und Flamme.«
Jeremy zuckte die Achseln. »Na gut«, sagte er und wandte sich an Alvin. »Ich breche am Dienstag auf. Versuch doch mal, ob du kommenden Freitag dort sein kannst. Ich ruf dich vorher an und gebe dir die Daten durch.«
Alvin trank einen kräftigen Schluck Bier. »Na, super«, sagte er. »Ich werde ins Land der Maisgrütze und der Innereien reisen. Und ich verspreche dir, meine Spesen fallen nicht astronomisch aus.«
Jeremy musste lachen. »Warst du denn überhaupt schon mal in den Südstaaten?«
»Nein. Du?«
»Ja, in New Orleans und Atlanta«, sagte Jeremy. »Aber das sind Großstädte, und die sind eigentlich überall gleich. Für diese Recherche müssen wir allerdings in den finstersten Süden, in ein winziges Kaff in North Carolina namens Boone Creek. Du musst dir mal die Homepage ansehen. Da wird dir was von Azaleen und Hartriegelsträuchern erzählt, die im April wunderschön blühen, und sie zeigen voller Stolz ein Foto des berühmtesten Bürgers der Stadt. Das ist ein Typ namens Norwood Jefferson.«
»Wer ist das denn?«
»Ein Politiker. Er saß von neunzehnhundertsieben bis neunzehnhundertsechzehn im Senat von North Carolina.«
»Na und?«
»Genau.« Jeremy ließ seinen Blick durch die Bar schweifen und stellte enttäuscht fest, dass die Rothaarige verschwunden war.
»Und wo liegt dieser Ort?«
»Zwischen ›Mitten im Nichts‹ und ›Wo sind wir hier eigentlich?‹. Ich habe ein Zimmer in einem Hotel mit dem schönen Namen Greenleaf Cottages gebucht. Das Verkehrsbüro schreibt, es liege landschaftlich sehr hübsch und sei rustikal, aber durchaus modern. Was immer das heißen mag.«
»Klingt wie ein unvergessliches Abenteuer«, sagte Alvin lachend.
»Keine Sorge – du wirst dich fühlen wie ein Fisch im Wasser.«
»Glaubst du?«
Mit einer Kopfbewegung deutete Jeremy auf Leder, Tattoos und Piercings.
»Auf jeden Fall. Die Leute dort wollen dich bestimmt sofort adoptieren.«
KAPITEL 2
Am Dienstag, einen Tag nach seinem Interview mit dem People Magazine, traf Jeremy in North Carolina ein. Es war kurz nach zwölf Uhr mittags. Bei grauem Schneeregen war er in New York aufgebrochen, doch hier, unter dem endlosen blauen Himmel des Südens, schien der Winter weit weg.
Wenn man sich auf die Landkarte verlassen konnte, die er sich im Geschenkeladen am Flughafen gekauft hatte, lag Boone Creek in Pamlico County, hundertfünfzig Kilometer südöstlich von Raleigh und hunderttausend Kilometer entfernt von allem, was Jeremy als Zivilisation betrachtete. Die Landschaft war flach und karg und ungefähr so aufregend wie Pfannkuchenteig. Die Farmen wurden durch schmale Reihen von Weihrauchkiefern getrennt, und weil kaum Autos unterwegs waren, musste sich Jeremy beherrschen, um nicht aus purer Langeweile noch hemmungsloser aufs Gaspedal zu treten.
Aber irgendwie war das gar nicht so übel. Der reinste Geschwindigkeitsrausch. Das Lenkrad vibrierte, der Motor brummte, und extreme Beschleunigung sorgte bekanntlich dafür, dass der Adrenalinspiegel stieg, vor allem bei Männern (über dieses Thema hatte er einmal einen Artikel geschrieben). Wenn man in einer Großstadt wohnte, brauchte man eigentlich gar kein Auto, und Jeremy hatte den Kostenaufwand nie so ganz vor sich selbst rechtfertigen können. Stattdessen wurde man entweder in überfüllten U-Bahnen von einem Ort zum anderen gekarrt oder in Taxis, in denen man sich unweigerlich ein Schleudertrauma zuzog. Überall nur Lärm und Hektik, und wenn man den entsprechenden Taxifahrer erwischte, schwebte man ständig in akuter Lebensgefahr. Aber als echter New Yorker hatte sich Jeremy längst an diese Unannehmlichkeiten gewöhnt und akzeptierte sie als unerlässlichen Bestandteil der Stadt, in der er geboren wurde und die seine Heimat war.
Seine Gedanken wanderten zu Maria, seiner Exfrau. Sie wäre begeistert, wenn sie jetzt neben ihm sitzen würde. In den ersten Jahren ihrer Ehe hatten sie öfter einen Wagen gemietet und waren gemeinsam in die Berge oder ans Meer gefahren, auch wenn die Autofahrt mehrere Stunden dauerte. Maria hatte in der Werbeabteilung der Zeitschrift Elle gearbeitet. Kennen gelernt hatten sie sich auf einer Verlagsparty. Als er Maria fragte, ob sie mit ihm in das Café um die Ecke gehen wolle, ahnte er nicht, dass sie die große Liebe seines Lebens werden würde. Anfangs dachte er sogar, es wäre besser gewesen, wenn er sie nicht angesprochen hätte. Sie schienen nicht viel gemeinsam zu haben. Maria war energisch und gefühlsbetont, ganz anders als er, aber als er sie später vor ihrer Haustür küsste, war er wie verzaubert.
Mit der Zeit wuchsen ihm ihre temperamentvolle Art und ihr untrüglicher Instinkt im Umgang mit Menschen immer mehr ans Herz. Und es gefiel ihm, dass sie alles an ihm zu akzeptieren schien, die guten wie die schlechten Seiten. Sie verurteilte ihn nie. Ein Jahr später heirateten sie kirchlich und feierten mit Freunden und Verwandten ein wunderbares Fest. Er war damals sechsundzwanzig und arbeitete noch nicht als Kolumnist beim Scientific American, war aber schon im Begriff, einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erlangen. Trotzdem konnten sie sich die kleine Mietwohnung in Brooklyn kaum leisten. Doch sie waren jung und glücklich, auch wenn sie noch kämpfen mussten. So sah er ihre Ehe. Für Maria war manches anders, wie er später erfuhr: Theoretisch fühlte sie sich ihm sehr nahe, doch in der Realität stand ihre Beziehung auf wackeligen Füßen. Während Maria wegen ihres Jobs in New York bleiben musste, war er ständig auf Achse und rannte hinter irgendeiner spannenden Geschichte her. Oft war er mehrere Wochen hintereinander nicht bei ihr. Maria versicherte ihm zwar, damit könne sie umgehen, doch irgendwann musste sie gemerkt haben, dass sie es nicht ertragen konnte. Kurz nach ihrem zweiten Hochzeitstag und kurz bevor er wieder einmal wegfahren musste, setzte sich Maria zu ihm aufs Bett, faltete die Hände und schaute ihn mit ihren großen braunen Augen an.
»So geht das nicht weiter«, sagte sie nur. Eine Weile lang schwiegen sie beide, dann fuhr sie fort: »Du bist nie zu Hause, und das ist nicht fair mir gegenüber. Es ist nicht fair uns beiden gegenüber.«
»Willst du, dass ich mit dem Job aufhöre?« Er fühlte leise Panik in sich hochsteigen.
»Nein, ich will nicht, dass du aufhörst. Aber vielleicht kannst du hier in der Stadt etwas finden. Zum Beispiel bei der Times. Oder bei der Post. Oder den Daily News.«
»Aber es bleibt doch nicht immer so, wie es jetzt ist!«, rief er flehentlich. »Nur noch für eine Weile.«
»Das hast du vor sechs Monaten auch schon gesagt. Aber es hat sich nichts geändert. Es wird nie anders werden.«
Rückblickend wusste Jeremy, dass er die Warnsignale hätte erkennen müssen, aber damals war er gerade einer tollen Story auf der Spur, die mit Los Alamos zu tun hatte. Als er sich von Maria verabschiedete, lächelte sie unsicher, und im Flugzeug dachte er noch lange über ihren seltsamen Gesichtsausdruck nach.
Doch als er nach Hause kam, war alles wieder wie früher. Sie verbrachten das ganze Wochenende im Bett, und Maria sprach davon, wie es wäre, wenn sie ein Kind hätten. Die Vorstellung macht Jeremy nervös, aber er fand sie auch sehr spannend und schön. Er ging also davon aus, dass sie sich mit seinem Arbeitsstil abgefunden hatte, doch ihre Beziehung war längst angeknackst, und mit jeder seiner Reisen entstanden neue unsichtbare Risse. Der endgültige Bruch kam ein Jahr später, einen Monat nachdem sie einen Arzt in der Upper East Side aufgesucht hatten. Dieser Arzt hatte sie mit einer Zukunft konfrontiert, auf die sie beide nicht vorbereitet gewesen waren. Was sie in seinem Sprechzimmer erfuhren, war für das rasche Ende ihrer Ehe viel entscheidender als seine Reisen, das begriff Jeremy sehr schnell.
»Ich kann nicht bei dir bleiben«, sagte Maria zu ihm. »Ich würde gern, und ein Teil von mir wird dich immer lieben, aber ich kann nicht.«
Mehr brauchte sie nicht zu sagen, und in den stillen, selbstmitleidigen Momenten nach der Scheidung fragte Jeremy sich manchmal, ob sie ihn je wirklich geliebt hatte. Sie hätten es schaffen können, sagte er sich. Emotional konnte er allerdings nachvollziehen, weshalb sie gegangen war; er machte ihr deswegen keine Vorwürfe. Er rief sie öfter an, konnte sich jedoch nicht überwinden, zu ihrer Hochzeit zu gehen, als sie drei Jahre später einen Anwalt in Chappaqua heiratete.
Die Scheidung war vor sieben Jahren rechtsgültig geworden. Eigentlich war sie das einzig Bedauerliche, was ihm in seinem bisherigen Leben widerfahren war. Das machte ihn zu einer absoluten Ausnahmeerscheinung, das wusste er. Er hatte sich nie ernsthaft verletzt, er hatte gute Freunde, und in seiner Kindheit hatte er keines der psychischen Traumata erlitten, die so vielen Leuten in seinem Alter zu schaffen machten. Seine Brüder und ihre Frauen, seine Eltern und sogar seine Großeltern – alle vier inzwischen weit über neunzig – waren gesund. Sie verstanden sich untereinander blendend: An zwei Wochenenden im Monat versammelte sich der immer größer werdende Clan im Haus seiner Eltern, die immer noch in Queens wohnten, wo Jeremy aufgewachsen war. Er hatte siebzehn Nichten und Neffen, und auch wenn er sich bei diesen Familientreffen manchmal etwas fehl am Platz fühlte, da er wieder ein Junggesellendasein führte und alle anderen glücklich verheiratet waren, verhielten sich seine Brüder ihm gegenüber ausgesprochen solidarisch und fragten nie nach den eigentlichen Scheidungsgründen.
Er hatte den Schmerz überwunden. Zum größten Teil jedenfalls. Gelegentlich, wie zum Beispiel jetzt auf dieser Reise, überkam ihn plötzlich Sehnsucht nach dem, was hätte sein können, aber auch das geschah immer seltener, und sein Verhältnis zu Frauen im Allgemeinen war durch die Scheidung keineswegs getrübt worden.
Vor ein paar Jahren hatte er sich mit einer hochinteressanten Studie befasst, deren Fragestellung lautete: Ist unser Schönheitsbild ein Produkt kultureller Normen oder genetisch bedingt? Für diese Studie wurden verschiedene Frauen gebeten, ein Kleinkind im Arm zu halten. Attraktive Frauen und weniger attraktive. Gemessen wurde die Länge des Blickkontakts zwischen Frau und Kind. Die statistische Auswertung zeigte angeblich, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Schönheit und Blickkontakt gab: Die Kleinkinder starrten die attraktiven Frauen länger an, woraus man herleitete, dass Schönheit instinktiv als solche wahrgenommen würde. Die Studie war in der Newsweek und im Time Magazine ausführlich besprochen worden.
Jeremy hatte eine kritische Kolumne darüber schreiben wollen, weil er fand, dass man mehrere zentrale Aspekte nicht beachtet hatte. Äußerliche Schönheit mochte sofort ins Auge stechen – das wusste er selbst am besten, denn er reagierte auf das Aussehen der Super-models genau wie jeder andere Mann –, aber eigentlich fand er von jeher Intelligenz und die Fähigkeit, emotional zu reagieren, wesentlich attraktiver und war der festen Überzeugung, dass diese Faktoren auf Dauer für eine Beziehung eine entscheidendere Rolle spielten. Diese Eigenschaften waren allerdings nicht sofort augenfällig, man brauchte eine Weile, um sie zu entdecken, und mit äußerlicher »Schönheit« hatten sie nichts zu tun. Es mochte ja stimmen, dass diese zuerst alles dominierte, doch es handelte sich nur um eine relativ kurze Zeitspanne, während mittel- oder längerfristig die kulturellen Normen – vor allem die von der Familie vermittelten Werte – viel größeres Gewicht besaßen. Sein Redakteur hatte das Thema der Kolumne allerdings als »zu subjektiv« verworfen und ihm vorgeschlagen, er solle lieber etwas über die hohen Antibiotika-Anteile im Hühner-futter schreiben und dass sich Streptokokken dadurch in eine Art Pest verwandeln könnten. Dass dem Redakteur dieses Thema besser gefiel, konnte Jeremy bei aller Enttäuschung durchaus nachvollziehen: Der Mann war Vegetarier, und seine Frau sah supertoll aus, wohingegen ihr Verstand so hell leuchtete wie der Winterhimmel über Alaska.
Redakteure! Schon vor langer Zeit war er zu dem Schluss gekommen, dass die Mehrzahl unter ihnen Heuchler waren. Aber wie in den meisten Berufssparten, so vermutete er, galten Heuchler als engagiert und verhielten sich politisch klug – mit anderen Worten, sie waren diejenigen, die sich in jedem Betrieb durchsetzten. Und sie vergaben nicht nur die Aufträge, sondern bezahlten auch die Spesenrechnungen.
Nun, wenn er Nate Glauben schenkte, hatte sich dieses Problem für ihn demnächst ein für alle Mal erledigt. Na ja – nicht ganz. Alvin hatte sicher Recht, wenn er sagte, dass sich die Fernsehproduzenten nicht grundsätzlich von den Redakteuren in den Printmedien unterschieden, aber das Fernsehen zahlte wenigstens Gehälter, von denen man leben konnte. Er könnte dann viel wählerischer mit seinen Projekten umgehen und müsste nicht dauernd irgendwelche Vorschläge unterbreiten. Nicht ohne Grund hatte Maria immer geklagt, er arbeite viel zu viel. Und in der Hinsicht hatte sich in den vergangenen Jahren bei ihm nicht viel verändert. Natürlich, seine Themen waren profilierter, und er hatte keine Schwierigkeiten mehr, seine Artikel unterzubringen, aber trotzdem musste er sich jedes Mal etwas Neues, Originelles einfallen lassen. Er produzierte auch heute noch ein Dutzend Kolumnen für den Scientific American , von denen einige mit aufwändigen Recherchen verknüpft waren, und dazu kamen noch etwa fünfzehn kleinere Artikel im Jahr, die teilweise jahreszeitlich gebunden waren. Steht Weihnachten vor der Tür? Dann schreib was über die historische Figur des heiligen Nikolaus, der aus der Türkei stammte, Bischof von Myra wurde und bekannt war für seine Großzügigkeit, seine Kinderliebe und seine Fürsorge für die Seeleute. Der Sommer kommt? Wie wär’s mit einem Artikel über (a) die globale Erwärmung und den unleugbaren Anstieg der Temperatur um 0,5 Grad in den letzten hundert Jahren, woraus sich für die ganzen Vereinigten Staaten Sahara-ähnliche Wetterbedingungen herleiten lassen — oder (b) darüber, weshalb die globale Erwärmung eine neue Eiszeit hervorrufen wird und sich die USA in eine bitterkalte Tundra verwandeln werden. An Thanks-giving hingegen bot es sich an, die Wahrheit über das Leben der Pilgerväter zu offenbaren, denn dieses bestand nicht nur aus freundlichen Mahlzeiten mit den eingeborenen Amerikanern, sondern zeichnete sich aus durch Hexenverfolgung, Pockenepidemien und inzestuöse Neigungen.
Interviews mit berühmten Wissenschaftlern und Artikel über Satelliten oder andere NASA-Projekte stießen immer auf Interesse und ließen sich mühelos veröffentlichen, unabhängig von der Jahreszeit. Das Gleiche galt für Texte über Drogen (legale und illegale), Sex, Prostitution, Glücksspiel, Alkohol, Gerichtsfälle, bei denen es um große Summen ging, sowie alles, aber auch wirklich alles, was mit übernatürlichen Erscheinungen zu tun hatte, selbst wenn es dabei in den meisten Fällen nicht um naturwissenschaftliche Probleme ging, sondern um Scharlatane und Schwindler wie Clausen.
Klar, seine journalistische Karriere hatte sich Jeremy etwas anders vorgestellt. Er war auf der Columbia University gewesen – als Einziger der Brüder hatte er das College besucht und war überhaupt der Erste in der ganzen Familie gewesen, der einen akademischen Abschluss machte, was seine Mutter Fremden gegenüber immer voller Stolz betonte. Studiert hatte er Physik und Chemie, mit dem Ziel, Professor zu werden. Aber eine Freundin, die bei der Studentenzeitung arbeitete, hatte ihn überredet, er solle doch mal einen Artikel über die unfairen Methoden bei der Auswertung der Highschool-Noten für die Uni-Zulassung schreiben. Dieser (stark auf Statistiken basierende) Artikel führte zu mehreren Studentendemonstrationen, woraus man ableiten konnte, dass Jeremy seine Argumente überzeugend vorgetragen hatte. Aber seine Berufspläne änderten sich erst, als sein Vater von einem kriminellen Finanzberater um gut vierzigtausend Dollar geprellt wurde, kurz bevor Jeremy Examen machte. Das Elternhaus war in Gefahr – sein Vater war Busfahrer und hatte bis zum Ruhestand für die New Yorker Port Authority gearbeitet –, und Jeremy beschloss, die große Abschlussfeier sausen zu lassen und stattdessen lieber den Mann, der seinen Vater reingelegt hatte, zu überführen. Wie ein Besessener durchwühlte er Gerichtsakten und öffentliche Archive, befragte Bekannte des Betrügers und machte sich detaillierte Notizen.
Wie das Schicksal es wollte, verfolgte die New Yorker Staatsanwaltschaft lieber größere Gangster und konnte sich nicht um einen unbedeutenden kleinen Betrüger kümmern. Also überprüfte Jeremy all seine Informationen noch einmal, strich das Material zusammen und verfasste seinen ersten großen Enthüllungsartikel – mit dem Ergebnis, dass das Elternhaus gerettet wurde und das New York Magazine den Artikel druckte. Der Redakteur dieser Zeitschrift versicherte ihm glaubhaft, dass ihm ein Leben im akademischen Elfenbeinturm nichts bringen würde. Jeremy solle seine Ziele höher stecken, suggerierte er mit einer gekonnten Mischung aus Schmeichelei und Rhetorik – er könnte doch etwas über Leffertex schreiben, ein Antidepressivum, das sich damals gerade in der dritten Phase der klinischen Erprobung befand und von den Medien intensiv beäugt wurde.
Jeremy griff den Vorschlag auf und recherchierte zwei Monate lang auf eigene Kosten. Wegen seines Artikels musste der Hersteller das Medikament zurückziehen. Anschließend ging Jeremy nicht auf das Massachusetts Institute of Technology, um dort seinen Master zu machen, sondern reiste nach Schottland: Er begleitete eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich mit dem Ungeheuer von Loch Ness beschäftigten. So kam es, dass er anfing, über populärwissenschaftliche Themen zu schreiben. Er war dabei, als ein berühmter Arzt auf dem Sterbebett gestand, das Foto, das er 1933 von dem Monster gemacht hatte – und durch das die große Öffentlichkeit überhaupt erst von der Monsterlegende erfuhr –, sei eine Fälschung gewesen, die er und ein Freund an einem schönen Sonntagnachmittag als Witz zusammengebastelt hätten.
Aber fünfzehn Jahre lang hinter möglichen Themen herzulaufen bedeutete fünfzehn Jahre Jagd – und was hatte er davon? Er war jetzt siebenunddreißig, alleinstehend, mit einer kleinen Zweizimmerwohnung in der Upper West Side, unterwegs nach Boone Creek, North Carolina, wo er nachforschen wollte, was es mit irgendwelchen rätselhaften Friedhofslichtern auf sich hatte.
Jeremy schüttelte den Kopf. Wirklich komisch, welche Wendungen das Leben manchmal nahm. Wo war der Traum vom großen Glück geblieben? Diesem Traum jagte er immer noch nach, und er war nach wie vor fest entschlossen, ihn zu finden. Aber war das Fernsehen der richtige Weg?
Dass er sich mit der Geschichte der geheimnisvollen Lichter befassen wollte, ging auf einen Brief zurück, den er vor einem Monat erhalten hatte. Zuerst hatte er gedacht, dass sich daraus ein witziger Halloween-Artikel stricken ließe, der sich – je nachdem, welchen methodischen Ansatz er wählte – entweder für die Oktober-Nummer von Southern Living oder für den Reader’s Digest eignen würde. Falls er etwas eher Literarisches schreiben wollte, käme auch Harper’s oder der New Yorker in Frage. Sollte allerdings die Stadt versuchen, Kapital aus diesen »Lichtern« zu schlagen, ähnlich wie es Roswell, New Mexico, mit UFOs gemacht hatte, dann würde der Text wahrscheinlich besser in eine der großen Südstaatenzeitungen passen, die ihn dann weiterverkaufen würde. Oder er könnte etwas Kurzes schreiben und es für seine Kolumne verwenden. Sein Chefredakteur beim Scientific American legte zwar größten Wert auf wissenschaftliche Seriosität, aber wie alle anderen brauchte natürlich auch er neue Abonnenten. Darüber redete er pausenlos – und er wusste genau, dass die Leser gute Geistergeschichten liebten. Wahrscheinlich würde er sich schrecklich winden, den Blick immer auf das Foto seiner Ehefrau gerichtet, und so tun, als müsste er erst noch die wahre Bedeutung des Artikels abwägen. Aber letzten Endes ließ er sich solche Texte nie entgehen. Redakteure mochten leichte Kost genauso gern wie ihre Leser, und treue Abonnenten waren für das Geschäft lebensnotwendig. Das Triviale gehörte für die Medien zum täglichen Brot.
Insgesamt hatte Jeremy schon sieben verschiedene Geistererscheinungen recherchiert und vier von ihnen in seine Kolumne aufgenommen. Sie waren in der Mehrzahl eher durchschnittlich gewesen — Spektralvisionen, die niemand wissenschaftlich dokumentieren konnte –, doch bei dreien waren Poltergeister aufgetreten, diese übermütigen kleinen Gespenster, die gern Gegenstände verrückten oder beschädigten. Nach Aussagen parapsychologischer Wissenschaftler – eine Berufsbezeichnung, die, so fand Jeremy, eigentlich ein Widerspruch in sich war – fühlten sich Poltergeister meist zu einer bestimmten
Titel der Originalausgabe True Believer
Taschenbuchausgabe 04/2008
Copyright © 2003 by Nicholas Sparks Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2005 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: Christine Roither Verlagsservice, Breitenaich
eISBN 978-3-641-06013-8
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe