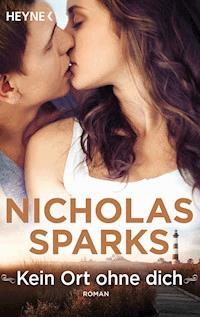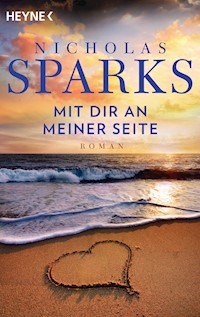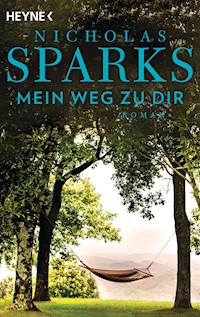2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An der Schwelle zwischen Leben und Tod findet Logan Thibault einen Glücksbringer: die Fotografie einer lächelnden schönen Frau. Obwohl er sie noch nie zuvor gesehen hat, glaubt Thibault, dass sie den Schlüssel zu seinem Schicksal in Händen hält. Er sucht die geheimnisvolle Frau auf – und sein Leben nimmt eine so wunderbare wie dramatische Wendung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
Kann es wirklich so etwas wie einen Glücksbringer geben? Logan Thibault würde so einen Gedanken weit von sich weisen – bis er selbst in höchster Gefahr das Foto einer schönen Frau findet. Er nimmt es an sich und fühlt sich ab diesem Moment auf wunderbare Weise beschützt. Unversehrt kehrt er aus dem Krieg zurück. Er macht sich auf die Suche quer durch ganz Amerika, um die Frau zu finden. Und es gelingt ihm tatsächlich: In einem kleinen Örtchen in North Carolina steht er plötzlich Elizabeth gegenüber. Um ihr nahe zu sein, lässt er sich als Aushilfe in der Hundeschule ihrer Großmutter einstellen. Und schon bald verliebt er sich hoffnungslos in Elizabeth. Sie hat jedoch große Vorbehalte gegen diesen Fremden, der sie so komisch anstarrt und sie von irgendwoher zu kennen scheint. Nur langsam öffnet sie sich ihm – und Thibault beginnt zu erahnen, dass die Schatten der Vergangenheit ihre aufkeimende Liebe zerstören könnten.
»Nicholas Sparks lässt kein Herz unberührt.« Bild am Sonntag
Der Autor
Nicholas Sparks, 1965 in Nebraska geboren, lebt zusammen mit seiner Frau und den gemeinsamen fünf Kindern in North Carolina. Mit seinen Romanen, die ausnahmslos die Bestsellerlisten eroberten und weltweit in 46 Ländern erscheinen, gilt Sparks als einer der meistgelesenen Autoren der Welt. Mehrere seiner Bestseller wurden erfolgreich verfilmt. www.nicholas-sparks.de
Inhaltsverzeichnis
Für Jamie Raab und Dennis Dalrymple
Ein Jahr, an das wir immer denken werden …und ein Jahr, das wir oft am liebsten vergessen möchten.Ich bin in Gedanken bei euch.
KAPITEL 1
Clayton und Thibault
Er hatte sie nicht kommen hören, und aus der Nähe gefielen ihm die beiden auch nicht besser als von weitem. Vor allem der Hund war ihm unsympathisch. Deputy Keith Clayton, Beamter im Sheriff’s Department, mochte keine deutschen Schäferhunde, auch wenn sie noch so friedlich aussahen. Und dieser hier erinnerte ihn an Panther, den Begleiter von Deputy Kenny Moore, der blitzschnell losschoss und jeden Verdächtigen in den Schritt biss, wenn man ihn auch nur andeutungsweise dazu aufforderte. Eigentlich fand Clayton seinen Kollegen Moore völlig verrückt, aber er war der Einzige in der Abteilung, den er tendenziell als Freund betrachtete. Und diese Geschichten, wie Panther die Leute attackierte, erzählte Moore wirklich witzig, so dass sich alle immer bogen vor Lachen. Garantiert hätte Moore die kleine Nacktbadeparty, die Clayton soeben aufgestöbert hatte, auch sehr gut gefallen. Zuerst hatte er unten am Fluss aus der Ferne zwei Studentinnen dabei ertappt, wie sie sich unverhüllt von der Morgensonne bräunen ließen. Er machte natürlich gleich ein paar Schnappschüsse von ihnen – aber da tauchte plötzlich hinter einem Hortensienstrauch ein drittes Mädchen auf. Hektisch warf er die Kamera ins Gebüsch und kam hinter seinem Baum hervor. Eine Sekunde später stand er vor der Studentin.
»Na, was haben wir denn hier?«, fragte er mit dickem Südstaatenakzent, um sie möglichst gleich in die Defensive zu drängen.
Es ärgerte ihn, dass er beim Fotografieren überrascht worden war, und mit seiner lahmen Begrüßungsformel war er auch nicht zufrieden. Normalerweise trat er in solchen Situationen souveräner auf. Wesentlich souveräner sogar. Zum Glück war das Mädchen viel zu eingeschüchtert, um seine Unsicherheit zu registrieren. Sie hüpfte ein paar Schritte rückwärts und wäre dabei fast gestolpert. Hilflos stammelnd versuchte sie, sich mit den Händen zu bedecken. Es sah aus, als würde ein kleines Kind versuchen, ganz allein Twister zu spielen.
Clayton grinste breit und tat so, als merkte er gar nicht, dass sie splitternackt war. Oder als würde er jeden Tag im Wald unbekleideten jungen Damen begegnen. Seine Nervosität war verflogen, weil sie offensichtlich seine Kamera nicht gesehen hatte.
»Nur keine Panik, wenn ich bitten darf. Aber können Sie mir vielleicht erklären, was hier los ist?«, fragte er.
Dabei wusste er ganz genau, was los war. Es passierte jeden Sommer ein paarmal, vor allem im August: Studentinnen von der Chapel Hill University oder der North Carolina State University in Raleigh fuhren für ein verlängertes Wochenende nach Emerald Isle ans Meer, ehe das Herbstsemester begann. Unterwegs machten sie einen kleinen Abstecher zu dem alten Waldweg, der früher zur Holzabfuhr gedient hatte. Dieser Weg schlängelte sich knapp zwei Kilometer durch den National Forest, bis zu der Stelle, wo der Swan Creek eine scharfe Biegung in Richtung South River machte. Dort gab es einen hübschen kleinen Kiesstrand, und jeder wusste, dass man da ungestört nackt baden konnte.
Clayton hatte keine Ahnung, wie diese Tradition entstanden war. Aber er hatte sich angewöhnt, öfter mal dort vorbeizufahren, immer in der Hoffnung, einen Glückstreffer zu landen, so wie heute. Vor sechs Wochen hatte er sechs entblößte Mädels aufgespürt, jetzt waren es immerhin drei. Die beiden, die bisher auf ihren Handtüchern gedöst hatten, tasteten hastig nach ihren T-Shirts. Die eine war etwas zu mollig für seinen Geschmack, aber die beiden anderen – auch die Brünette, die vor ihm stand – hatten eine Figur, die jeden männlichen Kommilitonen um den Verstand bringen konnte. Und jeden Polizeibeamten.
»Wir wussten nicht, dass Leute hierherkommen. Wir haben gedacht, das darf man hier.«
Sie machte so ein Unschuldsgesicht, dass er automatisch dachte: Na, Daddy wäre bestimmt superstolz, wenn er wüsste, was sein kleines Töchterchen hier anstellt. Er malte sich aus, wie erschrocken sie auf diesen Satz reagieren würde, aber weil er Uniform trug, musste er leider etwas Seriöses von sich geben. Außerdem durfte er auf keinen Fall zu weit gehen. Wenn es sich herumsprach, dass hier in der Gegend Polizei patrouillierte, kamen bald keine Studentinnen mehr, und das wäre doch sehr schade.
»Kommen Sie mit. Ich würde gern auch mit Ihren Freundinnen sprechen.«
Er folgte ihr hinunter zum Kiesstrand und beobachtete dabei belustigt, wie sie vergeblich versuchte, ihre Rückseite zu schützen. Sehr niedlich. Als sie die Lichtung beim Fluss erreichten, hatten die beiden anderen Mädchen bereits ihre T-Shirts angezogen. Die Brünette hopste schnell zu ihnen, schnappte sich ein Handtuch und warf dabei ein paar Bierdosen um. Clayton deutete auf einen Baum in der Nähe.
»Habt ihr das Schild hier nicht gesehen?«
Wie auf Kommando schauten drei Augenpaare in die angegebene Richtung. Die Menschen sind Schafe und warten nur auf den nächsten Befehl, dachte Clayton. Das Schild war klein und teilweise durch die niedrigen Zweige einer alten immergrünen Eiche verdeckt. Auf Anordnung von Richter Kendrick Clayton war es dort aufgehängt worden. Dieser Richter war, nebenbei bemerkt, Keiths Onkel, und der Vorschlag, hier so einen Hinweis anzubringen, stammte von Keith Clayton selbst – er wusste nämlich, dass ein offizielles Verbot die Anziehungskraft des Ortes nur noch steigern würde.
»Nein, das haben wir gar nicht bemerkt!«, rief die Brünette entsetzt, während sie sich in ihr Handtuch wickelte. »Wir hatten keine Ahnung. Uns hat erst vor ein paar Tagen jemand von diesem Strand erzählt!« Die anderen beiden waren so verängstigt, dass sie kein Wort herausbrachten und sich nur stumm bemühten, irgendwie in ihre Bikini-Unterteile zu kommen. Aber das dritte Mädchen redete tapfer weiter. »Wir sind heute wirklich zum allerersten Mal hier!«
Sie klang, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen. Typisch für so eine verwöhnte höhere Tochter. Bestimmt gehörten sie alle drei in diese Kategorie. Man sah es ihnen irgendwie an.
»Wusstet ihr, dass öffentliche Nacktheit hierzulande ein kriminelles Vergehen ist?«
Er sah, wie die drei Grazien erblassten. Bestimmt hatten sie Angst, diese Übertretung des Gesetzes würde als Aktennotiz in ihrem polizeilichen Führungszeugnis auftauchen. Ein Bild für die Götter, diese Mädels. Aber er musste wirklich vorsichtig sein und durfte auf keinen Fall seine Strenge übertreiben.
»Wie heißt ihr?«
»Ich heiße Amy«, sagte das Mädchen mit den braunen Haaren und schluckte. »Amy White.«
»Und woher kommt ihr?«
»Ich komme aus Chapel Hill. Das heißt, eigentlich aus Charlotte.«
»Ich sehe, dass hier alkoholische Getränke herumstehen. Dürft ihr überhaupt schon Alkohol trinken? Seid ihr schon einundzwanzig?«
Endlich zeigten auch die anderen beiden eine Reaktion. »Jawohl, Sir«, antworteten alle drei im Chor.
»Okay, Amy. Ich sage euch jetzt, was ich tun werde. Dass ihr das Schild nicht gesehen habt, glaube ich euch. Und auch, dass ihr berechtigt seid, Alkohol zu trinken. Deshalb bin ich bereit, ein Auge zuzudrücken und keine Staatsaktion daraus zu machen. Ich werde so tun, als wäre ich nie hier gewesen. Im Gegenzug müsst ihr mir allerdings versprechen, dass ihr nicht zu meinem Vorgesetzten rennt und ihm erzählt, ich hätte euch ohne Strafe laufen lassen.«
Die Mädchen wussten nicht recht, ob sie ihm trauen sollten.
»Ehrlich?«, flüsterte Amy.
»Ehrlich«, wiederholte er. »Ich war schließlich auch mal auf dem College.« Das stimmte zwar nicht, aber es klang gut, fand er. »Und wenn ihr euch jetzt bitte anziehen würdet … Man weiß ja nie, wer sonst noch durchs Gebüsch schleicht.« Er grinste vielsagend. »Und, bitte, entsorgt sämtliche Bierdosen, verstanden?«
»Jawohl, Sir.«
»Sehr gut.« Er wandte sich zum Gehen.
»War’s das?«, rief Amy verdutzt.
Clayton drehte sich um und grinste wieder. »Ja, das war’s. Und passt gut auf euch auf.«
Durchs Unterholz machte er sich auf den Weg zurück zu seinem Streifenwagen. Immer wieder musste er sich wegen der niedrigen Zweige ducken. Er hatte seine Sache gut gemacht, fand er. Sehr gut sogar. Und Amy hatte ihm am Schluss noch zugelächelt! Kurz spielte er mit dem Gedanken, ob er nicht umdrehen und sie um ihre Telefonnummer bitten sollte. Nein, befand er dann, es war besser, es bei dieser Begegnung zu belassen. Höchstwahrscheinlich erzählten die drei ihren Freundinnen, der Sheriff habe sie zwar beim Nacktbaden erwischt, aber es sei nichts Schlimmes passiert. Es würde sich herumsprechen, dass die Polizeibeamten in dieser Gegend cool waren. Und hoffentlich hatte er ein paar knackige Aufnahmen hinbekommen, als hübsche Ergänzung zu seiner bisherigen Sammlung.
Als er gerade die Kamera aus dem Gebüsch holen wollte, hörte er ein Pfeifen. Er folgte dem Geräusch bis zu der ehemaligen Holzzufahrt. Dort entdeckte er einen unbekannten Mann, der langsam den Weg entlangging. Mit Hund. Der Typ erinnerte ihn an die Hippies aus den sechziger Jahren.
Auf jeden Fall gehörte er nicht zu den Mädchen. Erstens war er zu alt fürs College – mindestens Ende zwanzig. Mit seinen langen Haaren würde er auch nicht zu den höheren Töchtern passen, oder? Auf dem Rücken trug er einen schweren Rucksack, an den unten ein Schlafsack geschnallt war. Dieser Mann wollte nicht für einen Tag zum Strand, nein, er wirkte wie jemand, der eine richtige Wanderung machte. Vermutlich mit Camping. Wie lange war er schon hier? Hatte er etwas gesehen?
Hatte er – zum Beispiel – mitbekommen, wie Clayton fotografierte?
Nein, das war völlig unmöglich. Vom Weg aus konnte man nichts sehen, weil das Unterholz viel zu dicht war, und wenn jemand durch den Wald gegangen wäre, hätte Clayton das gehört. Unter Garantie. Trotzdem erschien es ihm eigenartig, dass er in dieser Gegend einem Wanderer begegnete. Hier gab es keine Touristenattraktionen, man befand sich mitten im Nichts. Und Clayton wollte mit allen Mitteln verhindern, dass irgendwelche blöden Hippies den Studentinnen das Strandleben vermiesten.
Inzwischen war der Fremde an ihm vorbeigegangen. Er näherte sich dem Streifenwagen und dem Jeep, in dem die Mädchen gekommen waren. Clayton trat auf den Waldweg und räusperte sich. Der Fremde und sein Hund drehten sich um.
Aus der Distanz versuchte der Deputy, sie einzuschätzen. Der Mann schien nicht besonders beeindruckt von seinem plötzlichen Erscheinen. Der Hund auch nicht. Im Blick des Fremden lag etwas, was Clayton durcheinanderbrachte. Es war fast so, als hätten er und sein Begleiter ihn bereits erwartet. Der Hund wirkte verschlossen, intelligent und gleichzeitig extrem wachsam – genau wie Panther, bevor Kenny Moore ihn losließ. Claytons Magen krampfte sich zusammen. Am liebsten hätte er seinen Intimbereich mit den Händen bedeckt, aber er beherrschte sich.
Eine ganze Weile starrten Clayton und der Fremde einander an. Der Deputy wusste natürlich, dass seine Uniform die Leute in der Regel verunsicherte. Auch wenn sie gar nichts verbrochen hatten. Jeder wurde unruhig in Gegenwart eines Gesetzeshüters, und Clayton ging davon aus, dass dieser Typ da keine Ausnahme bildete. Die einschüchternde Wirkung seiner Berufsbekleidung war schließlich einer der Gründe, warum er schon als Kind gern Polizist werden wollte.
»Haben Sie eine Leine für Ihren Hund?«, rief er. Es sollte wie ein Befehl klingen, nicht wie eine Frage.
»In meinem Rucksack.«
Clayton konnte in der Aussprache des Mannes keinen regionalen Akzent ausmachen. Er redet Englisch wie Johnny Carson, hätte seine Mutter gesagt, weil ja so ein Talkmaster im Fernsehen keinen Akzent haben durfte. »Nehmen Sie ihn an die Leine.«
»Keine Sorge. Er rührt sich nicht, wenn ich es nicht sage.«
»Trotzdem.«
Der Fremde nahm seinen Rucksack ab und wühlte darin herum. Clayton reckte den Hals in der Hoffnung, vielleicht etwas zu erspähen, was nach Drogen oder nach einer Waffe aussah. Gleich darauf war der Hund angeleint, und der Mann musterte den Deputy mit einem Gesichtsausdruck, der zu fragen schien: Und was jetzt?
»Was machen Sie hier?«, fragte Clayton.
»Wandern.«
»Ihr Rucksack ist ganz schön groß für eine einfache Wanderung.«
Der Fremde reagierte nicht.
»Oder sind Sie vielleicht nur herumgeschlichen, weil Sie dachten, es gibt hier was zu sehen?«
»Tun das die Leute hier?«
Weder der Tonfall noch die versteckte Andeutung in diesem Satz gefiel Clayton. »Ich möchte Ihren Ausweis sehen.«
Wieder nahm der Mann den Rucksack ab und holte gehorsam seinen Pass heraus. Mit der flachen Hand gab er dem Hund zu verstehen, er solle sitzen bleiben, während er auf Clayton zuging, um ihm den Pass zu zeigen.
»Sie haben Ihren Führerschein nicht dabei?« Normalerweise trug niemand seinen Pass mit sich herum, weil der Führerschein als Ausweis genügte.
»Ich besitze keinen.«
Clayton studierte den Namen, formte ihn mit den Lippen. »Logan Thibault?«
Der Fremde nickte.
»Woher kommen Sie?«
»Aus Colorado.«
»Ganz schön weit weg von hier.«
Schweigen.
»Haben Sie ein bestimmtes Ziel?«
»Ich bin unterwegs nach Arden.«
»Was ist in Arden?«
»Kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich war noch nie dort.«
Clayton runzelte die Stirn. Die Antwort fand er frech. Fast schon unverschämt. Jedenfalls passte sie ihm nicht. Überhaupt konnte er den Kerl nicht ausstehen. »Warten Sie einen Moment«, sagte er. »Sie haben doch sicher nichts dagegen, wenn ich die Daten überprüfe.«
»Bitte – gern.«
Als Clayton zu seinem Wagen ging, schaute er kurz über die Schulter und sah, dass Thibault eine kleine Schüssel aus seinem Rucksack holte und sie mit Wasser aus einer Flasche füllte. Er wirkte völlig unbekümmert. Als wäre ihm alles egal.
Wir werden schon was finden, Freundchen! In seinem Streifenwagen nahm Clayton Funkkontakt mit der Zentrale auf, gab den Namen durch und buchstabierte ihn. Die Frau in der Zentrale unterbrach ihn.
»Das spricht man Ti-bo aus. Ist französisch.«
»Die Aussprache interessiert mich nicht. Ti-bo! Mir doch egal. Ich spreche ihn amerikanisch aus. Thai-bolt.«
»Ich wollte nur –«
»Ist schon gut, Marge. Du sollst die Daten überprüfen.«
»Sieht er aus wie ein Franzose?«
»Woher zum Teufel soll ich wissen, wie ein Franzose aussieht?«
»Ich frag doch bloß. Reg dich nicht gleich so auf. Wir haben hier viel Stress.«
Ja, klar, dachte Clayton. Vor allem müsst ihr Donuts futtern. Im Lauf eines Arbeitstages verdrückte Marge mindestens ein Dutzend Krispy Kremes. Sie wog sicher hundertfünfzig Kilo, wenn nicht mehr.
Durchs Wagenfenster sah er, dass der Fremde neben seinem Hund kauerte und ihm etwas zuflüsterte, während dieser das Wasser schlabberte. Clayton schüttelte den Kopf. Wie konnte man nur mit Tieren reden! So was machten doch ausschließlich Spinner. Als würde der Hund irgendetwas verstehen außer den Grundkommandos. Seine Exfrau quasselte auch immer auf ihre Hunde ein und behandelte sie wie Menschen. Eigentlich hätte er daran schon anfangs merken müssen, dass es keinen Sinn mit ihr hatte. Dann wäre ihm viel Ärger erspart geblieben.
»Ich kann nichts finden«, hörte er Marge sagen. Sie klang, als würde sie etwas kauen. »Soweit ich das sehe, gibt es keine ausstehenden Haftbefehle.«
»Bist du dir da ganz sicher?«
»Natürlich! Ich verstehe was von meinem Job.«
Es war, als hätte der Fremde das Gespräch mitgehört. Jedenfalls richtete er sich auf, packte die Schüssel wieder ein und schulterte den Rucksack.
»Sind auch keine Anrufe eingegangen? Über Leute, die herumstreunen oder so?«
»Nein, heute Morgen ist das Telefon ruhig. Wo steckst du überhaupt? Dein Dad hat dich schon gesucht.«
Claytons Dad war der Sheriff.
»Sag ihm, ich bin gleich da.«
»Er ist ziemlich sauer.«
»Dann richte ihm aus, dass ich auf Patrouille bin, okay?«
Damit er weiß, ich arbeite, hätte er am liebsten hinzugefügt, ließ es aber bleiben.
»Wird gemacht.«
Schon besser.
»Ich muss los.«
Er hängte das Funkgerät wieder ein, blieb aber noch einen Moment sitzen. Schade eigentlich. Es hätte Spaß gemacht, den Typen in eine Zelle zu sperren, mit seiner Mädchenfrisur und allem. Die Brüder Landry hätten sich garantiert blendend mit ihm amüsiert. Sie waren samstagabends sozusagen Stammgäste: wegen Trunkenheit, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, wegen Schlägereien – meistens verprügelten sie sich gegenseitig. Außer wenn sie eingelocht waren. Dann suchten sie sich andere Opfer.
Clayton legte die Hand auf den Türgriff. Und warum war sein Dad diesmal sauer? Der alte Herr ging ihm auf die Nerven. Tu dies. Tu das. Hast du die Unterlagen schon bearbeitet? Warum bist du so spät dran? Wenn sein Vater loslegte, hätte Clayton immer am liebsten klargestellt, dass ihn das nichts anging und er sich um seinen eigenen Kram kümmern sollte. Aber der Alte bildete sich ein, er hätte bei ihm noch das Sagen.
Na, egal. Früher oder später würde er es schon kapieren. Und Clayton musste erst mal den Hippie loswerden, bevor die Mädchen kamen. In diesem Wald sollten sich die Menschen wohlfühlen. Versiffte Wanderer konnten alles kaputt machen.
Clayton stieg aus, knallte die Tür hinter sich zu. Der Hund legte den Kopf schief, als der Deputy näher kam und Thibault den Pass hinhielt. »Entschuldigen Sie die Verzögerung, Mr Thai-bolt.« Diesmal sprach er den Namen absichtlich falsch aus. »Ich habe nur meine Pflicht getan. Oder haben Sie etwa Drogen und Waffen in Ihrem Rucksack?«
»Habe ich nicht.«
»Könnte ich mal selbst nachsehen?«
»Lieber nicht. Sie wissen doch – der vierte Zusatzartikel zur Verfassung und so.«
Nicht zu fassen! Jetzt belehrte dieser Vollidiot ihn auch noch indirekt, dass es im amerikanischen Rechtssystem so etwas wie einen Schutz der Privatsphäre gab!
»Ich sehe, Sie haben einen Schlafsack dabei. Zelten Sie irgendwo?«
»Gestern Abend war ich in Burke County.«
Clayton musterte den Mann eingehend, während er über die Antwort nachdachte.
»Hier in der Gegend gibt es keine Campingplätze.«
Der Fremde schwieg.
Nun war Clayton derjenige, der den Blick abwandte. »Sie sollten den Hund besser an der Leine lassen.«
»Soviel ich weiß, gibt es in diesem Bezirk keinen Leinenzwang.«
»Stimmt. Ich meine ja nur – damit Ihr Hund nicht in Gefahr gerät. Auf der Hauptstraße ist viel Verkehr.«
»Ich werde aufpassen.«
»Gut.« Clayton wollte gehen, überlegte es sich aber anders. »Nur noch eine Frage – wie lange sind Sie schon hier unterwegs?«
»Ich bin gerade den Waldweg hochgekommen. Warum fragen Sie?«
Der Ton, in dem er antwortete, irritierte Clayton. Er zögerte für einen Moment. Aber nein – der Typ konnte ihn unmöglich beim Fotografieren beobachtet haben. »Nur so.«
»Kann ich jetzt los?«
»Ja. Klar.«
Clayton schaute ihm nach. Herr und Hund gingen weiter die Straße entlang. Sobald sie außer Sichtweite waren, ging Clayton zurück zu dem Gebüsch, um die Kamera zu holen. Er fasste zielstrebig zwischen die Zweige. Nichts. Das konnte doch nicht wahr sein! Um sich zu vergewissern, dass er sich an der richtigen Stelle befand, ging er ein paar Schritte zurück. Schließlich kniete er nieder und suchte den Boden ab. Er geriet in Panik. Die Kamera gehörte dem Sheriff’s Department. Er hatte sie sich nur geborgt, speziell für diese Unternehmung. Sein Dad löcherte ihn bestimmt mit tausend Fragen, wenn sich herausstellte, dass sie nicht mehr da war. Noch schlimmer würde er natürlich ausrasten, wenn festgestellt wurde, dass auf der Speicherkarte lauter Nacktfotos waren. In puncto Verhaltenskodex konnte sein Vater fürchterlich pedantisch sein.
Inzwischen waren mindestens fünf Minuten vergangen. Clayton hörte das Aufheulen eines Motors. Wahrscheinlich fuhren die Studentinnen weg. Was hatten sie wohl gedacht, als sie seinen Streifenwagen noch dastehen sahen? Aber darüber durfte er sich keine Gedanken machen. Im Moment hatte er andere Probleme.
Die Kamera war weg.
Verloren hatte er sie nicht. Sie war weg. Und das verdammte Ding konnte sich ja nicht ohne fremde Hilfe aus dem Staub gemacht haben. Steckten vielleicht die Mädchen dahinter? Nein, das war unmöglich. Das bedeutete, dass dieser Thai-bolt ihn reingelegt hatte. Nicht zu fassen. Der Typ hatte ihn an der Nase herumgeführt. Ihn, Keith Clayton! Ihm war ja gleich aufgefallen, dass sich dieser Mann merkwürdig benahm, so nach dem Motto: Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Aber damit kam er nicht durch. Gegen Keith Clayton war so ein blöder, stinkender Hippie, der sich mit seinem Hund unterhielt, machtlos. Gegen Clayton konnte er sich nicht behaupten. Jedenfalls nicht in diesem Leben.
Er musste zurück zu seinem Wagen. Vielleicht konnte er Logan Thai-bolt noch einholen und ihn sich gleich vorknöpfen. Aber das wäre erst der Anfang. Die Sache würde ein Nachspiel haben. Jemand wagte es, sich mit ihm anzulegen? Tja, Pech gehabt. Und der Hund? Kein Problem. Ach, das arme Tier verliert die Nerven? Na, dann tschüss, Hundilein. So einfach war das. Deutsche Schäferhunde waren Waffen – mit dieser Begründung kam man vor jedem Gericht im Staat durch. Garantiert.
Oberste Priorität: Thibault finden. Dann: Kamera an sich nehmen. Die weiteren Maßnahmen musste er sich danach überlegen.
Erst als er vor seinem Streifenwagen stand, stellte er fest, dass beide Hinterreifen platt waren.
»Wie heißen Sie noch mal?«
Thibault beugte sich näher zu ihr. Er musste fast schreien, um gegen den Wind im Jeep anzukommen, damit das Mädchen ihn verstand. »Logan Thibault.« Mit dem Daumen deutete er nach hinten. »Und das da ist Zeus.«
Zeus hockte dort, mit hechelnder Zunge, die Nase im Wind, während sich der Wagen dem Highway näherte.
»Schöner Hund. Ich heiße Amy. Und das sind Jennifer und Lori.«
Thibault drehte sich zu den beiden. »Hi.«
»Hallo.«
Sie wirkten alle drei etwas konfus. Kein Wunder, dachte Thibault, nach allem, was sie gerade durchgemacht haben. »Ich finde es sehr nett, dass ihr mich mitnehmt.«
»Das machen wir doch gern. Habe ich Sie richtig verstanden – Sie wollen nach Hampton?«
»Wenn es nicht zu weit ist.«
»Es liegt direkt an der Strecke.«
Thibault hatte, als sich ihm der Jeep von hinten näherte, spontan den Daumen rausgestreckt. Nur gut, dass Zeus bei ihm war! Jedenfalls hielten die Studentinnen sofort an.
Manchmal klappte einfach alles.
Obwohl er es nicht zugab, hatte er die drei gesehen, wie sie am Morgen hierhergekommen waren – er hatte auf dem kleinen Hügel gleich beim Strand übernachtet. Aber als sie begannen, sich auszuziehen, hatte er sich zurückgezogen. Seiner Meinung nach gehörte das, was sie taten, in die Rubrik »Tut keinem weh«. Außer ihm war niemand da, und er selbst hatte nicht die geringsten voyeuristischen Neigungen. Wen interessierte es schon, ob die Mädchen nackt herumrannten oder ob sie alberne Kostüme anzogen? Es ging ihn nichts an, und eigentlich hatte er auch nicht vorgehabt, sich einzumischen – bis er sah, dass der Deputy in einem Streifenwagen des Sheriff’s Departments von Hampton County angefahren kam.
Er konnte den Polizeibeamten durch die Windschutzscheibe gut sehen und ahnte instinktiv, dass hier etwas nicht stimmte. Das merkte man auf den ersten Blick. Was es genau war, konnte er natürlich nicht sagen, aber er überlegte nicht lange, sondern schlug sich in die Büsche, um die Situation im Auge zu behalten. Da sah er, wie der Deputy die Speicherkarte seiner Kamera überprüfte, ganz leise die Tür seines Streifenwagens hinter sich schloss und dann zu dem kleinen Hügel beim Strand schlich. Natürlich konnte es sein, dass er offiziell ermittelte. Aber er machte ein Gesicht wie Zeus, wenn er sich auf ein Leckerli freute. Ein bisschen zu viel gierige Vorfreude im Blick.
Thibault befahl Zeus, zurückzubleiben und zu warten. Er musste aufpassen, dass der Deputy ihn nicht hörte. Der Rest ergab sich von ganz allein. Eine direkte Konfrontation brachte nichts, das wusste er – der Deputy würde behaupten, er sammle Beweismaterial, und seine Aussage hätte viel mehr Gewicht gehabt als die Spekulationen eines Fremden. Ihn körperlich anzugreifen, kam ebenfalls nicht infrage, weil ihm das nur Probleme einbringen würde. Dabei wäre er diesem Polizisten für sein Leben gern kräftig auf die Zehen getreten! Zum Glück – oder bedauerlicherweise, je nach Blickwinkel – tauchte dann das dritte Mädchen auf, der Deputy verlor die Nerven, und Thibault sah, wo er die Kamera hinwarf. Nachdem der Bulle und das Mädchen zu den anderen beiden gegangen waren, holte sich Thibault die Kamera. Er hätte danach spurlos verschwinden können, aber er fand, dass man diesem Mistkerl eine Lektion erteilen sollte. Keine Riesenlektion, nur eine kleine, die aber genügte, um zu verhindern, dass er die Mädchen weiter belästigte. Dann konnte Thibault beruhigt weiterziehen, und dem Deputy war die Laune für den Tag vermasselt. Also lief Thibault rasch zurück und durchstach die Reifen des Polizeiautos. »Ach, da fällt mir ein –«, begann er jetzt. »Ich habe im Wald eine Kamera gefunden.«
»Mir gehört sie nicht. Lori, Jen – hat eine von euch eine Kamera verloren?«
Beide schüttelten den Kopf.
»Ich lasse sie euch trotzdem hier.« Thibault legte den Fotoapparat neben sich auf den Sitz. »Ich habe selbst eine.«
»Die sieht aber ziemlich teuer aus.«
»Ich brauche sie nicht.«
»Vielen Dank.«
Thibault betrachtete Amys Gesicht, das Spiel der Schatten auf ihren Zügen. Sie war sehr attraktiv, mit klaren Gesichtszügen, olivfarbener Haut und braunen Augen mit hellen Punkten. Stundenlang hätte er sie anschauen können.
»Hey … haben Sie fürs Wochenende schon was geplant?« , fragte Amy. »Wir fahren ans Meer.«
»Danke für die Einladung, aber ich kann leider nicht.«
»Sie sind garantiert mit Ihrer Freundin verabredet, stimmt’s?«
»Wie kommen Sie auf die Idee?«
»Das merkt man Ihnen an.«
Er zwang sich, den Blick abzuwenden. »Ja, so was Ähnliches habe ich vor.«
KAPITEL 2
Thibault
Es war schon verblüffend, wenn man darüber nachdachte, was für erstaunliche Wendungen es im Leben eines Menschen geben konnte. Bis vor einem Jahr hätte sich Thibault so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen – er wäre ganz selbstverständlich mitgefahren und hätte das Wochenende mit Amy und ihren Freundinnen verbracht. Und bestimmt täte ihm genau das jetzt auch richtig gut. Aber als die Mädchen ihn am Stadtrand von Hampton absetzten und er ihnen in der glühenden Augusthitze zum Abschied nachwinkte, war er richtig erleichtert. Es strengte ihn maßlos an, die Fassade der Normalität aufrechtzuerhalten.
Seit er vor fünf Monaten aufgebrochen war, hatte er höchstens ein paar Stunden mit anderen Menschen verbracht. Die einzige Ausnahme war der alte Milchfarmer südlich von Little Rock gewesen, der ihn in einem ungenutzten Schlafzimmer im oberen Stockwerk übernachten ließ – nach einem Abendessen, bei dem der Farmer genauso wenig gesprochen hatte wie er. Es war wohltuend, dass der Mann ihn nicht bedrängte oder ausquetschte. Keine Fragen, keine neugierigen Anspielungen. Er akzeptierte es, dass Thibault keine Lust hatte zu reden. Aus lauter Dankbarkeit blieb Thibault mehrere Tage da und half ihm, das Scheunendach zu reparieren, ehe er sich wieder mit seinem schweren Rucksack und mit Zeus im Schlepptau auf den Weg machte.
Bis auf die kurze Fahrt mit den Mädchen war er die ganze Strecke von Colorado bis hierher zu Fuß gegangen. Mitte März hatte er die Schlüssel zu seiner Wohnung bei der Hausverwaltung abgegeben. Seither hatte er acht Paar Schuhe durchgelaufen und sich auf den langen, einsamen Strecken zwischen den Ortschaften mehr oder weniger von Fitnessriegeln und Wasser ernährt. Unterwegs war viel passiert. Gemeinsam mit Zeus hatte er jeder Witterung getrotzt: Sturm, Hagel, Regen und sengender Sonne, von der er auf den Armen Blasen bekam. In Tennessee verdrückte er einmal fünf Stapel Pfannkuchen, nachdem er drei Tage lang so gut wie nichts gegessen hatte. Nicht weit von Tulsa, Oklahoma, sah er am Horizont einen Tornado, und zweimal wäre er fast vom Blitz erschlagen worden. Er machte zahlreiche Umwege, oft ganz spontan, weil er die Hauptstraßen meiden wollte, was seine Reise natürlich enorm verlängerte. Meistens ging er so lange, bis er müde war, und suchte sich dann gegen Ende des Tages eine Übernachtungsmöglichkeit, egal wie komfortabel – das Einzige, was zählte, war, dass er und Zeus ungestört blieben. Am Morgen machten sie sich immer schon vor Anbruch der Dämmerung auf den Weg, damit keiner es mitbekam. Bisher waren sie von niemandem belästigt worden.
Im Durchschnitt legte er pro Tag schätzungsweise dreißig Kilometer zurück. Aber er hielt weder die Zeiten noch die Entfernungen irgendwo fest. Darum ging es ihm nicht. Manche Leute dachten, er mache diese Wanderung, um den Erinnerungen an sein bisheriges Leben zu entkommen – was sehr poetisch klang. Andere nahmen an, dass er einfach nur unterwegs sei, um unterwegs zu sein. Aber beides stimmte nicht. Er ging gern zu Fuß, und er hatte ein Ziel. Eine andere Erklärung gab es nicht. Er wollte selbst bestimmen, wann er aufbrach und wie weit er kam, er wählte das Tempo, das ihm entsprach, und den Ort, der ihm gefiel. Nachdem er vier Jahre lang beim Marine Corps nichts anderes getan hatte, als Befehlen zu gehorchen, fand er diese Form der Freiheit wunderbar.
Seine Mutter machte sich Sorgen um ihn, aber für eine Mutter gehörte sich das so. Oder jedenfalls für seine Mutter. Er rief sie alle paar Tage an, um ihr mitzuteilen, dass es ihm gutging, aber nachdem er aufgelegt hatte, dachte er jedes Mal, dass er sich ihr gegenüber nicht fair verhielt. Er war schon die letzten fünf Jahre nicht daheim gewesen, und vor jedem seiner drei Irak-Aufenthalte hatte sie am Telefon gejammert und ihn angefleht, bitte keine Dummheiten zu machen. Er hatte keine Dummheiten gemacht, aber mehr als einmal war er kurz davor gewesen. Das hatte er ihr nie erzählt – aber sie las ja die Zeitung und wusste einigermaßen Bescheid. »Und jetzt auch das noch!«, jammerte sie an dem Abend, bevor er losging. »So eine verrückte Idee.«
Vielleicht hatte sie Recht. Vielleicht aber auch nicht. Das konnte er noch nicht wissen.
»Was denkst du, Zeus?«
Der Hund blickte hoch, als er seinen Namen hörte, und kam zu ihm getrottet.
»Ja, ich weiß. Du hast Hunger. Ganz was Neues!«
Auf dem Parkplatz eines etwas schäbig aussehenden Motels am Stadtrand blieb Thibault stehen und holte die Schüssel samt dem letzten Rest Hundefutter aus dem Rucksack. Während Zeus begeistert zu fressen begann, schaute Thibault die Straße hinunter.
Hampton war zwar nicht die hässlichste Ortschaft, durch die er bisher gekommen war, aber dass die Stadt besonders einladend wirkte, konnte man auch nicht behaupten. Sie lag am Ufer des South River, etwa fünfundfünfzig Kilometer nordwestlich von Wilmington und der Küste, und auf den ersten Blick schien sie sich kaum von den Tausenden Arbeitersiedlungen zu unterscheiden, wie es sie überall hier im Süden gab und die alle sehr stolz waren auf ihre Geschichte und Tradition. Ein paar Ampeln hingen an schlaffen Leitungen über der Straße und regelten den Autoverkehr zur Brücke, die den Fluss überspannte. An der Hauptstraße reihte sich über eine Strecke von etwa einem Kilometer ein niedriges Backsteingebäude an das andere. Die Schilder in den Fenstern oder über den Türen verkündeten, dass man hier essen und trinken oder Eisenwaren kaufen konnte. Hier und dort wuchsen alte Magnolien, und oft wölbten sich die Gehwege, weil die Wurzeln der Bäume den Asphalt nach oben drückten. In der Ferne entdeckte Thibault einen dieser gestreiften Pfosten, wie man sie früher vor jedem Friseursalon angetroffen hatte, und daneben hockten ein paar alte Männer auf einer Bank. Thibault lächelte. Alles wirkte so hübsch altmodisch wie auf einem Foto aus den fünfziger Jahren.
Auf den zweiten Blick merkte man allerdings, dass dieser Eindruck täuschte. Obwohl Hampton am Fluss lag – oder vielleicht gerade deswegen –, konnte man an den Dächern Verfallserscheinungen feststellen. An den Fundamenten bröckelten die Backsteine, während man weiter oben an den Hausmauern verblasste brackige Flecken entdeckte, die darauf hinwiesen, dass es hier schon katastrophale Überschwemmungen gegeben hatte. Keins der Geschäfte war verrammelt – bis jetzt jedenfalls nicht. Aber da relativ wenige Autos vor den Läden parkten, fragte man sich, wie lang sie noch überleben würden. Die Einkaufszeilen in den Kleinstädten gingen alle dem gleichen Schicksal entgegen wie die Dinosaurier, und wenn diese Stadt so war wie die meisten anderen, durch die er gekommen war, dann gab es auch hier schon längst neue Shoppingmöglichkeiten auf der grünen Wiese, die sich um Supermarktketten wie Wal-Mart oder Piggly Wiggly scharten und das Ende des kommerziellen Stadtzentrums einläuteten.
Trotzdem – es fühlte sich alles sehr seltsam an. Nun war er also tatsächlich in Hampton. Er wusste selbst nicht, wie er sich die Stadt vorgestellt hatte, aber so bestimmt nicht.
Zeus hatte sein Futter aufgefressen. Wie lange würde es dauern, sie ausfindig zu machen? Sie, die Frau auf dem Foto. Die Frau, deretwegen er hierhergekommen war.
Er würde sie finden. Davon war er fest überzeugt. Lächelnd setzte er seinen Rucksack wieder auf. »Kann’s losgehen?«
Zeus legte den Kopf schief.
»Komm, wir suchen uns ein Zimmer. Ich möchte etwas essen und duschen. Und du musst gebadet werden.«
Nach ein paar Schritten merkte Thibault, dass sich Zeus nicht von der Stelle rührte. Er blickte über die Schulter.
»Schau mich nicht so an. Es geht nicht anders – ich muss dich waschen. Du stinkst.«
Stur blieb Zeus sitzen.
»Gut, meinetwegen. Mach, was du willst. Ich gehe.« Er begab sich zur Rezeption, um sich anzumelden. Zeus würde schon kommen. Letzten Endes kam er immer.
Bevor er das Foto gefunden hatte, war sein Leben ganz nach Plan verlaufen. Seine Ziele wählte er immer selbst. Er wollte gut sein in der Schule – und er hatte es geschafft. Er wollte verschiedene Sportarten ausüben – und hatte in allen Höchstleistungen erbracht. Er wollte Klavier und Geige spielen – und auch auf dem Gebiet der Musik war er so weit gekommen, dass er sogar eigene Stücke komponieren konnte. Nach dem Studium an der University of Colorado beschloss er, zu den Marines zu gehen. Der Werbeoffizier freute sich, dass er sich als ganz normaler Soldat meldete und nicht gleich die Offizierslaufbahn einschlagen wollte. Die meisten Leute mit akademischem Abschluss hatten keine Lust, als Gefreite zu dienen, aber genau das war Thibaults Wunsch.
Mit den Angriffen auf das World Trade Center hatte seine Entscheidung wenig zu tun gehabt. Nein, ihm erschien es richtig, zur Armee zu gehen, weil schon sein Vater fünfundzwanzig Jahre lang bei den Marines gewesen war. Auch er hatte als Gefreiter begonnen, und als er das Marine Corps verließ, war er einer der grauhaarigen Sergeants mit kantigem Kinn, die jeden, dem sie begegneten, unglaublich einschüchterten – nur nicht ihre Ehefrau und die Truppen, die sie befehligten. Er behandelte die jungen Männer, als wären sie seine Söhne. Sein höchstes Ziel war es, das versicherte er ihnen immer wieder, sie alle heil, unversehrt und als erwachsene Männer zu ihren Müttern zurückzubringen. Im Lauf der Jahre war Dad bestimmt zu mehr als fünfzig Hochzeiten eingeladen worden, weil die ihm anvertrauten Soldaten sich nicht vorstellen konnten, ohne seinen Segen zu heiraten. Ein guter Kämpfer war er außerdem gewesen. Er hatte in Vietnam den Bronze Star und zwei Purple Hearts bekommen und war später beim Einsatz in Grenada, Panama, Bosnien und im ersten Golfkrieg dabei gewesen. Als Mitglied der Marines machte es ihm selbstverständlich nichts aus, dass er ständig versetzt wurde. Thibault war in seiner Kindheit immer wieder umgezogen und hatte auf Militärstützpunkten überall auf der Welt gelebt. In gewisser Weise erschien Okinawa ihm heimatlicher als Colorado. Sein Japanisch war zwar etwas eingerostet, aber er müsste sicher höchstens eine Woche in Tokio verbringen, und schon könnte er die Sprache wieder genauso fließend sprechen wie damals. Wie sein Vater hatte er von Anfang an vor, sich eines Tages von den Marines zurückzuziehen, aber er wollte anschließend noch eine Weile lang das Leben genießen können. Dad war nur zwei Jahre, nachdem er die blaue Uniform für immer in den Schrank gehängt hatte, an einem Herzinfarkt gestorben. Es war ein massiver Infarkt gewesen, aus heiterem Himmel: Er schaufelte Schnee in der Einfahrt – und eine Minute später war er tot. Das lag nun schon dreizehn Jahre zurück. Thibault war damals fünfzehn.
Der schicksalhafte Tag und das anschließende Begräbnis gehörten für Thibault zu den deutlichsten Erinnerungen an sein Leben vor den Marines. Wenn man als Armeekind aufwächst, verschwimmt vieles und wird nebulös, schon allein deswegen, weil man so oft den Wohnort wechselt. Freunde kommen und gehen, Kleidungsstücke werden verpackt und wieder ausgepackt, alle unnötigen Sachen müssen aussortiert werden, und deshalb bleibt nicht allzu viel hängen. Manchmal ist das hart, aber es gibt einem eine Kraft, die andere Menschen nicht so leicht verstehen. Die Kinder lernen, dass sie sich zwar immer wieder von Personen trennen müssen, dass aber andere ganz problemlos ihren Platz einnehmen werden. Sie lernen, dass jeder Ort seine guten – und seine schlechten – Seiten hat. Man wird sehr schnell erwachsen, wenn man so aufwächst.
Selbst die College-Jahre waren in Thibaults Erinnerung eher diffus. Aber dieses Kapitel in seinem Leben hatte seine eigenen Regeln gehabt: Während der Woche wurde gelernt, am Wochenende wurde gefeiert, vor den Prüfungen musste man büffeln wie verrückt, das Essen im Wohnheim schmeckte mies. Außerdem hatte er zwei Freundinnen, eine sogar etwas länger als ein Jahr. Jeder, der aufs College ging, erzählte die gleichen Geschichten, und nur wenige Erlebnisse hinterließen einen bleibenden Eindruck. Letzten Endes zählte nur das, was man gelernt hatte. Fast kam es Thibault so vor, als hätte sein Leben erst bei der Grundausbildung in Parris Island richtig angefangen. Sobald er dort aus dem Bus stieg, brüllte ihn auch schon der Drill Sergeant an. So ein Ausbildungsoffizier brachte einem sehr schnell bei, dass das bisherige Leben unwichtig war. Jetzt gehörte man ihm, und alles andere zählte nicht mehr. Fünfzig Liegestütz, und zwar sofort, Sportsfreund! College-Ausbildung? Bau das Gewehr zusammen, Einstein. Vater war bei den Marines? Dann putz mal die Latrine, genau wie dein alter Herr früher. Die gleichen Klischees. Laufen, marschieren, stramm stehen, durch den Matsch robben, Wände hochklettern: In der Grundausbildung gab es nichts, womit Thibault nicht gerechnet hatte.
Zugegeben – zum großen Teil funktionierte der Drill. Die Leute wurden fertiggemacht, bis sie so klein mit Hut waren, und dann wurden Marines aus ihnen geformt. So hieß es jedenfalls in der Theorie. Thibault jedoch ließ sich nicht kleinmachen. Er befolgte die Befehle mit gesenktem Kopf, er gehorchte, aber er blieb derselbe Mensch, der er schon vorher gewesen war. Und trotzdem wurde er einer der Marines.
Schließlich kam er zu der Einheit First Battalion, Fifth Marines. Sein Standort war die Militärbasis Camp Pendleton, nicht weit von San Diego, Kalifornien. San Diego war eine Stadt ganz nach seinem Geschmack, fantastisches Wetter, wunderschöne Strände und noch schönere Frauen. Im Januar 2003, gleich nach seinem dreiundzwanzigsten Geburtstag, wurde Thibault nach Kuwait City geschickt, im Rahmen der Operation Iraqui Freedom. Camp Doha, in einem der Industrieviertel von Kuwait City gelegen, existierte schon seit dem ersten Golfkrieg und war sozusagen eine selbstständige Stadt. Es gab dort ein Fitnessstudio und ein Computerzentrum, einen Supermarkt, Restaurants – und endlose Zeltreihen, die sich bis zum Horizont erstreckten. Hier war immer viel los, aber wegen der bevorstehenden Invasion herrschte noch mehr Betrieb als sonst, was zu einem allgemeinen Chaos führte. Die Tage bestanden aus stundenlangen Besprechungen, dazu kamen die strapaziösen Übungen und Manöver für die permanent wechselnden Angriffspläne. Thibault übte bestimmt hundert Mal, wie er im Fall eines Angriffs mit chemischen Waffen blitzschnell seinen Schutzanzug überziehen musste. In der Gerüchteküche brodelte es. Am schlimmsten war natürlich, dass man nie wissen konnte, welches Gerücht stimmte. Jeder hatte etwas anderes gehört, und selbstverständlich immer von jemandem, der einen kannte, der haargenau wusste, was wirklich geplant war. Am einen Tag hieß es, der Einmarsch stehe unmittelbar bevor, am nächsten wurde verkündet, die Invasion werde sich noch eine ganze Weile lang hinauszögern. Erst behaupteten alle, man werde von Norden und von Süden einmarschieren, dann nur von Süden – oder vielleicht gar nicht. Der Gegner verfüge über chemische Waffen, hieß es, und er plane auch, sie einzusetzen. Am folgenden Tag erfuhren sie, dass die Waffen mit Sicherheit nicht zur Anwendung kommen würden, weil der Feind fürchte, die Vereinigten Staaten könnten Atomwaffen einsetzen. Es wurde gemunkelt, dass die Republikanischen Garden der Iraker direkt hinter der Grenze als Selbstmordkommando bereitstünden, andere versicherten glaubhaft, sie würden in der Nähe von Bagdad warten. Oder bei den Ölfeldern. Kurz – niemand wusste etwas Bestimmtes, wodurch natürlich die Fantasie der 150 000 in Kuwait City stationierten Soldaten erst recht zum Blühen gebracht wurde.
Zum größten Teil waren diese Soldaten ja noch Kinder. Das vergaßen die Leute oft. Achtzehn, neunzehn, zwanzig Jahre alt – die Hälfte der Staatsbürger in Uniform hatte nicht einmal das gesetzliche Mindestalter erreicht, um ein Bier kaufen zu dürfen. Sie waren selbstbewusst und gut ausgebildet, und sie wollten unbedingt loslegen – aber andererseits konnten sie die realen Gefahren der bevorstehenden Ereignisse nicht verleugnen. Einige von ihnen würden ihren Einsatz mit dem Leben bezahlen müssen. Darüber redeten manche ganz offen, andere schrieben Briefe für ihre Familien und gaben sie dem Militärpfarrer. Immer wieder gingen jemandem die Nerven durch. Manche konnten nicht schlafen, andere schliefen fast die ganze Zeit. Thibault beobachtete das alles mit dem eigenartigen Gefühl, als wäre er selbst gar nicht betroffen. Willkommen im Krieg, hörte er seinen Vater sagen. Situation normal, also bescheiden.
Thibault war natürlich nicht vollkommen immun gegen die wachsende Anspannung, und wie alle anderen brauchte auch er ein Ventil. Ohne Ablenkung ging es nicht. Er fing an, Poker zu spielen. Das hatte er von seinem Dad gelernt, und er kannte alle Tricks … oder jedenfalls glaubte er das. Leider fand er ziemlich schnell heraus, dass andere die Tricks noch besser beherrschten als er. In den ersten drei Wochen verlor er eigentlich jedes Mal seinen gesamten Einsatz – weil er bluffte, wenn es ratsam gewesen wäre auszusteigen, und weil er ausstieg, wenn er hätte weitermachen sollen. Er verspielte keine großen Summen, und außerdem hätte er das Geld ja sonst nirgends ausgeben können, aber trotzdem war er danach immer tagelang schlechter Laune. Er hasste es, wenn er verlor.
Die einzig sinnvolle Gegenmaßnahme war, morgens vor Sonnenaufgang als Erstes eine lange Strecke zu joggen. Meistens war um diese Tageszeit die Luft sehr kühl. Obwohl er schon einen Monat lang hier im Nahen Osten war, verblüffte es ihn immer wieder, wie kalt es in der Wüste sein konnte. Er lief sehr schnell unter dem funkelnden Sternenhimmel, und sein Atem bildete kleine Wölkchen.
Und dann, eines Morgens, geschah es. Als er sein Zelt aus der Ferne sah, verlangsamte er das Tempo. Die Sonne erschien gerade am Horizont und breitete ihren Goldschimmer über die karge Landschaft. Thibault stemmte die Hände in die Hüften, um den Atemrhythmus wieder zu normalisieren. In dem Moment sah er aus dem Augenwinkel etwas glänzen – ein Foto, das halb von Sand bedeckt war. Als er es aufhob, stellte er fest, dass es laminiert war, vermutlich, um es gegen die Elemente zu schützen. Vorsichtig wischte er den Sand ab. Es war das erste Mal, dass er sie sah.
Die blonde Frau mit dem zauberhaften Lächeln und den blitzenden jadegrünen Augen. Sie trug Jeans und ein T-Shirt mit der Aufschrift LUCKY LADY. Hinter ihr befand sich ein Schild, auf dem HAMPTON FAIR-GROUNDS stand, und neben ihr hockte ein deutscher Schäferhund, der schon etwas grau um die Schnauze war. Im Hintergrund waren viele Leute zu sehen, die sich auf dem Rummelplatz amüsierten, darunter zwei junge Männer, die an einem Ticketschalter warteten. Sie waren nicht genau zu erkennen, aber auch sie trugen T-Shirts mit irgendwelchen Aufdrucken. In der Ferne sah man drei immergrüne Bäume, wie man sie eigentlich überall finden konnte. Auf der Rückseite des Fotos stand in einer sympathischen Handschrift: Pass gut auf dich auf! E.
Diese Details bemerkte er allerdings nicht sofort. Sein erster Impuls war, das Bild wieder wegzuwerfen. Fast hätte er das auch getan, aber dann fiel ihm ein, dass derjenige, der es verloren hatte, es bestimmt zurückhaben wollte. Für irgendjemanden auf dieser Welt war diese Aufnahme wertvoll.
Als er ins Lager kam, hängte er das Foto an das schwarze Brett beim Eingang zum Computerzentrum, weil er sich ausrechnete, dass so gut wie jeder im Lager früher oder später dort vorbeikam. Also zweifellos auch der Besitzer dieses Bildes.
Eine Woche verging. Zehn Tage. Das Foto hing immer noch da. Inzwischen machte seine Einheit jeden Tag Drillübungen, und auch die Pokerspiele wurden allmählich todernst. Manche Männer hatten Tausende von Dollar verspielt – es hieß, ein Gefreiter habe sogar zehntausend verloren. Thibault, der seit seinen demütigenden Anfangserfahrungen nicht mehr gespielt hatte, verbrachte seine Freizeit lieber damit, über die bevorstehende Invasion nachzudenken. Wie würde er wohl reagieren, wenn er unter Beschuss kam? Als er drei Tage vor Beginn der Invasion zum Computerzentrum ging, sah er, dass das Foto immer noch an dem Anschlagbrett hing. Ohne lange zu überlegen, nahm er es ab und steckte es in die Tasche – warum, wusste er selbst nicht.
Victor, sein bester Freund bei den Marines – seit der Grundausbildung war er immer mit ihm zusammen –, überredete ihn an diesem Abend, wieder Poker zu spielen, obwohl Thibault eigentlich keine Lust hatte. Weil er kaum noch finanzielle Reserven besaß, begann er sehr vorsichtig und ging davon aus, dass er höchstens eine halbe Stunde mitmachen würde. In den ersten drei Spielen hatte er Pech, im vierten eine Straße und im sechsten Full House. Die Karten kamen genau so, wie er sie brauchte – Flush, Straße, Full House –, und als der Abend zur Hälfte vorüber war, hatte er seine früheren Verluste wieder wettgemacht. Die Spieler, die anfangs mit dabei gewesen waren, hatten sich längst verabschiedet und waren von anderen abgelöst worden. Thibault blieb. Die nächsten kamen. Thibault blieb. Seine Glückssträhne riss nicht ab, und als der Morgen dämmerte, hatte er mehr Geld gewonnen, als er während des ersten halben Jahres bei den Marines verdient hatte.
Erst als er gemeinsam mit Victor den Spieltisch verließ, wurde ihm bewusst, dass er die ganze Zeit das Foto in der Tasche gehabt hatte. Im Zelt zeigte er Victor das Bild und deutete auf die Aufschrift auf dem T-Shirt. Victors Eltern waren illegale Immigranten und lebten in der Nähe von Bakersfield, Kalifornien. Er selbst war nicht nur fromm, sondern glaubte auch an alle möglichen Vorzeichen. Gewitter, Weggabelungen und schwarze Katzen waren seine Favoriten. Bevor sie nach Kuwait geschickt wurden, erzählte er Thibault von seinem Onkel, der angeblich den bösen Blick hatte. »Wenn er jemanden auf eine bestimmt Art anschaut, ist es nur eine Frage der Zeit, bis derjenige tot ist.« Bei solchen Geschichten hatte Thibault immer das Gefühl, er wäre wieder zehn Jahre alt und würde wie gebannt zuhören, während Victor sein Gesicht von unten mit einer Taschenlampe anstrahlte. Er widersprach aber nie. Alle hatten ihre Marotten. Victor wollte an Vorzeichen glauben? Thibault hatte nichts dagegen einzuwenden. Viel wichtiger war für ihn, dass sein Freund ein erstklassiger Soldat war, den man notfalls auch als Scharfschützen einsetzen konnte und dem Thibault jederzeit sein Leben anvertrauen würde.
ENDE DER LESEPROBE
Die Originalausgabe The Lucky Oneerschien bei Grand Central Publishing / Hachette Book Group USA, New York
Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 10/2010
Copyright © 2008 by Nicholas Sparks Copyright © 2009 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung und Motiv: © Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich Satz: Leingärtner, Nabburg
eISBN 978-3-641-10243-2
www.heyne.de
www.randomhouse.de