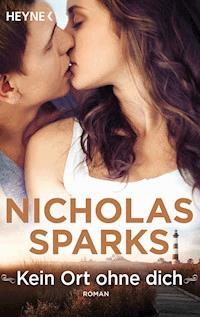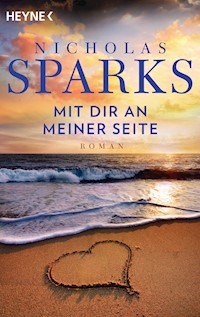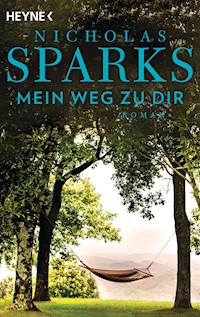
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amanda und Dawson sind erst siebzehn, als sie sich unsterblich ineinander verlieben. Doch ihre Familien bekämpfen die Beziehung, und widrige Umstände trennen sie schließlich endgültig. Fünfundzwanzig Jahre später kehren die beiden in ihr Heimatstädtchen zurück. Sie empfinden noch genauso tief füreinander wie damals. Aber beide sind von Schicksalsschlägen gezeichnet, und die Kluft zwischen ihnen scheint größer denn je zu sein ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Epilog
Dank
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Leseprobe: Nicholas Sparks, The Lucky One - Für immer der Deine/Film
Newsletter-Anmeldung
Orientierungsmarken
Hauptteil
Epilog
Danksagungen
NICHOLAS
SPARKS
Mein Weg zu dir
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Adelheid Zöfel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel THE BEST OF ME
bei Grand Central Publishing/Hachette Book Group USA, New York
Copyright © 2011 by Nicholas Sparks
Copyright © 2012 der deutschen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Redaktion: Lüra – Klemt & Mues GbR
Covergestaltung: zero-media.net
STOCKSY/J. Márquez; FinePic®, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-07368-8V004
www.nicholas-sparks.de
www.heyne.de
Für Scott Schwimer,
einen wunderbaren Freund
Kapitel 1
Gleich nach der Explosion auf der Bohrinsel begannen die Halluzinationen. Es war der Tag, an dem Dawson Cole eigentlich hätte sterben sollen.
Seit vierzehn Jahren arbeitete er auf verschiedenen Ölplattformen, und eigentlich glaubte er, alles, was passieren konnte, schon erlebt zu haben. 1997 hatte er zum Beispiel gesehen, wie ein Hubschrauber bei der Landung die Kontrolle verlor, auf die Plattform krachte und sich in einen glühenden Feuerball verwandelte. Dawson erlitt Verbrennungen zweiten Grades auf dem Rücken, weil er versuchte, ein paar seiner Kollegen zu retten. Dreizehn Personen starben bei dem Unglück – die meisten im Helikopter. Vier Jahre später stürzte ein Kran um, und ein Stück Metall, so groß wie ein Basketball, sauste durch die Luft und hätte beinahe Dawsons Kopf zertrümmert. 2004 war er einer der wenigen Arbeiter, die auf der Bohrinsel blieben, als sich Hurrikan Ivan näherte, mit fast zweihundert Stundenkilometern. Die Wellen waren so gigantisch, dass Dawson überlegte, ob er sich vorsichtshalber schon mal einen Fallschirm schnappen sollte, falls die gesamte Bohrinsel zusammenbrach. Und auch in der Alltagsroutine lauerten überall Gefahren. Man konnte ausrutschen, das Gleichgewicht verlieren, von Bauteilen getroffen werden – ohne Schnittwunden und Prellungen kam kaum einer davon. Dawson war Zeuge von so vielen Knochenbrüchen gewesen, dass er sie nicht mehr zählen konnte. Zweimal war die gesamte Besatzung von einer schlimmen Lebensmittelvergiftung betroffen gewesen, und vor zwei Jahren, also 2007, musste Dawson zuschauen, wie ein Versorgungsschiff unterging, als es sich von der Ölplattform entfernte. Glücklicherweise wurde die Besatzung in letzter Minute von einem Kutter der Küstenwache gerettet.
Aber die Explosion war schlimmer als alles Bisherige. Weil kein Öl austrat – die Sicherheitsventile und andere Schutzmechanismen verhinderten eine größere Umweltkatastrophe –, wurde der Zwischenfall zwar in den Nachrichten nur beiläufig erwähnt und geriet nach ein paar Tagen schon wieder in Vergessenheit. Aber für diejenigen, die dabei waren, und zu ihnen gehörte Dawson, war es ein einziger Albtraum. Das Unglück geschah an einem ganz normalen Vormittag. Alles lief nach Plan. Dawson musste wie immer die Pumpen überwachen. Aus heiterem Himmel explodierte plötzlich einer der Speichertanks. Ehe Dawson begriff, was los war, wurde er von der Wucht der Detonation in einen Schuppen in der Nähe geschleudert. Und sofort begann es überall zu brennen. Weil die gesamte Bohrinsel mit verkrusteten Ölrückständen bedeckt war, verwandelte sie sich rasend schnell in eine Flammenhölle. Dadurch gab es zwei weitere Explosionen, welche die Bohrinsel noch heftiger erschütterten. Dawson erinnerte sich, wie er mehrere Verletzte aus den Flammen zerrte, doch dann kam die vierte Explosion, noch gewaltiger als die ersten drei, und er flog erneut durch die Luft. Was danach geschah, wusste er nicht mehr genau, es waren nur noch undeutliche Bilder, bruchstückhaft – irgendwie landete er im Wasser, und nach menschlichem Ermessen hätte ihn dieser Sturz das Leben kosten müssen. Als er wieder zu sich kam, trieb er im Golf von Mexiko, etwa hundertfünfzig Kilometer südlich von Vermilion Bay, Louisiana.
Wie fast alle anderen hatte er nicht genügend Zeit gehabt, seinen Rettungsanzug überzuziehen oder sich auch nur eine Schwimmweste zu greifen. Zwischen den Wellen erblickte er in der Ferne immer wieder einen dunkelhaarigen Mann, der ihm zuwinkte und ihm signalisierte, er solle nicht aufgeben, sondern in seine Richtung weiterschwimmen. Dawson folgte der Aufforderung. Zu Tode erschöpft kämpfte er gegen den Sog der Tiefe an. Seine Kleidung und die Stiefel zogen ihn nach unten, seine Arme und Beine wurden immer schwächer. Er hatte kaum noch Überlebenschancen. Zwar kam es ihm so vor, als würde er sich dem winkenden Mann nähern, aber weil das Wasser sehr unruhig war, konnte er die Entfernung nicht richtig einschätzen. Da fiel sein Blick auf einen Rettungsring, der nicht weit von ihm zwischen den Trümmern trieb. Mit letzter Kraft klammerte er sich daran. Viel später erst erfuhr er, dass ihn nach vier Stunden ein Versorgungsschiff aufgegriffen hatte, das zur Unfallstelle geeilt war. Zu diesem Zeitpunkt war er schon mehr als anderthalb Kilometer von der Bohrinsel entfernt. Er wurde an Bord gehievt und unter Deck getragen, wo sich noch andere Überlebende aufhielten. Von der Unterkühlung war er wie erstarrt, konnte nur verschwommen sehen und auch nicht klar denken – der Arzt stellte bei ihm eine ziemlich schwere Gehirnerschütterung fest –, aber eines war ihm durchaus bewusst: dass er großes Glück gehabt hatte. Er sah Männer mit grauenvollen Verbrennungen an Armen und Schultern, andere bluteten aus den Ohren oder hielten sich die gebrochenen Gliedmaßen. Die meisten von ihnen kannte er mit Namen. Auf einer Bohrinsel gab es nur eine begrenzte Anzahl von Orten, wo man sich aufhalten konnte – letztlich war so eine Insel eine Art kleines Dorf mitten im Ozean –, und jeder kam irgendwann in die Cafeteria, in den Aufenthaltsraum oder ins Fitnesscenter. Ein Mann allerdings erschien ihm nur vage bekannt. Und ausgerechnet dieser starrte ihn unverwandt an, obwohl er am anderen Ende des Raumes saß. Er hatte dunkle Haare, war etwa vierzig Jahre alt und trug eine blaue Windjacke, die ihm vermutlich jemand vom Schiff geliehen hatte. Und irgendwie wirkte er deplatziert – er sah aus wie ein Büromensch, nicht wie ein Bohrturmarbeiter. Dieser Fremde winkte Dawson zu, was ihn an den Typ erinnerte, den er vorhin im Wasser erspäht hatte – ja, genau, das war er, der Mann aus den Wellen, ganz bestimmt! Und auf einmal spürte Dawson, wie sich ihm die Nackenhaare sträubten. Doch bevor er genauer darüber nachdenken konnte, warum er so seltsam reagierte, legte ihm jemand eine Wolldecke um die Schultern und führte ihn zu dem Tisch, wo ihn ein Sanitätsoffizier erwartete, um ihn zu untersuchen.
Als er anschließend wieder an seinen Platz zurückkam, war der dunkelhaarige Mann verschwunden.
Im Verlauf der nächsten Stunde wurden noch weitere Überlebende an Bord gebracht. Aber wo war der Rest seiner Mannschaft?, fragte sich Dawson, während sich sein Körper langsam erwärmte. Mit manchen Kollegen arbeitete er seit Jahren zusammen, aber nun konnte er sie nirgends entdecken. Es dauerte ziemlich lange, bis er erfuhr, dass vierundzwanzig Menschen ums Leben gekommen waren. Die meisten Leichen wurden gefunden, aber nicht alle. Als Dawson im Krankenhaus lag, um wieder zu Kräften zu kommen, verging kein Tag, an dem er nicht daran denken musste, dass die Angehörigen dieser Toten nie die Möglichkeit haben würden, richtig Abschied zu nehmen.
Seit der Explosion litt er unter massiven Schlafstörungen. Nicht, weil ihn schlimme Träume quälten, sondern weil er ständig das Gefühl hatte, er würde beobachtet. Diese Wahnvorstellung konnte er einfach nicht abschütteln. Es kam ihm vor, als würde er … verfolgt, auch wenn das absolut albern erschien. Selbst tagsüber glaubte er immer wieder, aus dem Augenwinkel etwas zu sehen, was sich heimlich in seiner Nähe bewegte, aber wenn er sich umdrehte, konnte er nichts ausmachen. War er womöglich kurz davor durchzudrehen? Sein Arzt vertrat die Theorie, dass er wegen der Explosion an einer posttraumatischen Stressreaktion litt und dass sein Gehirn immer noch durch die Erschütterung beeinträchtigt war. Das klang logisch, und vom Verstand her leuchtete es Dawson auch ein, aber es überzeugte ihn doch nicht vollständig. Er nickte höflich und bekam ein Rezept für Schlaftabletten, das er nie einlöste.
Ein halbes Jahr lang sollte er bezahlten Urlaub nehmen, während sich die Räder der Justiz und der Bürokratie langsam in Bewegung setzten. Sein Arbeitgeber bot ihm nach drei Wochen einen Vergleich an, und Dawson unterschrieb die Dokumente ohne Zögern. In der Zwischenzeit war er bereits von mindestens zehn Anwälten kontaktiert worden, die ihn alle überreden wollten, sich einer Sammelklage anzuschließen, doch das ging Dawson gegen den Strich. Zu viel Ärger, zu viel Aufwand. Er akzeptierte lieber das Angebot seiner Firma, und als der Scheck eintraf, löste er ihn noch am selben Tag ein. Nun besaß er so viel Geld, dass manche Leute ihn als reich bezeichnet hätten. Den größten Teil transferierte er auf ein Konto auf den Cayman Islands. Von dort ging die Summe auf ein Gesellschaftskonto in Panama, das er mit minimalem bürokratischen Aufwand eröffnet hatte. Erst danach wurde das Geld an sein endgültiges Ziel weitergeleitet. Wie immer war es praktisch unmöglich, den ursprünglichen Besitzer aufzuspüren.
Dawson behielt nur so viel, dass er problemlos seine Miete zahlen und noch ein paar lebenswichtige Dinge finanzieren konnte. Er lebte in einem kleinen Trailer, am Ende einer ungeteerten Straße in einem Außenbezirk von New Orleans. Beim Anblick dieses »Mobilehome« dachten die Leute bestimmt vor allem daran, dass es erstaunlicherweise den Hurrikan Katrina im Jahr 2005 unbeschadet überstanden hatte und nicht fortgeschwemmt worden war – also konnte es nicht ganz schlecht sein. Die äußere Verkleidung war aus Plastik, das schon etwas rissig wurde und verblasste, und es stand auf Betonblöcken, die ursprünglich nur als provisorisches Fundament dienen sollten. Aber mit der Zeit waren sie zur Dauerlösung geworden. Es gab in diesem Trailer ein kleines Schlafzimmer, ein Bad, eine winzige Sitzecke und eine Küche, in der kaum Platz für den Minikühlschrank war. Die Wände waren so gut wie gar nicht isoliert, und im Laufe der Jahre hatte sich wegen der Feuchtigkeit der Boden so verzogen, dass man das Gefühl bekam, ständig auf einer schiefen Ebene zu gehen. Das Linoleum in der Küche bröckelte in den Ecken, der kleine Teppich war völlig abgetreten, und die spärlichen Möbel stammten alle aus irgendwelchen Secondhandläden. Kein einziges Bild hing an der Wand, kein Foto. Dawson wohnte zwar schon fast fünfzehn Jahre dort, aber für ihn war es immer noch nicht sein Zuhause, sondern der Ort, wo er aß und schlief und sich duschte.
Obwohl der Trailer schon so viele Jahre auf dem Buckel hatte, war er makellos gepflegt und sauber. Fast so wie die Häuser im Garden District. Dawson war seit jeher ein Ordnungs- und Sauberkeitsfanatiker gewesen. Zweimal im Jahr reparierte er alle Risse und verkittete die Ritzen, um kleine Nagetiere und Insekten fernzuhalten. Und bevor er zur Bohrinsel zurückkehrte, schrubbte er jedes Mal die Fußböden in Küche und Bad mit Desinfektionsmittel und räumte alles, was verderben oder verschimmeln konnte, aus den Schränken. Was nicht in einer Dose war, vergammelte erfahrungsgemäß in weniger als einer Woche, besonders im Sommer. Normalerweise arbeitete Dawson dreißig Tage hintereinander und hatte anschließend dreißig Tage frei. Wenn er zurückkam, putzte er den Trailer wieder und lüftete gründlich, um nur ja den abgestandenen Geruch loszuwerden.
Es war hier sehr ruhig, und diese Ruhe brauchte Dawson dringend. Er wohnte zwar fast einen halben Kilometer von der Hauptstraße entfernt, und sein nächster Nachbar war sogar noch weiter fort. Aber nach einem Monat auf der Bohrinsel sehnte er sich immer nach dieser Abgeschiedenheit. Er konnte sich einfach nicht an den dauernden Krach auf der Bohrinsel gewöhnen. Überall hämmerte, klirrte und schepperte es. Kräne, die Lieferungen und Vorräte umluden, Hubschrauber, die landeten oder abhoben, das endlose Klacken von Metall auf Metall. Ein dröhnendes Konzert, das nie verstummte. Rund um die Uhr wurde Öl gepumpt, was bedeutete, dass der Lärm auch nicht aufhörte, wenn man schlafen wollte. Dawson bemühte sich stets krampfhaft, ihn auszublenden, aber jedes Mal, wenn er in seinen Trailer zurückkehrte, staunte er über die wunderbar berauschende Mittagsstille, wenn die Sonne hoch am Himmel stand. Morgens konnte er in den Bäumen die Vögel zwitschern hören, und abends, nachdem die Sonne untergegangen war, zirpten die Grillen, die Frösche quakten, und manchmal verfielen Frösche und Grillen ein paar Minuten lang in denselben Rhythmus. Meistens fand Dawson diese Geräuschkulisse sehr beruhigend, doch es konnte auch passieren, dass sie ihn zu stark an seine Heimat erinnerte. Dann zog er sich ins Innere des Trailers zurück, um die Erinnerungen zu vertreiben.
Er aß. Er schlief. Er ging joggen, er trainierte mit Gewichten, und er schraubte an seinem Auto herum. Er unternahm lange Fahrten, ohne ein festes Ziel vor Augen. Hin und wieder angelte er. Abends las er, und gelegentlich schrieb er einen Brief an Tuck Hostetler. Das war alles. Er besaß keinen Fernseher, kein Radio, und in seinem Handy waren nur Nummern gespeichert, die mit der Arbeit zusammenhingen. Einmal im Monat fuhr er zum Supermarkt und kaufte Lebensmittel und Grundvorräte. Außerdem schaute er noch in der Buchhandlung vorbei. Sonst ging er nie ins Zentrum von New Orleans. In den fast fünfzehn Jahren, die er jetzt hier lebte, war er noch nicht einmal in der Bourbon Street gewesen, er war nie durch das French Quarter geschlendert, er hatte kein einziges Mal im Café du Monde einen Kaffee getrunken oder sich in Lafitte’s Blacksmith Shop Bar einen Hurricane Cocktail genehmigt. Statt ins Fitnesscenter zu gehen, trainierte er lieber hinter seinem Trailer unter einer alten Abdeckplane, die er zwischen dem Wagen und den Bäumen aufgespannt hatte. Er ging nicht ins Kino, und selbst am Sonntagnachmittag schaute er nie bei irgendwelchen Freunden vorbei, um mit ihnen Football zu gucken, wenn die New Orleans Saints spielten. Er war zweiundvierzig, und seit seiner Teenagerzeit war er nie mehr mit einem Mädchen ausgegangen.
Die meisten Menschen hätten sicher verständnislos den Kopf geschüttelt, weil sie sich solch ein Leben nur schwer vorzustellen vermochten. Sie kannten Dawson nicht – sie konnten ja nicht ahnen, wie er früher gewesen war. Und Dawson legte größten Wert darauf, dass es so blieb.
Doch dann bekam er an einem warmen Nachmittag Mitte Juni einen Anruf, und die Erinnerung an die Vergangenheit wurde wieder wach. Dawson arbeitete seit knapp neun Wochen nicht mehr, und nach beinahe zwanzig Jahren würde er nun zum ersten Mal wieder in seine Heimat zurückkehren. Bei dem Gedanken daran fühlte er sich ziemlich unwohl, aber er wusste, dass ihm keine andere Wahl blieb. Tuck war für ihn mehr gewesen als ein Freund. Fast eine Art Vaterersatz. Und während Dawson über das Jahr nachdachte, das der große Wendepunkt in seinem Leben gewesen war, nahm er wieder einmal aus dem Augenwinkel eine huschende Bewegung wahr. Als er sich umdrehte, konnte er nichts sehen. Wurde er etwa doch verrückt?
Der Anruf kam von Morgan Tanner, einem Anwalt in Oriental, North Carolina. Mr Tanner teilte Dawson mit, dass Tuck Hostetler gestorben sei. »Es gibt verschiedene Dinge zu regeln, um die Sie sich am besten persönlich kümmern sollten«, erklärte der Anwalt. Nachdem Dawson aufgelegt hatte, beschloss er, einen Flug zu buchen, in einem Bed-and-Breakfast ein Zimmer zu reservieren und dann einen Floristen anzurufen, der Blumenschmuck schicken sollte.
Nachdem er am nächsten Morgen die Tür seines Trailers verriegelt hatte, ging er zu dem Blechschuppen, in dem er immer sein Auto unterstellte. Es war der 18. Juni 2009, ein Donnerstag. Dawson hatte den einzigen Anzug, den er besaß, dabei und einen Seesack, den er mitten in der Nacht gepackt hatte, weil er nicht schlafen konnte. Er öffnete das Vorhängeschloss und rollte die Tür hoch. Helle Sonnenstrahlen fielen auf den Wagen, an dem er seit einer halben Ewigkeit herummontierte. Im Grunde seit der Highschool. Es war ein Ford Mustang, Baujahr 1969, mit Fließheck, genannt Fastback. Ein Auto, nach dem sich die Leute schon umgedreht hatten, als Nixon Präsident war. Auch heute noch erregte es Aufsehen. Es glänzte, als käme es direkt vom Fließband, und im Laufe der Jahre hatten unzählige Leute, die Dawson gar nicht kannte, ihm jede Menge Geld dafür geboten. Doch er hatte immer höflich abgelehnt. »Dieser Fastback hier ist mehr als ein Auto«, sagte er jedes Mal, ohne seine Worte näher auszuführen. Tuck hätte sofort verstanden, was er meinte.
Er warf den Seesack auf den Beifahrersitz, legte den Anzug darüber und setzte sich hinters Steuer. Als er den Zündschlüssel drehte, sprang der Motor mit einem lauten Rumpeln an. Vorsichtig fuhr Dawson aus dem Schuppen und stieg dann noch einmal aus, um das Schloss wieder anzubringen. Im Kopf ging er rasch seine Checkliste durch, ob er auch an alles gedacht hatte. Zwei Minuten später war er schon auf der Hauptstraße. Und nach einer halben Stunde stellte er den Wagen auf dem Langzeitparkplatz des Flughafens von New Orleans ab. Es fiel ihm sehr schwer, ihn dort stehen zu lassen, aber was hätte er sonst tun sollen? Er nahm sein Gepäck und begab sich zielstrebig zum Flughafengebäude, wo ihn am Schalter bereits sein Ticket erwartete.
In der Halle war viel Betrieb. Paare, Arm in Arm. Familien, die ihre Großeltern oder Disney World besuchen wollten. Studenten, die von der Uni nach Hause flogen. Geschäftsreisende zogen ihr Handgepäck hinter sich her und quasselten in ihre Handys. Dawson stand in einer Schlange, die sich extrem langsam bewegte. Als er endlich an die Reihe kam, zeigte er seinen Ausweis vor und beantwortete brav die Sicherheitsfragen, ehe man ihm die Bordkarte aushändigte. Zwischenlandung in Charlotte, in etwa einer Stunde. Ganz okay. In New Bern würde er sich einen Mietwagen nehmen. Dann musste er noch vierzig Minuten fahren. Falls es keine Verspätung gab, würde er am späten Nachmittag in Oriental eintreffen.
Als er auf seinem Platz saß, merkte er erst, wie müde er war. Er konnte sich nicht erinnern, wann er in der Nacht zuvor endlich eingeschlafen war – das letzte Mal hatte er kurz vor vier auf die Uhr geschaut und sich damit getröstet, dass er ja im Flugzeug schlafen konnte. Außerdem gab es für ihn in Oriental kaum Verpflichtungen. Er war ein Einzelkind – seine Mutter hatte sich aus dem Staub gemacht, als er drei Jahre alt war, und sein Dad hatte der Welt einen Gefallen getan, indem er sich systematisch zu Tode gesoffen hatte. Zu seinen übrigen Verwandten pflegte Dawson seit Jahren keinen Kontakt mehr, und auch jetzt wollte er am liebsten nichts mit ihnen zu tun haben.
Eine kurze Reise. Hin und wieder zurück, mehr nicht. Er würde erledigen, was erledigt werden musste, und keine Minute länger bleiben als unbedingt nötig. Klar, er war in Oriental aufgewachsen, aber richtig dazugehört hatte er nie. Die Stadt Oriental, die er kannte, hatte wenig Ähnlichkeit mit dem bunten, fröhlichen Bild, das vom Fremdenverkehrsamt entworfen wurde. Für die meisten Leute, die einen Nachmittag dort verbrachten, war Oriental ein eigenwilliges, interessantes kleines Städtchen, sehr beliebt bei Malern und Dichtern und bei Pensionären, die ihren Lebensabend damit verbringen wollten, auf dem Neuse River zu segeln. Es gab die übliche hübsche Altstadt mit Antiquitätenläden, Kunstgalerien und Cafés, und für einen Ort, der weniger als tausend Einwohner hatte, wurden dort unglaublich viele Festivals gefeiert. Aber das reale Oriental, das Dawson als Kind und Jugendlicher kennengelernt hatte, wurde dominiert von ein paar Familien, die schon seit der Kolonialzeit in dieser Gegend lebten. Menschen wie Richter McCall und Sheriff Harris, außerdem noch Eugenia Wilcox und die Familien Collier und Bennett. Ihnen gehörte das Land, sie bauten das Getreide an, verkauften das Holz und führten die Geschäfte. Sie waren mächtig und einflussreich und betrachteten die Stadt schon immer als ihr Eigentum, ohne dass dies je offiziell ausgesprochen werden musste. Und sie richteten alles so ein, wie es ihnen passte.
Das hatte Dawson ganz direkt zu spüren bekommen, als er achtzehn Jahre alt war. Und später noch einmal, mit dreiundzwanzig. Daraufhin war er für immer fortgegangen. Nirgends in Pamlico County war es leicht, ein Cole zu sein, aber am schlimmsten war es in Oriental. Soviel er wusste, hatte jeder Cole bis hin zu seinem Urgroßvater irgendwann wegen eines Delikts im Gefängnis gesessen. Die Coles waren wegen Körperverletzung und wegen Brandstiftung verurteilt worden, wegen Totschlags und auch wegen Mordes. Das steinige Grundstück mit den Bäumen, das die Großfamilie bewohnte, war wie ein Territorium mit eigenen Gesetzen: eine Handvoll baufällige Hütten, alte Wohnwagen und mehrere Schuppen voller Schrott. Wer konnte, mied dieses Gelände – selbst der Sheriff. Auch die Jäger machten einen großen Bogen um den Bereich, weil sie zu Recht vermuteten, dass das Schild mit der Aufschrift EINDRINGLINGE WERDEN ERSCHOSSEN ernst gemeint war und nicht nur als leere Warnung. Die Coles waren Schwarzbrenner und Drogenhändler, sie waren Alkoholiker und prügelten ihre Frauen, die Eltern misshandelten ihre Kinder. Sie waren Diebe und Zuhälter, und vor allem waren sie gewalttätig. In einem Artikel, der in einer inzwischen nicht mehr existierenden Zeitschrift veröffentlicht worden war, beschrieb man sie als »die brutalste, rachsüchtigste Familie östlich von Raleigh«. Dawsons Vater bildete da keine Ausnahme. Zwischen zwanzig und dreißig verbrachte er den größten Teil der Zeit im Gefängnis, und auch danach war er noch häufig dort anzutreffen, wegen aller möglichen Vergehen. Zum Beispiel attackierte er einmal einen Mann mit einem Eispickel, weil dieser ihm die Vorfahrt genommen hatte. Zweimal gab es eine Mordanklage, aber er wurde freigesprochen, nachdem mehrere Zeugen auf mysteriöse Weise verschwunden waren. Der Rest der Familie war klug genug, ihn nicht zu reizen. Wieso seine Mutter ihn geheiratet hatte, war Dawson unbegreiflich. Er nahm es ihr nicht übel, dass sie fortgelaufen war. Als Kind hätte er am liebsten ebenfalls die Flucht ergriffen. Mehr als einmal hatte er es versucht, aber vergeblich. Er machte seiner Mutter auch keine Vorwürfe, weil sie ihn nicht mitgenommen hatte. Die Männer der Familie Cole waren sehr besitzergreifend, was ihre Nachkommen anging, und Dawson zweifelte keinen Moment daran, dass sein Vater sie gnadenlos verfolgt hätte, um seinen Sohn zurückzuholen. Das hatte er ihm immer wieder versichert, und Dawson fragte ihn lieber nicht, was er getan hätte, wenn seine Mom ihn, den Sohn, nicht herausgerückt hätte. Er kannte die Antwort sowieso.
Wie viele Familienmitglieder lebten heute auf dem Gelände? Er wusste es nicht, aber als er von Oriental fortging, waren es außer seinem Vater und seinem Großvater noch vier Onkel, drei Tanten und sechzehn Cousins und Cousinen gewesen. Inzwischen waren diese natürlich längst erwachsen und hatten selbst Kinder. Nein, Dawson wollte das alles gar nicht so genau wissen. Er war in dieser Welt aufgewachsen, aber was für Oriental galt, das galt auch für die Coles: Er hatte nie richtig dazugehört. Vielleicht hatte es etwas mit seiner Mom zu tun, obwohl er sie ja gar nicht kannte, aber er war anders als die anderen. Seine Cousins gingen zwar in dieselbe Schule wie er, aber er war als Einziger nie in Schlägereien verwickelt, bekam gute Noten, nahm keine Drogen, trank keinen Alkohol, und er war auch nicht dabei, wenn sie abends mit dem Auto durch die Straßen fuhren, um die Innenstadt aufzumischen. Meistens gab er als Begründung an, er müsse die Destille beaufsichtigen. Oder helfen, einen Wagen auseinanderzunehmen, den irgendein Familienmitglied gestohlen hatte. Er verhielt sich immer möglichst zurückhaltend und bemühte sich, nirgends groß aufzufallen.
Doch es war eine Gratwanderung. Die Coles waren zwar eine kriminelle Sippe, aber dumm waren sie deshalb noch lange nicht. Dawson wusste intuitiv, dass er sein Anderssein verbergen musste, so gut es nur ging. Er war wahrscheinlich der einzige Junge in der Geschichte der Schule, der vor einer Klassenarbeit besonders viel lernte, um dann absichtlich eine schlechte Note zu schreiben, und der sein Zeugnis fälschte, damit es nicht so gut aussah, wie es eigentlich war. Er entwickelte Strategien, wie er eine Bierdose heimlich ausleeren konnte, wenn die anderen gerade nicht hinschauten, indem er sie mit einem Messer anstach. Und wenn er die Arbeit als Ausrede benutzte, um nicht mit seinen Cousins losziehen zu müssen, schuftete er oft bis spät in die Nacht. Eine Weile lang funktionierten diese Methoden, aber mit der Zeit bekam die Fassade Risse. Einer seiner Lehrer erwähnte zum Beispiel gegenüber einem Trinkkumpan seines Vaters, dass Dawson der beste Schüler seines Jahrgangs sei. Tanten und Onkel registrierten, dass er als Einziger der Familie nicht mit dem Gesetz in Konflikt kam. In einer Familie, für die Loyalität und Konformität die höchsten Werte waren, galt so etwas als Todsünde.
Besonders sein Vater war deswegen richtig sauer. Er hatte seinen Sohn schon immer geschlagen, seit seiner frühesten Kindheit – am liebsten mit dem Gürtel oder mit einem Riemen. Aber als Dawson zwölf wurde, ging sein Vater noch methodischer vor. Er schlug ihn, bis Rücken und Brust schwarz und blau waren, und kam dann eine Stunde später wieder, um sich den Beinen und dem Gesicht zu widmen. Die Lehrer wussten genau, was in dieser Familie los war, aber sie sagten nichts, weil sie Angst um ihre eigenen Angehörigen hatten. Wenn der Sheriff Dawson auf dem Heimweg von der Schule begegnete, tat er so, als würde er die blauen Flecken und Striemen nicht bemerken. Die Mitglieder der Familie Cole fanden das alles eh völlig normal. Abee und Crazy Ted, Dawsons ältere Cousins, fielen mehr als einmal über ihn her und verprügelten ihn mindestens so gemein wie sein Vater – Abee, weil er fand, dass Dawson es verdient hatte, Crazy Ted einfach so, ohne jeden Grund. Abee war groß und kräftig und hatte Fäuste wie Bärentatzen. Er war gewalttätig und unbeherrscht, aber klüger, als man dachte. Crazy Ted hingegen war einfach nur brutal. Schon im Kindergarten griff er einen anderen Jungen mit einem spitzen Bleistift an, als die beiden sich um einen Schokoriegel stritten, und ehe er in der fünften Klasse aus der Schule ausgeschlossen wurde, hatte er einen seiner Mitschüler krankenhausreif geschlagen. Es hieß, er habe einen Junkie umgebracht, als er noch keine zwanzig war. Dawson kam zu der Überzeugung, dass es besser war, sich gar nicht gegen ihn zu wehren, und lernte stattdessen, wie er sich gegen die Schläge schützen konnte, bis seine Cousins die Aktion langweilig fanden oder müde wurden – oder beides.
Er stieg allerdings nicht in die Familiengeschäfte ein und gab deutlich zu verstehen, dass er dies nie tun werde. Mit der Zeit fand er heraus, dass sein Vater desto heftiger auf ihn eindrosch, je lauter er schrie, also hielt er lieber den Mund. Sein Vater war aggressiv, aber er war auch ein Tyrann, und Dawson spürte instinktiv, dass er wie alle Tyrannen nur an Auseinandersetzungen interessiert war, bei denen er im Voraus wusste, dass er sie gewinnen konnte. Irgendwann würde er, Dawson, stark genug sein, um sich wirkungsvoll zu widersetzen. Dann brauchte er keine Angst mehr vor seinem Vater zu haben. Während die Schläge auf ihn niederprasselten, rief er sich oft ins Gedächtnis, dass seine Mutter unglaublich viel Mut bewiesen hatte, als sie die Verbindung zu dieser Familie abbrach.
Er tat, was er konnte, um den Prozess zu beschleunigen und immer stärker zu werden. Systematisch trainierte er seine Muskeln. Jeden Tag band er einen mit Lumpen gefüllten Sack an einen Baum und boxte mehrere Stunden. Er wuchtete Steine und Maschinenteile hoch. Er machte Liegestütze, Klimmzüge und Sit-ups, konsequent mehrmals täglich. Als er dreizehn war, hatte er sich schon fünf Kilo Muskelmasse antrainiert, mit vierzehn waren es noch zehn mehr. Mit fünfzehn war er fast so groß wie sein Vater. Eines Abends, genau einen Monat nach seinem sechzehnten Geburtstag, kam sein Vater mit dem Gürtel zu ihm, nachdem er den ganzen Abend gesoffen hatte. Dawson baute sich vor ihm auf und riss ihm den Gürtel aus der Hand. »Wenn du mich noch einmal anfasst«, sagte er zu ihm, »bringe ich dich um.«
In jener Nacht suchte er Zuflucht in Tucks Werkstatt. Er wusste nicht, wohin, und etwas anderes fiel ihm nicht ein. Als Tuck ihn am nächsten Morgen dort fand, fragte Dawson ihn, ob er einen Job für ihn habe. Es gab eigentlich keinen Grund, weshalb Tuck ihm helfen sollte, denn er kannte Dawson nicht, und außerdem war sein Überraschungsgast ein Cole. Tuck wischte sich die Hände an seiner roten Bandana ab, dem kleinen, viereckigen Tuch, das er immer in der hinteren Hosentasche stecken hatte, zündete sich eine Zigarette an und dachte nach. Er war damals einundsechzig und seit zwei Jahren verwitwet. Als er anfing zu reden, konnte Dawson seine Alkoholfahne riechen, und die Stimme klang rau und heiser, weil Tuck seit seiner Kindheit Camel ohne Filter rauchte. Seine Aussprache verriet sofort, dass er vom Land kam – genau wie bei Dawson.
»Ich nehme mal an, du kannst Wagen auseinandernehmen, aber kannst du sie auch wieder zusammensetzen?«
»Jawohl, Sir«, antwortete Dawson.
»Musst du heute in die Schule?«
»Jawohl, Sir.«
»Dann komm gleich danach zu mir, damit ich sehe, wie du dich anstellst.«
Also ging Dawson nach der Schule wieder in die Werkstatt und gab sich alle Mühe, Tuck zu beweisen, dass er etwas taugte. Weil es anschließend den ganzen Abend regnete, wollte sich Dawson wieder im Werkstattschuppen verkriechen. Tuck erwartete ihn bereits.
Wortlos zog der alte Mann an seiner Zigarette und musterte den Jungen eingehend. Schließlich ging er ins Haus. Von da an schlief Dawson nie wieder bei seiner Familie. Tuck verlangte keine Miete von ihm, aber Dawson verpflegte sich selbst und kaufte seine eigenen Lebensmittel. Im Laufe der Monate begann er, sich zum ersten Mal in seinem Leben Gedanken über die Zukunft zu machen. Er sparte so viel Geld wie möglich. Nur etwas Luxus leistete er sich: den Fastback-Mustang, den er von einem Schrotthändler kaufte, und eine Vierliterflasche Eistee. Er reparierte den Wagen abends nach der Arbeit, trank seinen Tee und malte sich dabei aus, wie er aufs College ging, was noch kein Cole je getan hatte. Er überlegte, ob er zum Militär gehen oder sich lieber eine eigene Wohnung mieten sollte, aber ehe er eine Entscheidung treffen konnte, erschien plötzlich sein Vater in der Werkstatt, in Begleitung von Crazy Ted und Abee, die beide einen Baseballschläger in der Hand hielten. Außerdem konnte man in Teds Hosentasche die Umrisse eines Messers erkennen.
»Her mit dem Geld, das du verdient hast«, sagte sein Vater ohne lange Vorrede.
»Nein«, entgegnete Dawson.
»Ich wusste, dass du so reagierst, mein Junge. Deshalb hab ich Ted und Abee mitgebracht. Sie können das Geld aus dir rausprügeln – oder du kannst es einfach hergeben. Du schuldest es mir, weil du weggelaufen bist.«
Dawson schwieg. Sein Vater kaute auf einem Zahnstocher herum.
»Tja – ich kann dein mieses kleines Leben sofort beenden, wenn ich will. Dafür brauche ich nur irgendein Verbrechen außerhalb der Stadt, mehr nicht. Vielleicht ein Raubüberfall. Oder Brandstiftung – wer weiß? Dann müssen wir noch für die entsprechenden Beweismittel sorgen. Ein anonymer Anruf beim Sheriff genügt, und schon mahlen die Mühlen des Gesetzes. Du bist abends immer allein hier, niemand kann dir ein Alibi verschaffen, und von heute auf morgen bist du für den Rest deines Lebens umgeben von Beton und Gitterstäben. Dort kannst du meinetwegen vermodern, mich interessiert das kein Stück. Also – her mit der Kohle.«
Dawson wusste, dass sein Vater diese Drohung ernst meinte. Ohne eine Miene zu verziehen, holte er die Scheine aus dem Geldbeutel. Sein Vater zählte nach, spuckte den Zahnstocher auf den Boden und verkündete mit einem breiten Grinsen:
»Nächste Woche bin ich wieder da.«
Dawson schränkte sich von da an noch mehr ein. Er schaffte es trotzdem, eine minimale Summe abzuzweigen, um seinen Wagen weiter restaurieren und sich Eistee kaufen zu können, aber der größte Teil seines Verdienstes ging an seinen Vater. Zwar vermutete er, dass Tuck die Situation durchschaute, aber der alte Mann sprach ihn nie darauf an. Nicht, weil er Angst vor den Coles hatte, sondern weil er fand, dass ihn die Sache nichts anging. Stattdessen kochte er abends immer so viel, dass er nicht alles allein aufessen konnte. Dann kam er mit einem Teller zu Dawson in den Schuppen und sagte: »Ich hab ein paar Reste – falls du was möchtest.« Meistens ging er dann ohne ein weiteres Wort zurück ins Haus. Das war typisch für ihn und für seine Beziehung zu Dawson, und Dawson respektierte dieses Verhalten. Er respektierte Tuck. Der alte Mann war der wichtigste Mensch in seinem Leben geworden, und Dawson konnte sich nicht vorstellen, dass sich das je ändern würde.
Bis zu dem Tag, an dem Amanda Collier in sein Leben trat.
Er kannte Amanda schon lange – in Pamlico County gab es nur eine einzige Highschool, und Dawson war fast die ganze Zeit mit Amanda gemeinsam in die Schule gegangen. Doch erst im Frühling des vorletzten Schuljahrs wechselte er mehr als ein paar Worte mit ihr. Er hatte Amanda schon immer sehr hübsch gefunden, aber damit war er nicht allein. Sie war sehr beliebt, ein Mädchen, das in der Schul-Cafeteria immer von ihren Freundinnen umringt war, während die Jungs um ihre Aufmerksamkeit wetteiferten. Sie war nicht nur Klassensprecherin, sondern auch Cheerleader. Außerdem war sie reich und für Dawson so unerreichbar wie eine Schauspielerin im Fernsehen. Er hätte es nie gewagt, sie anzusprechen, doch dann wurde sie ihm als Partnerin bei den Experimenten im Chemieunterricht zugeteilt.
Nun kämpften sie also gemeinsam mit den Reagenzröhrchen und lernten mit vereinten Kräften für die Klausuren. Dawson merkte, dass Amanda ganz anders war, als er sie sich vorgestellt hatte. Es schien sie überhaupt nicht zu beeindrucken, dass sie eine Collier und er ein Cole war. Das wunderte ihn sehr. Außerdem lachte sie gern und ganz ungekünstelt, und oft grinste sie verschmitzt, als wüsste sie etwas, wovon sonst niemand etwas ahnte. Ihre Haare waren honigblond, ihre Augenfarbe erinnerte an den strahlend blauen Sommerhimmel. Manchmal, wenn sie und Dawson chemische Formeln in ihre Hefte notierten, legte sie ihm die Hand auf den Arm, um ihn auf eine besonders interessante Lösungsmöglichkeit hinzuweisen, und diese Berührung glaubte er noch Stunden später zu fühlen. Während er nachmittags in der Werkstatt arbeitete, musste er dauernd an sie denken. Doch erst im Frühjahr wagte er es, sie zu fragen, ob er sie zu einem Eis einladen dürfe – und danach verbrachten sie bis zum Schuljahresende fast jede freie Minute miteinander.
Das war 1984, und Dawson war siebzehn. Als die Sommerferien vorbei waren, merkte er, dass er sich ernsthaft verliebt hatte, und als die Luft kühler wurde und rote und gelbe Herbstblätter zu Boden schwebten, war er sich sicher, dass er den Rest seines Lebens mit Amanda verbringen wollte – auch wenn es noch so verrückt klang. Im nächsten Schuljahr wurde ihre Beziehung immer intensiver, und schließlich waren sie unzertrennlich. In Amandas Gegenwart fiel es Dawson leicht, an sich selbst zu glauben, und zum ersten Mal im Leben war er zufrieden und optimistisch.
Bis zum heutigen Tag musste er häufig an dieses letzte Jahr denken, das er mit ihr erlebt hatte.
Oder, genauer gesagt: Er dachte immeran sie. An Amanda.
Im Flugzeug suchte er seine Sitznummer. Ein Fensterplatz in der hinteren Hälfte, neben einer jungen Frau, groß, Mitte dreißig, rote Haare, lange Beine. Nicht unbedingt sein Typ, aber ziemlich attraktiv. Sie beugte sich etwas zu dicht zu ihm, als sie ihren Sicherheitsgurt suchte, und entschuldigte sich dann mit einem charmanten Lächeln dafür.
Dawson nickte, aber als er spürte, dass sie sich mit ihm unterhalten wollte, schaute er schnell aus dem Fenster. Er sah, wie sich der Wagen für das Gepäck von der Maschine entfernte – und wieder wanderten seine Gedanken zu Amanda. Die Erinnerungen lagen weit zurück, aber er sah alles noch genau vor sich: wie sie in jenem ersten Sommer im kalten Neuse River schwimmen gingen und wie kühl sich ihre Haut anfühlte, wenn sie sich danach zufällig berührten. Oft saß Amanda auf der Bank, während er in Tucks Werkstatt an seinem Wagen herumschraubte. Sie schlang dann die Arme um die angezogenen Knie, und Dawson wünschte sich nichts sehnlicher, als dass sie immer so bei ihm sitzen würde. Im August war der Wagen endlich fahrbereit, und als erste Unternehmung fuhr Dawson mit Amanda an den Strand. Dort lagen sie auf ihren Handtüchern, die Finger ineinander verschränkt, und unterhielten sich über ihre Lieblingsbücher und welche Filme sie am liebsten mochten. Sie vertrauten sich ihre größten Geheimnisse an und ihre schönsten Träume für die Zukunft.
Natürlich stritten sie sich auch gelegentlich, und Dawson lernte auf diese Weise Amandas temperamentvolle Seite kennen. Diese Auseinandersetzungen zogen sich nie lange hin, denn sie brausten beide ziemlich schnell auf, beruhigten sich jedoch genauso rasch wieder. Oft fingen sie wegen lächerlicher Kleinigkeiten an, sich heftig zu streiten – Amanda konnte ganz schön eigensinnig und stur sein. Ein falsches Wort, und schon flogen verbal die Fetzen. Aber selbst wenn Dawson echt in Wut geriet, bewunderte er sie, ob er wollte oder nicht, einfach weil sie so direkt und aufrichtig reagierte. Er wusste, dass diese Ehrlichkeit darauf beruhte, dass er für sie wichtiger war als sonst für irgendjemanden auf der Welt.
Außer Tuck verstand keiner, was Amanda an Dawson fand. Anfangs versuchten die beiden zwar noch, ihre Beziehung geheim zu halten, doch Oriental war eine typische Kleinstadt, und es wurde viel getratscht. Nach und nach zogen sich Amandas Freundinnen von ihr zurück, und es dauerte nicht lange, bis ihre Eltern alles herausfanden. Dawson war ein Cole, und Amanda war eine Collier – das reichte schon, um bei Mom und Dad Collier für schlechte Stimmung zu sorgen. Zuerst hofften sie noch, dass ihre Tochter nur eine rebellische Phase durchmachte, und beschlossen, die Angelegenheit zu ignorieren. Als das nichts half, ergriffen sie strenge Maßnahmen: Sie kassierten Amandas Führerschein ein und verboten ihr zu telefonieren. Im Herbst bekam sie oft wochenlang Hausarrest und durfte auch am Wochenende nicht ausgehen. Dawson war es sowieso nicht erlaubt, das Haus zu betreten, und als Amandas Vater mit ihm redete – was nur ein einziges Mal vorkam –, beschimpfte er ihn als »asozialen Gangster«. Mutter Collier flehte ihre Tochter immer wieder an, doch bitte mit Dawson Schluss zu machen, und im Dezember verkündete der Vater schließlich, er werde von nun an mit Amanda kein Wort mehr wechseln.
Aber alle Verbote und Vorwürfe halfen nichts, im Gegenteil, sie bewirkten nur, dass Amanda und Dawson noch enger zusammenrückten. Und wenn er in aller Öffentlichkeit ihre Hand nahm, drückte sie sie ganz fest, als wollte sie zeigen, dass keiner es wagen sollte, sie beide voneinander zu trennen. Aber Dawson war nicht naiv, und obwohl Amanda ihm unendlich viel bedeutete, hatte er trotzdem immer das Gefühl, dass ihre gemeinsame Zeit irgendwann zu Ende sein würde. Die ganze Welt hatte sich gegen sie verschworen. Seit Dawsons Vater von Amanda erfahren hatte, erkundigte er sich jedes Mal nach ihr, wenn er das Geld abholte. Sein Tonfall war nie offen bedrohlich, doch sobald Dawson hörte, wie er ihren Namen aussprach, lief es ihm kalt über den Rücken.
Im Januar wurde Amanda achtzehn. Obwohl ihre Eltern so strikt gegen ihre Beziehung mit Dawson waren, brachten sie es nicht übers Herz, ihre Tochter hinauszuwerfen. Was sie dachten, interessierte Amanda allerdings nicht mehr – jedenfalls sagte sie das Dawson gegenüber. Wenn sie sich wieder einmal furchtbar mit ihren Eltern gestritten hatte, kletterte sie mitten in der Nacht heimlich aus dem Fenster und floh zu Dawson in die Werkstatt. Da konnte es natürlich sein, dass er schon schlief – er rollte immer auf dem Fußboden des Bürobereichs seine Matte aus. Aber weil Amanda unbedingt mit ihm reden musste, rüttelte sie ihn wach, und sie gingen gemeinsam hinunter zum Fluss, um sich auf einen der niedrigen Äste der uralten Eiche zu setzen. Dawson schlang dann zärtlich den Arm um sie, und während die Rotbarben im Fluss sprangen, berichtete ihm Amanda im Mondlicht vom Streit mit ihren Eltern, oft mit zitternder Stimme. Sie war sehr rücksichtsvoll ihm gegenüber und wollte ihn nicht kränken, indem sie alles zitierte, was über ihn gesagt worden war. Dafür liebte er sie, aber er wusste natürlich trotzdem genau, was ihre Eltern von ihm hielten. Und als sie ihm eines Abends wieder einmal unter Tränen von einer Auseinandersetzung erzählte, fragte er sie leise, ob es nicht leichter für sie wäre, wenn sie sich nicht mehr treffen würden.
»Meinst du das ernst?«, fragte Amanda ihn mit erstickter Stimme.
Er zog sie noch enger an sich. »Ich möchte nur eins: dass du glücklich bist«, flüsterte er.
Amanda schmiegte sich an ihn und lehnte den Kopf an seine Schulter. Und während er sie so nahe bei sich spürte, wurde ihm wieder einmal bewusst, wie grausam es für ihn war, als ein Cole auf die Welt gekommen zu sein.
»Am glücklichsten bin ich, wenn ich mit dir zusammen bin«, murmelte sie.
Und an jenem Abend schliefen sie das erste Mal miteinander.
Seither waren mehr als zwei Jahrzehnte vergangen, doch Dawson trug die Erinnerung an diese Nacht und an Amandas Worte immer noch in seinem Herzen. Was sie gesagt hatte – dass sie am glücklichsten sei, wenn sie mit ihm zusammen sein konnte –, das galt umgekehrt auch für ihn. Sie hatte auch für ihn gesprochen.
Nach der Landung in Charlotte nahm Dawson seinen Seesack samt Anzug und durchquerte mit raschen Schritten die Ankunftshalle. Er merkte kaum, was sich um ihn herum abspielte, weil er so mit den Erinnerungen an die letzten Monate mit Amanda beschäftigt war. Im Frühjahr erhielt sie damals die Mitteilung, dass sie an der Duke University in Durham angenommen worden sei, wovon sie schon als kleines Mädchen geträumt hatte. Das Gespenst ihrer Abreise, verbunden mit der Tatsache, dass ihre Familie und ihre Freundinnen ihre Beziehung immer noch nicht akzeptierten – dies alles verstärkte bei Amanda und bei Dawson die Sehnsucht, möglichst viel Zeit gemeinsam zu verbringen. Sie amüsierten sich stundenlang am Strand und unternahmen tolle Autofahrten, immer mit lauter Radiomusik. Oder sie hingen einfach nur in Tucks Werkstatt herum. Sie schworen beide, dass sich zwischen ihnen nichts ändern werde, wenn Amanda fortging – entweder würde Dawson zu ihr nach Durham fahren, oder sie würde ihn besuchen kommen. Amanda zweifelte keine Minute daran, dass sie es irgendwie schaffen konnten.
Doch Amandas Eltern hatten ihre eigenen Pläne. An einem Samstagmorgen im August, eine gute Woche vor ihrer Abreise nach Durham, fingen sie ihre Tochter ab, ehe diese das Haus verlassen konnte. Ihre Mom war diejenige, die redete, aber Amanda wusste, dass ihr Vater alles, was sie sagte, uneingeschränkt unterstützte.
»Wir haben dieses Theater lange genug mit angesehen – jetzt reicht es«, begann ihre Mutter. Und mit verblüffend ruhiger Stimme eröffnete sie ihrer Tochter, falls sie die Absicht habe, sich weiterhin mit Dawson zu treffen, müsse sie im September ausziehen und von da an alle ihre Rechnungen selbst bezahlen. Auch das College würden sie Amanda nicht finanzieren. »Wir sehen nicht ein, wieso wir Geld für ein Studium ausgeben sollen, wenn du sowieso die Absicht hast, dein Leben wegzuwerfen.«
Als Amanda protestieren wollte, unterbrach ihre Mutter sie sofort.
»Er wird dich ruinieren, Amanda. Du bist noch zu jung, um das zu begreifen. Wenn du deine Entscheidungen selbstständig und unabhängig von uns treffen willst, dann musst du konsequent sein und die gesamte Verantwortung übernehmen. Mach dir deine Zukunft ruhig kaputt und bleib bei Dawson – wir werden dich nicht daran hindern. Aber wir wollen dich auch nicht dabei unterstützen.«
Ohne ein Wort zu erwidern, rannte Amanda aus dem Haus. Für sie gab es nur noch einen Gedanken: Sie musste mit Dawson sprechen, und zwar gleich. Als sie zur Werkstatt kam, weinte sie schon so hemmungslos, dass sie kein Wort herausbrachte. Dawson drückte sie an sich und hörte sich geduldig ihr unzusammenhängendes Gestammel an, bis sie endlich aufhörte zu schluchzen.
Ihr Gesicht war nass von tausend Tränen. »Wir ziehen zusammen«, stieß sie hervor.
»Wo sollen wir wohnen? Hier? In der Werkstatt?«
»Keine Ahnung. Irgendwo. Uns wird schon etwas einfallen.«
Dawson schwieg für eine Weile, den Blick auf den Boden gerichtet. »Du musst aufs College gehen«, sagte er schließlich.
»Das College ist mir egal – es interessiert mich nicht!«, rief Amanda. »Das Einzige, was mich interessiert, bist du.«
Dawson ließ die Arme sinken. »Du bist mir auch wichtiger als alles andere. Und genau deswegen darf ich dir diese Chance nicht nehmen.«
Amanda schüttelte den Kopf. »Du nimmst mir doch nichts! Es sind meine Eltern, die mir alles wegnehmen! Sie behandeln mich wie ein kleines Mädchen.«
»Ja, aber sie tun es meinetwegen. Das wissen wir beide.« Er kickte den Staub auf. »Wenn man jemanden liebt, muss man auch loslassen können, nicht wahr?«
Jetzt blitzten ihre Augen wütend. »Und wenn man dann trotzdem wieder zusammenkommt, ist es vorbestimmt? Glaubst du das tatsächlich? Das ist doch nur ein blödes Klischee! Das sind doch nicht wir!« Sie grub die Finger in seinen Arm. »Wir finden eine Lösung, ganz sicher. Ich kann als Bedienung arbeiten oder irgendetwas, und wir mieten uns gemeinsam eine Wohnung.«
Dawson bemühte sich, ruhig zu bleiben. »Wie sollen wir das machen? Denkst du vielleicht, mein Vater hört auf mit seinen Schikanen?«
»Wir können in eine andere Stadt ziehen.«
»Wohin? Mit welchem Geld? Ich habe nichts! Willst du das denn nicht sehen?« Er wartete einen Moment lang, und als Amanda schwieg, fuhr er fort: »Ich bin doch nur realistisch. Wir sprechen über dein Leben. Und … ich gehöre nicht mehr dazu.«
»Was redest du für einen Quatsch!«
»Ich sage nur, dass deine Eltern recht haben.«
»Aber das kannst du doch nicht ernst meinen!«
In ihrer Stimme schwang so etwas wie Furcht mit. Ach, wie gern hätte Dawson sie zärtlich in die Arme geschlossen, doch er trat ganz bewusst einen Schritt zurück. »Geh nach Hause«, sagte er.
Sie kam näher. »Dawson –«
»Nein!«, rief er und wich noch weiter zurück. »Du hörst mir nicht zu. Es ist aus! Wir haben alles versucht, aber es hat nicht funktioniert. Das Leben geht weiter.«
Amanda wurde totenblass, ihr Gesicht leer und ausdruckslos. »Soll das heißen, du machst mit mir Schluss?«
Statt zu antworten, zwang er sich, ohne einen Blick zurück in die Werkstatt zu gehen. Er wusste, wenn er Amanda anschaute, konnte er nicht konsequent bleiben. Und das durfte er ihr nicht antun. Das wollte er ihr nicht antun. Er steckte den Kopf unter die offene Kühlerhaube seines Autos, damit sie nicht seine Tränen sah.
Als Amanda endlich gegangen war, ließ sich Dawson auf den staubigen Betonfußboden neben seinem Wagen sinken und blieb viele Stunden reglos liegen, bis Tuck aus dem Haus kam und sich zu ihm setzte. Lange sagte der alte Mann kein Wort.
»Du hast dich von ihr getrennt«, murmelte er dann.
»Ich musste es tun.« Mehr brachte Dawson nicht über die Lippen.
Tuck nickte. »Verstehe.«
Die Sonne stieg immer höher, und außerhalb der Werkstatt lag über allem ein Schleier der Stille. Der Totenstille.
»Habe ich das Richtige getan?«
Tuck kramte umständlich eine Zigarette aus der Tasche, als wollte er Zeit gewinnen.
»Keine Ahnung. Zwischen euch beiden ist etwas Besonderes, das kann keiner leugnen. Etwas Magisches. Und wenn da was Magisches ist, kann man es schwer vergessen.« Tuck klopfte ihm auf den Rücken und ging. So viel am Stück hatte er noch nie gesprochen. Dawson kniff die Augen zusammen und blinzelte ins Sonnenlicht. Wieder kamen ihm die Tränen. Er wusste, dass Amanda für immer das Beste in seinem Leben gewesen sein würde, jener Teil seines Ichs, der ihm die Möglichkeit gab, der Mensch zu sein, der er sein wollte.
Was er nicht ahnen konnte, war, dass er Amanda nicht mehr sehen und kein Wort mehr mit ihr wechseln würde. Im Laufe der nächsten Woche zog sie nach Durham, in ein Studentenwohnheim der Duke University. Und einen Monat später wurde Dawson verhaftet.
Er verbrachte die nächsten vier Jahre hinter Gittern.
Kapitel 2
Amanda stieg aus ihrem Auto und starrte wie gebannt auf das kleine Haus am Rand von Oriental, in dem Tuck gewohnt hatte. Nach drei Stunden Fahrt war es angenehm, sich ein bisschen die Beine zu vertreten. Gegen die Verspannungen im Nacken und in den Schultern half es allerdings nicht viel – ein Überbleibsel ihrer Auseinandersetzung mit Frank an diesem Morgen. Frank wollte einfach nicht kapieren, dass sie unbedingt zu dem Begräbnis fahren musste. Im Grunde konnte sie seine Reaktion ja verstehen. Sie war seit fast zwanzig Jahren mit ihm verheiratet, und in der ganzen Zeit hatte sie kein einziges Mal den Namen Tuck Hostetler erwähnt. An Franks Stelle hätte sie sich garantiert auch aufgeregt.
Aber bei dem Streit war es eigentlich gar nicht um Tuck oder um ihre Geheimniskrämerei gegangen. Auch nicht darum, dass sie wieder einmal ein langes Wochenende fern von der Familie verbrachte. Tief in ihrem Inneren wussten sie das beide. Nein, es war einfach eine Fortsetzung der ewig gleichen Debatte, die sie seit zehn Jahren führten und die jedes Mal nach demselben Schema ablief. Nicht laut, nicht gewalttätig – zum Glück war Frank dafür nicht der Typ –, aber aussichtslos. Am Ende hatte sich Frank kurz und schroff entschuldigt, bevor er zur Arbeit ging. Wie üblich verbrachte Amanda den Rest des Morgens und den ganzen Nachmittag damit, den Streit irgendwie abzuschütteln. Sie konnte nichts an der Situation ändern, und inzwischen hatte sie gelernt, sich gegen die Wut und die Angst, die seit Langem ihre Beziehung definierten, zu wappnen.
Während der Fahrt nach Oriental hatten sich zwei ihrer Kinder, Jared und Lynn, telefonisch bei ihr gemeldet, und für diese Ablenkung war sie sehr dankbar gewesen. Die beiden hatten gerade Sommerferien, und seit Wochen war das Haus erfüllt von dem ständigen Trubel, den die Anwesenheit von Jugendlichen mit sich brachte. Tucks Begräbnis passte von außen betrachtet ganz gut in Amandas Planung: Jared und Lynn wollten das Wochenende sowieso mit Freunden verbringen, Jared mit einem Mädchen namens Melody und Lynn mit einer Freundin von der Highschool – sie planten, auf dem Lake Norman, an dessen Ufer die Eltern der Freundin ein Haus besaßen, segeln zu gehen. Und Amandas Tochter Annette – der »wunderbare Unfall«, wie Frank sich immer ausdrückte – war zwei Wochen im Ferienlager. Bestimmt hätte sie auch schon längst angerufen, aber im Camp waren Handys verboten. Das war auch gut so, denn sonst hätte sich die kleine Schnatterente garantiert morgens, mittags und abends bei ihrer Mutter gemeldet.
Der Gedanke an ihre Kinder zauberte ein Lächeln auf Amandas Gesicht. Sie arbeitete zwar ehrenamtlich im Kinderkrebszentrum des Duke University Hospital, aber ihr Leben drehte sich doch zuerst und vor allem um ihren Nachwuchs. Seit Jareds Geburt war sie Hausfrau und Mutter. Im Grunde gefiel ihr diese Rolle, aber ein Teil von ihr ärgerte sich trotz allem gelegentlich über die Einschränkungen. War sie nicht doch ein bisschen mehr als Ehefrau und Mutter? Sie hatte auf Lehramt studiert, und eine Weile hatte sie sogar daran gedacht zu promovieren, damit sie an einer der Universitäten im Umkreis lehren konnte. Nach dem College-Abschluss hatte sie angefangen, in einer Grundschule zu unterrichten … doch dann hatte das Leben andere Pläne für sie gehabt. Heute, mit zweiundvierzig, sagte sie manchmal scherzhaft, sie könne es kaum erwarten, endlich erwachsen zu werden und sich zu überlegen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen sollte.
Manche Leute hätten vielleicht von einer Midlife-Crisis gesprochen, doch Amanda glaubte nicht, dass diese Beschreibung auf sie zutraf. Sie verspürte ja nicht plötzlich den Wunsch, einen Sportwagen zu kaufen oder zum Schönheitschirurgen zu rennen oder sich auf eine Insel in der Karibik abzusetzen. Ihr war auch nicht langweilig – die Kinder und die Arbeit im Krankenhaus hielten sie auf Trab und sorgten für genug Abwechslung. Sie hatte nur immer wieder den Eindruck, dass sie die Person, die sie hätte werden sollen, aus den Augen verloren hatte, und sie war sich nicht sicher, ob sie je die Möglichkeit haben würde, diese Person wiederzufinden.
Lange Zeit hatte sie sich als Glückskind betrachtet, und dabei war Frank ein zentraler Faktor gewesen. Sie hatte ihn im zweiten Studienjahr bei einer Studentenparty an der Duke University kennengelernt. Obwohl das Fest furchtbar laut und chaotisch war, fanden Frank und sie ein ruhiges Plätzchen, wo sie bis in die frühen Morgenstunden saßen und redeten. Er war zwei Jahre älter als sie, ernst, intelligent, und gleich an diesem ersten Abend war ihr klar gewesen, dass Frank Erfolg haben würde – gleichgültig, für welchen Beruf er sich entschied. Das genügte, um ihr Interesse zu wecken. Im folgenden August begann Frank seine Fachausbildung als Zahnarzt, und zwar in Chapel Hill. Während der nächsten zwei Jahre besuchten sie sich regelmäßig, und es erschien ihnen selbstverständlich, dass sie zusammenbleiben würden. Sie verlobten sich, und im Juli 1989, nur wenige Wochen nach Amandas Examen, heirateten sie.
Die Hochzeitsreise ging auf die Bahamas, und danach begann Amanda zu unterrichten. Aber als im nächsten Sommer Jared geboren wurde, ließ sie sich beurlauben. Achtzehn Monate später kam Lynn, und aus der Beurlaubung wurde ein Dauerzustand. Frank hatte inzwischen genügend Geld zusammengeborgt, um eine eigene Praxis eröffnen und ein kleines Haus in Durham kaufen zu können. In diesen ersten Jahren lebten sie sehr sparsam und anspruchslos. Frank wollte es aus eigener Kraft schaffen und weigerte sich, von seiner oder ihrer Familie finanzielle Unterstützung anzunehmen. Nachdem alle Rechnungen bezahlt waren, konnten sie von Glück reden, wenn sie noch genug Geld übrig hatten, um sich am Wochenende einen Film auszuleihen. Sie gingen nur sehr selten in ein Restaurant, und als ihr Auto den Geist aufgab, saß Amanda einen ganzen Monat lang im Haus fest, bis sie sich endlich die Reparatur leisten konnten. Sie schliefen immer mit zwei Bettdecken, um Heizkosten zu sparen. Das war zwar alles ziemlich anstrengend und stressig, aber wenn Amanda an diese Phase zurückdachte, war ihr klar, dass es die glücklichsten Jahre ihrer Ehe gewesen waren.
Franks Praxis florierte, und in vielerlei Hinsicht entwickelte sich in ihrem Leben eine pragmatische Alltagsroutine. Frank arbeitete, Amanda kümmerte sich um Haus und Kinder. Ihr drittes Kind, Bea, kam zur Welt, als sie gerade das kleine Haus verkauften und in ein geräumigeres zogen, das sie sich in einem begehrteren Stadtviertel gebaut hatten. Danach waren sie extrem beschäftigt. Franks Praxis wuchs und wuchs. Amanda brachte Jared mit dem Auto in die Schule und holte ihn wieder ab, sie fuhr mit Lynn in den Park oder zu Verabredungen mit anderen Kindern, während Bea friedlich in ihrem Kindersitz hockte und plapperte. In diesen Jahren dachte Amanda darüber nach, ob sie noch einmal zur Universität gehen sollte, sie ließ sich sogar verschiedene Master-Programme schicken, weil sie erwog, die entsprechenden Kurse zu besuchen, wenn Bea in den Kindergarten kam. Aber als Bea starb, verschwand dieser Ehrgeiz. Ohne es je laut auszusprechen, schob Amanda die Unterlagen für die Universität beiseite und verstaute sie samt den Bewerbungsformularen ganz hinten in ihrer Schreibtischschublade.
Die unerwartete Schwangerschaft mit Annette bestärkte Amanda in ihrem Entschluss, nicht wieder zu studieren. Jetzt wollte sie sich erst recht dem Familienleben widmen. Sie konzentrierte sich voll und ganz auf die Aktivitäten und Verpflichtungen ihrer Kinder. Das half ihr, die Trauer in Schach zu halten. Für Jared und Lynn verblasste die Erinnerung an ihre kleine Schwester mit der Zeit, und das Leben konnte wieder seinen gewohnten Gang gehen. Dafür war Amanda außerordentlich dankbar. Und Annette war ein fröhliches Kind, sie brachte viel Freude ins Haus, und hin und wieder gelang es Amanda, sich einzubilden, dass sie eine ganz normale, liebevolle Familie waren, unberührt von allem Tragischen.
Was ihre Ehe mit Frank betraf, fiel es ihr allerdings sehr schwer, an Harmonie und Glück zu glauben.
Amanda hatte nie die Illusion gehabt, dass man als Ehepaar ständig im siebten Himmel schwebte. Wenn zwei Menschen zusammenlebten, gab es immer ein Auf und Ab, und dadurch kam es zwangsläufig zu Reibungen und auch zu heftigen Auseinandersetzungen, selbst wenn sich ein Paar noch so sehr liebte. Es konnte gar nicht anders sein. Die Zeit war ebenfalls ein wichtiger Faktor. Wenn man sich sehr gut und schon sehr lange kannte, war das zwar wunderbar, aber die Leidenschaft und die Spannung ließen unvermeidlich nach. Alles wurde berechenbar und vertraut, es gab eigentlich keine Überraschungen mehr, man hatte keine neuen Geschichten zu erzählen, und oft konnte man den Satz des anderen zu Ende führen, ohne viel zu überlegen. Sie und Frank waren an dem Punkt, an dem ein einziger Blick so viel mitteilte, dass Worte weitgehend überflüssig wurden. Doch Beas Tod hatte sie beide verändert. Für Amanda erwuchs aus dieser Erfahrung der Wunsch, sich noch stärker im Krankenhaus zu engagieren. Frank hingegen, der schon immer gern ein Glas Wein getrunken hatte, entwickelte sich zum Alkoholiker.
Amanda kannte den Unterschied. Sie hatte nichts dagegen, dass man ausgelassen feierte. Während des Studiums hatte auch sie das eine oder andere Mal ein paar Schluck zu viel getrunken, und einen guten Wein zum Abendessen wusste sie durchaus zu schätzen. Gelegentlich genehmigte sie sich sogar noch ein zweites Glas, aber das genügte ihr dann. Bei Frank war das anders. Ursprünglich wollte er nur den Schmerz mildern, aber inzwischen hatte er keine Kontrolle mehr über seinen Alkoholkonsum.
Im Rückblick dachte sie oft, sie hätte es merken müssen. Im College hatte er gern gemeinsam mit seinen Freunden Basketballspiele angeschaut und dazu gebechert. Bei der Vorbereitung auf das Zahnarztexamen trank er nach den Kursen zur Entspannung immer gern zwei, drei Bier. Aber in den dunklen Monaten während Beas Krankheit wurde aus zwei, drei Bier bald ein Sixpack am Abend. Und nach ihrem Tod wurden es zwei Sixpacks. Als sich Beas Todestag das zweite Mal jährte und Annette schon unterwegs war, trank Frank bis zum Exzess, selbst wenn er am nächsten Morgen arbeiten musste. Er kam oft nach Mitternacht völlig betrunken ins Schlafzimmer getorkelt und begann so laut zu schnarchen, dass Amanda im Gästezimmer schlafen musste. Der Alkohol war der wahre Grund, weshalb sie sich heute Morgen gestritten hatten. Nicht Tuck.
Amanda kannte längst die ganze Palette. Manchmal war nur Franks Aussprache beim Essen oder bei einem Grillabend etwas undeutlich. Es konnte allerdings auch vorkommen, dass er besoffen und bewusstlos im Schlafzimmer auf dem Fußboden lag. Doch er galt nach wie vor als erstklassiger Zahnarzt, fehlte nur ganz selten bei der Arbeit und bezahlte seine Rechnungen absolut pünktlich – deshalb glaubte er nicht, dass er ein Problem hatte. Er wurde durch den Alkohol weder ausfallend noch aggressiv – auch deshalb glaubte er nicht, dass er ein Problem hatte. Und er trank immer nur Bier – deshalb konnte er doch gar kein Problem haben!
Doch Frank hatte ein Problem und entwickelte sich langsam, aber sicher zu einem Mann, den Amanda niemals geheiratet hätte. Sie vermochte nicht mehr zu zählen, wie oft sie seinetwegen schon geweint hatte. In regelmäßigen Abständen versuchte sie, mit ihm über das Thema zu sprechen, und sie ermahnte ihn, doch bitte an die Kinder zu denken. Sie flehte ihn immer wieder an, mit ihr zu einem Paartherapeuten zu gehen, um gemeinsam eine Lösung zu suchen. Sie tobte vor Wut, weil er so unglaublich egoistisch war. Dann wieder ignorierte sie ihn tagelang und zwang ihn, im Gästezimmer zu schlafen. Und wenn sie gar nicht mehr weiterwusste, betete sie zu Gott. Einmal im Jahr nahm sich Frank ihre Bitten zu Herzen und hörte für eine Weile auf zu trinken. Aber nach ein paar Wochen gönnte er sich doch wieder ein Bier zum Abendessen. Nur eins. Am ersten Abend blieb es dabei, und alles war okay. Vielleicht auch noch am nächsten. Doch er hatte die Tür aufgestoßen – der Dämon kehrte zurück. Die Spirale drehte sich unaufhaltsam. Und Amanda begann erneut zu bitten und zu flehen, genau wie vorher. Wieso konnte er dem Impuls nicht widerstehen? Und warum weigerte er sich, einzusehen, dass diese Sucht ihre Ehe zerstörte?