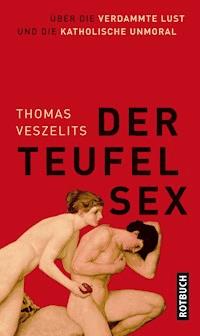Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Neckermanns ist eine faszinierende Saga voll bislang unbekannter Details. Sie handelt vom Aufstieg und spektakulären Fall einer Unternehmerfamilie, von ihren brisanten Verstrickungen in die deutsche Geschichte, von ihren Geheimnissen und Tragödien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2005
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
|5|Für Dieter
|11|Prolog
»Adel ohne Adelstitel«
Zum ersten Mal habe ich den Namen Neckermann im Alter von 15 Jahren gehört. Damals lebten wir noch hinter dem Eisernen Vorhang. Ich kann mich gut an das Gesicht meiner Mutter erinnern, als sie eines Tages mit einem dicken, bunten Heft in der Hand nach Hause kam. Es war die Neckermann Illustrierte. Mit diesem Titel klang es nach mehr als es eigentlich war, nämlich ein Warenkatalog. Meine Mutter strahlte so glücklich, als hätte sie das Paradies gesehen.
Wir lebten damals in Marienbad, das auf tschechisch Mariánské Lázne heißt. Anfang der 60er Jahre, nach der Kuba-Krise, als die Kalten Krieger sich eine kurze Verschnaufpause gönnten, tröpfelten an Wochenenden die ersten Besucher aus Westdeutschland in diesen malerischen Erholungsort mitten im satten Grün des Böhmischen Waldes. Sie parkten ihre VW Käfer, Opel Rekord und Borgward Isabella vor der Promenade, wo das Kurorchester Walzer von Strauß und Léhar spielte.
Vor dem Palace Hotel hielten die Neoplan-Busse. Wir Kinder waren fasziniert von den verglasten Dächern und den blitzblank strahlenden Zierleisten aus Chrom. Die Menschen, die diesen gläsernen Bussen entstiegen, trugen knitterfreie Trevira-Anzüge und weiße Nyltest-Hemden. Die festen Krägen ragten am Hals steif wie ein Tellerrand. Ganz Marienbad bestaunte diese fremdartige Wesen, als wären sie vom Mars gelandet. Und wie hießen sie? »Die Neckermänner!«
Tatsächlich kamen sie beinahe von einem anderen Planeten, der Wunderwelt des Kapitalismus und des Konsums. Beim Eintritt in die hermetisch bewachte Welt des Sozialismus wurden sie von unseren |12|wachsamen Grenzsoldaten gründlich gefilzt. Die scharfe Suchaktion galt Illustrierten wie Quick, Bunte oder Neue Revue. Was man fand, wurde sofort rigoros beschlagnahmt. Die westdeutschen Reiseveranstalter hatten ihre Fahrgäste ausdrücklich gewarnt, auf keinen Fall den Spiegel oder Stern als Reiselektüre mitzunehmen. Was nahm man also stattdessen auf eine fünfstündige Fahrt mit? Die neueste Ausgabe der Neckermann-Illustrierten. So kamen diese »Fenster zum Westen«, wie wir solche Sammelobjekte nannten, in unseren Staat der Arbeiter und Bauern.
Meine Mutter bewachte ihren Schatz mit Argusaugen. Ich durfte nicht unbeaufsichtigt im Neckermann-Katalog herumblättern. Sie hatte Bedenken, ich könnte heimlich etwas herausreißen und die Bilder in der Schule herumzeigen. Natürlich wäre mir das als wohlerzogener Sohn nie in den Sinn gekommen. Dennoch musste es irgendwie durchgesickert sein, dass wir im Besitz von »imperialistischem Propagandamaterial« waren. Unvermittelt schneite die staatliche Geheimpolizei bei uns herein. Mein Vater wurde verhaftet und erst spät am Abend freigelassen. Danach wurde er mehrmals zu Verhören zitiert. In mir begann damals die Abneigung gegen dieses totale Überwachungssystem zu keimen.
Heute würde ich sagen, die Befürchtungen der Kommunisten waren nicht unbegründet. Der Neckermann-Katalog lieferte den Beweis, dass der von Marx postulierte »Fetischcharakter der Ware« nicht bloß ein Merkmal bürgerlicher Gesellschaften war, sondern auch in den sozialistischen Köpfen Wunschträume weckte. Auch bei mir meldete sich die Sehnsucht nach dem »Neckermannland« mit seinem scheinbar unbegrenzten Warenangebot.
Das Jahr 1968 stand im Zeichen des »Prager Frühlings« und ich, inzwischen Student am Prager Konservatorium, nutzte die Chance. Ich beantragte einen Pass, besorgte mir in der deutschen Botschaft ein Visum und setzte mich in den nächsten Zug gen Westen. Mit 20 Mark in der Tasche, die ich auf dem Prager Wenzelsplatz zu einem Schwindel erregenden Schwarzmarktkurs gewechselt hatte, kam ich in München an. Als erstes musste ich mich um einen Job kümmern. Voller Hoffnung schlug ich den Weg zu Neckermann ein. Ob er für mich Arbeit haben würde?
|13|Die Münchner Filiale des Neckermann-Kaufhauses lag in der Neuhauserstraße. Auf dem Weg dorthin blieb ich am Personaleingang von Karstadt hängen. »Plakatmaler gesucht«, stand dort auf einer Tafel. Welcher Prager konnte so was nicht! Schließlich haben wir uns alle schon mal als Pflaster-Picassos an der Karlsbrücke versucht. Nachdem die Sowjetpanzer den »Prager Frühling« überrollt hatten, waren die Sympathien für uns Tschechen in Deutschland groß, und ich bekam den Job sofort. Am Monatsende kamen genau 460 Mark in die Lohntüte. Damit ging ich zu Neckermann: Mal sehen, was dort billiger ist als bei Karstadt.
Bin ich in Deutschland, bin ich ein Neckermann
Später, als ich Journalist für die Münchner Abendzeitung war, hatte ich Gelegenheit, Josef Neckermann persönlich kennen zu lernen. Ich hatte ihn schon öfter bei Sportfesten, Vernissagen und sogar bei einer Party des Playboy in München gesehen. Auf dem »Ball des Sports« in der Rheingoldhalle in Mainz 1981 sprach ich ihn spontan an. Als Vorsitzender der Deutschen Sporthilfe war Neckermann der Organisator der Veranstaltung. Die gesamte bundesdeutsche Prominenz aus Industrie und Unterhaltung war da, man hätte das »Who’s who der Millionäre« erstellen können. Neckermann kannte jeden persönlich. Wenn er rief, kamen sie alle.
Man musste auch nicht lange fragen, wo ist Herr Neckermann? Aus dem Trubel ragte sein asketischer Kopf wie ein Leuchtturm hervor. Er flirtete gern, verstrahlte Charme in Überdosis und schwang das Bein als Dauertänzer. Von Walzer bis Rumba, er beherrschte alles. Sein Hüftschwung erinnerte beinahe an Elvis Presley.
Es war gar nicht einfach, eine ruhige Minute mit ihm zu erwischen. Der Mann war eine Legende. Auf der Höhe seines Lebens war er Herr über das drittgrößte Versandhaus, das zweitgrößte Reiseunternehmen und die größte Fertighausfirma der Bundesrepublik gewesen. Er hatte Anlagefonds und Versicherungen vertrieben und Bungalows für Feriendörfer am Mittelmeer verkauft. Als Dressurreiter war er mehrmals Welt- und Europameister geworden und schien ein |14|Abonnement auf olympische Medaillen gehabt zu haben. Wie immer umschwirrten ihn auf dem Ball Bekannte, Funktionäre, Journalisten, Gesichter vom Film und Fernsehen und schließlich die Sportler selbst. Unentwegt grüßte ihn jemand, zupfte an seinem Ärmel, klopfte ihm auf die Schulter.
Um ein Gespräch zu provozieren, hechtete ich hinter dem »Bettler der Nation« her, wie er sich scherzhaft selbst bezeichnete, und fragte: »Hallo, Herr Neckermann, kennen Sie ›Schwoaßfuß‹ ...? Das ist eine Rockgruppe aus Schwaben.«
Josef Neckermann blieb im Strom des Publikums stehen und sah mich für einen Moment mit seinem stechenden Blick an. »Warum fragen Sie?«
»Weil es von dieser Gruppe namens ›Schweißfüße‹ einen Song gibt, wo es heißt: ›Bin ich in Döjtschland, bin ich a Neckermann; bin ich a Neckermann, bin ich a Oarsch im Kopf von Mannesmann.‹«
Was dieser Text genau bedeuten sollte, wusste damals niemand so richtig. Er hatte mit der Gastarbeiterthematik zu tun. Die Deutschen hießen im Süden Europas nur noch »Neckermänner«, und wer aus dem Mezzogiorno oder aus Ostanatolien nach Deutschland kam, wurde als Verdiener der D-Mark selbst zu einem Neckermann. Mannesmann stand als Synonym für die Konzerne und reimte sich auf Neckermann. Auf diese Weise versuchten die Feuilletonisten (darunter auch ich), die kryptischen Zeilen zu interpretieren. Natürlich hatte ich nicht die Zeit, Josef Neckermann dies alles so zu erklären. Ich wollte einfach wissen, wie er reagieren würde.
»Und wie gefällt Ihnen dieser Text?«, bohrte ich nach.
Der einstige Versandhauskönig lächelte verschmitzt: »Haben Sie sich mit meiner Nichte Marlene abgesprochen? Sie hat mir neulich diese Platte geschenkt.«
Über die Musik kamen wir ins Gespräch. »Freddy Quinn finde ich besser!«, gestand mir Josef Neckermann und auch, dass er ein Fan von Hans Albers, Rudi Schuricke und Peter Kraus sei. Aber der Größte für ihn war Franz Lambert, der, wie bei jedem »Ball des Sports«, mit seiner Hammondorgel im Foyer der Rheingoldhalle aufspielte.
Josef Neckermann lud mich ein, Lambert zu lauschen. »Kommen Sie, so was haben Sie noch nie gehört!« So geriet ich in Neckermanns |15|Schlepptau, aber es war nicht leicht, ihm zu folgen. Er eilte nicht voran, er rannte, als ginge es darum, die letzte Bahn zu erwischen. Im Gewühl verlor ich ihn bald aus den Augen. Als ich ihn wiederfand, lotste er bereits den Bundespräsidenten Carl Carstens mit seiner Frau Veronica zu Lamberts donnernder Orgel. Neckermanns ungestümer Drang beeindruckte mich. Spät nach Mitternacht strahlte er immer noch unverwüstliche Energie aus. Später stand ich neben ihm vor dem Bierzelt im Foyer. Um den Sporthilfechef versammelten sich die Bosse der Bosse der deutschen Wirtschaft auf eine Bockwurst für 5 Mark. Neckermann aß sie diätbewusst – ohne Semmel, aber mit scharfem Senf. Der Reinerlös dieser Gala betrug, wie am nächsten Tag überall in der Presse stand, satte 2,2 Millionen Mark. Davon rund 1 Million aus Privatspenden.
Die Würzburger und die Frankfurter Neckermanns
Im Jahr 1995 intensivierte sich mein Kontakt zu Marlene Neckermann, der Nichte des Kaufhauskönigs. Sie ist die Tochter von Josefs jüngerem Bruder Walter, der den familiären Kohlenhandel in Neckermanns Geburtsstadt Würzburg weitergeführt hatte, nachdem Josef zu größeren Zielen aufgebrochen war. Marlene hatte auf der Münchner Kunstakademie studiert und galt als das »schwarze Schaf« des Familienclans. Als vielbeachtete Erotik-Malerin verkehrte sie in der Clique des umtriebigen Fürsten Thurn & Taxis. Mit 50 rettete die begeisterte Reiterin den 125 Jahre alte Traditionshandel für Kohlen und Brennstoffe und gründete ein Start-Up-Unternehmen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien. Heute liefert sie unter anderem Biodiesel aus Raps für die Heizungsanlage des neuen Bundestages in Berlin.
Ich traf sie damals, um einen Bericht über ihr Unternehmen zu schreiben, und der Kontakt hat sich bis heute erhalten.
Die erste Begegnung ging auf das Jahr 1982 zurück, als mein Freund Dieter Heisig, ein begnadeter PR-Fachmann in der internationalen Filmbranche, mich seiner »neuen Flamme« Marlene vorstellte und gleich vorschlug, eine Geschichte über sie als Erotik-Malerin |16|zu schreiben. Marlene überraschte mich mit ihrer schüchternen, zurückhaltenden Art.
Irgendwann lag es nahe, ein Buch über diese vielschichtige Familie zu schreiben. Als ich mit den Recherchen begann, half mir Marlene, Kontakt zu den »Frankfurter Neckermanns« aufzunehmen. Diese Bezeichnung geht auf den Umzug von Josef Neckermann zurück. Nach dem Krieg fand er in seiner Heimatstadt Würzburg für einen Neubeginn keine günstigen Bedingungen mehr – auch deshalb, weil er dort als unrühmlicher »Arisierer« eines jüdischen Kaufhauses in Verruf geraten war. »Profiteur der Nazis« nannte ihn die Würzburger Tageszeitung Main Post noch kürzlich.
Josef Neckermanns jüngster Sohn, Johannes, 1942 in Berlin geboren, erklärte sich nach einigen E-Mails zu einem Interview bereit. Er schlug vor, sich zu den Wagner-Festspielen in Bayreuth mit mir zu treffen. Die Wahl des Ortes überraschte mich angesichts der vielfältigen Verstrickungen der Neckermanns in die NS-Vergangenheit.
Zu unserem Treffen erschien Johannes Neckermann, der heute am Schuyler Lake im US-Bundesstaat New York lebt, im feinkarierten, braun-beigen Sakko. Doch das typisch amerikanische Muster täuschte: Das strapazierfähige Kaschmirjackett stammte aus dem Neckermann-Katalog. Johannes hält an der Tradition fest und lässt sich die neueste Ausgabe stets in die USA schicken – »und hin und wieder bestelle ich auch etwas. Es gibt in diesem Katalog immer Dinge, die es woanders nicht gibt«, meinte er.
Es war ein angenehmes Gespräch, aus der ursprünglich vereinbarten knappen Stunde wurde ein langer Nachmittag mit dem eingefleischten Wagnerianer. Anschließend dinierten wir am traditionellen Neckermann-Stammtisch im Gasthof »Goldner Löwe« in Auerbach in der Oberpfalz. Im Laufe des Nachmittags kamen wir auch auf die NS-Zeit zu sprechen. Johannes Neckermann meinte: »Alles was es zu dieser Zeit zu sagen gab, hat mein Vater in seinen Memoiren niedergeschrieben. Alles, was darin steht, ist auch die Meinung der Familie.« Wann immer ich mich während meiner späteren Recherchen mit Fragen zu diesem Thema an ihn wandte, verwies Johannes Neckermann immer auf die Memoiren seines Vaters. Er kannte das |17|Buch Seite für Seite beinahe auswendig und schien keinerlei Zweifel an deren Richtigkeit zu haben.
Ich merkte bald, dass die Frankfurter Linie wie eine verschworene Gemeinschaft agiert. Ohne den Segen von Johannes Neckermann, der nun als Oberhaupt über die Tradition des Hauses wacht, öffnete sich kein Weg zu den weiteren Familienmitgliedern oder früheren Angestellten. »Wir Neckermanns funktionieren wie eine Festung – wir sind ein Adel ohne Adelstitel«, räumte Johannes ein. In seiner »Ritterlichkeit« war er schließlich bereit, mich bei meinen Recherchen zu unterstützen – ohne mein Manuskript vor dem Abdruck vorgelegt zu bekommen.
Durch ihn traf ich auch Klara Rupp, die 30 Jahre lang Haushälterin der Familie war. Ein Besuch bei ihr in Gemünden am Main verschlug mir förmlich die Sprache. Die Wohnung der 84-jährigen agilen Fränkin gleicht einem Neckermann-Museum. In den drei geräumigen Zimmern befindet sich das komplette Mobiliar »des Chefs« und »der Chefin« – so wie es zwischen 1951 und 1955 bei einem Kunsttischler in Frankfurt nach Maß angefertigt wurde.
Dunkles Wurzelholz, Ahorn, Kirsch und Mahagoni, in robuster Ausführung. Ich saß an einem runden, auslegbaren Esstisch, um mich herum großbürgerliche Schränke und Kommoden. Besonders fiel mir eine Vitrine mit Kristallglas ins Auge, die nach dem Vorbild eines Stücks von Katerina der Großen ausgeführt war: »Die Chefin«, also Annemarie Neckermann, »hatte das Original bei ihrer Familienreise in Petersburg gesehen und danach bei dem Tischler in Auftrag gegeben«, erzählte »Klärchen«, wie sie von den Neckermanns genannt wurde.
Frau Rupps Offenheit war herzerfrischend. Auch mit 84 immer noch das Mädchen vom Lande, streng katholisch, das sich in ihrem Herzen nie verbiegen ließ. Ohne Umschweife antwortete sie, als ich fragte: »Und wie war Josef Neckermann zu Hause?« – »Den Chef habe ich bewundert und gefürchtet. Die Chefin war nie launisch, sie war jeden Tag gleich. So konnte ich es auch ohne Schwierigkeiten 30 Jahre bei den Neckermanns aushalten.«
Die Bewirtung war wie damals bei Neckermanns: Semmeln mit Schinkenwurst. Was nicht bedeutete, dass Josef Neckermann keinen |18|Hummer liebte. Von einem Foto an der Wand schauten mir zwei Hunde in den Teller: Axel und Sony, aufgenommen im Garten der Neckermanns. »Die Neckermanns waren sehr großzügig,« erzählte mir Frau Rupp, während ich mich umsah. »Bei meinem Abschied erhielt ich zur Firmenrente zusätzlich rund 30 000 Mark auf einmal ausgezahlt, für jedes Jahr 1 000 Mark. Damit habe ich ein sorgloses Alter. Das Glück meines Lebens war, dass ich zu den Neckermanns kam.«
Über Johannes kam schließlich auch ein Treffen mit seiner Schwester Eva-Maria, genannt Evi, zustande. Eva-Maria Pracht, die 1982 in Seoul im Dressurreiten die Bronzemedaille holte, lebt seit 1986 in Kanada. Sie war Papis Liebling und suchte mit goldenem Händchen seine Pferde aus. Im Oktober 2004 kam sie an den Tegernsee, um ihren Bruder Peter zu besuchen, der nach einem Unfall an den Rollstuhl gefesselt war.
Unser Gespräch fand in einer ruhigen Ecke im Hotel Parkresidenz statt, wo Eva-Maria Neckermann bereitwillig erzählte. Besonders genüsslich berichtete sie vom Aberglauben in der Familie. Josef Neckermann habe bei jedem Turnier eine Miniaturbibel in einer winzigen Silberbox in der Tasche gehabt, und seine Frau Annemarie habe ihm vor jedem Turnier auf die Stiefel gespuckt. Einmal warnte die Tochter ihren Vater, als er geschniegelt ausritt: »In brandneuen Hosen reitet man bei einem Turnier nicht.« Josef Neckermann hörte nicht auf seine Tochter und fiel prompt vom Pferd. Als Evi ihn deswegen hänselte: »Siehst du, ich habe es doch gesagt, in neuen Hosen reitet man nicht«, blickte sie der Vater auf eine Weise an, die man nie vergisst: »Er war kurz davor, mir eine zu scheuern.« Eva-Maria erzählte mir eine Anekdote nach der anderen aus der Geschichte der Familie und der Nachmittag verging im Fluge.
Die Legende lebt
Seit ich mich intensiv mit der Familie Neckermann beschäftige, begegne ich dem Namen noch häufiger als früher. Vor einigen Monaten war ich in Hongkong, um einen Bericht für ein Reisemagazin zu |19|schreiben. Auf dem Pier der Star Ferry wartete ich auf eine Dschunke, als ein fröhliches Grüppchen aus einem Bus ausschwirrte. Sie folgten ihrem chinesischen Führer, der mit einem Fähnlein wedelte: »Neckermann« stand darauf. Das Sächseln wies unverkennbar auf die Herkunft der Weltenbummler hin.
»Sind Sie von Neckermann?«, fragte ich eine etwas opulente Leipzigerin. Ihr Gesicht erstrahlte, als hätte sie ein Kompliment bekommen: »Jaaa! Sie auch!?«
In sektenähnlicher Begeisterung erkundigte sie sich gleich: »Sehen wir uns morgen beim Ausflug?« Als wäre es selbstverständlich, dass ein Deutscher in Hongkong ein Neckermann-Tourist sein muss. So zwitscherte es aus der Gruppe auch fröhlich: »Na, dann bis morgen! Mit Neckermann.«
Auf dem Rückflug nach Frankfurt saß ich neben einem Jungmanager. Aus seinem ledernen Gucci-Aktenkoffer holte er eine Zeitschrift: PM Forum – für alle Freunde des Pferdes. Aus dem Augenwinkel las ich: »Dr. Josef Neckermann ... durch sein Wirken ... fruchtbare Verbindung zwischen der Sporthilfe und dem Pferdesport ... nicht wegzudenkende Meilensteine ... Wir sind zu Dank verpflichtet.«
Wieder zurück in Deutschland, war ich zu einer Hochzeit eingeladen. Unter den Gästen waren auch einige alte Freunde aus der ehemaligen DDR. Wir erinnerten uns an die alten Zeiten – und schwärmten von den alten Neckermann-Katalogen. »Wenn es uns gelang, einen heimlich zu ergattern, kam es uns wie ein Fenster zum Westen vor«, meinten die Ost-Freunde. Meine selige Mutter tauchte vor meinem geistigen Auge auf und ihr Glück, als sie von diesen gepflegten, freundlichen Westdeutschen einen Neckermann-Katalog geschenkt bekommen hatte. Welch rührendes Geschenk! Sofort verstummte damals jedes Gerede über Alt-Nazis, Neofaschismus und Revanchismus. Sobald man im Neckermann-Katalog zu blättern anfing, war die Welt für eine Weile in Ordnung. Die Wünsche und Illusionen vom Konsumglück vereinten West und Ost. Diesen Glanz hat der Name auch nach den vielen Aufs und vor allem Abs der Familie und des Unternehmens nicht verloren. Neckermann bleibt ein deutscher Mythos.
|21|Kapitel 1
»Schnelligkeit im Rudern und gute Beziehungen in der Politik«
Der Aufstieg der Familie Neckermann
Das Maintal bei Würzburg. »Wandrer, führ’n dich deine Wege vorbei, hier auf rebbekränzten Hügeln, findst du Aussicht, Labung, Ruh!« verkündete eine Postkarte aus dem Jahre 1890. Die Idylle hat sich bis heute erhalten. Romantische Winzerorte, umgürtet von den Resten alter Stadtmauern, prägen die wellige unterfränkische Landschaft. Der ockerfarbene Sandstein schmeichelt dem Auge. Allerorts überragen die runden Türme und Türmchen die Hügel. An den sonnigen Hängen reift der vollmundige Bacchus, ein kräftiger Kerner, und die lieblichen Rieslingsorten. Die Region ist zudem für eine deftige Spezialität berühmt, die Meterbratwurst. Sie wird auch von der Metzgerei Neckermann aus Aub hergestellt, deren weiße Lastwagen mit weithin leuchtenden roten Lettern durch die Straßen von Würzburg, Kitzingen, Markt Einersheim, Ochsenfurt oder Uffenheim kurven.
Hier, in einer unterfränkischen Metzgerei, beginnt die Geschichte der Familie Neckermann, einer der Familien, die in Deutschland Wirtschaftsgeschichte geschrieben haben. Jahrhunderte lang hatte die Familie hier Schweine geschlachtet, Schinken gepökelt und Würste gemacht. Im Jahr 1890 begann sie, aus diesem Schatten herauszutreten.
Ursprünglich kam die Familie vom Neckar, wie ihr Name verrät. Die Männer vom Neckar waren Flößer. In der Zunftordnung wurden sie 1508 eingetragen. Doch die Flößerei allein konnte die große Familie nicht ernähren. Den damaligen Regeln folgend konnte nur der älteste Sohn das väterliche Erbe antreten. Die jüngsten Söhne mussten auf die Wanderschaft gehen, um woanders Arbeit zu suchen.
|22|Dass der Zug der Neckermänner in Richtung Würzburg ging, lag an einer traditionellen Veranstaltung, die seit dem Mittelalter alle »Flussratten« anzog: dem Würzburger Fischerstechen. Zu diesem Wettbewerb brachen auch die Männer vom Neckar auf. Würzburg, der »unterfränkische Vatikan«, beeindruckte die tief religiösen Neckermänner. Auf dem langen Weg zur Ansiedlung in Würzburg ließen sie sich zunächst in dem fruchtbaren Gollachtal nieder. Hier wurden sie als Metzgermeister branchenkundig. Die nächste Station auf dem Weg nach Würzburg war Hemmersheim, Geburtsort des ersten Neckermanns, mit dem die heutige Generation ihre Vergangenheit zu erzählen beginnt: Peter Neckermann, Metzgermeister, den das Schicksal in die Politik schickte.
Das Jahr 1890 sollte nicht nur für die Familie Neckermann entscheidend werden, sondern für die gesamte deutsche Geschichte. Zwei Jahre zuvor war Wilhelm II. zum deutschen Kaiser gekrönt worden. Nach andauernden Konflikten zwang er den Reichskanzler Otto von Bismarck im März 1890 zum Rücktritt. Nun stand dem eitlen, machtbesessenen Wilhelm II. nichts mehr im Wege, sein »eigener Kanzler« zu werden.
Dies hatte für die Reichstagswahl 1890 Auswirkungen bis in die Provinz. Viele Abgeordnete hatten angesichts des absolutistischen Kurses Wilhelms II. wenig Lust, sich erneut zur Wahl aufstellen zu lassen. So fehlte der Zentrumspartei bei der Eröffnung der Kampagne für die Reichstagswahl am 12. Oktober 1890 für den Wahlkreis 6 in Würzburg noch ein Kandidat. Ein Weinhändler, ein Magistrat und ein Domvikar nach dem anderen hatten verzichtet. In der Not einigten sich die Vertrauensmänner auf einen Würzburger Metzgermeister, der erst seit kurzem im Gemeinderat von Hemmersheim seine ersten politischen Erfahrungen sammelte. Am nächsten Tag berichtete die Münchner Post über einen gewissen Peter Neckermann, Jahrgang 1842, der bis dahin »politisch recht unbekannt und ziemlich farblos« geblieben sei.
Die Gesinnung in Unterfranken war schon von je her schwarz. Die Region, die bis ins erste Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts unabhängig gewesen und von den Würzburger Bischöfen regiert worden war, zählte als eine sichere Hochburg der Katholiken. Und für gute |23|Katholiken kam eigentlich nur eine Wahl in Frage: die Zentrumspartei. Diese war 1870 auf die Initiative der Kölner Bischöfe gegründet worden, um im preußisch-protestantischen Deutschen Reich die Interessen der katholischen Glaubengemeinschaft zu wahren. Vom Kaiser wurde die Zentrumspartei misstrauisch als die »fünfte Kolonne Roms« beäugt. Bismarck führte einen langen Kulturkampf, um den Einfluss der Katholiken auf das öffentliche Leben zurückzudrängen. Die Jesuiten wurden verboten, Schulen und Krankenhäuser verstaatlicht, die Zivilehe eingeführt und die Kirche unter staatliche Aufsicht gestellt. Trotz oder wegen der Verfolgung wurde das Zentrum zur stärksten Partei im Reichstag. Doch nachdem die Wogen sich geglättet hatten, unterstützte die Zentrumspartei die Politik Bismarcks, besonders die neue Sozialgesetzgebung. Die Partei war Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts an der Ausarbeitung der Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherungen beteiligt.
Die Wähler der Zentrumspartei kamen anfangs aus der Landbevölkerung und den unteren sozialen Schichten. Doch im Laufe des Kulturkampfes gewannen sie immer neue Wähler hinzu. Gerade in Bayern war das Zentrum der Block gegen die ungeliebten protestantischen Preußen. Bei der Wahl 1890 wurde die Partei von den meisten mittelständischen und wohlhabenden Katholiken unterstützt.
»Der Wahlkampf war eröffnet. Am Montag reisten eine große Anzahl von Geistlichen, Mönchen, selbst Nonnen mit den Mittagszügen nach allen Richtungen ab, nachdem sie sich in Würzburg mit Flugblättern und sonstigem Agitationsmaterial versehen hatten«, schreibt die Münchner Post. Unter den Wahlkämpfern war auch Peter Neckermann. In der Presse wurden die Auftritte der einzelnen Kandidaten genau verfolgt. Zum Beispiel war zu lesen, dass Neckermanns Wahlrivale, der Vaselinefabrikant Theodor Voigt von der Partei »Die Freisinnigen« eine viel schwächere Figur gemacht habe als Peter Neckermann.
Die Bevölkerung zeigte kaum Interesse an der Wahl. In Unterfranken gingen gerade einmal 58,2 Prozent der Wahlberechtigten, also der Männer über 25 Jahren an die Urnen. Die Zentrumspartei, die eifrig für mehr soziale Gerechtigkeit und Erhaltung christlich-moralischer Werte eintrat, konnte ihre Wähler noch am besten mobilisieren |24|und gewann das Mandat schon im ersten Wahlgang. Entscheidend für den Sieg war der Einbruch der Sozialdemokraten, die zwar mit einem ganz ähnlichen Programm ihren Wahlkampf führten wie die Zentrumspartei, denen aber die Unterstützung der Kirche fehlte. Im Vergleich zur vorigen Wahl verloren sie allein in Würzburg die Hälfte ihrer Stimmen. Peter Neckermann dagegen durfte sich freuen: In seinem Wahlkreis bekam er eines der besten Ergebnisse für die Zentrumspartei und zog als Abgeordneter in den Berliner Reichstag.
Peter Neckermanns Metzgerei wird kaum unter der Abgeordnetentätigkeit gelitten haben. Die Parlamentarier hatten damals nicht viel zu tun: Der Reichstag wurde lediglich ein oder zwei Mal im Jahr vom Kaiser einberufen und tagte nur einige Wochen lang. Außerhalb der Sitzungszeiten betrieben die Abgeordneten jedoch heftige Lobbyarbeit, es bildeten sich Interessenpakte und Seilschaften, Intrigen innerhalb einer Fraktion waren an der Tagesordnung. Sobald solche Querelen an die Öffentlichkeit drangen, wurden sie in der Presse genüsslich breitgetreten. Diese Art von Berichterstattung setzte Peter Neckermann offenbar derart zu, dass er sich schon 1893 mit der Absicht trug, wieder aus der Politik auszusteigen. In diesem Jahr erschien in der Neuen Würzburger Zeitung ein Auszug aus seiner Rede: »Es ist hinlänglich bekannt, mit welchen Verdächtigungen und Verleumdungen ich in den Blättern herumgezogen wurde. Nur der einstimmige Wunsch der Vertrauensmänner unserer Partei hat mich dazu bewegen können, nochmals eine Kandidatur anzunehmen.«
Um welche Art von Verleumdungen es sich handelte, ist nicht mehr nachvollziehbar, da die Würzburger Archive im Zweiten Weltkrieg größtenteils zerstört wurden. Doch die Verstimmung kann nur vorübergehend gewesen sein, und die Anschuldigungen in der Presse schienen ihm nichts angehabt zu haben. Als sich Neckermann für eine zweite Amtsperiode aufstellen ließ, fand er erneut große Zustimmung. Im Vergleich zu den anderen Abgeordneten hielt ihn der Fränkische Bauernbund für »das kleinere Übel«. Damit war ihm die Unterstützung der Landwirte sicher. Doch diesmal verliefen die Wahlen dramatischer als vorher. Erst in der Stichwahl konnte sich Neckermann gegen den Kandidaten der Sozialdemokraten durchsetzen.
|25|Dieser Wiederwahl verdankt es Peter Neckermann, dass er an einem bedeutenden Ereignis in Berlin teilnahm. Am 5. Dezember 1894 wurde nach zehnjähriger Bauzeit der neue Reichstag eingeweiht. Damit drückte Neckermann die Abgeordnetenbank im großzügigsten und prachtvollsten Parlament Europas. Das imposante Äußere des Monumentalgebäudes entsprach dem neuen Machtstreben des kaiserlichen Deutschlands. Auch die Zentrumspartei mitsamt Peter Neckermann schwenkte auf des Kaisers »Neuen Kurs« ein.
Dass Peter Neckermann es schaffte, Parlamentarier zu werden, erfüllte die Familie mit großem Stolz. Sie erinnert sich nicht an den Metzgermeister, sondern stets an den Reichstagsabgeordneten Neckermann. Dessen Verbindungen sollte sie schließlich auch ihren Aufstieg verdanken.
Schwarzes Gold und Herrgottsschnitzer
Ab Mitte der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts vollzog sich in Deutschland ein noch nie da gewesener wirtschaftlicher Aufschwung. Die Menschen wurden wie mit einem Katapult in das Zeitalter der Industrialisierung geschleudert. Die Veränderungen erfassten auch Würzburg. Diese beschauliche Bischofs- und Universitätsstadt wurde lange als »Pensionopolis« belächelt, weil sich dort so viele Beamten, Lehrer und Offiziere im Ruhestand niederließen. Doch mit einem Mal wuchs entlang der beiden Mainufer ein vitales Industriezentrum heran.
Die barocken Befestigungsanlagen wurden abgerissen, die mittelalterlichen, verschachtelten Stadtteile saniert, die Straßen im Eiltempo verbreitert. Die riesigen Grundstücke der Klöster boten genügend Platz für die Ansiedlung von Fabriken und Lagerhallen. Großschlachthöfe, Möbelfabriken, Nähereien, Maschinenwerke, Brauereien und Mühlen für Mehl und Gips schossen wie Pilze aus dem Boden. Aufgrund der günstigen Verkehrslage entwickelte sich die Stadt zum Eisenbahnknotenpunkt mit Verbindungen in alle vier Himmelsrichtungen. Die Mainmetropole wurde zu einem der wichtigsten Produktionszentren in Bayern. Auch die ehemals bischöfliche |26|Julius-Echter-Universität wurde von der Modernisierung erfasst: 1895 entdeckte hier der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen eine unsichtbare Strahlung, die nach ihm benannt wurde. Innerhalb von nur zehn Jahren mauserte sich Würzburg zur Kreishauptstadt erster Klasse. War bis dahin von Würzburg nur mit dem Hinweis auf die vielen Kirchtürme die Rede, so sprach man nun von einer »Großstadt mit Krone«.
Peter Neckermanns Sohn Josef Carl, der 1868 aus der Ehe mit der sieben Jahre älteren Barbara Barth geboren wurde, verkörperte den Geist dieser Aufbruchszeit. Schon im Alter von 27 Jahren sagte er Gelbwurst und Schweinskopfsülze im väterlichen Betrieb ade. Den Schlachthof und die Zerlegungshallen mit den Schweinehälften am Haken hasste er ohnehin. Schon als Kind wünschte er sich nur eines: »In meinem Leben nie mehr Blut wie mein Vater sehen zu müssen.«
Er hatte eine andere Branche im Sinn, die eher der Zeit entsprach und mit der sich mehr Geld verdienen ließ: den Kohlenhandel. Die Steinkohle war der Brennstoff der Industrialisierung, mit ihr wurden die Maschinen der neuen Fabriken entlang des Mains betrieben. Aber auch zur Befeuerung des heimischen Herdes wurde jetzt nicht mehr Brennholz oder Torf verwendet, sondern Kohle.
Der aufgeweckte Metzgersohn ließ sich sein Erbe ausbezahlen. Der Bruch mit der Metzgerzunft war gründlich. Wenn man die heutige Metzgerei Neckermann in Würzburg anruft, heißt es lapidar: »Wir haben mit den Versandhaus-Neckermanns nichts zu tun.« Josef Carl krempelte die Ärmel hoch. Was er zum Start in der Kohlebranche brauchte, lässt sich im Archiv eines Kohlengrossisten von damals, Zerssen & Co., Hamburg, nachlesen: »Schnelligkeit im Rudern und gute Beziehungen in der Politik, aber auch Faustrecht und Lautstärke beim Vortrag«.
Aber auch Glück brauchte er. Schon ein Grundstück in der Würzburger Innenstadt zu finden, war gar nicht so einfach: Der Bauboom grassierte. Ein unbekannter zeitgenössischer Autor berichtete: »Überall musste man über die frisch ausgehobenen Gruben auf Brettern balancieren, über die Sand- und Kiesberge klettern, die aufgewühlten Straßenseiten wechseln. Neben den Schienen wurden noch Leitungen für Wasser, Gas und Strom verlegt, Rohre für die Kanalisation verbuddelt. |27|Wegen dem Lärm, dem Fluchen der Bauarbeiter und dem Gestank hagelte es jeden Tag Beschwerden ins Rathaus. Zwecklos. Die hohen Herren Stadträte hatten Besseres zu tun, als den Ärger der Bürger zu schlichten. Sie waren gerade dabei, eine neue Bauvorschrift für die Innenstadt zu verabschieden, die bei neuen Häusern schon mindestens drei Stockwerke und den Dachausbau verordnete.«
Mit dieser neuen Bauvorschrift sollte die Platzausnutzung verbessert werden. Sie regte aber auch die Fantasie der Architekten an. Die neuen Häuser glichen Palästen mit Giebeln, Erkern und Türmchen und präsentierten sich in einem märchenhaften Neuschwanstein-Stil. Und es dauerte nicht lange, da baute Siegmund Ruschkewitz, ein jüdischer Händler aus Danzig, das erste Kaufhaus in Würzburg. Es sollte in der Geschichte der Neckermanns noch eine Rolle spielen. 1898 wurde das Kaufhaus feierlich eröffnet. Der ganze Charakter der Schönbornstraße veränderte sich damit schlagartig. Nun nannten die Würzburger die Einkaufsstraße: »unser Boulevard«. Die Fassade des vierstöckigen Ruschkewitz-Neubaus ähnelte tatsächlich der Galerie Lafayette, die Theophile Bader und Alphonse Kahn zwei Jahre zuvor eröffnet hatten. In Paris wie in Würzburg oder in Berlin, überall veränderten die neuen Kaufhäuser mit ihren klassizistisch strukturierten Fassaden, den Reliefsäulen aus Quadersteinen und den dreieckigen Dachsimsen über den Fenstern das Bild der Großstädte. Insofern war auch das neue Synonym für Würzburg als »Klein-Paris« nicht aus der Luft gegriffen, zudem der Barockarchitekt Johann Balthasar Neumann (1687–1753) schon die erzbischöfliche Residenz dem Louvre nachempfunden hatte.
Das Grundstück für die Neckermannsche Kohlenhandlung fand sich schließlich in der Sterngasse 3, ganz in der Nähe der Franziskanerkirche. Mit dem Gang in dieses Gotteshaus fing der streng geordnete Tagesablauf von Josef Carl Neckermann an. Der Weg führte ihn am Geburtshaus von Tilman Riemenschneider (1460–1531) vorbei. Riemenschneider war ein begnadeter Herrgottschnitzer, dessen Marienaltar schon der Reichstagsabgeordnete Neckermann bewundert hatte und der nun auch seinen Sohn in diese Kirche führte.
Unter den Figuren auf dem Altar befand sich auch der Heilige Valentin, der in Bayern als Schutzpatron besonders verehrt wird. Der |28|Märtyrer, der im 3. Jahrhundert durch Enthauptung hingerichtet wurde, soll laut Legenden die Sehkraft seiner Augen auch nach dem Tode behalten haben und damit die wahre Liebe erkennen können. Doch in Bayern gilt der Heilige Valentin nicht nur als Beschützer der Liebenden, sondern auch als ein Helfer der Hirten und Patron des Kirchenbaus. Dass in jener Würzburger Franziskanerkirche eine wichtige Reliquie des Märtyrers aufbewahrt wurde, nämlich sein ganzes Haupt und Teile seines rechten Armes, betrachtete Neckermann als ein Zeichen der Vorsehung. Er war der Überzeugung, sich an einem gottgefälligen Ort niedergelassen zu haben. Mit Gottes Hilfe würde sein Werk gelingen. Beim täglichen Gebet erinnerte ihn daran die Inschrift unter Valentins Heiligenstatue: »Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten die Bauleute umsonst.«
Die Dampfrösser der Götter
Schon zum fünfjährigen Firmenbestehen kam die Firma Josef Carl Neckermann auf eine beachtliche Bilanz. Man schrieb das Jahr 1900 und der Fuhrpark im Hof der Kohlenhandlung zählte 15 Pferdewagen. Im Stall standen 16 belgische Kaltblütler und für die Expresslieferungen ein Gespann Oldenburger Rappen, die einen Zacken schneller waren als die »Dicken«. Josef Carl Neckermann war an zwei Mainkähnen beteiligt und erwog, damit eine eigene Reederei zu gründen. Als Partner bot sich ein Vetter an, Fritz Neckermann (1860–1934). Gemeinsam sicherten sie sich im Neuen Hafen ein großzügiges Gelände, das groß genug war, um später den Anlegeplatz zu erweitern und eigene Schiffe zu bauen. Aber die großen Geschäfte sollte er anderswo machen.
Die Fäden dafür zog ein weiterer Vetter, Mathias Neckermann. Mathias hatte ursprünglich das Färberhandwerk erlernt und seinen Meisterbrief erworben. Dann hatte er sich jedoch der Politik zugewandt, war erst Bürgermeister geworden und 1887 für die Zentrumspartei in den Bayerischen Landtag gewählt worden.
Für den Würzburger Neckermann war der Abgeordnete im Münchner Maximilianeum der richtige Mann am richtigen Ort. Bayern |29|hatte sich nach der Reichsgründung einige wichtige Privilegien behalten, unter anderem die Kontrolle des Eisenbahnnetzes.
In Bayern war schon im Jahre 1835 die erste Bahnstrecke Deutschlands gebaut worden. Der legendäre »Adler« verkehrte mit 20 Kilometern pro Stunde zwischen Nürnberg und Fürth. Seit 1866 war das deutsche Schienennetz um jährlich 1 000 Kilometer gewachsen. Bis zum Jahr 1913 sollten es 63 378 Kilometer werden. Die Bahnhöfe wurden zu pompösen Tempeln und stählernen Kathedralen der Technik. Vielerorts wurden Adler auf die Fassaden gepflanzt und Türmchen angebaut, die aztekischen Pyramiden ähnelten. Ein würdiger Empfang für die Lokomotiven, die man apokalyptisch als dampfende Rösser der Götter mit geflügelten Rädern darstellte.
Die Eisenbahn war das Schwungrad der Industrialisierung: Mit ihrer Hilfe wurden die Rohstoffe herbeigeschafft, die zur Herstellung von Stahl und zum Bau weiterer Eisenbahnen benötigt wurde. Ihr weiterer Ausbau stand ganz oben auf der Tagesordnung. Mathias Neckermann saß im zuständigen Ausschuss, und als Lieferant für die Kohleversorgung schlug er seinen Würzburger Vetter vor. Der zentrale Standort überzeugte, und so erhielt Josef Carl Neckermann den Zuschlag, und 1902 sogar den schönen und einträglichen Titel »Kohlenlieferant der königlich-bayerischen Eisenbahn«.
Nicht jedem gefiel der Fortschritt, der Pferde durch Dampfrösser ersetzte, und auch in der Familie Neckermann forderte er seine Opfer. Pferde scheuten beim Anblick der dampfend fauchenden Lokomotiven, und Kutscher übersahen oft die Gleise samt dem herannahenden Zug. Unfälle waren an der Tagesordnung. So auch an einem Nachmittag im Sommer 1902, als in der Nähe von Thüngersheim, wo die Neckermanns ein Weingut erworben hatten, eine Kutsche unter die Räder geriet. Bei der Bergung des Verunglückten fuhr den Helfern der Schreck in die Knochen: Der stattliche Mann, etwa 60 Jahre alt, war in der Gegend wohl bekannt. Es war der ehemalige Reichstagsabgeordnete Peter Neckermann. Sein Brustkorb war zerquetscht. Mit inneren Verletzungen wurde er ins Hospital gebracht. Dass er überhaupt noch lebte, verdankte er seiner Rossnatur. Nach seiner Entlassung war er nur noch ein Schatten seiner selbst. Auch die Gebete halfen nicht: Er sollte sich nicht wieder erholen. Am 1. Oktober |30|1902 schloss der Metzgermeister Peter Neckermann für immer die Augen.
Für den Sohn ging das Geschäft mit der Eisenbahn jedoch weiter. Da ihm in Würzburg die Konkurrenz zusetzte, musste er jenseits der Stadtgrenzen nach neuen Abnehmern suchen. Er fuhr nach Berlin, um sich bei der dortigen Reichsbahndirektion um einen Liefervertrag zu bewerben. Als Referenz konnte er immerhin die frühere Abgeordnetentätigkeit seines Vaters anführen. Mit der sprichwörtlichen Hartnäckigkeit der Neckermanns schaffte er es innerhalb der nächsten Jahre, zum Lieferanten der Reichseisenbahn aufzusteigen. Nun war Josef Carl Neckermann richtig dick im Geschäft.
Sporthilfe für Würzburg
»Sportbegeistert«, ist ein Wort, mit dem sich die Neckermanns gern und häufig beschreiben. Auch dies geht auf Josef Carl Neckermann zurück. Nur Geschäfte zu machen, reichte ihm schon bald nicht mehr aus. So wie damals üblich, wollte er als Unternehmer Gutes tun, nicht zuletzt, um seinem Ansehen durch soziales Engagement mehr Glanz zu verleihen. Zuerst erweckte der traditionsreiche Würzburger Ruderverein Neckermanns Interesse. Seine Förderung war nicht ganz uneigennützig: Dem Wassersportclub gehörte ein weitläufiger Grund mit Stallungen, in denen der Gönner seine Reitpferde unterbringen wollte. Doch Neckermann war mit der Pflege unzufrieden und entzog dem Sportverein schon bald seine Unterstützung. Als Revanche gründete er 1905 die Würzburger Rudergesellschaft Bayern.
Von da an erhielt die Rivalität am Wasser fast englischen Stil: Ähnlich wie Oxford gegen Cambridge traten nun die »Mainauer« gegen die »Bayern« an. Das Ruderderby gehörte zum wichtigsten Sportereignis der Stadt. Natürlich wurden Neckermanns Pferde bei dem neuen Club untergebracht und besser behandelt. Offenbar hatte man dort einen Lieblingsspruch des Gründers beherzigt: »Gute Pferde sind mehr wert als schlechte Menschen.« Trotzdem reichte ihm diese Unterbringungsmöglichkeit schon bald nicht mehr aus. Er begann, dem Verein Freie Turnerschaft Würzburg mit großzügigen |31|Spenden unter die Arme zu greifen, denn er hielt das Sportgelände, das sich zwischen der Löwenbrücke und dem Steinbachtal erstreckte, für geradezu ideal, um dort seinen eigenen Reiterverein zu gründen.
Sekt und Kohle
Noch immer war der erfolgreiche Kohlengrossist Junggeselle. Als solcher war er zwar wegen seines wachsenden Vermögens heiß begehrt, doch er beabsichtigte sein Kapital vorsichtig zu investieren. Deshalb zeigte er sich auf bei der Brautschau überaus wählerisch. Neben den üblichen Tugenden einer Frau setzte er noch eine überaus wichtige Eigenschaft voraus: Sie sollte Pferde lieben. Für den Ritt im Damensattel gab es allerdings zur damaligen Zeit in Würzburg nur eine Hand voll Kandidatinnen. Eine fiel ihm ins Auge: Jula, die jüngste Tochter des Kommerzialrates und Sektkellerers Franz Josef Lang.
Jula war um zehn Jahre jünger als der Bräutigam und in jeder Hinsicht außergewöhnlich, wie die Nachfahren versichern. Sie machte nicht nur eine gute Figur im Damensattel, sie ruderte auch noch und spielte Tennis. Doch die Brautwerbung erwies sich als schwierig, denn ihr Vater, der Kommerzienrat Franz Josef Lang, wünschte sich keinen Kohlenhändler zum Schwiegersohn, und sei er noch so vermögend. Er war begeisterter Hobbyarchäologe und hätte sich für seine Tochter gern einen Forscher gewünscht. Die Neckermanns mokierten sich: »Unter einer guten Partie verstand er zumindest einen Historiker vom Schlage des Troja-Entdeckers Heinrich Schliemann, der seiner Tochter den Schatz des Priamos zu Füßen legen würde – so ehrgeizig und hochnäsig waren die Langs.«
Doch es kam wie im Märchen: Der Wille der hübschen und energischen Jula siegte. Sie war in den Kohlenhändler verliebt. Allerdings weniger wegen der Kohle: Besonders Neckermanns bemerkenswerte Leistungen beim Springen und bei Treibjagden hatten es ihr angetan. So führte Josef Carl seine Jula 1908 vor den Traualtar. Von der Hochzeit soll ganz Würzburg gesprochen haben, wie die Nachfahren erzählen. Für Neckermann lag »das Glück dieser Erde auf den Rücken der Pferde«. |32|Das sollte über Generationen hinweg so bleiben: Fast jeder Neckermann sollte seinen künftigen Lebensgefährten auf dem Reitplatz finden.
Die Familie Lang bildete in Würzburg ebenfalls einen weit verzweigten Clan. Vom Stadtrat bis zum Anwalt und Arzt waren sie in jedem Stand und Status vertreten. Fast durchweg waren sie passionierte Reiter. Dass die Verbindung zwischen Schwarzkohle und Sektkellerei sich schließlich doch harmonisch fügte, lag nicht zuletzt am verbindenden katholischen Glauben.
Jula Neckermann galt als resolut, bestimmend und emanzipiert. Schon bald nach der Hochzeit bewies sie, dass ihr dieser Ruf nicht umsonst vorauseilte. Im Kohlengeschäft übernahm sie rasch die Rolle einer aktiven Beraterin ihres Gatten. Die energische, bodenständige Art der Frauen schien den Neckermännern auch später noch zu imponieren. Als hätten sie stets die schweren Zeiten mitbedacht, in denen die Frauen ihrem Mann stehen mussten, damit die Familie nicht unterging.
Im Jahr 1910 stand zum ersten Mal Nachwuchs ins Haus: Maria-Barbara kam zur Welt. Am Himmel bedrohte der Halleysche Komet die Erde mit einem giftigen Schweif. Astrologen behaupteten, in diesem Jahr würden keine glücklichen Menschen geboren. Dieser Aberglaube sollte sich noch bestätigen.
Kohle und Druckerschwärze
Wie so viele der neuen Reichen beschäftigte Josef Carl Neckermann vor allem eine Frage: Wohin mit dem vielen Geld? Die Gespräche über die Investitionsmöglichkeit füllten die Nachmittage in Cafés und die langen Abende beim Billard. Anteile am Ausbau der deutschen Flotte und Schiffe zu erwerben, galt als ein sicherer Tipp. Doch Neckermann entschied sich anders.
Auch das Zeitungsgeschäft boomte. Nur gab es bereits so viele Druck-Erzeugnisse, dass man einem neuen Objekt am Kiosk keine Chance mehr einräumte. Der Markt war mehr als gesättigt: 1912 erschienen allein in Bayern 463 Tageszeitungen mit einer täglichen Gesamtauflage von 1,5 Millionen Exemplaren. Führend waren die |33|Münchner Neuesten Nachrichten mit 65 000 verkauften Stück täglich.
Auf einmal munkelte man in Würzburgs Lobbykreisen über ein Konzept für ein neues Blatt mit einem völlig neuen Vertriebskonzept. Neckermann wurde sofort hellhörig. Die Idee stammte aus der Verlagsdynastie Hans und Paul Oldenburg. Der Name allein galt bereits als Garantie. Bekannt war das Münchner Verlagshaus vor allem durch sein Illustriertes Technisches Wörterbuch, das 1906 zum ersten Mal erschien. Auch bei Neckermann muss ein Exemplar dieses unentbehrlichen Nachschlagewerkes im Regal gestanden haben.
Der Haken an dem verlockenden Projekt war lediglich, dass bislang die amtliche Zulassung fehlte. Daran arbeiteten auch die Politiker der Zentrumspartei unaufhörlich. Sie übten so lange Druck aus, bis der Start der neuen Zeitung schließlich nur noch an einer einzigen Unterschrift hing. Die musste der hochbetagte, 91-jährige Monarch, Prinzregent Karl Joseph Wilhelm Luitpold, persönlich leisten. Er befand sich jedoch im Zustand der Halbdämmerung. Drei Wochen vor seinem Tod gelang es, ihm die Signatur zu entlocken. Es dürfte seine letzte Amtshandlung gewesen sein.
Am 12. Dezember 1912 starb der Prinzregent Luitpold. Am 1. Januar 1913 erschien die erste Ausgabe der Bayerischen Staatszeitung, gekoppelt mit dem Königlich Bayerischen Staatsanzeiger. Das königliche Löwenwappen zierte das Titelblatt. Der jährliche Bezugspreis betrug 12 Mark, das Einzelexemplar kostete fünf Pfennige. Die Namen der stillen Teilhaber erschienen nicht im Impressum. Doch die Archive belegen: Der »Kohlenlieferant für die königlich-bayerische Eisenbahn« war dabei.
Das neue Blatt hatte die alte Form. Neben den üblichen Berichten aus dem Reich befand sich auf den nächsten Seiten das Bayernjournal. Dahinter las man über Kultur und Wirtschaft und wühlte sich am Schluss ellenlang durch die Börsenkurse. Wichtiger war jedoch, dass der Vertriebsclou tatsächlich funktionierte: Die Beamten und die Behörden sahen sich durch die Bezeichnung Bayerische Staatszeitung zum Abonnement verpflichtet.
Die Zahl der amtlich ausgewiesenen Zustelladressen betrug 15 000 Pflichtabonnements. Allein das machte bereits einen Garantieumsatz |34|von 180 000 Reichsmark jährlich aus. Zudem kamen die Umsätze aus den Anzeigen, weil die Beamten wiederum vielen Inserenten als wichtige Zielgruppe erschienen. Bei diesem finanzkräftigen Leserkreis ließen sich Gala-Uniformen genauso gut bewerben wie Löwenbräu-Flaschenbiere.
Während des Krieges gingen die üppigen Dividenden für Neckermann und weitere Teilhaber auf null zurück. Doch das Blatt überlebte und startete am 9. November 1918 neu. Danach hing es bis 1934 überall an den Kiosken. So lange, bis die Nazis die liberal orientierte Bayerische Staatszeitung verboten und das letzte Exemplar beschlagnahmten. Ob die Neckermanns zu diesem Zeitpunkt allerdings noch ihre stille Beteiligung an dem Blatt besaßen, lässt sich nicht mehr ermitteln.
Frühstück mit Barbier
Als Josef Carl Neckermann in den Ehestand trat, kehrten in die Sterngasse 3 wohlgeordnete, großbürgerliche Sitten ein. Das begann damit, dass sich das frischvermählte Paar ein Dienstmädchen leistete, das für 12 Mark im Monat, plus Kost und Logis, rund um die Uhr im Einsatz war. Auch bei den Neckermanns stand das Hausmädchen Marie im Sommer um sechs, im Winter schon um fünf Uhr in der Früh auf. Die Öfen mussten eingeheizt werden, das Wasser für die Wäsche und für Kaffee und Tee aufgekocht, das Frühstück für die Familie vorbereitet sein. Die Dame des Hauses durfte derweil noch ein bisschen im Bett ruhen. Für den Herren erschien Punkt sieben der Zugehbarbier im Badezimmer. Diesen Luxus gönnte sich der sonst sehr sparsame Hausherr, weil er sich während der schäumenden Nassrasur der Zeitungslektüre widmen konnte. Die Zeitung brachte der Barbier mit.
Im Untergeschoss war eine Annahmestelle der Süddeutschen Klassenlotterie, für die J.C. Neckermann eine Lizenz erwarb, um sie im Erdgeschoss seines Firmenanwesens neu zu eröffnen. Einer, der nie vergaß, sich regelmäßig einen Lottoschein zu besorgen, war der Chef selbst. Diese Ausdauer sollte belohnt werden. Ein Jahr vor seinem |35|Tod schneite ihm kurz vor Heiligabend ein Gewinn ins Haus: rund 10 000 Mark.
»Der Rockefeller von Würzburg«, wie Josef Carl später genannt wurde, wünschte sich dringend einen Erben, weil auch das Geschäft zunehmend expandierte und am Main schon der nächste neue Neckermann-Kohlenkahn gewassert wurde. Inzwischen hatte Vetter Fritz Neckermann die Schiffswerft Frank & Stühler übernommen. Am 5. Juni 1912 folgte eine Nachricht, die die ganze Firma zu einer Feier veranlasste: Der Erbe war da! Der langersehnte Bub, im Sternzeichen Zwilling, wurde nach seinem Vater Josef Carl getauft. Der dritte Spritzer Weihwasser brachte ihm noch den Vornamen Peter zur Erinnerung an den Großvater.
Zwei Jahre später, am 18. Mai 1914, bekam der Kronprinz des Kohlengrossisten noch ein Brüderchen, Walter Maria. An diesem Montag meldeten die Zeitungen, dass Deutschland nun die stattliche Zahl von 65 Millionen Einwohnern erreicht habe. Die Firma J.C. Neckermann zählte über 80 Angestellte in mehreren Filialen, verfügte über einen großen Pferdefuhrpark und eine eigene Reederei, |36|nannte etliche Häuser und jenen noch von Vater Peter Neckermann erworbenen landwirtschaftlichen Betrieb in Thüngersheim ihr Eigen. Um das Vermögen weiter zu mehren, erwarb Neckermann einige Anteile an der legendären Frankfurter Zeitung – auf Empfehlung und Vermittlung von Hugo Stinnes.
Maria-Barbara, Walter und Josef Neckermann, 1915.
|36|Der »Großhamster der deutschen Industriegeschichte«, wie manche Historiker dieses Kapitalgenie bezeichneten, gehörte zu Neckermanns Lieferanten. Seine Kohlenkähne brachten das schwarze Gold den Main flussaufwärts nach Würzburg. Wenn überhaupt jemand in Deutschland den Vergleich mit Rockefeller verdiente, dann war es Hugo Stinnes. Hie und da griff er zu den gleichen ruppigen Methoden der Kapitalvermehrung. Vom Bergbau und Kohlenhandel im Ruhrpott zum Reeder am Rhein aufgestiegen, besaß Stinnes auf dem Höhepunkt seiner Expansion rund 4 500 Unternehmen mit 600 000 Beschäftigten. Das überwältigte sogar den russischen Dichter Wladimir Majakowski: »Vor ihm verblasst die Sonne als Plunder«, schrieb er über den größten Kriegsgewinnler des Ersten Weltkrieges.
Josef Neckermann durfte Hugo Stinnes als zwölfjähriger Knirps in seinem herrschaftlichen Haus in Essen erleben. Die Begegnung beeindruckte ihn nachhaltig: »So sieht ein Vorbild aus«, vermerkte er in seinen Erinnerungen und betonte: »Mit solchen wichtigen Leuten verkehrte mein Vater damals.« Es blieb ihm auch keine andere Wahl. Denn Stinnes hielt im Brennstoffvertrieb Deutschlands alle Fäden in der Hand. Wer sich mit ihm nicht gut stellte, konnte sein Kohlenmagazin bald schließen.
Pferde für den Ersten Weltkrieg
Josef Neckermann war zwei Jahre und sein Bruder Walter gerade drei Monate alt, da machte Europa mobil. Am Samstag, den 1. August 1914 strahlte die Sonne am wolkenlosen Himmel, wie es Kaiser Wilhelm II. liebte. Das war sein »Kaiserwetter«, und bei solcher Stimmung erklärte er Russland den Krieg. An den folgenden drei Tagen überschlugen sich die historischen Entscheidungen im Eiltempo. Das kaiserliche Wochenende setzte sich fort mit dem Einmarsch der deutschen |37|Truppen nach Luxemburg. In Deutschland läuteten die Kirchenglocken zum Gebet – und auch die Neckermanns in Würzburg gingen wie jeden Sonntag zu ihrer Franziskaner Kirche, nur 200 Schritte von ihrem Haus entfernt.
Als der Sonntagsbraten auf dem Tisch stand, war in Istanbul der Vertrag unterzeichnet, der die Türken verpflichtete, unverzüglich über das Schwarze Meer Russland anzugreifen, sobald die Deutschen mit den Kampfhandlungen gegen Russland begannen. Am Montag, dem 3. August, reichte die kaiserliche Administrative die deutsche Kriegserklärung an Frankreich. Am Dienstag, den 4. August, billigte der deutsche Reichstag einstimmig die Kriegskredite in Höhe von 5 Milliarden Mark. Ab Mittwoch redeten alle nur noch über die Geschäfte. Die teutonischen Wirtschaftskapitäne gerieten ins Profitfieber.
Mit Hurra ging es an die Front. Die Soldaten kritzelten, bevor sie die Güterzüge in Richtung Frankreich bestiegen, fröhlich mit weißer Kreide an die Wagonwände: »Ausflug nach Paris«, »Auf in den Kampf, mir juckt die Säbelspitze«, »Auf Wiedersehen auf dem Boulevard«. In Würzburg als Garnisonsstadt mischte sich maßloser Patriotismus mit schicksalhafter Vorahnung. Auf dem riesigen Platz vor dem Bahnhof taumelten die Soldaten nicht nur im Heldenrausch. Viele standen da, vom schmerzlichen Abschied mitgenommen, schwermütig in Trauer versunken. So mancher ahnte, dass man sich nie mehr wieder sehen würde. Josef Carl Neckermann war sich nicht sicher, wann ein Einberufungsbefehl ins Haus flattern würde. Er war ein Offizier der Reserve bei dem Würzburger Reiterbataillon. Aber er war immerhin schon 46 Jahre alt. Im Ansturm der Freiwilligen keimte die Hoffnung, dass man die Alten nicht mehr brauchen würde. Die Rechnung ging auf, aber nicht aus Altersgründen. Neckermann wurde bei der zweiten Mobilmachung zu den Ulanen, dem kaiserlichen Reiterregiment eingezogen, aber nach einigen Wochen schon wieder als für die Wirtschaft unentbehrliche Person vom Kriegsdienst freigestellt. Da waren eben seine gute Beziehungen zu den örtlichen Kommandanten und Reiterfreunden im Spiel.
Die Firma Josef Carl Neckermann kämpfte also als Lieferant für den Sieg des Kaisers. Auf den Gleisen, die sich entlang des Mains vom |38|Zentrum bis in den Hafen erstreckten, wurden die Transportzüge Tag und Nacht beladen. Das brachte vorerst einen wirtschaftlichen Aufschwung, der anfänglich weitere Euphorie für den »Gotteskrieg« schürte. Auch in den Konservenfabriken von Würzburg wurden Sonderschichten eingelegt. Rund um die Uhr wurde für die Fronttruppen Fleisch eingemacht und für Postkarten als Motiv fotografiert. Abgelichtet wurde auch die Hafenanlage der Brennstoffhandlung Josef Carl Neckermann, wo man fröhlich Kohle für die Kriegsmaschinerie bunkerte. Die Schornsteine der umliegenden Fabriken rauchten im Hintergrund. Die Lokomotiven fuhren im Fünf-Minuten-Takt aus den Toren ab. Es wurden auch Pferde aufgeladen, und in dieses lukrative Kriegsgeschäft wollte Neckermann ebenfalls einsteigen.
Reiterregimenter hatten in Würzburg lange Tradition und genossen hohes Ansehen. Auf jeder zweiten Grußkarte, die aus Würzburg kam, posierte ein schnuckeliger Kadett oder hoher Offizier hoch zu Ross. Das Requirieren der Pferde für die Front erhielt höchste Priorität: Ohne die Pferdestärken hätte die Kriegsmobilität zumindest am Anfang keine Schlagkraft gehabt.
Neckermann brauchte sich keine Gewissensfragen zu stellen. Die Absolution für alle Art von Geschäften, die dem Vaterland nützlich sein konnten, erteilte Kaiser Wilhelm II.: »Uns treibt nicht die Eroberungslust, uns beseelt der unbeugsame Wille, den Platz zu bewahren, auf den Gott uns gestellt hat, für uns und alle kommenden Geschlechter.« Das stärkte die Überzeugung auch eines streng gläubigen Katholiken, wie Josef Carl Neckermann es war, dass es sich um höhere Fügung handelte. Nur Atheisten wie Walter Rathenau, der zu diesem Zeitpunkt noch Aufsichtsratsvorsitzender von AEG war, sinnierte im Herbst dieses Schicksalsjahres mit gedämpfter Skepsis: »Nie wird der Augenblick kommen, wo der Kaiser als Sieger der Welt mit seinen Paladinen auf weißen Rössern durch das Brandenburger Tor zieht. An diesem Tage hätte die Weltgeschichte ihren Sinn verloren!«
Schon im Januar 1915 verwandelten sich diese dunklen Ahnungen in Realität. Für Brot, Milch und Mehl wurden Marken eingeführt. Für die Industrie waren die Tage des Profits rasch gezählt. Auch bei Neckermann gingen bald einige Lichter aus. Das Hauptproblem lag |39|beim Kohlennachschub. Der Brennstoffhandel musste sich ganz umstellen. Die Binnenschifffahrt kam fast vollständig zum Erliegen. Englische und westfälische Kohle stand nicht mehr zur Verfügung. Für die Lieferungen aus oberschlesischen und polnischen Gruben war der Weg bis nach Würzburg zu weit. Die Einbrüche führten allmählich bis zum Stillstand. Aber noch gab es in der Neckermann-Sippschaft einige Metzger und auch den eigenen Bauernhof in Thüngersheim. Mit Schwarzschlachtungen sorgte man dafür, dass man auf die kleiner werdende Scheibe Brot wenigstens noch Schmalz schmieren konnte, auch wenn die Schicht immer dünner wurde. Das waren auch die ersten Kindheitserinnerungen von Josef Neckermann: »Das winzige Stück Wurst, das ich bis zum letzten Bissen vor mir herschob.«
|40|Kapitel 2
»Im langsamen Galopp an der Schule vorbei«
Die Neckermanns und ihre Pferde
Am 9. November erklärte Reichskanzler Prinz Max von Baden den Kaiser für abgesetzt, noch am selben Tag floh Wilhelm II. in die Niederlande, und am 11. November 1918 unterzeichneten die deutschen Generäle im Wald von Compiègne einen Waffenstillstand. Der Krieg war vorüber.
Doch für die deutsche Zivilbevölkerung begann der Schrecken erst. Zwar waren 2 Millionen deutsche Soldaten an der Front gefallen, doch die Kampfhandlungen hatten sich nicht auf deutschem Boden abgespielt. In Deutschland hatte Hunger geherrscht, aber kein Krieg. In deutschen Straßen fielen die ersten Schüsse erst nach der Heimkehr der demoralisierten Soldaten. Von der Front oder aus der Gefangenschaft heimgekehrt, landeten viele in einem hoffnungslosen Kreislauf aus Arbeitslosigkeit, Hunger und Elend. Gegen Ende des Krieges war kein Sold mehr bezahlt worden. Und es sollte mit den Schuldigen des Kriegsdesasters abgerechnet werden: den Militaristen und den Kapitalisten. Sie sollten durch einen grundlegenden politischen Systemwechsel enteignet und entmachtet werden. Der Ruf zu Klassenkampf und bolschewistischer Revolution nach russischem Modell hallte allerorten.
In Kiel kam es bereits Ende Oktober zu Unruhen, als Matrosen ihren Sold verlangten. Von dort breitete sich die Revolution nach Süden aus. Angesichts der Unruhen dankte König Ludwig III. von Bayern bereits am 7. November ab, eine sozialistische Regierung formierte sich unter dem Schriftsteller Kurt Eisner. In Berlin riefen am 9. November der Sozialdemokrat Philip Scheidemann und der Kommunist |41|Kurt Liebknecht unabhängig voneinander die Republik aus. Doch die Sozialdemokraten verbündeten sich bald mit den Militärs und unterdrückten die kommunistische Konkurrenz blutig. Nationalistische Frontkämpfer schlossen sich zu Kampfverbänden zusammen, die sich heftige Straßenschlachten mit den Kommunisten lieferten. In den Jahren darauf kam es immer wieder zu Putschversuchen, vor allem von nationalistischen Gruppen.
Auch an Würzburg ging die Revolution nicht spurlos vorüber. Im Vergleich zu Nürnberg, Bayreuth oder München kam es allerdings nicht zur Bildung von Arbeiter- oder Soldatenräten. »Nur der Mob rebellierte, die Kommunisten und die Plünderer zogen durch die Stadt und es wuchs die Angst um die Kirche. Man befürchtete, sie könnte säkularisiert werden«, berichtete Peter Maximilian Bauer, Guardian des Franziskaner Klosters. Da griff der Patriarch J.C. Neckermann in die Würzburger Stadtgeschichte ein. Um die Kirche und ihr Eigentum zu sichern, »privatisierte« er das Kloster, indem er es pro forma kaufte. Seit dieser Zeit herrschte zwischen den Franziskanerbrüdern und den Neckermanns ein besonders inniges Verhältnis.
Ein Herrschertyp wie Josef Carl Neckermann war in dieser Zeit nicht gerade beliebt. Dass es ihm gelang, in den Chaostagen des Krieges eine prachtvolle Rappstute für sich zu ergattern, schürte Neid und Missgunst. Wenn er ausritt, musste er auf Schleichwegen erst aus der Stadt herauskommen, sonst wurde er hoch zu Ross vom Fußvolk beschimpft, bespuckt oder gar mit Steinen beworfen.
Auch wirtschaftlich war mit Ende des Krieges kein Ende der Not in Sicht. Zu verschiedenen Zeiten besetzten die Alliierten das Ruhrgebiet und beanspruchten die geförderte Kohle für sich. Die Kohlenkrise legte Deutschland schon fast lahm. Die früheren Hauptlieferanten von hochwertiger schwarzer Stückkohle, die vor allem für den Lokomotivbrand benötigt wurde, gehörten nun zu Polen, die Lieferungen aus England blieben weitgehend aus.
Für Josef Carl Neckermann ging es nach dem Krieg darum, seinen Kohlenhandel rasch wieder in Schwung zu bekommen. Er musste schnell verhandeln, um an die äußerst knapp verfügbaren Kontingente von diesem fossilen Brennstoff heranzukommen. Also schrieb er eine Stelle als Einkäufer aus. Es meldeten sich viele, die keine Ahnung |42|vom Geschäft hatten: Der Krieg hatte den Nachwuchs in allen Berufsparten stark ausgedünnt. Die Firmen lagen darnieder. So betrachtete es der fromme Josef Carl Neckermann als ein Geschenk des Himmels, als Guido Klug bei ihm vorstellig wurde.
Beim Vorstellungsgespräch bemühte sich Klug um ein breites Unterfränkisch, aber er konnte seinen elsässischen Dialekt nicht verbergen. Doch Neckermann war angetan von dem jungen Mann und vor allem von dessen Zeugnis. Das Firmenlogo auf dem Empfehlungsschreiben zeigte Fördertürme, die spitzen Kohlenhalden und ein weitverzweigtes Netz von Gleisen. Es stammte von Union Minier aus Elsass-Lothringen. Dort hatte Klug eine Lehre absolviert. Die Carl-Alexander-Kohle aus Baesweiler galt als die beste Kohle in Deutschland und ließ sich günstig bis nach Würzburg mit Schiffen transportieren. Für Neckermann war es wahrhaft ein Glücksfall, dass bei ihm dieser begabte junge Mann vorstellig wurde, der fließend Englisch und Französisch sprach und sogar einige wichtige Leute im elsasslothringischen Kohlenrevier persönlich kannte. Mit ihm konnten die Geschäfte wieder beginnen.
»Der Stinker«
Josef Neckermann war kurz vor dem Ende des Ersten Weltkrieges sechs Jahre alt geworden. Das Unbehagen dieser Zeit prägte sich in sein Gedächtnis ein. Dass sich die Schreckensparolen des Klassenkampfs auch gegen seinen überaus verehrten Vater richteten, erschreckte ihn. Aus dieser Zeit stammt sein Kommunistenhass, der ihn ein Leben lang begleitete: »Sie hatten etwas gegen die Reiter, wie mein Vater es war«, notierte er.
Das Mittelkind fühlte sich in der Familie als benachteiligter Außenseiter. Das Nesthäkchen Walter wurde in Josefs Augen zu sehr verhätschelt, während er immer die Prügel bezog. Je älter er wurde, umso mehr litt er darunter, dass er sich gegen Walter, den Schwächeren, bei den Eltern nicht durchsetzen konnte. Sobald Unordnung in Kinderzimmer herrschte oder irgendwo im Hause eine Fensterscheibe zu Bruch ging, hieß es gleich: »Das war Josöfchen.« Da |43|packte ihn die Wut und von da war es nur ein kleiner Schritt zur Raserei. Diese Eigenschaft sollte sich später noch weiter ausprägen: Wann immer Josef Neckermann etwas unfair vorkam oder er sich im Unrecht fühlte, »da konnte ich sofort auf die Palme gehen«, bekannte er freimütig.
Familie Neckermann in den 20er Jahren. Vorn: Walter und Josef. Mitte: Maria-Barbara, Jula und die Tanten Franka und Toni Lang. Hinten: Josef-Carl Neckermann.
Auch in der Schule war Josef ein Außenseiter. Das begann mit dem ersten Tag, als es um die Sitzverteilung ging. Josef Neckermann hatte von seiner Großmutter einen Ziegenbock geschenkt bekommen, den er vor einen Leiterwagen spannte und mit ihm durch die Gegend fuhr. Es ist bekannt, dass wer mit Ziegen umgeht auch riecht wie sie. Nun wollte am ersten Schultag keiner neben »dem Stinker« sitzen. Doch der Ärger in der Schule juckte ihn kaum. Nichts war für ihn schöner, als mit diesem Mecker-Gespann den breiten Hindenburgring, Würzburgs breiteste Straße hinaufzupreschen, um für Großmutter Lang Besorgungen zu erledigen. Das Feilschen am Markt, das zu dieser Aufgabe gehörte, entpuppte sich als seine nächste Leidenschaft: |44|Früh begann sich zu üben, was einmal der Pfennigfuchser der Nation werden sollte.
Josöfchen spielte kaum mit seinen Geschwistern oder anderen Kindern, sondern suchte ausschließlich die Welt der Erwachsenen. Von der Schule führte sein Weg direkt in den Hof des Kohlenmagazins. Dort fühlte er sich frei, dort stand er nicht dauernd unter der strengen väterlichen Aufsicht. Doch die Gesellschaft war nicht gerade kindgerecht, denn die Fuhrleute und Knechte gingen mit dem Sohn des Kohlenhändlers nicht zimperlich um. Die meisten waren Kriegsveteranen, und sie machten sich einen Spaß daraus, sich den Knirps vorzuknöpfen und ihm die Hosen herunterzuziehen. »Schinkenklopfen« nannten sie das, und Neckermann erinnert sich, dass sie ihn schlugen, »bis das Sitzfleisch blutig wie ein Stück Rohschinken wurde«.
Doch so schlimm es auch wurde: Josöfchen hielt dicht. Der Grund waren die Pferde im Kohlenmagazin. Die schwergewichtigen Belgier und Oldenburger übten eine unwiderstehliche Faszination auf ihn aus. Gebannt sah er zu, wie sie ein- und ausgespannt, abgeschirrt, gelenkt, gefüttert, getränkt, beschlagen, gestriegelt wurden. Doch er wollte nicht nur zuschauen. Wo es ging, fasste er mit an und ließ sich nicht vertreiben. Am liebsten führte er die Pferde vom Sternplatz vor dem elterlichen Haus nach hinten in den Stall. Es passt, dass Neckermanns erste Erinnerung mit Pferden zu tun hat, »als man mich als einen Knirps, der kaum laufen konnte, aufs Pferde setzte«. Dieses Gefühl beschrieb er euphorisch als eine hypnotische Berührung. Es sollte ihn nicht mehr loslassen: »Reiten!«
Das Gefühl, zum ersten Mal auf einem Pferd zu sitzen, sollte für alle Neckermanns in gleicher Weise ein Schlüsselerlebnis werden. Mit den Episoden des Kindheitsglücks ist untrennbar der Klang des Hufgetrappels verbunden. »Mit meinem Vater in einem eleganten Junkergespann am Sonntag durch die Straßen von Würzburg zu fahren, das war für mich das Höchste«, erinnerte sich Josef Neckermann 1985 in einem ZDF-Gespräch und schien noch im Alter von 73 Jahren von Glückgefühlen übermannt.
Doch von den Stallknechten auf dem Kohlenhof nahm Josef Neckermann nicht nur seine Begeisterung für Pferde mit, sondern auch |45|seine Vorliebe für Kraftausdrücke. Zeitlebens war er für seine Wutausbrüche und seinen unflätigen Sprachgebrauch bekannt. Folgende Begebenheit wird in der Familie erzählt. Einmal in guter Laune vertraute der sonst despotische Josef Carl seinem zehnjährigen Sohn die Zügel an. Der kutschierte auch ordentlich, bis plötzlich aus einer Seitengasse ein Handwerksgeselle stürmisch mit einem hochrädrigen Karren einbog. Neckermanns Pferde sprangen erschrocken zur Seite. Der Junior am Kutschbock behielt nur mit viel Mühe die Kontrolle über das Gespann.
»Pass auf du Hurensohn, Kruzifix! Hast du keine Augen, du Arschgeige!«, schrie Josef.
Der Vater war entsetzt. Kaum zu Hause, ließ der dem Sohn die Hosen herunter und verdrosch ihn mit der Reitpeitsche, bis die Striemen an Josefs Hintern blutig und dick angeschwollen waren. Die Bestrafung fiel allerdings nicht allein wegen der unflätigen Flüche so hart aus, sondern vor allem, weil der Sohn ausgerechnet vor dem Priesterseminar das Wort »Kruzifix« verunglimpft hatte.
Toleranz zeigte der strenge Vater nur im Hinblick auf die Zukunftspläne seines Ältesten. Er bestand nicht darauf, dass Josef den Kohlenhandel übernehmen sollte, und unterstützte dessen Reiterträume. Josef konnte mit einer glanzvollen Karriere bei der Kavallerie liebäugeln. Mit seiner Statur, hochgewachsen und schlank, schien er dafür prädestiniert zu sein, einen schneidigen Kadetten abzugeben. Schon zum zehnten Geburtstag bekam er seine ersten Reitstiefel geschenkt. Diese Kostbarkeit pflegte er liebevoll mit Schuhwichse und viel Spucke, bis der Schaft wie ein Spiegel glänzte.
Stiefelputzen, Fluchen, Strafen ertragen: Bald sollte das echte Reiterleben beginnen. Mit guten Noten schien es ohnehin hoffnungslos zu werden. Josef lernte seine Lektionen lieber in der Praxis. »Als Vaters Rappstute Lady gedeckt wurde«, berichtet Josef Neckermann in seinem Reiterbuch Im starken Trab, »ließ ich es mir nicht nehmen, aus aller Nähe zuzuschauen. Sexualkunde gab es ja damals in den Schulen noch nicht. Ich wurde auf der Deckstelle aufgeklärt. Von den Bienen jedenfalls brauchten mir die Lehrer danach nichts mehr zu erzählen.«
|46|Immerhin war er schon zwölf. Lady nahm sein ganzes Interesse in Beschlag. Als sie ihr Fohlen zur Welt bringen sollte, wollte der junge Neckermann wieder unbedingt dabei sein. Tage und Nächte hielt er Wache im Stall und schwänzte dafür die Schule. Von Müdigkeit überwältigt, verschlief er schließlich den Höhepunkt. »Als ich morgens in der Pferdebox aufwachte, lag neben mir ein wunderschönes Stutenfohlen. Es erhielt den Namen Silvia und es wurde später ein sehr ordentliches Reitpferd.«