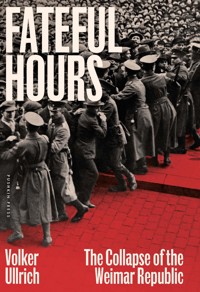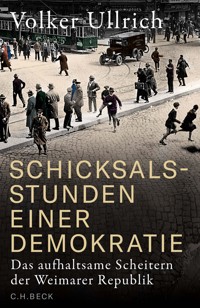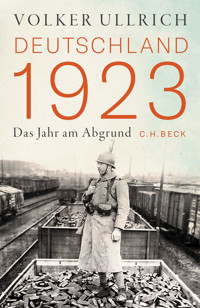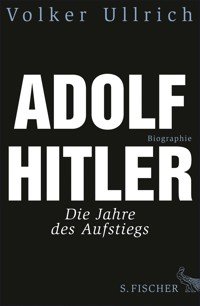13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die glänzende Gesamtdarstellung des Kaiserreichs und des Wegs in den Ersten Weltkrieg In seinem auf den neuesten Stand gebrachten Klassiker zeigt Volker Ullrich die Widersprüche und Ambivalenzen des deutschen Kaiserreichs von 1871 bis 1918, vor allem die Gleichzeitigkeit von Beharrung und Modernität. Aus diesem Gemisch rührte eine nervöse Reizbarkeit als Kennzeichen wilhelminischer Mentalität, die eine wichtige Ursache dafür war, dass sich die Reichsleitung 1914 auf das halsbrecherische Risiko eines Weltkriegs einließ. Die Neuausgabe wurde um ein aktuelles Nachwort mit der neuesten Literatur zum Kaiserreich erweitert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1097
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Volker Ullrich
Die nervöse Grossmacht 1871–1918
Aufstieg und Untergang des deutschen Kaiserreichs
Über dieses Buch
Im August 1914 begann der Erste Weltkrieg. Ohne dass die Zeitgenossen dies schon ahnten, war es der Anfang einer Katastrophe, die bis weit über das Jahr 1918 hinaus wirkte. Wie kam es, dass viele Menschen in Deutschland diesen Krieg herbeiwünschten, und warum ließ sich die deutsche Reichsleitung auf das Risiko eines großen Konflikts ein?
Volker Ullrich sieht im Neben- und Gegeneinander von rückständigen und fortschrittlichen Elementen in Politik, Gesellschaft und Kultur des Kaiserreichs eine Ursache. Aus der brisanten Mixtur von Kraftbewusstsein und Zukunftsangst, Technikeuphorie und Endzeitstimmung erklärt er die nervöse Reizbarkeit, die zu einem spezifischen Merkmal wilhelminischer Politik und Mentalität wurde und die konservativen Führungsschichten 1914 zur »Flucht nach vorn« in den Weltkrieg trieb.
In seiner glänzend erzählten Geschichte des Deutschen Kaiserreichs, die erstmals 1997 erschienen ist, gelingt es dem Autor, die frappierenden Widersprüche und Ambivalenzen der Epoche anschaulich darzustellen. Darüber hinaus wird die Frage nach den Kontinuitäten zwischen dem Kaiserreich und dem »Dritten Reich« mit neuer Schärfe aufgeworfen: Vieles, was im Nationalsozialismus schreckliche Wirklichkeit werden sollte, war bereits in der wilhelminischen Ära angelegt.
Ergänzt wird die aktuelle Neuausgabe durch ein umfassendes Nachwort, in dem die seit 1997 erschienene Forschungsliteratur mit ihren neuen Erkenntnissen vorgestellt wird.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Volker Ullrich,geboren 1943, studierte Geschichte, Literaturwissenschaft und Philosophie. Der promovierte Historiker ist Autor der »Zeit« und Mitherausgeber des Magazins »Zeit-Geschichte« und lebt in Hamburg. Von 1990 bis 2009 leitete er das Ressort »Politisches Buch« bei der Hamburger Wochenzeitung. Ullrich hat zahlreiche historische Werke zum 19. und 20. Jahrhundert veröffentlicht. Bei S. Fischer erscheint 2013 »Adolf Hitler. Die Jahre des Aufstiegs 1889–1939. Biographie«. Für sein publizistisches Wirken wurde er mit dem Alfred-Kerr-Preis und der Ehrendoktorwürde der Friedrich-Schiller-Universität Jena ausgezeichnet.
Impressum
Covergestaltung: buxdesign │ München
Erweiterte Neuausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1997
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402896-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
Teil I Das deutsche Reich im Zeitalter Bismarcks
1. Die Gründung des Kaiserreichs
Die Kaiserproklamation in Versailles
Der Gründungsmythos des neuen Reiches
Reichsgründung und europäisches Gleichgewicht
2. Probleme der inneren Reichsgründung
Verfassung und Regierungssystem des Kaiserreichs
Vom Gründerboom zum Gründerkrach
Der erste innenpolitische Präventivkrieg: der »Kulturkampf«
Die innenpolitische Wende von 1878/79
Der zweite innenpolitische Präventivkrieg: Sozialistengesetz und Sozialgesetzgebung
3. Deutsche Aussenpolitik nach 1871
Halbe oder ganze Hegemonie? Das Deutsche Reich im Konzert der europäischen Mächte
Bismarcks Drohpolitik: die Krieg-in-Sicht-Krise 1875
Konfliktverlagerung an die Peripherie: Orientkrise und Berliner Kongreß 1878
Der Aufbau des Bismarckschen Bündnissystems
Anfänge deutscher Kolonialpolitik
4. Das Ende der Bismarck-Ära
Die Krise des Bismarckschen Bündnissystems
Das Dreikaiserjahr 1888
Bismarcks Sturz
Bilanz der Bismarck-Ära
Teil II Das wilhelminische Deutschland
1. Vom Agrar- zum Industriestaat
Der große Sprung nach vorn: die wirtschaftliche Entwicklung 1890 bis 1914
Bevölkerung und Mobilität
Urbanisierung und soziale Frage
2. Das Herrschaftssystem unter Kaiser Wilhelm II.
Das »persönliche Regiment«
Die Kanzler nach Bismarck
Die Stellung des Reichstags
Parteien und Verbände
3. Der »Neue Kurs« in der Aussen- und Innenpolitik nach 1890
Die Abkehr vom außenpolitischen System Bismarcks
Das Scheitern der inneren Reformpolitik
4. Weltmachtstreben, Schlachtflottenbau und nationale Sammlung
Anfänge wilhelminischer Welt- und Flottenpolitik (1897–1901)
Die wachsende außenpolitische Isolierung des Deutschen Reiches (1901–1909)
Die Neuauflage der Sammlungspolitik (1897–1906)
Die Krise des »persönlichen Regiments«: Bülow-Block, Daily-Telegraph-Affäre und Reichsfinanzreform (1906–1909)
5. Der Weg in die Sackgasse
Zwischen Entspannung und Krisenverschärfung: die deutsche Außenpolitik 1909 bis 1914
Zwischen bürokratischem Reformkurs und Selbstblockade: die deutsche Innenpolitik 1909 bis 1914
6. Die Flucht nach vorn: Julikrise und Kriegsausbruch 1914
Die deutsche Risikopolitik im Juli 1914
Das »Augusterlebnis«
Teil III Die Gesellschaft des Kaiserreichs
1. Soziale Schichtung und Gesellschaftsordnung
Der Adel
Bürgertum und Kleinbürgertum
Industriell-gewerbliche Arbeiterschaft
Bauern und Landarbeiter
Konturen der wilhelminischen Klassengesellschaft
2. Frauen in der Männergesellschaft
Rechtliche Situation
Familienleben
Sexualität
Frauenarbeit
Frauenbewegung und Frauenemanzipation
3. Bildung – Wissenschaft – Kultur
Das Schulwesen
Universitäten und Hochschulen
Kultur im Kaiserreich
4. Nationalismus – Antisemitismus – Militarismus vor 1914
Die Radikalisierung des Nationalismus und der Aufstieg der Agitationsverbände
Die Ausbreitung des Antisemitismus
Die Militarisierung der Gesellschaft und die Schwäche der Gegenkräfte
Teil IV Der erste Weltkrieg
1. Kriegführung und Politik 1914 bis 1916
Vom Scheitern des Schlieffenplans bis zum Sturz Falkenhayns
Das Streben nach Hegemonie: die Kriegszielbewegung und die Politik Bethmann Hollwegs
Das Dilemma der Friedenssondierungen
Burgfriede, innenpolitische Neuorientierung und die Spaltung der Sozialdemokratie
2. Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur im Kriege
Die Organisation der Kriegswirtschaft
Soziale Auswirkungen des Krieges
»Heimatfront« und Schützengraben: der Kriegsalltag
Die Radikalisierung des Antisemitismus
Kultur und Krieg
3. Das Epochenjahr 1917
Die Entscheidung für den uneingeschränkten U-Boot-Krieg und der Kriegseintritt der USA
Die russische Februar-Revolution und ihre Rückwirkungen auf Deutschland
Die Julikrise 1917, der Sturz Bethmann Hollwegs und der Beginn der Parlamentarisierung
4. Der Zusammenbruch 1918
Die Januarstreiks: das Vorspiel zur Revolution
Der Gewaltfrieden von Brest-Litowsk und das deutsche Ostimperium
Das Scheitern der deutschen Frühjahrsoffensive
Die wilhelminische Gesellschaft in der Auflösung
Reform von oben und Revolution von unten
Das Ende
Bilanz und Ausblick
ANHANG
Ausgewählte Bibliographie
Quellensammlungen, Aktenpublikationen, Dokumentationen
Biographien, Erinnerungen, Tagebücher, Briefe
Allgemeine Darstellungen, Handbücher, Aufsatzsammlungen
Wirtschaft, Wirtschaftspolitik, Interessenverbände
Gesellschaft, Alltag, Mentalitäten
Außen-, Innen-, Sozial- und Militärpolitik
Kultur, Bildung, Wissenschaft
Neue Forschungen zum Kaiserreich
I. Bismarck und Bismarckreich
II. Innere Reichsgründung und Globalisierung
III. Der Kaiser und das wilhelminische Deutschland
IV. Nervöse Reizbarkeit
V. Antisemitismus, Nationalismus, Militarismus
VI. Der Weg in den Ersten Weltkrieg
VII. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts
VII. Der Krieg der Bilder und Erinnerungen
Vorwort
Noch eine Geschichte des deutschen Kaiserreichs? Gibt es davon mittlerweile nicht genug? Ist diese Geschichte nicht viele Male erzählt und gedeutet, gepriesen und verflucht worden? Ja, das alles ist richtig, und dennoch gibt es drei gute Gründe, noch einmal den Versuch einer Synthese zu wagen:
1. Die neueren Gesamtdarstellungen aus der Feder von Thomas Nipperdey, Wolfgang J. Mommsen und Hans-Ulrich Wehler sind ohne Zweifel allesamt herausragende Werke der Geschichtsschreibung.[1] Die deutsche Geschichtswissenschaft hat derzeit kaum etwas Besseres zu bieten; auch im internationalen Vergleich präsentiert sie sich damit auf der Höhe der Zeit. Es soll nicht verschwiegen werden, daß das vorliegende Buch vor allem diesen drei Gelehrten wichtige Erkenntnisse und Einsichten verdankt. Wenn Nipperdey in allzu großer Bescheidenheit bekannte: »Wir sind Zwerge auf den Schultern von Riesen«,[2] so gilt dies natürlich erst recht für diese Untersuchung.
Dennoch haben die drei genannten Großwerke einige Nachteile, über die sich nur schwer hinwegsehen läßt: Sie sind überaus umfangreich, und sie richten sich in erster Linie an die Fachwissenschaft. Nipperdey pflegt einen bedächtigen, altväterlich-belehrenden Vorlesungsstil, der auf die Dauer doch sehr strapaziös ist. »Es finden sich kaum Zitate von Zeitgenossen«, so hat der englische Sozialhistoriker Richard Evans angemerkt, »es gibt keine Beschreibung … kaum einmal eine Anekdote oder kleine Geschichte. Die Menschen, die in dieser Epoche lebten, kommen kaum zu Wort. Statt dessen hören wir ständig die Stimme Nipperdeys, der sie abwägt, ausgleicht und bewertet.«[3] Dieses Urteil läßt sich, in abgewandelter Form, auch auf die Arbeiten von Wolfgang J. Mommsen und Hans-Ulrich Wehler beziehen, wobei besonders der Bielefelder Historiker mit seiner Neigung, das sozialhistorische Material möglichst vollständig und in allen Verästelungen auszubreiten, selbst dem einschlägig vorgebildeten Leser über weite Strecken schwerverdauliche Kost zumutet.
Schließlich weisen alle drei Werke trotz ihrer ausladenden Dimensionen gewisse Begrenzungen auf. Wehlers Konzept von Gesellschaftsgeschichte orientiert sich bekanntlich an Max Weber. Seine Schlüsselkategorie sind die »marktbedingten Klassen«. Da die meisten Frauen im Kaiserreich nicht am Markt positioniert waren, sprich: keiner bezahlten Erwerbstätigkeit nachgingen, fallen sie aus Wehlers Analyse weitgehend heraus. Es handelt sich also, strenggenommen, um eine halbierte Gesellschaftsgeschichte. Wolfgang J. Mommsens zwei Bände zeichnen sich dadurch aus, daß den politikgeschichtlich akzentuierten Teilen der Darstellung jeweils längere Exkurse über die Kultur des Kaiserreichs angefügt werden. Allerdings wird Kultur hier reduziert auf die Hervorbringungen der bürgerlichen Hochkultur; die populäre Kultur oder Massenkultur, die gerade um die Jahrhundertwende bedeutsame Veränderungen in Lebensformen und Lebensstilen hervorbrachte,[4] wird hingegen fast vollständig ausgeblendet. Nipperdey hat im ersten Band seiner DEUTSCHEN GESCHICHTE 1866–1918 eine beeindruckende Fülle von sozial- und kulturhistorischen Phänomenen abgehandelt; allerdings werden diese streng getrennt von den struktur- und politikgeschichtlichen Teilen des zweiten Bandes, so daß sich der Leser selbst zusammenreimen muß, wie das eine mit dem anderen verknüpft ist.
Demgegenüber versucht dieses Buch die Geschichte des Kaiserreichs nicht nur in einem überschaubaren Rahmen zu halten, sondern sie auch so zu erzählen, daß ein größeres, nicht nur fachlich interessiertes Publikum daran Gefallen finden kann. Angestrebt wird gleichwohl eine moderne Synthese aus Politik-, Gesellschafts- und Kulturgeschichte, welche die Ergebnisse der neuesten, zum Teil hochspezialisierten Forschung berücksichtigt und dem Leser darüber hinaus Einblicke gibt in Kontroversen der Geschichtswissenschaft der letzten Jahrzehnte. Zweifellos ist das ein ehrgeiziges Unterfangen. Gerade die sozialhistorische Analyse läßt sich, wie man weiß, nur schwer in Form erzählender Geschichtsschreibung vermitteln. Dennoch wurde mit dem vorliegenden Band der Versuch eines solchen Brückenschlags unternommen.
2. Ein weiterer Grund, sich aufs neue der Geschichte des Kaiserreichs zuzuwenden, hängt zusammen mit der Debatte um das Buch von Daniel Jonah Goldhagen HITLERS WILLIGE VOLLSTRECKER, das im vergangenen Jahr die Gemüter erregte.[5] Wie immer man über die provozierenden Thesen des amerikanischen Politologen denken mag: sie zwingen uns, die Vorgeschichte des Dritten Reiches – und das heißt auch immer die Geschichte des deutschen Kaiserreichs – noch einmal genauer ins Auge zu fassen. Nur vierzehn Jahre nach dem Untergang der Hohenzollernmonarchie wurde die Macht an Hitler übertragen – mit den bekannten schrecklichen Folgen für Deutschland und die Welt. Von den langen Schatten abzusehen, die der Nationalsozialismus nach rückwärts wirft, ist schlechterdings unmöglich. Thomas Nipperdey bezeichnet in seiner Bilanz am Ende des zweiten Bandes die Perspektive auf das Jahr 1933 nicht nur als legitim, sondern als notwendig: »Wer sich ihr entziehen wollte, verfiele der einsichtslosen Apologie der Vergangenheit.«[6] Tatsächlich aber hat Nipperdey in seiner Darstellung versucht, eine Art cordon sanitaire um das Kaiserreich zu ziehen und die Kontinuitäten, die von hier ins Dritte Reich führen, im Lichte des Rankeschen Diktums, wonach jede Epoche unmittelbar zu Gott sei, entweder abzumildern oder ganz verschwinden zu lassen.
Gegen solche Bemühungen, das Kaiserreich künstlich von seiner Nachgeschichte zu distanzieren, wendet sich dieses Buch. Es weiß sich der Forderung Hans-Ulrich Wehlers verpflichtet, daß »die Erklärung jenes Absturzes, der die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert nur sehr wenige Jahre nach dem Untergang des Kaiserreichs in die unverhüllte Barbarei geführt hat«, ein »unumgänglicher Fluchtpunkt des bilanzierenden Urteils« bleiben müsse.[7] Das bedeutet nicht etwa, daß ich einfach angeknüpft hätte an jene Theorie vom deutschen Sonderweg, die in der Kluft zwischen ökonomischer Modernisierung und politischer Rückständigkeit ein Grundübel der neueren deutschen Geschichte und die eigentliche Ursache für Deutschlands Abweichen von einem als normal betrachteten westlichen Entwicklungspfad zu erkennen meinte. Diese Theorie, die seit Wehlers immer noch überaus anregender Skizze zur Geschichte des Kaiserreichs aus dem Jahre 1973[8] für über ein Jahrzehnt die Deutungen beherrschte, ist inzwischen von der historischen Forschung modifiziert und auch vom Kopf der »Bielefelder Schule« im dritten Band seiner DEUTSCHEN GESELLSCHAFTSGESCHICHTE zwar nicht ganz fallengelassen, aber doch erheblich abgeschwächt worden.[9]
Heute bietet sich die Geschichte des Kaiserreichs in der Tat weitaus komplexer und vielgestaltiger dar, als es das relativ einfache Erklärungsmodell vom deutschen Sonderweg seinerzeit nahezulegen schien. Widersprüche und Ambivalenzen zeigen sich auf allen Ebenen von Gesellschaft, Politik und Kultur – ja, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen scheint geradezu das Hauptcharakteristikum der Jahrzehnte vor und nach 1900 zu sein: Neben einer überaus dynamischen, innovativen Industriewirtschaft finden wir die monströse Spätblüte einer neoabsolutistischen Hofkultur; neben erstaunlichen Leistungen in Wissenschaft und Technik eine weitverbreitete Uniformgläubigkeit, die Vergötzung alles Militärischen; neben Tendenzen zur Parlamentarisierung und Demokratisierung die latente Drohung mit dem Staatsstreich, das Liebäugeln mit der Militärdiktatur; neben einer lebendigen avantgardistischen Kulturszene die plüschigste Salonkunst; neben einer erstaunlichen kulturellen Liberalität die kleinlichsten Zensurschikanen und eine harte Klassenjustiz; neben der Sozialfigur des wilhelminischen Untertanen, wie sie Heinrich Mann in seinem Roman so trefflich geschildert hat,[10] den selbstbewußten großbürgerlichen Unternehmer und den klassenbewußten sozialdemokratischen Arbeiter; neben auftrumpfendem Kraftgefühl und ungebremster Aggressivität ein tiefsitzendes Gefühl von Angst und Unsicherheit. In diesem Neben- und Ineinander des scheinbar Unvereinbaren liegt vermutlich ein Erklärungsschlüssel für die nervöse Reizbarkeit, in der dieses Buch – im Anschluß an die wegweisenden Untersuchungen Joachim Radkaus[11] – ein spezifisches Merkmal von Politik und Mentalität der wilhelminischen Ära sieht.
Eine Geschichte des Kaiserreichs kommt also nicht umhin, die widerspruchsvolle Verbindung von Beharrung und Modernität, von Rückständigkeit und Fortschritt auf den verschiedenen Ebenen zu thematisieren. Dabei geht es nicht darum, mit Nipperdey nun unter allen Umständen »den Urgroßeltern vor dem Ersten Weltkrieg … Gerechtigkeit widerfahren zu lassen«[12] – was heißt hier schon Gerechtigkeit? –, sondern um das schlichte Gebot, vielschichtige, sich überlagernde Strukturen, Prozesse und Phänomene zunächst einmal zu erfassen und zusammenhängend zu deuten. Eine ausschließlich auf das Jahr 1933 fixierte Perspektive würde der verblüffenden Vielfalt und Widersprüchlichkeit der Epoche zweifellos nicht gerecht. Neben den besonderen Belastungen ist auch nach den verschütteten Möglichkeiten, den entwicklungsfähigen Momenten zu fragen. Der Untergang des Kaiserreichs war durch die Gründungskonstellation von 1870/71 so wenig determiniert wie das Scheitern der Weimarer Demokratie durch die mißglückte Revolution von 1918/19. Aber noch einmal: Die Frage, inwieweit im Kaiserreich bereits Voraussetzungen und Bedingungen geschaffen wurden für den einzigartigen Zivilisationsbruch von 1933, bleibt die entscheidende Herausforderung, der kein Historiker, der sich mit dieser Zeit befaßt, ausweichen kann.
3. Ein dritter Grund, sich heute wieder mit der Geschichte des Kaiserreichs zu beschäftigen, liegt in der Zäsur von 1989/90 beschlossen, die offensichtlich nicht nur vielen einst linken Intellektuellen, sondern auch manchem Historiker hierzulande den Kopf verdreht hat. Es berührt merkwürdig, wenn Wolfgang J. Mommsen zu Beginn seiner Darstellung verkündet: »Es wäre gewiß unangemessen, wenn man in dem wiederentstandenen deutschen Staat nur eine Fortsetzung des deutschen Kaiserreichs sehen wollte«, um gleich darauf in der Bismarck-Schöpfung doch den »zentralen Orientierungspunkt für die nationale Identität der Deutschen« zu entdecken.[13] Und es ist gewiß kein Zufall, daß Nipperdey den Abschluß seines Werkes auf den 3. Oktober 1991, den Tag der deutschen Einheit, datiert und zugleich seiner Freude darüber Ausdruck gegeben hat, daß er »das unverhoffte Glück der Vereinigung Deutschlands« noch erleben durfte.[14]
Ich gestehe gern, daß ich derlei Gefühle zu keinem Zeitpunkt teilen konnte – sosehr ich es begrüßt habe, daß die Menschen in der DDR sich aus eigener Kraft und unblutig der SED-Herrschaft entledigten, wie die revolutionären Arbeiter und Soldaten 81 Jahre zuvor sich der Hohenzollernherrschaft entledigt hatten. Doch eingedenk des katastrophal fehlgeschlagenen Experiments des ersten deutschen Nationalstaats schien mir jene schwarz-rot-goldene Jubelstimmung, wie man sie am Tag der deutschen Einheit beobachten konnte, gänzlich unangebracht. Noch ist nicht ausgemacht, ob das zweite Experiment mit einem deutschen Nationalstaat in der Mitte Europas glücken wird. Die Zeichen dafür stehen allerdings ungleich günstiger als vordem: Die neue Berliner Republik ist zunächst einmal kleiner als das Kaiserreich, und sie ist nicht aus einem Krieg hervorgegangen; sie pflegt relativ entspannte Beziehungen zu allen Nachbarstaaten; sie agiert in ihrer Außen- und Militärpolitik eher zurückhaltend, jedenfalls keineswegs im Stile eines neuen auftrumpfenden Wilhelminismus, für den manche Kritiker bereits sichere Anzeichen zu erkennen glaubten. Vor allem aber: Das vereinigte Deutschland ist diesmal fest eingebunden in die westliche Allianz und deren demokratisches Wertesystem. Die alte Antinomie zwischen westlicher Zivilisation und deutscher Kultur, eine Grundbedingung der deutschen Sonderentwicklung, ist aufgehoben; die Gefahr, daß Deutschland wieder zum unberechenbaren Störenfried Europas und der Welt werden könnte, ist damit erheblich reduziert.
Das bedeutet freilich nicht, daß schwere innere Verwerfungen und Krisen künftig ausgeschlossen werden können. Gerade ein Blick auf die Endphase des Kaiserreichs zeigt, wie rasch ein relativ stabiles Gemeinwesen aus den Fugen geraten kann, wenn die soziale Ungleichheit zu krasse Formen annimmt und wenn die Politik die Fähigkeit zu rechtzeitigen Reformen verliert. Das war im Ersten Weltkrieg der Fall, in dem sich alle strukturellen Probleme des Kaiserreichs bündelten und zugleich potenzierten. Dieser Teil ist nicht zufällig der umfangreichste des Buches; er ist im Hinblick auf kommende gesellschaftliche Konflikte vielleicht auch der lehrreichste.
Thomas Karlauf hat das Manuskript kenntnisreich und stilsicher redigiert. Ihm bin ich zu großem Dank verpflichtet. Ebenso danke ich Walter H. Pehle, der das Buch angeregt und den Entstehungsprozeß mit Geduld und ermunterndem Zuspruch begleitet hat.
Teil IDas deutsche Reich im Zeitalter Bismarcks
»Schwarz, weiß und rot! um ein Panier
Vereinigt stehen Süd und Norden;
Du bist im ruhmgekrönten Morden
Das erste Land der Welt geworden:
Germania, mir graut vor dir!«
(GEORG HERWEGH: EPILOG ZUM KRIEGE, FEBRUAR 1871)
1.Die Gründung des Kaiserreichs
Die Kaiserproklamation in Versailles
Es war bitterkalt im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles, an jenem 18. Januar 1871, als das deutsche Kaiserreich ausgerufen wurde. Das Ganze war eine militärische Veranstaltung. Wohin der Blick auch fiel – Uniformen, Helme, Säbel, Fahnen und Standarten; die wenigen Gestalten im Frack verloren sich inmitten dieser kriegerischen Gesellschaft.[1] Das Volk war nicht vertreten, nicht einmal durch eine Abordnung des gewählten Parlaments, des norddeutschen Reichstags – ein getreues Abbild der Tatsache, daß der kleindeutsch-preußische Nationalstaat nicht durch demokratischen Willensentscheid, sondern durch Siege auf dem Schlachtfeld zustande gekommen war.
Um den besiegten Gegner zusätzlich zu demütigen, hatte man – eine Instinktlosigkeit ohnegleichen – als Ort der Proklamation gerade jenes Prachtschloß Ludwigs XIV. gewählt, mit dem sich für viele Franzosen Ruhm und Glanz einer vergangenen Epoche verbanden. Und auch das Datum war von hohem Symbolwert: 170 Jahre zuvor, am 18. Januar 1701, hatte der Sohn des Großen Kurfürsten als Friedrich I. den Königsthron in Preußen bestiegen. Die preußische Geschichte, so sollte suggeriert werden, war nun endlich an ihrem Zielpunkt angelangt. »Morgen ist hier großer Mummenschanz, d.h. es soll der deutsche Kaiser proklamiert werden, am alten Krönungstag der preußischen Könige«, notierte Paul Bronsart von Schellendorff, ein hoher Generalstabsoffizier, am 17. Januar in sein Tagebuch, und er mokierte sich über die »Helden des Zeremoniells«, die schon in Versailles eingetroffen waren.[2]
Fast hätte die Zeremonie noch in letzter Minute abgesagt werden müssen. Denn König Wilhelm I., der sich ohnehin nur widerstrebend zur Annahme der Kaiserwürde hatte entschließen können, weil er instinktiv spürte, daß er damit »von dem alten Preußen … Abschied nehmen müßte«[3], sperrte sich bis zuletzt gegen den ihm von Bismarck zugedachten Titel Deutscher Kaiser. Hätte der preußische König geahnt, daß Bismarck den bayerischen Monarchen Ludwig II. erst durch erhebliche finanzielle Zuwendungen hatte bewegen können, Wilhelm I. im Namen der deutschen Fürsten die Kaiserkrone anzubieten – sein Widerstand wäre vermutlich noch heftiger ausgefallen. Wenn schon, dann wollte er wenigstens Kaiser von Deutschland heißen. Dem aber widersetzte sich Bismarck, weil damit ein territorialer Herrschaftsanspruch verbunden schien, der den mühsam ausgehandelten Kompromiß mit den süddeutschen Staaten hätte in Frage stellen können.
Die Gegensätze in der Titelfrage überschatteten noch die Zeremonie im Spiegelsaal. Im Anschluß an eine kurze Ansprache Wilhelms I. verlas Bismarck, »der ganz grimmig verstimmt aussah«, »in tonloser, ja geschäftlicher Art und ohne jegliche Spur von Wärme oder feierlicher Stimmung« die Proklamation An das deutsche Volk.[4] Darin wurde die heikle Titelfrage insofern ausgeklammert, als nur von der »deutschen Kaiserwürde« die Rede war. Auch der Großherzog von Baden vermied es in seinem Hoch auf »Seine Kaiserliche und Königliche Majestät, Kaiser Wilhelm«, die Empfindlichkeiten der einen wie der anderen Seite zu reizen. Und doch blieb bei Wilhelm I. eine nachhaltige Verstimmung zurück. Bei der anschließenden Gratulationscour übersah er ganz bewußt den Mann, der die deutsche Einheit unter Preußens Führung zustande gebracht hatte. »Diese Kaisergeburt war eine schwere«, beklagte sich Bismarck einige Tage später in einem Brief an seine Frau Johanna, »und Könige haben in solchen Zeiten ihre wunderlichen Gelüste, wie Frauen, bevor sie der Welt hergeben, was sie doch nicht behalten können. Ich hatte als Accoucheur mehrmals das dringende Bedürfnis, eine Bombe zu sein und zu platzen, daß der ganze Bau in Trümmer gegangen wäre.«[5]
Nicht nur auf den Reichsgründer selbst, sondern auch auf manchen anderen Teilnehmer wirkte die Inszenierung vom 18. Januar 1871 alles andere als erhebend. Vor allem die anwesenden Bayern empfanden Trauer bei dem Gedanken, künftig einem von Preußen dominierten Deutschland anzugehören. »Ach Ludwig«, schrieb Prinz Otto am 2. Februar an seinen königlichen Bruder, »ich kann Dir gar nicht beschreiben, wie unendlich weh und schmerzlich es mir während der Zeremonie zu Mute war, wie sich jede Faser in meinem Innern sträubte und empörte gegen all das, was ich mit ansah … Alles so kalt, so stolz, so glänzend, so prunkend und großtuerisch und herzlos und leer … Mir war’s so eng und schal in diesem Saale, erst draußen in der freien Luft atmete ich wieder auf. Dieses wäre also vorbei.«[6]
Ganz anders wurde die Reichsgründung offenbar in Deutschland erlebt, und zwar auch in den süddeutschen Staaten, wo es vor 1870 noch starke Aversionen gegen einen Anschluß an den Norddeutschen Bund gegeben hatte. Der nationalliberale Reichstagsabgeordnete Hans Viktor von Unruh beobachtete während einer Reise durch Baden und Württemberg im Frühjahr 1871: »In allen Schenkstuben hingen, wenn auch schlechte, wohlfeile Bildnisse des Kaisers, Bismarcks, des Kronprinzen und Moltkes … Kaiser und Reich fanden enthusiastische Zustimmung.«[7] Unter dem Eindruck der Kaiserkrönung in Versailles und der Kapitulation von Paris wenige Tage später schrieb der auf dem rechten Flügel der Nationalliberalen stehende Historiker Heinrich von Sybel an seinen langjährigen politischen Weggefährten Hermann Baumgarten: »Wodurch hat man die Gnade Gottes verdient, so große und mächtige Dinge erleben zu dürfen? Und wie wird man nachher leben? Was zwanzig Jahre der Inhalt alles Wünschens und Strebens gewesen, das ist nun in so unendlich herrlicher Weise erfüllt! Woher soll man in meinen Lebensjahren noch einen neuen Inhalt für das weitere Leben nehmen?«[8]
Dennoch gab es gerade für die Nationalliberalen keinen Grund zur Euphorie. Zwar hatte sich Bismarck seit 1866 mit ihnen ausgesöhnt, weil er nur zu genau wußte, daß das Werk der deutschen Einheit ohne oder gar gegen die stärkste gesellschaftliche Kraft der Zeit, die bürgerliche Nationalbewegung, nicht vollendet werden konnte. Zugleich aber hatte der Kanzler sorgfältig darauf geachtet, daß Reichstag und Parteien im Prozeß der Reichsgründung von jedem direkten Einfluß auf den Gang der Verhandlungen ferngehalten wurden. Das deutsche Reich sollte als dynastische Gründung ins Leben treten, durch Vereinbarung der Fürsten und nicht durch die Initiative des Parlaments. Und so war die Kaiserproklamation am 18. Januar zuallererst auch ein dynastischer Akt, wobei in der Dominanz der Uniformen der Charakter des neuen Reiches als eines Militärstaats unübersehbar zutage trat. »Dieser militärisch-höfische Charakter, der dem deutschen Kaisertum in der Stunde seiner Geburt aufgeprägt wurde, hat ihm angehaftet, solange ein Hohenzoller die Kaiserkrone getragen hat. Das wurde eine Grund-Tatsache der deutschen politischen Entwicklung.«[9] In dieses Urteil des liberalen Publizisten Erich Eyck aus dem Londoner Exil 1943 ist bereits die Kenntnis des Späteren, des unrühmlichen Endes der Hohenzollernmonarchie 1918, eingegangen. Aus der Perspektive von 1871 nahm sich der weitere Gang der Dinge nicht so eindeutig aus. So schwer die Hypothek auch wog, die aus der Konstellation der Geburtsstunde erwuchs – die Weichen waren damit noch nicht unausweichlich auf Scheitern und Untergang gestellt. Wie sich der deutsche Nationalstaat, der aus drei Kriegen hervorgegangen war, in der äußeren und inneren Politik entwickeln, welche Kräfte in ihm vorherrschen, wie sich insbesondere das Machtverhältnis zwischen Krone, Regierung und Parlament verteilen und ob es den Liberalen gelingen würde, die militärstaatlich-autoritäre Prägung der Gründungsphase zu überwinden, das mußte sich in der Zukunft erweisen.
Der Gründungsmythos des neuen Reiches
Aus staatsrechtlicher Sicht war die Kaiserproklamation in Versailles nur eine, wenn auch wichtige Etappe auf dem Wege zur Reichsgründung. Mindestens ebenso bedeutsam war die Verabschiedung der neuen Reichsverfassung durch den Reichstag am 16. April 1871. Doch nicht dieser Tag wurde zum Symbol deutscher Einheit, sondern die Szene im Schlosse von Versailles, die unter Ausschluß der Öffentlichkeit stattgefunden hatte. Künstler, Publizisten, Historiker wetteiferten darin, sie zum nationalen Großereignis, zum identitätsstiftenden Schöpfungsakt zu verklären. Auf der Skala nationaler Gedenktage im Kaiserreich rangierte das Reichsgründungsfest an erster Stelle – noch vor Kaisers Geburtstag am 22. März (später, zu Zeiten Wilhelms II., am 27. Januar) und dem Sedantag am 2. September.[10]
Keiner hat so zur Popularisierung des Gründungsmythos beigetragen wie Anton von Werner mit seinem berühmten Bild der Kaiserproklamation, das, unzählige Male reproduziert, zur nationalen Ikone der Deutschen wurde. Der Historienmaler hatte am 15. Januar 1871 ein Telegramm des preußischen Hofmarschalls von Eulenburg erhalten mit der Aufforderung, sich umgehend ins Hauptquartier nach Versailles zu begeben, wo er etwas seines »Pinsels Würdiges erleben« würde.[11] Er traf gerade noch rechtzeitig ein, um die Zeremonie im Spiegelsaal mitzuerleben. Noch in Versailles begann Anton von Werner mit Entwürfen und Skizzen. Es dauerte allerdings noch einige Jahre, bis das Werk vollendet und am 22. März 1877, dem 80. Geburtstag Wilhelms I., dem Kaiser als Geschenk der Fürsten und freien Städte überreicht werden konnte.
Das großflächige Gemälde suchte den Eindruck einer detailgetreuen, fast photographischen Wiedergabe des Geschehens zu erwecken; in Wirklichkeit lieferte Anton von Werner durch die Komposition und das Arrangement der Figuren eine bestimmte idealisierende und heroisierende Interpretation des historischen Ereignisses.[12] Noch deutlicher zeigt sich diese Tendenz in der zweiten Fassung des Bildes von 1882: Die Hauptprotagonisten, allen voran Wilhelm I. und Bismarck, sind hier unverkennbar in den Mittelpunkt gerückt. Anstelle der blauen Dienstuniform trägt der Reichskanzler jetzt die weiße Galauniform der Kürassiere, wodurch er gleichsam als eine germanische Lichtgestalt die Blicke in besonderer Weise auf sich zieht. Mittelalterliche Reichsidee und preußischer Machtstaatsgedanke wurden in der Ikonographie des Gründungsaktes miteinander verschmolzen, Vergangenheit und Gegenwart versöhnt in der Vorstellung einer besonderen nationalen Sendung der Hohenzollern, die am 18. Januar ihre Erfüllung gefunden habe.
In den nationalliberalen Historikern der Reichsgründungszeit fand dieser Ursprungsmythos seine wirkungsmächtigsten Propagandisten. Gebannt vom militärischen Sieg über Frankreich und dem staatsmännischen Geschick Bismarcks, verfolgten sie den deutschen Beruf Preußens bis ins Mittelalter zurück. In dieser teleologischen Sicht der Reichsgründung »erschien die preußisch-deutsche Geschichte als ein sich mit Notwendigkeit erfüllender Entwicklungsprozeß, der von Luther und der Reformation über den Großen Kurfürsten und Friedrich den Großen bis zur preußischen Reformzeit führte, um dann im Werk Bismarcks seinen krönenden Abschluß zu finden«.[13] Es werde wohl nicht mehr allzulange dauern, spottete der große Basler Historiker Jacob Burckhardt am Ende des Jahres 1872, »bis die ganze Weltgeschichte von Adam an siegesdeutsch angestrichen und auf 1870/71 orientiert sein wird«.[14]
Mit seiner nach 1871 begonnenen DEUTSCHEN GESCHICHTE IM 19. JAHRHUNDERT verfolgte Heinrich von Treitschke, der historiographische Herold des neuen Reiches, die Absicht, »eine allen Gebildeten gemeinsame nationale Geschichtsüberlieferung« zu schaffen und damit ein »einmütiges Gefühl froher Dankbarkeit« zu wecken – Dankbarkeit vor allem für jene »politischen Helden«, die den »Traum vom preußischen Reich deutscher Nation« verwirklicht hätten.[15] Daß allein die idealisierte preußische Militärmonarchie das Werk der Reichsgründung vollbringen konnte – das stand für Treitschke, das stand für die gesamte borussisch geprägte Historikerzunft nach 1871 ganz außer Frage: »Die Macht Preußens in unserem neuen Reiche ist von langer Hand her durch redliche stille Arbeit vorbereitet; darum wird sie dauern.«[16] Neben Anton von Werners Gemälde hat Treitschkes Geschichtsschreibung das historisch-politische Bewußtsein der Deutschen nach 1871, vornehmlich jener Schichten, die sich selbst für gebildet hielten, am stärksten geformt.
Von Anfang an trug der neue Reichsnationalismus Züge eines überschießenden Selbstbewußtseins, verbunden mit einem Gestus anmaßender Überheblichkeit gegenüber anderen Nationen, vor allem dem besiegten Frankreich. Deutlich wurde das bereits beim triumphalen Empfang der heimkehrenden Truppen in Berlin am 16. Juni 1871. Ein Augenzeuge, der Dichter Berthold Auerbach, schrieb einen Tag später an einen Freund: »Als die 81 französischen Trikoloren und goldenen Adler vorübergetragen wurden und ein Jubelschrei ohnegleichen erdröhnte, da durchschauerte es mich unsagbar: es ist vollbracht, der sinnenverwirrende blutlechzende Dämon der Gloire ist niedergeworfen, hoffentlich für alle Zeit.«[17]
Daß der Sieg über Frankreich nicht nur der Tüchtigkeit der Armee, sondern auch der Überlegenheit deutscher Kultur zu verdanken sei, war eine weitverbreitete Überzeugung. In seinen UNZEITGEMÄSSEN BETRACHTUNGEN von 1873 warnte Friedrich Nietzsche vor solchem Triumphalismus: »Von allen schlimmen Folgen aber, die der letzte mit Frankreich geführte Krieg hinter sich drein zieht, ist vielleicht die schlimmste ein weitverbreiteter, ja allgemeiner Irrtum: der Irrtum der öffentlichen Meinung und aller öffentlich Meinenden, daß auch die deutsche Kultur in jenem Kampfe gesiegt habe und deshalb jetzt mit den Kränzen geschmückt werden müsse, die so außerordentlichen Begebnissen und Erfolgen gemäß seien. Dieser Wahn ist höchst verderblich: nicht etwa, weil er ein Wahn ist – denn es gibt die heilsamsten und segensreichsten Irrtümer – sondern weil er im Stande ist, unseren Sieg in eine völlige Niederlage zu verwandeln: in die Niederlage, ja Exstirpation des deutschen Geistes zu Gunsten des deutschen Reiches.«[18]
Reichsgründung und europäisches Gleichgewicht
Generationen von Historikern haben die Vollendung der deutschen Einheit dem überragenden politischen Genie Bismarcks zugeschrieben. Tatsächlich wurde sie entscheidend begünstigt durch eine ungewöhnliche internationale Konstellation: jenes »Wellental der Großen Politik« (Ludwig Dehio)[19] nach dem Krimkrieg (1854–56), das die Mitte Europas weitgehend vom Druck der Großmächte entlastete. Rußland konzentrierte sich nach der Niederlage auf die Expansion in Ostasien und die Modernisierung seiner Gesellschaft. Der große Nachholbedarf an inneren Reformen setzte der außenpolitischen Manövrierfähigkeit des Zarenreiches Grenzen.[20] Auch die Aufmerksamkeit der englischen Politik war durch innenpolitische Probleme, vor allem durch die Kämpfe um die Wahlrechtsreform, dazu von globalen Verpflichtungen des Empire stark in Anspruch genommen. Was die Verhältnisse in Mitteleuropa betraf, verfolgte die britische Regierung eine Politik der Nichteinmischung, wobei sie gegen die Errichtung eines von Preußen dominierten deutschen Nationalstaats im Prinzip nichts einzuwenden hatte, weil sie darin ein Gegengewicht zu den Ambitionen Napoleons III., mithin eine Garantie für das Gleichgewicht auf dem Kontinent erblickte.[21]
Das relative Desinteresse sowohl Rußlands als auch Englands an Zentraleuropa erleichterte es Bismarck, den Krieg mit Österreich um die Vorherrschaft in Deutschland 1866 und die Auseinandersetzung mit Frankreich 1870 zu begrenzen. Wenn der Reichskanzler später betonte, daß die deutsche Einheit »unter dem bedrohenden Gewehranschlag des übrigen Europa ins Trockene gebracht« worden sei,[22] dann war das eine Übertreibung, die die eigenen Verdienste in besonders hellem Lichte erstrahlen lassen sollte.
Nach der Schlacht von Sedan, der Abdankung Napoleons III. und dem Bekanntwerden der Pläne für eine Annexion Elsaß-Lothringens schlug die Stimmung sowohl in London als auch in Petersburg um. Man befürchtete, daß Frankreich zu nachhaltig geschwächt und dadurch das europäische Gleichgewicht aus den Angeln gehoben werden könnte. Die Sympathien der öffentlichen Meinung in Europa wandten sich der Dritten Republik zu, insbesondere der belagerten Hauptstadt Paris, deren Außenforts seit Ende 1870 unter deutschem Artilleriebeschuß lagen. »Man erblickt in uns nicht mehr die unschuldig Bedrohten, sondern vielmehr die übermütigen Sieger, die sich an der Bezwingung des Gegners nicht mehr genügen lassen, sondern sein gänzliches Verderben herbeiführen wollen«, notierte besorgt Kronprinz Friedrich Wilhelm am 31. Dezember 1870.[23]
Die Beunruhigung der politischen Kreise Englands über die Machtverschiebung in der Mitte Europas brachte unüberhörbar der konservative Oppositionsführer im britischen Unterhaus, Benjamin Disraeli, am 9. Februar 1871, wenige Tage nach der Kaiserproklamation und dem Abschluß des Waffenstillstands, zum Ausdruck: »Dieser Krieg bedeutet die deutsche Revolution, ein größeres politisches Ereignis als die Französische Revolution des letzten Jahrhunderts … Das Gleichgewicht der Macht ist völlig zerstört, und das Land, welches am meisten darunter leidet und die Wirkungen dieser Veränderung am stärksten spürt, ist England.«[24] Ende Februar 1871 berichtete der deutsche Botschafter in London, Albrecht Graf von Bernstorff, an Bismarck: »Selbst die uns bisher freundlich oder doch weniger feindlich gesinnten Blätter zeigen jetzt eine Leidenschaftlichkeit gegen Deutschland, wie sie bisher im Laufe des Krieges noch nicht hervorgetreten ist.«[25] Auch aus der Sicht der russischen Regierung hatten die deutschen Militärs 1870/71 »zu gründlich gesiegt«[26], und sie machte aus ihrem Unbehagen über diese Entwicklung keinen Hehl. Das neugegründete Deutsche Reich war, so schien es, im Begriff, das Frankreich Napoleons III. in seiner Rolle als potentielle Vormacht in Europa zu beerben.
Doch in den Monaten zwischen dem Abschluß des Präliminarfriedens am 26. Februar und der Ratifizierung des Friedensvertrages in Frankfurt am 10. Mai 1871 trat wiederum ein Stimmungsumschwung, diesmal zuungunsten Frankreichs, ein. Verursacht wurde er durch den Kommune-Aufstand in Paris, der nicht nur unter den Konservativen Europas, sondern auch in weiten Kreisen des liberalen Bürgertums Ängste vor Chaos und Anarchie hervorrief. Preußen-Deutschland, das der großbürgerlichen französischen Regierung des Adolphe Thiers erlaubte, das kühne Experiment der Selbstorganisation der Pariser Massen blutig niederzuschlagen, erschien nun als ein Bollwerk gegen die rote Gefahr. Insofern trug der Kommune-Aufstand dazu bei, »psychologische und stimmungsmäßige Voraussetzungen zu schaffen, welche die Einfügung der neuen Großmacht in die europäische Staatengemeinschaft erleichterten«.[27] Daß es freilich noch großer Anstrengungen bedurfte, um die anderen Mächte an die Existenz eines deutschen Nationalstaats in der Mitte Europas zu gewöhnen – dies war Bismarck von Anfang an bewußt.
2.Probleme der inneren Reichsgründung
»Setzen wir Deutschland, sozusagen, in den Sattel! Reiten wird es schon können«, so hatte Bismarck noch im März 1867 prophezeit.[1] Doch so problemlos wie die äußere Einheit vollzog sich die innere Einheit nicht. Es wuchs nicht einfach zusammen, was zusammengehörte. Nicht nur wirkten die Partikularismen, die sich aus den unterschiedlichen Traditionen der Einzelstaaten speisten, auf vielfältige Weise fort. Durch seine Innenpolitik nach 1871 riß Bismarck überdies neue, tiefe Gräben auf. Die innere Reichsgründung blieb unvollendet. Dies hat schon Max Weber in seiner akademischen Antrittsrede von 1895 zum Angelpunkt seiner Kritik am Lebenswerk des Reichskanzlers gemacht. »Denn dieses Lebenswerk hätte« – so stellte er fest – »doch nicht nur zur äußeren, sondern auch zur inneren Einigung der Nation führen sollen und jeder von uns weiß: das ist nicht erreicht. Es konnte mit seinen Mitteln nicht erreicht werden.«[2]
Verfassung und Regierungssystem des Kaiserreichs
Am 3. März 1871 fanden die Wahlen zum ersten deutschen Reichstag statt. Wählen durften alle Männer ab 25 Jahre. Bismarck hatte das allgemeine Wahlrecht in die Verfassung des Norddeutschen Bundes aufgenommen, nicht etwa um Demokratie und Parlamentsherrschaft den Weg zu bereiten, sondern im Gegenteil: um die konservative, königstreue Wählerschaft, vor allem auf dem Lande, zu mobilisieren und die Liberalen zu schwächen. Daß diese Rechnung nicht aufging, hatten allerdings schon die Wahlen zum Norddeutschen Reichstag gezeigt, und das zeigte sich auch am 3. März 1871. Eindeutige Gewinner waren die Nationalliberalen, die mit 32,7 Prozent der Stimmen und 125 Mandaten als stärkste Partei aus der Wahl hervorgingen, während auf die beiden konservativen Parteien, Deutschkonservative und Freikonservative, zusammen 23 Prozent der Stimmen bzw. 94 Mandate entfielen. Überraschend gut schnitt das Zentrum ab, die erst 1870 gegründete Partei der katholischen Wählerschaft; sie wurde mit 18,6 Prozent und 63 Mandaten zweitstärkste Partei. Die linksliberale Fortschrittspartei mußte sich mit 8,8 Prozent bzw. 46 Mandaten zufriedengeben. Die noch jungen, zudem zerstrittenen Sozialdemokraten konnten nur 3,2 Prozent und 2 Mandate erringen.[3]
Die Wahlbeteiligung lag mit 51 Prozent relativ niedrig. Das scheint darauf hinzudeuten, daß keineswegs alle Schichten der Bevölkerung gleichermaßen von nationaler Leidenschaft erfaßt waren. Die Reichsbegeisterung blieb, vorerst jedenfalls, vor allem eine Sache des nationalliberalen Bürgertums.
Am 21. März 1871 wurde im Weißen Saal des Königlichen Schlosses in Berlin der Reichstag mit einer Thronrede Wilhelms I. eröffnet. Um die vollzogene Synthese von Reichsidee und Kaisermythos zu zelebrieren, hatte man aus der alten Kaiserpfalz Goslar den Thronsessel Heinrichs III. heranschaffen lassen; preußische Generäle, allen voran der siegreiche Feldherr Helmuth von Moltke, trugen die Reichsinsignien[4] – eine Symbolhandlung, die noch einmal auf die Ursprünge des Kaiserreichs verwies. Im Unterschied zur Proklamation in Versailles waren diesmal die gewählten Vertreter des Volkes anwesend, doch inmitten der hohen Würdenträger wirkten sie eher wie Statisten: »Wenn die Szenerie dazu bestimmt war, dem liberalen Bürgertum vor Augen zu führen, wer im Deutschen Reich der Zukunft das Sagen haben werde, so ließ sie es an Deutlichkeit nicht fehlen. Paradeuniformen und weiße Helmbüsche waren nicht nur Teil eines lebenden Bildes im Stil zeitgenössischer Historienmalerei, sondern politische Demonstration.«[5]
Erste Aufgabe des Reichstags war die Verabschiedung der Reichsverfassung. Bismarck hatte von Anfang an klargemacht, daß es nicht um einen ganz neuen Entwurf, sondern nur um eine Anpassung der Verfassung des Norddeutschen Bundes an die veränderten Verhältnisse ging. Die Nationalliberalen fügten sich, in der stillen Hoffnung, daß es zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein würde, verfassungspolitische Korrekturen durchzusetzen. Lediglich die Zentrumsfraktion machte sich mit ihrem Antrag auf eine verfassungsrechtliche Garantie von Grundrechten zum Fürsprecher alter liberaler Forderungen, stieß damit aber bei den anderen Parteien auf keine Gegenliebe. Am 14. April 1871 wurde die revidierte Verfassung des Norddeutschen Bundes mit nur wenigen Gegenstimmen als neue Reichsverfassung angenommen.
Die Verfassung des Kaiserreichs war ein merkwürdiger Zwitter, eine Mischung aus konservativen und progressiven Elementen. Sie suchte die historisch gegensätzlichen Kräfte und Ideen – Föderalismus und Unitarismus, Volkssouveränität und monarchisches Prinzip – auszubalancieren und zugleich die preußische Hegemonie in Deutschland zu zementieren. Mit der Gewährung des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts kam sie dem demokratischen Trend der Zeit weit entgegen, doch enthielt sie andererseits starke Sicherungen gegen eine Weiterentwicklung in Richtung auf ein parlamentarisches System. Manches ließ dieses komplizierte Kompromißprodukt in der Schwebe, so daß man es mit Wolfgang J. Mommsen als ein »System umgangener Entscheidungen« charakterisieren kann.[6]
Das deutsche Kaiserreich war ein Bundesstaat, dem 25 Einzelstaaten angehörten: vier Königreiche (Preußen, Sachsen, Bayern, Württemberg); sechs Großherzogtümer (Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Sachsen-Weimar-Eisenach, Oldenburg); fünf Herzogtümer (Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Anhalt); sieben Fürstentümer (Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sonderhausen, Waldeck, Reuß ältere Linie, Reuß jüngere Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe); drei freie Städte (Lübeck, Bremen, Hamburg); dazu das Reichsland Elsaß-Lothringen, das 1871 annektiert worden war.
Formal betrachtet, stand der Bundesrat, die Vertretung der Einzelstaaten, an der Spitze der Verfassungsorgane. Darin kam die von Bismarck zäh aufrechterhaltene Fiktion zum Ausdruck, daß das Reich auf der freien Vereinbarung der Fürsten beruhe, die verbündeten Regierungen mithin als eigentliche Träger der Souveränität anzusprechen seien. Ausdrücklich hatte der Reichskanzler sich dagegen gewandt, den Bundesrat in Reichsrat umzubenennen, weil dadurch die föderalistischen Grundlagen des Reiches als eines ewigen Bundes der Fürsten nicht mehr deutlich genug hervorträten. Der Bundesrat setzte sich zusammen aus Bevollmächtigten der einzelstaatlichen Regierungen. Von den 58 Stimmen entfielen auf Preußen 17, Bayern 6, Sachsen und Württemberg je 4, Baden und Hessen-Darmstadt je 3, Mecklenburg-Schwerin und Braunschweig je 2, während die übrigen siebzehn Kleinstaaten jeweils eine Stimme besaßen. Auf den ersten Blick schien Preußen, der bei weitem größte und bevölkerungsreichste Bundesstaat, stark benachteiligt, weil es nicht einmal über ein Drittel der Stimmen gebot und so jederzeit majorisiert werden konnte. Tatsächlich aber verfügte es über genügend Druckmittel, um die von ihm wirtschaftlich abhängigen nord- und mitteldeutschen Kleinstaaten seinen Wünschen gefügig zu machen. Faktisch besaß Preußen in diesem Gremium stets ein Übergewicht. Hinzu kam, daß der Vorsitz im Bundesrat dem Reichskanzler zustand, der als preußischer Ministerpräsident und Außenminister die preußischen Bevollmächtigten zum Bundesrat »instruierte«.
Der Bundesrat diente jedoch nicht nur als Instrument der preußischen Hegemonie, indem er diese zugleich absicherte und verhüllte. Ihm war von Bismarck darüber hinaus die Funktion zugedacht, den Machtgelüsten des Reichstags und der Parteien Grenzen zu setzen und jede Entwicklung zum Parlamentarismus zu blockieren. In dieser Konstruktion des Bundesrats als Gegengewicht zum Reichstag lag – wie Thomas Nipperdey hervorgehoben hat – das »eigentliche Geheimnis der deutschen, der Bismarckschen Reichsverfassung«.[7]
Zu den Aufgaben des Bundesrats gehörten nicht nur die Gesetzgebung des Reiches und die Verabschiedung des Reichshaushalts, gleichberechtigt mit dem Reichstag, sondern der Erlaß von Verwaltungsvorschriften hinsichtlich der Ausführung der Gesetze sowie eine Reihe weiterer Exekutivfunktionen im Rahmen der Reichsaufsicht und der auswärtigen Politik. Insofern stellte er eine Art Gesamtregierung dar, deren Ausschüsse ursprünglich die fehlenden Reichsministerien ersetzen sollten. In der Praxis jedoch kamen die Gesetzesinitiativen zumeist aus den preußischen Ministerien. Der Geschäftsführung durch den Reichskanzler fiel dabei eine Schlüsselrolle zu. Er konnte ihm politisch mißliebige Beschlüsse des Reichstags scheitern lassen, indem er sich hinter dem Votum des Bundesrats verschanzte. Ebenso traten der Kanzler, erst recht die preußischen Minister und später die Staatssekretäre der Reichsämter nicht als Mitglieder einer Reichsregierung – die Bezeichnung wurde sorgfältig vermieden –, sondern als Bundesratsbevollmächtigte vor den Reichstag, womit die wirkliche Regierung »gleichsam hinter dem Bundesrat versteckt« wurde.[8] Sinn dieser ungewöhnlichen »juristischen Konstruktion der Regierung des Reiches aus dem Bundesrat heraus«[9] war es, die preußisch dominierte Exekutive, soweit es ging, gegenüber dem Reichstag abzuschirmen und ihr ein größtmögliches Maß an Handlungsautonomie zu sichern.
Obwohl, laut Verfassung, der Bundesrat auch Exekutivbefugnisse ausübte, lag die ausführende Gewalt in Wirklichkeit beim Kaiser und beim Reichskanzler. Der Kaiser war das monarchische Oberhaupt des Reiches. Als König von Preußen führte er zugleich das Präsidium des Bundes – wiederum eine die tatsächlichen Machtverhältnisse eher verschleiernde Formel. Denn der Kaiser war im Kreis der Bundesfürsten nicht primus inter pares, sondern besaß kraft seines kaiserlichen Amtes eine den anderen Landesherren weit überlegene Autorität. Er bestimmte als oberster Kriegsherr über Heer und Marine, entschied über Krieg und Frieden, ernannte und entließ die Reichsbeamten, einschließlich des Reichskanzlers, berief Bundesrat und Reichstag ein, verkündete die Reichsgesetze und überwachte deren Ausführung. Ein Vetorecht gegen die vom Bundesrat und Reichstag verabschiedeten Gesetze räumte ihm die Verfassung allerdings nicht ein.
Die Monarchie war an die Verfassung gebunden; insoweit war sie konstitutionell. Aber sie besaß in der kaiserlichen Kommandogewalt einen harten extrakonstitutionellen Kern. Das war ein Teil des Erbes, das Preußen in den kleindeutschen Nationalstaat einbrachte. In allen militärischen Angelegenheiten entschied allein der Monarch, beraten durch sein Militärkabinett, das sich zu einer Art Nebenregierung entwickelte. Hier zeigte sich die militärstaatlich-autoritäre Prägung der Reichsgründung am deutlichsten, und gerade hier, in den tradierten militärischen Vorrechten der Krone, lag auch ein Ansatzpunkt zur Errichtung eines »persönlichen Regiments«, wie es der spätere Kaiser Wilhelm II. anstreben sollte.
Nach der Verfassung bestimmten Kaiser und Reichskanzler gemeinsam die Richtlinien der Politik. Der Kanzler mußte die kaiserlichen Anordnungen und Verfügungen »gegenzeichnen«; damit übernahm er zugleich die Verantwortung vor Reichstag und Öffentlichkeit. Schon das macht deutlich, daß der Reichskanzler mehr war als ein bloßer Gehilfe des Kaisers. Zwar war er vom Vertrauen des Monarchen abhängig, der ihn jederzeit entlassen konnte. Doch wurde diese Möglichkeit wesentlich eingeschränkt durch das gewaltige politische Prestige, das Bismarck als Gründer des Reiches jederzeit in die Waagschale werfen konnte. Mit der Drohung seines Rücktritts besaß er ein sehr wirkungsvolles Mittel, dem Kaiser seinen Willen aufzuzwingen. »Es ist nicht leicht, unter einem solchen Kanzler Kaiser zu sein«, soll Wilhelm I. einmal geklagt haben.[10]
Schon Zeitgenossen fühlten sich angesichts der Sonderstellung Bismarcks an eine Kanzlerdiktatur erinnert. Neuerdings hat Hans-Ulrich Wehler versucht, die Ausnahmeposition des Reichsgründers nach Max Weber als »charismatische Herrschaft« zu charakterisieren – eine Deutung, die auf Kritik gestoßen ist.[11] Wie immer man die Rolle Bismarcks in dem von ihm geschaffenen und geprägten Herrschaftssystem begrifflich faßt – sicher ist, daß er aufgrund seiner langjährigen politischen Erfahrung, seiner starken Persönlichkeit und seines Ansehens als »Macher« der deutschen Einheit eine Machtfülle auf sich vereinigte, die über seine verfassungsrechtlichen Befugnisse weit hinausreichte. Und die sicherten ihm ohnehin schon einen bedeutenden Einfluß. Der Reichskanzler bekleidete in der Regel zugleich das Amt des preußischen Ministerpräsidenten und das des Außenministers, besaß also eine stabile Hausmacht im konservativ-monarchischen Bollwerk Preußen.
Als Vorsitzender des Bundesrats versammelte er den stärksten Stimmenblock, den der preußischen Bundesratsbevollmächtigten, hinter sich. Und er war es schließlich, der die Reichspolitik vor dem Reichstag vertrat. Der Reichskanzler war also das einzige verfassungsmäßige Bindeglied zwischen Kaiser, preußischem Staatsministerium, Bundesrat und Reichstag. Er war die eigentliche Integrationsfigur, die das komplizierte System austarierte. Das machte ihn zwar nach mehreren Seiten abhängig, eröffnete ihm aber, wenn er es nur geschickt genug anstellte, beachtliche Handlungsspielräume. Bismarck hat diese Spielräume auf seine Weise optimal genutzt.
Ursprünglich hatte Bismarck als der einzige verantwortliche Reichsminister ganz ohne Reichsbehörden auskommen wollen. Das von ihm geschaffene Reichskanzleramt sollte den normalen Geschäftsverkehr mit den anderen Regierungsinstanzen koordinieren, während die eigentliche Regierungsarbeit weiterhin in der Zuständigkeit der preußischen Fachressorts verbleiben sollte. Angesichts der dem Reich zuwachsenden Aufgaben entwickelte sich das Reichskanzleramt unter seinem ersten Präsidenten, Rudolf von Delbrück, jedoch rasch »zu einer Superbehörde, die zu Bismarcks Ärger immer größere Eigenständigkeit an den Tag legte und das Arcanum imperii des Bismarckschen Systems, nämlich die ›Fassade der Regierung‹ aus dem Bundesrat heraus, zunehmend mißachtete«.[12] So wurden nach und nach bestimmte Aufgabenbereiche aus dem Reichskanzleramt ausgegliedert und dafür eigene Reichsämter geschaffen, darunter das Auswärtige Amt, das Reichsamt des Innern, das Reichsjustizamt, das Reichsschatzamt.
Ein Reichskriegsamt wurde nicht eingerichtet – die Zuständigkeit für das Heer blieb beim preußischen Kriegsminister –, dafür aber 1889 ein Reichsmarineamt: eine jener Paradoxien, die aus der Sonderstellung des preußischen Militärs erwuchsen.
An die Spitze der Reichsämter wurden sogenannte Staatssekretäre berufen, die dem Reichskanzler untergeordnet waren. Darin wird wieder der Wille Bismarcks erkennbar, keine verantwortlichen Reichsministerien zuzulassen, weil sie die Kompetenzen des Bundesrats schmälern und »zu Einfallstoren einer parlamentarischen Kontrolle über die Regierung werden könnten«.[13] Sorgfältig achtete der Kanzler daher auch darauf, daß das, was um ihn herum entstand, nicht als Reichsregierung firmierte. Erst später, nach dem Sturz Bismarcks, bürgerte sich die Bezeichnung Reichsleitung ein.
Der durch Kaiser und Kanzler verkörperten Exekutive und dem Bundesrat als Vertretung der Einzelstaaten stand die gewählte Volksvertretung, der Reichstag, gegenüber. Die Legislaturperiode war zunächst auf drei Jahre beschränkt und wurde 1888 auf fünf Jahre ausgeweitet. Allerdings konnten der Kaiser und – über den Bundesrat – auch der Kanzler den Reichstag vorzeitig auflösen und Neuwahlen ansetzen. Die Androhung der Auflösung des Reichstags war die stärkste Waffe der Regierung gegenüber einer widerspenstigen Parlamentsmehrheit.
Die Abgeordneten des Reichstags erhielten keine Diäten (erst von 1906 an wurde ihnen eine Aufwandsentschädigung gezahlt). Bismarck wollte dadurch verhindern, daß die parlamentarische Tätigkeit sich zu einem Erwerbsberuf entwickelte. Die Folge war, daß unbemittelte Bürger gar nicht erst kandidieren konnten, sofern ihre Partei ihnen nicht aushalf.
Nach dem Wahlgesetz von 1871 war als Abgeordneter gewählt, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen in einem der 397 Wahlkreise auf sich vereinigen konnte. Erreichte ein Bewerber die absolute Mehrheit nicht, kam es zu einer Stichwahl der beiden bestplazierten Kandidaten. Dabei wurden Wahlabsprachen zwischen den Parteien getroffen, die sich später vor allem gegen die stärkste oppositionelle Kraft im Kaiserreich, die Sozialdemokratie, richteten.
Benachteiligt war die SPD auch durch die Wahlkreiseinteilung, die auf dem Bevölkerungsstand von 1864 beruhte und den Verschiebungen im Zuge von Industrialisierung und Verstädterung seit den siebziger Jahren nicht gerecht wurde. Begünstigt waren dadurch vor allem die konservativen Parteien, die ihr Wählerreservoir in den agrarischen Gebieten besaßen. Die Sozialdemokratie, die ihre Klientel vor allem in den Großstädten und industriellen Ballungszentren hatte, mußte in der Regel erheblich mehr Stimmen für den Gewinn eines Mandats mobilisieren als ihre bürgerlichen Konkurrenten.[14]
Es wäre verfehlt, im Reichstag lediglich »ein konstitutionelles Feigenblatt für ein ansonsten autoritäres Regiment« zu sehen.[15] Die Verfassung wies ihm eine Reihe wichtiger Kompetenzen zu: Erstens war er maßgeblich an der Gesetzgebung beteiligt. Ohne seine Zustimmung gab es keine Gesetze (gegen den Bundesrat, das heißt gegen den Kanzler und die preußische Ministerialbürokratie, konnte er allerdings auch keine Gesetze durchbringen). Zweitens verfügte der Reichstag über das Budgetrecht, also über die jährliche Bewilligung der Einnahmen und Ausgaben. Der Militäretat war von der strengen Budgetkontrolle insofern ausgenommen, als er die Ausgaben jeweils für mehrere Jahre festlegte – wiederum »eine beträchtliche Einbruchstelle militärischer Einflüsse auf die Politik«[16]. Schließlich hatte der Reichstag über das Petitions- und Interpellationsrecht die Möglichkeit, alle Bereiche der Regierungstätigkeit zum Gegenstand öffentlicher parlamentarischer Debatten zu machen. Die Immunität der Abgeordneten garantierte dabei ein hohes Maß an Freiheit und Offenheit der Kritik.
Doch ein Recht besaß der Reichstag nicht: Zwar konnte er die Politik des Reichskanzlers mißbilligen – ihn durch ein Mißtrauensvotum zum Rücktritt zwingen, das konnte er aber nicht. Damit fehlte ihm das entscheidende Qualitätsmerkmal einer parlamentarischen Verfassung. Der Reichskanzler übernahm zwar (laut Artikel 17) die politische Verantwortung für Anordnungen und Verfügungen des Kaisers; aber wirklich verantwortlich, im Sinne einer Bindung seiner Politik an Mehrheitsbeschlüsse, war er dem Parlament nicht, ebensowenig wie die preußischen Staatsminister oder Staatssekretäre der Reichsämter. Verfassungsrechtlich handelten sie als Bevollmächtigte des – für das Parlament nicht greifbaren – Bundesrats. Anders als in parlamentarisch regierten Staaten gab es im Kaiserreich keine Regierung aus verantwortlichen Ministern. Zudem war der Aufstieg von Parlamentariern in Regierungsämter verfassungsrechtlich dadurch erschwert, daß nach Artikel 9 eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Reichstag und im Bundesrat ausgeschlossen war. Das hieß, daß Parteiführer, die in verantwortliche Positionen aufrücken wollten, ihr Reichstagsmandat aufgeben und sich damit ihres parlamentarischen Rückhalts begeben mußten.
So besaß der Reichstag kaum eine Möglichkeit, die Exekutive wirksam zu kontrollieren oder gar gestaltenden Einfluß auf die Regierungspolitik zu gewinnen. Damit fehlte den Parteien aber auch ein wesentlicher Anreiz, sich auf gemeinsame Ziele zu verständigen, Interessengegensätze zu überbrücken und Kompromisse zu schließen. Wenn Bismarck selber sich später über das »Überwuchern des Parteihaders und des Fraktionshasses« beklagte,[17] dann vergaß er, daß er an der Denaturierung der Parteien maßgeblich beteiligt war. Sie hat schon früh zu einem realitätsfernen Doktrinarismus und einer ideologisch fixierten Lagermentalität der Parteien beigetragen, die sich als schwere Belastung für die Einführung eines parlamentarischen Systems in Deutschland erweisen sollte.[18]
Dennoch war das Kaiserreich, verfassungspolitisch betrachtet, keine Sackgasse. Zwar setzte vor allem die hegemoniale Stellung Preußens mit der Dominanz der auf die Krone eingeschworenen Armee und Bürokratie einer Entwicklung zu mehr Freiheit und Demokratie von vornherein Grenzen. Die Frage aber war, ob die starken institutionellen Barrieren, die Bismarck gegen eine Parlamentarisierung aufgerichtet hatte, auf Dauer Bestand haben würden. Diese Frage richtete sich zuallererst an die Liberalen. Sie hatten sich, jedenfalls soweit es ihren nationalen Flügel betraf, seit 1866 mit dem zuvor verachteten Konfliktminister arrangiert, um die äußere Reichsgründung nicht zu gefährden und – nach 1871 – um die innere Reichsgründung voranzubringen. Es lag jetzt an ihnen, die liberal-parlamentarische Ausgestaltung der Verfassung durchzusetzen – gegen Bismarck.
Vom Gründerboom zum Gründerkrach
Die Reichsgründung fiel in eine Phase ökonomischer Prosperität. Ein lang anhaltender Aufschwung sorgte in allen Branchen für Wachstum und Beschäftigung. Getragen von einer Welle des wirtschaftsliberalen Optimismus, konnte Bismarck die deutsche Einheit unter Dach und Fach bringen.
Der konjunkturelle Aufschwung setzte sich nach dem deutsch-französischen Krieg fort, ja, er wies in den sogenannten Gründerjahren nach 1871 alle Merkmale eines überschäumenden Booms auf. Wesentlichen Anteil daran hatte die Überschwemmung des deutschen Kapitalmarkts mit fünf Milliarden Goldfranc, deren Zahlung Frankreich im Frankfurter Friedensvertrag vom Mai 1871 auferlegt worden war. Wider Erwarten gelang es der französischen Regierung, die riesige Summe mittels einer internationalen Anleihe in kürzester Frist aufzubringen. Bereits im September 1873 beglich Paris die letzte Rate.
Der rasche Kapitaltransfer wirkte stimulierend auf das Wirtschaftsleben. Ein Teil der Geldes wurde in die Modernisierung des Heeres und den Festungsbau investiert; davon profitierten vor allem die Rüstungs- und die Bauindustrie. Ein anderer Teil wurde von den einzelstaatlichen Regierungen dazu verwendet, die Kriegsanleihen zurückzuzahlen. Diese Mittel flossen direkt auf den Kapitalmarkt und suchten dort nach Anlagemöglichkeiten. Die vermehrte Nachfrage nach zinsgünstigen Wertpapieren trieb die Aktienkurse in die Höhe und stachelte die Spekulationslust an.
Angeheizt wurde die Konjunktur nicht nur durch die französischen Milliarden, sondern auch durch eine wirtschaftsliberale Gesetzgebung, die die letzten Beschränkungen im Kapitalverkehr beseitigte. Im Juni 1870 wurde die Konzessionspflicht für Aktiengesellschaften aufgehoben. Daraufhin wurden zwischen 1870 und 1874 in Preußen 857 Aktiengesellschaften gegründet.[19] Dem rheinischen Wirtschaftsführer Gustav Mevissen erschien es im Juni 1872, als würde »das Erwerbsleben des ganzen großen Deutschen Reiches … sich in eine riesenhafte Aktiengesellschaft verwandeln«.[20]
Keineswegs alle Neugründungen zeichneten sich durch Solidität aus, im Gegenteil: es gab nicht wenige Schwindelunternehmen, deren einziger Zweck sich im spekulativen Börsengeschäft erschöpfte. Durch allerlei Tricks, etwa durch reißerisch aufgemachte Presseartikel, wurden die Aktienkurse künstlich hochgetrieben und dem Publikum nahezu unbegrenzte Gewinne vorgegaukelt. Viele Glücksritter wußten die Gunst der Stunde zu nutzen und häuften innerhalb kurzer Zeit riesige Vermögen an. Wie kaum ein anderer verkörperte der preußische Eisenbahnkönig Bethel Henry Strousberg die fiebrige Haussestimmung der Gründerjahre und die ihr innewohnenden Gefahren.[21]
Angelockt durch die Aussicht, rasch viel Geld zu verdienen, wurden aber auch Bürger, die mit den Usancen der Börse nicht vertraut waren. Das Spekulationsfieber erfaßte weite Kreise der Bevölkerung: »Und alle, alle flogen sie ans Licht, und alle tanzten mit in dieser Hetzgaloppade um das angebetete goldene Kalb: der gewitzte Kapitalist und der unerfahrene Kleinbürger, der General und der Kellner, die Dame von Welt, die arme Klavierlehrerin und die Marktfrau, man spekulierte in den Portierlogen und in den Theatergarderoben, in dem Atelier des Künstlers und im stillen Heim des Gelehrten, der Droschkenkutscher auf dem Bock und Aujuste in der Küche verfolgten mit Sachkenntnis und fieberndem Interesse das Emporschnellen der Kurse. Die Börse feierte Hausse-Orgien, Millionen, aus dem Boden gestampft, wurden gewonnen, der Nationalwohlstand hob sich zu scheinbar ungeahnter Höhe. Ein Goldregen rieselte über die trunkene Stadt.«[22]
Doch hinter allem Gründerrausch, hinter der Jagd nach Geld und Luxus verbargen sich tiefe Unsicherheiten und Verwerfungen. Keiner spürte das deutlicher als der Reichsgründer selbst. Im Mai 1872 klagte Bismarck einem Vertrauten, dem freikonservativen Abgeordneten und späteren preußischen Landwirtschaftsminister Robert Lucius von Ballhausen: »Mein Schlaf ist keine Erholung, ich träume weiter, was ich wachend denke. Neulich sah ich die Karte von Deutschland vor mir, darin tauchte ein fauler Fleck nach dem anderen auf und blätterte sich ab.«[23]
Wer sich durch die protzigen Fassaden der neuen Banken, Ladenpassagen und Hotels nicht täuschen ließ, der konnte auch in der Reichshauptstadt viele solcher »faulen Flecke« entdecken, etwa in den Barackenkolonien am Rande der Stadt, wo die Ärmsten der Armen, die Obdachlosen, Unterschlupf fanden. Eine hemmungslose Bauspekulation trieb Bodenpreise und Mieten in die Höhe. Zwischen 1871 und 1873 stiegen die Mieten von Quartal zu Quartal nicht selten um das Doppelte und Dreifache. Neureiche Börsianer, die jeden Preis zu zahlen bereit waren, verdrängten die bisherigen Mieter aus ihren Wohnungen. Viele der weniger bemittelten Berliner waren gezwungen, in eine der grauen Mietskasernen umzuziehen, die wie Pilze aus dem Boden schossen.[24]
Der Groll über die Wohnungsnot entlud sich immer wieder in Krawallen, am heftigsten in der Blumenstraße im Juli 1872, als ein Schuhmacher mit Polizeigewalt aus seiner Wohnung vertrieben werden sollte. Tagelang war das Stadtviertel in Aufruhr, lieferten sich Bevölkerung und Polizei regelrechte Straßenschlachten.[25] Zur gleichen Zeit erlebten Berlin und andere Industriezentren eine Welle von Streiks, die alle bisherigen Arbeitskämpfe an Umfang und Dauer übertraf. Diese erste große Streikbewegung im Kaiserreich zeigte, wieviel sozialer Sprengstoff sich gerade in den Gründerjahren unter der Hülle scheinbarer Prosperität anzusammeln begann.[26] In der bürgerlichen Öffentlichkeit wurde sie denn auch als ernstes Gefahrensymptom gedeutet.
Inmitten des verzückten Tanzes um das Goldene Kalb grassierten Ängste vor wirtschaftlichen und sozialen Erschütterungen. Sie wurden verstärkt, als der nationalliberale Abgeordnete Eduard Lasker Anfang Februar 1873 von der Rednertribüne des preußischen Abgeordnetenhauses aus den Gründerschwindel beim Namen nannte. Insbesondere prangerte er das System Strousberg an – jenes Geflecht aus Manipulation und Korruption bei der Vergabe von Eisenbahnkonzessionen, in das auch hohe Beamte im preußischen Handelsministerium verstrickt waren.[27] Laskers sensationelle Enthüllungen erschütterten das Vertrauen des Publikums und nährten das Empfinden, daß es so wie bisher nicht mehr lange gutgehen könne.
Wie immer kündigten Vorboten die Krise an: Im März 1873 erschienen im Wirtschaftsteil deutscher Zeitungen alarmierende Börsenmeldungen.[28] Von der Möglichkeit einer »Katastrophe in Wien« war im April die Rede; am 9. Mai 1873 war sie bereits eingetreten: Die Wiener Börse veröffentlichte einen Kurszettel, auf dem statt der Notierungen nur Striche verzeichnet waren. Noch herrschte an den deutschen Aktienbörsen eine trügerische Ruhe, doch Anfang Oktober 1873 fand der faule Spekulationszauber auch hier ein jähes Ende: Die Berliner Quistorpsche Vereinsbank, eine typische Treibhausblüte der Gründerzeit, mußte ihre Zahlungen einstellen. Dem Zusammenbruch folgten eine Welle von Konkursen und ein beispielloser Verfall der Aktienkurse. Panik ergriff alle großen und kleinen Finanzjongleure. Ohnmächtig mußten sie mit ansehen, wie ihre Vermögen sich buchstäblich über Nacht in Nichts auflösten. Die Hausse der Gründerjahre endete im großen Börsenkrach: »Krach! Krach! und durch ganz Deutschland hallte es, dieses kleine zermalmende Wort, und von der Donau, der Seine, der Themse und dem Tiber grollte es zurück, dieses furchtbare und unvergeßliche Wort!«[29]
Drei Jahre nach der Reichsgründung war von der Euphorie der ersten Stunde nichts mehr zu spüren; Katerstimmung machte sich breit. »Ein wenig ernüchtert«, schrieb die NATIONAL-ZEITUNG am 25. Dezember 1873, »nahen wir der Schwelle des nächsten Jahres, wir haben gleichsam die frohen Feste vorausgenommen, und die sauren Wochen der Arbeit stehen uns bevor.«[30]
Die Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Krise erfüllte sich nicht. Der Börsenkrach weitete sich vielmehr im Laufe der Jahre 1874/75 aus zu einer Produktions- und Absatzkrise, von der nach und nach alle Branchen erfaßt wurden. In ihrem Jahresbericht für 1876 klagte die Handelskammer Aachen: »Vielleicht niemals seit dem dreißigjährigen Krieg sah man eine Krise von dieser Dauer und das Traurigste ist, kein Ende ist noch zu ersehen, und man weiß nicht wie es anders werden soll.«[31]
Die psychologische Wirkung der sogenannten Gründerkrise war enorm. Der bislang weitverbreitete Glaube an die Segnungen des freien Marktes und das freie Spiel der Kräfte war erschüttert. Der Optimismus der Gründungsära machte tiefer Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit Platz. Wie häufig bei Wirtschaftskrisen war jedoch die Stimmung der Zeitgenossen schlechter als die tatsächliche Lage. Was sich seit 1873 im Deutschen Reich ereignete, war eine notwendige Anpassungs- und Modernisierungskrise nach einer beispiellosen Phase der Hochkonjunktur, in der die deutschen Unternehmer allzu sorglos gewirtschaftet hatten – so sorglos, daß sie sich um die internationale Wettbewerbsfähigkeit kaum noch gekümmert hatten. Die Folge war, daß auf der Weltausstellung in Philadelphia 1876 die deutschen Produkte von einem Beobachter, dem Berliner Professor Franz Reuleaux, mit dem Urteil billig und schlecht! bedacht wurden. Reuleaux führte die mangelnde Qualität zurück auf die deutsche Selbstüberschätzung seit 1870/71: »Aber das neue Deutschland ist verwöhnt von seinen Schmeichlern, die Phrase von Deutschlands Bestimmung und Stellung ist ihm oft ins Gesicht gesagt worden, das Lied seines Ruhmes so oft vorgetrillert worden, daß es die Fühlung mit den Forderungen verloren hat, welche ein internationaler Wettkampf an seine Kräfte stellt.«[32]
Jetzt, nach dem konjunkturellen Einbruch, waren die Betriebe gezwungen, ihre Produktion zu rationalisieren und die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Die Lasten des Gesundschrumpfungsprozesses trugen, wie immer in einer kapitalistischen Wirtschaft, die Arbeiter. In fast allen Bereichen der Industrie und des Handels kam es zu Entlassungen. In den Berliner Maschinenbaubetrieben zum Beispiel, in denen 1873 noch rund 35000 Arbeiter in Lohn und Brot standen, waren 1877 nur noch 16000 beschäftigt, also nicht einmal mehr die Hälfte. Nach zeitgenössischen Schätzungen waren 1878/7925 bis 28 Prozent der Arbeiter im Bereich der Industrie und des produzierenden Gewerbes ohne Beschäftigung.[33] Arbeitslosigkeit, sozialer Abstieg, Verelendung, Obdachlosigkeit – das war der Teufelskreis, in den viele Arbeiter unverschuldet hineingerieten.
Hans Rosenberg hat, in Anlehnung an die vor allem von Nikolai Kondratieff entwickelte Theorie der langen Wellen der Konjunktur, die Periode von 1873 bis 1896 als Große Depression bezeichnet.[34] Diese Deutung entsprach auch der pessimistischen Wahrnehmung der Zeitgenossen, für die der Börsenkrach von 1873 als »eine Art traumatischer Erfahrung«[35] nachwirkte. Dennoch erweist sich der Begriff Große Depression zur Charakterisierung der Wirtschaftsentwicklung seit 1873 als insgesamt wenig geeignet. Nüchtern betrachtet handelte es sich nämlich eher um eine normale Abkühlung der Konjunktur nach einer Phase der Überhitzung. Und schon im Herbst 1880 war die Talsohle der Wirtschaftsflaute durchschritten. Seitdem setzte der Trend eines zwar verlangsamten, aber relativ kontinuierlichen (von kurzfristigen Rückschlägen unterbrochenen) Wachstums ein. Man kann also nicht sagen, daß die Gründerkrise die industriekapitalistische Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft nachhaltig gebremst hätte. Im Gegenteil: dadurch, daß sie diese zwang, sich durch schmerzhafte Umstrukturierungen zu modernisieren, hat sie deren Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit auf lange Sicht verbessert.
Gravierender waren die Auswirkungen auf die politische Kultur und Mentalität im neuen Kaiserreich. Nachdem der erste Schock überwunden war, setzte eine Suche nach den Schuldigen ein. Sie waren bald gefunden: Da waren einmal die Liberalen, die durch ihre manchesterliche Wirtschaftspolititik angeblich den Boden für die hemmungslose Spekulationswut bereitet hatten; und da waren zum anderen die Juden, die traditionellen Sündenböcke in Zeiten der Krise. Nicht selten wurden beide Gruppen zusammen Zielscheibe von Angriffen – etwa in einem Artikel der KREUZZEITUNG, des Sprachrohrs der preußischen Konservativen, vom Juni 1875, überschrieben: »Die Ära Bleichröder, Delbrück, Camphausen und die neudeutsche Wirtschaftspolitik«. Darin wurde die »Geld- und Wirtschaftspolitik des deutschen Reiches« eine Judenpolitik