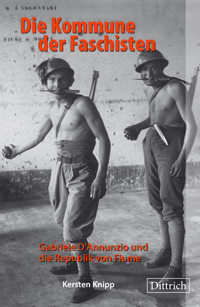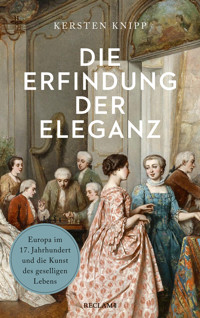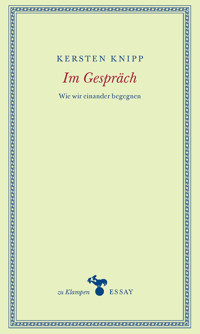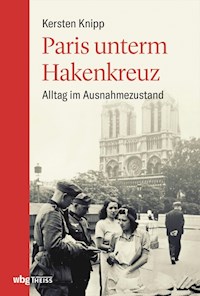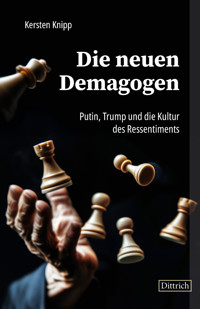
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dittrich Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was vor Kurzem noch unvorstellbar war, scheint nun Realität geworden zu sein: Die Grundlagen der aufgeklärten Gesellschaft geraten zunehmend ins Wanken. Der gegenwärtige Populismus dominiert den politischen Diskurs – er ist geprägt von »fake news«, Aggressivität und Kompromissverweigerung. Protest- und Streitkultur und der kritische Diskurs haben es nicht mehr leicht im demokratischen Westen, sie werden zerrieben im Sog persönlicher Befi ndlichkeiten, unsubstantiierter Meinungen und einer Shitstorm-Mentalität. Und über allem thronen die neuen Demagogen, die dies zu ihrem Vorteil zu nutzen wissen. Die Demokratie gerät zunehmend unter Druck. Droht sie gar an ihr Ende zu kommen? Eindrücklich analysiert der Essayist und Journalist Kersten Knipp die gegenwärtigen Entwicklungen. Er misstraut Patentrezepten, zeigt aber Wege auf, wie die demokratische Zivil gesellschaft (noch) eine Chance hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kersten Knipp
Die neuen Demagogen
Kersten Knipp
Die neuen Demagogen
Putin, Trump und die Kultur des Ressentiments
© Dittrich Verlag in der Velbrück GmbH Verlage, 2025
Meckenheimer Str. 47 · 53919 Weilerswist-Metternich
www.dittrich-verlag.de
Printed in Germany
ISBN 978-3-910732-91-9
eISBN 978-3-910732-96-4
Satz: Gaja Busch, Berlin
Umschlaggestaltung: Katharina Jüssen, Weilerswist
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Meinem Vater
Collioure 1978. Zauber der Zeitung
Inhalt
1. Einleitung. Abschied vom Westen, wie wir ihn kannten
2. Die Stadt, der Müll und der Zorn
3. The Great Depression
4. Wahrheitsdämmerung
5. Faschismus, made in USA?
6. Putin, die Propaganda und der Krieg
7. Deutschland im Visier
8. »Kriegslüstern« I: Deutsche Naivitäten
9. »Kriegslüstern« II: Das grosse Raunen
10. Anmerkungen
1. Einleitung. AbschiedvomWesten, wiewirihnkannten
»Rage, rage against the dying of the light.«
Dylan Thomas, Do not go gentle into that good night
Kein Tag wohl wie der 11. September 2001, als dschihadistische Terroristen in den USA zeitgleich mehrere Flugzeuge entführten, in gewaltige Geschosse verwandelten und mit ihnen furchtbare Massaker anrichteten – besonders grausam, besonders spektakulär in New York, wo sie sie in das World Trade Center rasen ließen, die beiden Türme im Abstand weniger Minuten zum Einsturz brachten und allein dort knapp 3.000 Menschen ermordeten. Der Angriff war, was er auch sein sollte: ein Spektakel, erzeugt von Bildern, deren Wucht ihresgleichen suchte. Über Tage gingen sie um die Welt und erzeugten erstmals vielleicht einen gemeinsamen globalen Eindruck, einen gemeinsamen globalen Moment, von dem sehr viele Menschen sagen, sie könnten sich an ihn erinnern, verbänden mit ihm die Erinnerung auch an die persönlichen Erlebnisse jenes Tages, die ihnen auch nach Jahren noch im Kopf waren.
Es gibt nicht viele Ereignisse von solcher Wucht. Die Anfänge und Enden von Kriegen mögen dazu gehören, generell politische Gewalt, wohl auch große Naturkatastrophen. Aber aufgrund seiner medialen Präsenz war der 11. September 2001 vielleicht das herausragende Globalereignis überhaupt. Doch einige andere Ereignisse reichen zumindest an ihn heran. Dazu dürfte der 24. Februar 2022 gehören, der Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Die mit ihm verbundenen Bilder wie von dem riesigen russischen Militäraufzug in den Tagen zuvor, angeblich nur ein Manöver, haben sich ebenfalls vielen Menschen eingebrannt. Diese Bilder und das, wofür sie standen, bündelten sich im Deutschen alsbald in einem bekannten, nun aber dramatisch nochmals aufgeladenen Wort: »Zeitenwende«.
Erheblich weniger spektakulär kam im Frühjahr 2025, ebenfalls Ende Februar, ein weiteres Ereignis daher: die Unterredung zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump sowie dessen Vize J.D. Vance. Auf den ersten Blick wirkte sie wie ein Routine-Gespräch: unauffällig, kaum mehr als eine gemeinsame Pressekonferenz. Erst auf den zweiten Blick stellte sich aber heraus, dass nichts an dieser Unterredung Routine war: weder das Setting, noch die Atmosphäre, noch die Argumentation des US-Präsidenten und seines Vizes. Die beiden stellten Selenskyj als Hauptverantwortlichen für den Krieg dar. »Sie spielen Karten. Sie setzen das Leben von Millionen Menschen aufs Spiel. Sie riskieren einen Dritten Weltkrieg«, blaffte Trump seinen Gast an. Kein Wort hingegen zu dem Aggressor, zu Putin. Trump und Vance sahen in dem ukrainischen Präsidenten und nicht in Putin das Haupthindernis für Frieden, zumindest taten sie so.1 Laut und erregt redeten sie auf Selenskyj ein, fragten ihn, ob er sich jemals für die Waffenlieferungen der USA bedankt hätte. Selenskyj bejahte, aber schon nahm das Gespräch eine andere Wendung. Vance bezichtigte Selenskyj der Propaganda, die er nun, in diesem Moment, aus dem Weißen Haus heraus, den amerikanischen Bürgern aufzudrängen versuche. »Sie spielen mit dem dritten Weltkrieg«, herrschte Trump ihn an, um kurz darauf den für ihn zentralen Punkt zu nennen, nämlich den Eindruck, den das bizarre Gespräch auf die Öffentlichkeit mache, jedenfalls machen soll: »Ich denke, es ist gut für das amerikanische Volk zu sehen, was vor sich geht«, sagte Trump. »Ich denke, es ist sehr wichtig. Deshalb habe ich das [die Pressekonferenz] so lange weitergeführt. Man muss dankbar sein.« Kurz darauf zog Trump eine ganz eigene Bilanz: »This is going to be great television. I will say that.«
Auch diese Rede hat sich eingebrannt. Denn auch sie markiert einen entscheidenden Moment mit gleich mehreren Implikationen. Zum einen eine Verdrehung der Tatsachen: Es war Selenskyj, der in diesem Augenblick mit einem Mal als wesentliche Gefahr für den Weltfrieden dastand, eine postfaktische, genauer: kontra-faktische Darstellung ersten Ranges. Und damit einhergehend die unverkennbare Distanzierung der USA zu Europa, ihrem über Jahrzehnte wichtigsten Verbündeten. Sicher, die Differenzen hatten sich zuvor bereits angekündigt, in den bereits seit Jahren anhaltenden Diskussionen über den finanziellen Beitrag der Europäer zur Finanzierung der NATO, ein Beitrag, der längst hätte höher ausfallen können und müssen. Doch an diesem Tag zeigte sich in aller Deutlichkeit der Riss, der durch dieses Verhältnis ging – ein Verhältnis, auf dem so unendlich viel gründete, allem voran Stabilität, Frieden und Sicherheit in Europa seit 80 Jahren (die Gewalt im ehemaligen Jugoslawien nicht mitgerechnet). Die USA, eine Ordnungsmacht im Großen, und Europa, eine Ordnungsmacht im Kleinen: Zusammen hatten sie viel erreicht seit 1945, vielleicht – gelegentlich – auch darüber hinaus. Doch diese Zeit schien vorbei an jenem 28. Februar 2025. Von einer zweiten »Zeitenwende« war fortan die Rede, auf dem Umstand gründend, dass Europa fortan ganz wesentlich selbst für seine Sicherheit würde sorgen müssen. »Der Westen, wie wir ihn kannten, ist weg«, stellte der Historiker Norbert Frei trocken fest.2 Was das heißt, umriss Heinrich August Winkler, ebenfalls Historiker. Nichts, deutete er an, wird fortan mehr so sein, wie es war. Alles habe sich geändert, wir müssten lernen, die Dinge gänzlich neu zu sehen, denn: »Das Jahr 2025 dürfte zur tiefsten Zäsur der Weltgeschichte seit dem Untergang des Sowjetimperiums in den Jahren 1989 bis 1991, ja vermutlich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren werden«.3 Die Diagnose deutet nicht nur einen politischen Bruch an, sondern auch eine erhebliche intellektuelle und psychische Zumutung. Denn fortan müssen sich die Europäer – müssen wir – uns massiv umstellen, müssen zumindest in Teilen politisch Abschied nehmen von einem Land, dem wir uns seit 1941, als die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten und so ganz wesentlich zum Sieg über Nazi-Deutschland beitrugen, auf das Engste verbunden fühlten. Das taten die USA unter höchsten Verlusten: Gut 400.000 US-Soldaten starben in diesem Krieg.4 Die Verbundenheit wuchs vor allem aber nach Kriegsende, auch auf Grundlage der mehr als freundlichen Gesten der Amerikaner. Wenn etwa die US-Soldaten – die »GIs«, wie sie voller Bewunderung für die fremde Sprache und fremde Kultur genannt wurden – Kaugummis und Schokolade unter der Zivilbevölkerung verteilten. Oder wenn sie 1948/49 mit den berühmten »Rosinenbombern« das westliche Berlin vor dem Fall in den sowjetischen Machtbereich bewahrten. Unvergessen auch andere Szenen: Etwa der Ruf von John F. Kennedy im Juni 1963 in die vor dem Schöneberger Rathaus versammelten Menge einige Monate nach Beginn des Mauerbaus. »Ich bin ein Berliner«, bekannte er. Die USA würden West-Berlin auch dieses Mal nicht der Sowjetunion überlassen – eine fast beiläufig geäußerte, aber sofort verstandene Garantie, die Ronald Reagan 25 Jahre später erweiterte, indem er die Freiheit auch des ostdeutschen Landesteiles forderte: »Mr. Gorbachev, open this gate«, rief er im Juni 1987 am Brandenburger Tor. »Mr. Gorbachev, tear down this wall!«
Den Willen, für den diese Worte stehen, müssen die Europäer fortan ganz wesentlich selbst aufbringen. Und das in einer Zeit, die dramatische Änderungen verzeichnet, außen- wie innenpolitisch. Beide Aspekte sind verknüpft mit einem Phänomen: dem Aufkommen populistischer, vor allem aber autokratischer Kräfte. Außenpolitisch ringt Europa insbesondere mit dem Regime im Kreml, verantwortlich für einen massiven Zivilisationsbruch, nämlich einen offenen Angriffskrieg. Europa hat das einzig Richtige getan: Es hat sich an die Seite der Ukraine gestellt und unterstützt sie militärisch. Doch Europa sieht sich nicht nur Russland gegenüber. Denn Russland seinerseits wird von Staaten unterstützt, die den Rechtsstaat ebenfalls mit Füßen treten und jegliche Opposition im Keim ersticken: Iran, Nordkorea, Belarus – sämtlich diktatorisch oder, in den Worten der Historikerin Anne Applebaum, »autokratisch« regierte Staaten. Die iranischen Drohnen, die nordkoreanischen Soldaten, die Verwandlung belarussischen Bodens in russisches Aufmarschgebiet: All dies verlieh Putins Krieg erst seine eigentliche Wucht. »Doch wenn Putin die Einigkeit der demokratischen Welt unterschätzt hatte, dann hatten die demokratischen Staaten die Dimension der Herausforderung unterschätzt. Wie die Oppositionellen in Venezuela oder Belarus mussten sie allmählich erkennen, dass sie in der Ukraine nicht nur gegen Russland kämpften. Sie kämpften gegen die Achse der Autokraten.«5, so Applebaum. Und mit der Ukraine, auch das ist eine der Thesen meines Essays, versucht Putin einen Staat zu zerschlagen, dessen – nun vorerst brutal gestoppter – Kurs Richtung Westen der russischen Bevölkerung zeigen könnte, dass ein anderes Leben – ein ökonomisch befriedigenderes und demokratisch wie rechtstaatlich unendlich weiter entwickeltes – durchaus möglich ist, jedenfalls dann, wenn Russland nicht von Autokraten wie Putin und seinen Helfern regiert würde. So verstanden, ist die Ukraine für die Russen ein Maßstab des Möglichen und damit eine Inspiration, ein Hinweis auf eine bessere Zukunft. Eben darum muss sie, wie Syrien, wie Tschetschenien, zerstört werden. »Russland, so könnte man sagen, ist dieser Sicht zufolge nicht von der NATO und ihren Raketen eingekreist worden, sondern von der Idee der Demokratie, der Menschenrechte, des Rechtsstaats, der individuellen Freiheit und vor allem dem Wunsch nach einem besseren Leben.«6
Das Ringen um die Freiheit der Ukraine ist umso schwieriger, als sich Europa nicht nur nach außen, sondern auch nach innen antidemokratischen Kräften gegenübersieht: Nahezu kein europäisches Land, in dem populistische Kräfte nicht massiv im Parlament vertreten wären oder gar die Regierung stellen. Der vorliegende Essay setzt in dieser Hinsicht mein Buch »Die Kommune der Faschisten« fort«, in dem ich die populistischen Experimente des italienischen Dichters und Demagogen Gabriele D'Annunzio nachgezeichnet habe, der in den Nachwirren des Ersten Weltkriegs in Fiume, dem heutigen Rijeka im Norden Kroatiens, für knapp anderthalb Jahre eine Republik gründete, und zwar in offenem Widerspruch zum Willen der internationalen Staatenwelt, wie sie sich in jenen Jahren in der großen Friedenskonferenz von Versailles artikulierte. D'Annunzios Republik gilt zumindest stilistisch – in all den Aufmärschen, Kundgebungen und Reden ihres Führers – als Experimentierfeld des italienischen Faschismus, wenngleich sich D'Annunzio, ein Freund Benito Mussolinis – diesem zuletzt auch verweigerte. In diesem Buch habe ich als historischen Nachschlag recht ausführlich auch den gegenwärtigen Populismus umrissen, mit Schwerpunkten auf Italien, Frankreich, dem Großbritannien des Brexits und den USA. In dem vorliegenden Essay spüre ich vor allem der Situation in Deutschland nach – in einer Zeit, in der die AfD der »Sonntagsfrage« zufolge kurzfristig als Partei mit dem meisten Zuspruch erschien, sich offenbar nun aber dauerhaft als zweitstärkste Partei des Landes etabliert hat, und das ungeachtet des Umstands, dass der Verfassungsschutz sie im Frühjahr 2025 als »gesichert rechtsextremistisch« eingestuft hat.
Wie ist es zu den jüngsten Entwicklungen gekommen? Das ist die Frage, denen dieser Essay nachgeht. Zunächst spürt er der Situation in Deutschland nach, den Facetten eines kulturellen und sozialen Unbehagens, das nicht immer leicht zu fassen ist, sich nicht leicht dokumentieren lässt – das aber doch »da« ist, als Stimmung, Atmosphäre, als »etwas«. Ein Essay ist, man weiß es, ein Versuch, und eben darum geht es: um den Versuch, diese Stimmung einzufangen. Nach dem Blick auf die Empfindungen in Deutschland schaue ich in drei Anläufen auf und in die USA, versuche zu verstehen, was eine derart erratische, derart demagogisch agierende Person wie Donald Trump in das höchste Amt des Landes hat bringen können. Die Vorgeschichte der Wahl führt weit weg vom Washingtoner Machtzentrum, weit hinaus auf das Land, in die unbeachteten, übersehenen – und wenn doch gesehenen, dann alsbald wieder vergessenen – kleinen Orte, dahin, wo nichts oder nicht viel zu hoffen ist, vor allem dann nicht, wenn ein Land kulturell und, zum Beispiel, demographisch so rasante Veränderungen durchläuft wie die USA in den letzten Jahrzehnten, in einem Tempo, das viele Menschen auf die unterschiedlichsten Arten überfordert – und sie dann politischen Menschenfängern in die Arme treibt, die es nicht durchweg gut mit ihnen meinen, man schaue etwa auf einige der religiös sich gebenden Glaubensunternehmer. Was passiert, wenn Menschen weder an sich noch an die Wahrheit glauben – und an letztere irgendwann explizit auch nicht mehr glauben wollen –, das hat sich in den USA gezeigt. Deren Entwicklung ist darum auch für Europa eine Warnung. Hier deutet sich an, was in den USA längst (vor)politische Realität ist.
Ganz anders zeigt sich die Lage in Russland, das nach einem guten Vierteljahrhundert unter der Präsidentschaft Putins (inklusive des rückschauend kaum minder trostlosen Zwischenspiels Dmitri Medwedews) zu einem repressiven Staat geworden ist, hart an der Grenze zur Diktatur, dazu hochgradig aggressiv nach innen und außen. Wie dieses Regime auf die Russen gewirkt hat, in welche sozialen Kälteräume und propagandistische Echokammern es sie gezogen hat, das ist eine Katastrophe von gleichermaßen moralischen wie politischen Dimensionen. Noch größer wird sie, weil die Herren des Kremls ihr antiliberales, antimodernes Weltbild längst auch in den Westen – auch nach Europa, auch nach Deutschland – exportieren. Auch diesem Export gehe ich in dem Buch nach. Darüber landet es am Ende wieder in Deutschland: genauer, bei der politischen Naivität des Landes im Vorfeld des Krieges, wie sie sich im Bau von Nordstream I und II zeigte. Rückschauend ist die deutsche Rolle so einfältig wie zynisch – zynisch den mittel- und osteuropäischen Nachbarn gegenüber, die immer wieder auf die politischen Risiken der Gasleitung hingewiesen haben – und in Deutschland, das gute Geschäft mit Russland vor Augen, niemand hören mochte. Hier zeigt sich eine Gleichgültigkeit unseren Nachbarn gegenüber, die man kennen sollte, um die derzeitige Situation und den deutschen Anteil an dieser besser zu gewichten. Zugleich steht Nordstream im Zeichen einer eigentümlichen Neigung deutscher Politik, zu sehr auf Moskau und zu wenig etwa auf Kiew, Riga oder Warschau zu schauen.
Im letzten Kapitel geht es noch einmal um den Zustand der deutschen – letztlich in großen Teilen wohl aber insgesamt westlichen – Diskussionskultur und deren Ursachen. Was der Blick auf die USA andeutete, legt auch der auf die Situation hier im Lande nahe: Es scheint, an die Politik richten sich zunehmend Erwartungen, die sich früher an die Kirche richteten, nämlich solche, die im weitesten Sinn mit Sinnfragen verbunden sind. Erstaunlich ist das nicht, denn das Tempo der Veränderungen – bei Migration, Digitalisierung und auf dem Arbeitsmarkt etwa – hat das Land enorm verändert und damit auch ein Gefühl für das erschüttert, was früher auf den großen Namen »Heimat« hörte (ein pathetischer Begriff, ja). Nichts zeugt davon so sehr wie die so genannten Identitären Bewegungen, denen es eben darum geht: ein Stück »Heimat« zu schaffen, so aussichtlos das auch ist, sobald es um mehr geht, als einen folkloristischen Tanz um den Dorfbaum aufzuführen (und das nicht – der schwierigste Teil der Veranstaltung – nicht komisch, lächerlich zu finden). Doch gibt es identitäre Regungen, so scheint es, auch in einem Teil der Linken, hier zeigen sie sich als der starke Wunsch, zu den Richtigen, den Fortschrittlichen, dem juste milieu zu gehören, einem Milieu, das mit republikanischen Spielregeln im Zweifel ebenfalls nur am Rande zu tun hat. Der Abschied vom Westen, wie wir ihn kannten, hat viele Ursachen. Ihnen geht dieses Buch nach.
2. DieStadt, derMüllundderZorn
»Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden, und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten.«
Franz Kafka, Vor dem Gesetz
In Köln liegt der Ärger auf der Straße. Er ist konkret, plastisch, vielgestaltig. Man könnte nach ihm greifen, aber das tut niemand. Denn der Ärger ist klebrig, ranzig, unappetitlich, und er stinkt. Er setzt sich zusammen aus Vielem: Zigarettenstummeln, leeren Pizzakartons, zerknüllt oder noch intakt, mit einem Rest zerkochter Tomate darin oder zerlaufenem Käse. Hinzu kommen die ausgetrunkenen »Minis«: kleine Likörflaschen, zu Dutzenden in das Pflaster gerammt, so lange schon, dass sie mit den Fugen beinahe verwachsen sind. Dazu Kaugummis, zerschmetterte Bierflaschen, Scherben, Erbrochenes, andere körperliche Hinterlassenschaften. Nicht ganz Köln ist derart vermüllt, wohl aber die Straßen rund um die Partyzone, in die sich mein Viertel in den letzten Jahren verwandelt hat. Es ist angenehm hier unter der Woche: ein unauffälliges Quartier mit einigen netten Cafés, ein, zwei kleinen Parks, zentral gelegen, beste Verkehrsanbindung, die Innenstadt ist auch zu Fuß in einigen Minuten zu erreichen. Doch Wochenende für Wochenende verwandelt sich das Viertel in ein Areal deftigen Vergnügens, lockt mit einer Unzahl von Imbissbuden, Sportsbars, Spätis und Kneipen, gegen die sich der klassische Handel immer weniger behaupten kann. Eine kurze Bilanz: Der Metzger ist seit langem weg, die privat geführte Bäckerei, der Schuhhändler erst seit ein paar Jahren. Auch das Reisebüro hat dicht gemacht, ebenso der Schreibwarenhändler, die kleine Druckerei und der Schlüsseldienst. Umso mehr freue ich mich, dass sich der Buchladen hält, der einzige seiner Art im Viertel, nachdem die großen Buchhandlungen rund um die nahe gelegene Universität eine nach der anderen geschlossen haben. In den Räumen der einen befindet sich jetzt eine Versicherungsrepräsentanz, in denen der anderen ein Kiosk. Das Viertel selbst hat seinen studentischen Charakter immer mehr verloren, von der Universität ist hier kaum etwas zu spüren. Stattdessen dominiert das Partyleben, vor allem an den Wochenenden, wenn hunderte, wenn nicht tausende Besucher durch das Viertel streifen und all das hinterlassen, was die städtischen Reinigungskolonnen am nächsten Morgen wegfegen – das meiste jedenfalls, denn die Besen und Kehrmaschinen erfassen nicht alles, und so zieht sich eine Restspur von weggeschmissenen Dönern, Burgern, an ausgegossenen Bier- und Schnapsflaschen über den Asphalt, bildet eine schmierig-dunkle Masse, die punktweise bis auf den Bordstein kriecht.
Müll ist ein Ärgernis. Und darum auch eine psychopolitische Erregungsmasse. Der Gedanke ist beklemmend, mehr als sonst noch im Frühjahr 2025. Der neue US-Präsident ist seit einigen Monaten im Amt, und wenn seine erste und die nun beginnende zweite Amtszeit eines gezeigt haben, dann dieses: Vor Populisten und Demagogen ist kein Thema sicher. Alles kann zum Anlass von Zorn, Affekten, Unmut werden, alles sich in Stoff einer ideologischen Offensive verwandeln lassen, dass es bergab gehe mit dem Land, die Zustände unhaltbar seien, es nun dringend jemanden brauche, der die Sache in die Hand nimmt, das Land vor dem Untergang rettet, und zwar durchaus auch in Sachen Dreck. Polizisten würden krank, nur weil sie auf Streife gingen, erklärte Trump im Juli 2019 auf dem ihm gewogenen Nachrichtensender Fox News. Auch die vielen Obdachlosen seien ein Problem. »Wir können unsere Städte nicht ruinieren.«7 Immer wieder griff er das Thema auf, so etwa im Mai 2023, als er es mit der Arbeit seiner politischen Gegner in Verbindung brachte: »Unsere von den Demokraten regierten Städte sind Rattenlöcher voller Kriminalität«, sagte er im Interview mit dem Sender GBNews.8»Washington (D.C.) ist zu einer schmutzigen, von Kriminalität geprägten Todesfalle geworden, die von der Bundesregierung übernommen und ordnungsgemäß geführt werden muss«, schrieb er im Oktober 2023 auf seiner Plattform Truth Social.9
Mit seinen Sprüchen bringt Trump seine Kritiker in Verlegenheit: Denn die Missstände existieren ja wirklich. Sie sind nicht nur herbeigeredet oder eingebildet. Sie sind real. Und sie beschäftigen die Menschen, ich wage zu behaupten: jeden einzelnen von uns. »Muss das so sein?« – die Frage dürfte noch zu den zurückhaltenden Reaktionen gehören. Genauso gut – ich bemerke es zumindest an mir selbst – dürften wir uns aber ärgern über diese Missstände, bestürzt, frustriert, missmutig sein. Denn Dreck ist mehr als nur Dreck. Dreck ist ein Ärgernis. Dreck fordert heraus. Eigentlich dürfte er gar nicht da sein. Unendlich viel haben wir unternommen, um ihn zu entsorgen, zumindest außer Sichtweite zu schaffen. Müll- und Abfalleimer, die Müllabfuhr, Müllverbrennungs- und Verarbeitungsanlagen, dazu – sehr unfein – der Export unseres Schrotts in den globalen Süden: Wir unternehmen erhebliche Anstrengungen, um den Müll loszuwerden. Aber trotzdem ist er da, er kommt uns nahe, und es scheint, als werde er immer mehr, immer aufdringlicher. Etwas stimmt nicht, wir als Gesellschaft werden des Mülls nicht mehr Herr, zumindest nicht durchgehend. Darum ist der Müll ein Ärgernis, dazu aber noch viel mehr: Er verhöhnt uns, verspottet die, die mit oder in ihm leben müssen: die ihre Fahrräder vorbei an den Scherben navigieren, die einen großen Schritt machen, um nicht auf den Kaugummi zu treten oder ihren Schuh nicht mit der klebrig-undefinierbaren Masse zu beschmutzen. So liegt der Dreck vor unseren Füßen, und in dunklen Momenten scheint es, als verweise er auf Risse im System. Und die machen nervös. Denn wenn wir es nicht einmal schaffen, den Müll zu beseitigen, dann stellt sich, gelegentlich, nicht immer, die Frage, was wir eigentlich überhaupt noch können. So viele Missstände derzeit: Marode Straßen, dringendst sanierungsbedürftige Schulen, ein teils um Jahre hinterherhinkendes Kabelnetz; dazu lange Wartzeiten auf Ämtern, eine überlastete Justiz, Großbaustellen, die einfach nicht vorankommen – nur ein paar willkürlich herausgegriffene Beispiele. Aus jedem dieser Missstände ließe sich eine Geschichte von Frust, Empörung, Entfremdung stricken, aus jedem sich üble Launen, bad vibrations schlagen, bereit für politischen, oder besser: postpolitischen, nämlich populistischen, Missbrauch. Denn Missstände weisen über sich hinaus. Sie stehen nicht nur für sich selbst, sondern sind Indizien, deuten etwas an, nämlich, dass das System – unser Staatssystem einschließlich des Öffentlichen Dienstes – nicht mehr so funktioniert, wie wir es über Jahre und Jahrzehnte gewohnt waren. Die Kommunen verweisen auf die Mitverantwortung der Bürger. »Keine Frage«, sagt der Vorstandschef der Berliner Stadtreinigung, »in Sachen Sauberkeit kann man immer noch mehr machen, aber das müssen dann auch alle zusammen tun.«10 In dieser nüchternen Tonlage werden auch die entsprechenden Kölner Diskussionen geführt, ungeachtet der sich häufenden Missstände. Neben dem Dreck zum Beispiel der dünner getaktete Fahrplan der kommunalen Verkehrsbetriebe; die häufig nicht funktionierenden Rolltreppen; die über Jahre sich hinziehenden Großbaustellen; die wachsende Zahl der Drogenabhängigen in den zentralen U-Bahn-Stationen, der offene Handel, der dort mit Rauschgiften getrieben wird. Der lokalen Zeitung, dem »Kölner Stadtanzeiger«, war die Schieflage bereits mehrere Artikel wert, so etwa im Februar 2025: »Betteln, Drogen und Exkremente – das ganze Elend von Köln«, war er überschrieben.11 Wer könnte Ordnung und Sauberkeit in der Stadt wiederherstellen, hatte der Stadtanzeiger kurz zuvor, im Januar 2025 die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker gefragt. »Mit den Mitteln, die uns aktuell zur Verfügung stehen, niemand«, antwortete sie.12 Das war kein Offenbarungseid. Aber die offene Antwort deutete an, wie komplex die Herausforderungen sind, mit denen die Verwaltung einer Millionenstadt zu tun hat.
Das ist beunruhigend, gerade mit Blick auf die USA, auf ihre Städte. »Ich bin nach New York gekommen, weil es der verlorenste, der elendste aller Orte ist. Die Zerbrochenheit ist allgegenwärtig, die Unordnung universal. Sie brauchen nur die Augen zu öffnen, um es zu sehen. Die zerbrochenen Menschen, die zerbrochenen Dinge, die zerbrochenen Gedanken. Die ganze Stadt ist ein Schrotthaufen. Sie eignet sich ausgezeichnet für meine Zwecke. Die Straßen sind eine endlose Materialquelle, ein unerschöpfliches Lagerhaus von zertrümmerten Dingen. Jeden Tag gehe ich mit meiner Tasche umher und sammle Gegenstände, die eine Untersuchung wert sind. Ich habe nun schon Hunderte von Proben – vom Zerdrückten bis zum Zerkratzten, vom Verbeulten bis zum Zerplatzten, vom Zerriebenen bis zum Verfaulten.«13 So beschreibt es einer der Protagonisten von Paul Austers New York Trilogie, verfasst Mitte der 1980er Jahre. Aber was damals Stoff der Literaten war, ist heute Stoff der Ideologen. »Die schönsten Städte Amerikas werden in der Tat durch liberale Politik ruiniert«, erklärte im Dezember 2021 der republikanische Kongressabgeordnete Dan Crenshaw dem Sender Fox News. »Es gibt eine direkte Verbindung zwischen Tod und Verfall und liberaler Politik.«14 Einige Städte seien »wie Kriegsgebiete«, sagte der Gouverneur Floridas, Ron DeSantis, im August 2023. »Es war eine Zivilisation im Verfall«, resümierte er seine Eindrücke aus dem drogengeplagten San Francisco.15
Aber das hier ist kein Buch über verdreckte Städte. Es ist ein Buch über Populismus und Demagogie, und darum könnte es überall anfangen, ein kleiner Spaziergang durch die Stadt würfe zahllose Themen auf. Wer sich mit böser Absicht durch die Stadt bewegt, fände Themen zuhauf. Auf der anderen, weniger wohlhabenden Rheinseite fielen ihm etwa die vielen Migranten auf (»Du siehst ja kaum noch einen Deutschen hier, das ist ja die reinste Überfremdung«). Die Fahrt im Auto über die Ringe, eine der zentralen Verkehrsachsen der Stadt, geriete ihm wegen des Tempolimits – 30 km/h – zur Geduldsprobe (»Freie Fahrt für freie Bürger statt so genannter Verkehrswende«) und auch die Fahrt in den Öffentlichen Verkehrsmitteln forderte ihm Langmut ab (»diese Scheiß-Bahn, ein echter Sanierungsfall«). Auch der Gang durch die Straßen der Stadt geriete zum Ärgernis, etwa angesichts der dort verkehrenden Lastenräder (»Panzer auf zwei Rädern«). In der Kantine könnte er sich über die vegetarischen Gerichte erregen, (»Es fehlt nicht mehr viel, und wir dürfen im Sommer noch nicht mal mehr ein Würstchen grillen«); und plauderte er beim Essen mit einer Kollegin, störte ihn ihr konstantes Gendern (»die reinste sprachliche Umerziehung«).
So viel gäbe es für Populisten also zu tun. Und tatsächlich stehen sie bereit, so richtig aufzuräumen. »Wir sind offensichtlich die Einzigen hier im Kölner Stadtrat, die Kettensäge statt Kuschelkurs wollen«, erklärt Matthias Büschges, Mitglied der AfD-Fraktion im Rat der Stadt Köln im Februar 2025 eben dort. »Wir wollen kein Kalkutta. Wir wollen aber auch kein Frankfurter Bahnhofsviertel.«16 So ist sie nun auch in Köln, die große Säge, Handwerkszeug des argentinischen Präsidenten Javier Milei, der sich vorgenommen hat, mit ihr für Ordnung zu sorgen, rigoros den argentinischen Staat zu zerlegen. »Der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem«, erklärte er auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Denn der Staat basiere auf nichts anderem als Zwang. Es gebe niemanden, der freiwillig Steuern zahle. Je höher die Steuern aber lägen, desto weniger Freiheit gebe es. »Lasst euch nicht von Parasiten einschüchtern, die vom Staat leben«, rief er dem Publikum zu. »Lasst euch nicht einreden, dass es unmoralisch ist, Geld zu verdienen.«17 Die Kettensäge, ein martialisches Werkzeug. Kein Instrument für Feinarbeit und behutsames Nacharbeiten, sondern eines fürs Grobe und Brachiale, das Abholzen und Niedermachen, nicht für Reformen gemacht, sondern für den Umsturz, für die Vernichtung des Alten um etwas Neues entstehen zu lassen, von dem allerdings oft genug, wie derzeit in den USA, nicht klar ist, was es ist. Folgerichtig ist die Kettensäge das Instrument, das Elon Musk von Milei Ende Februar in Washington auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) übernahm und mit dem er, der für diese Aufgabe kein offizielles demokratisch begründetes Mandat hat, nun als Chef des Department of Government Efficiency