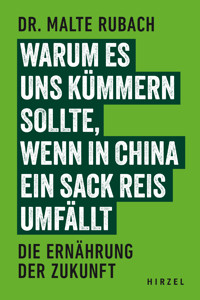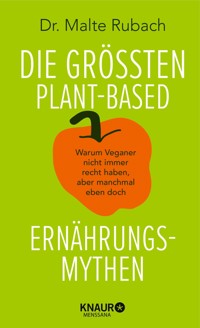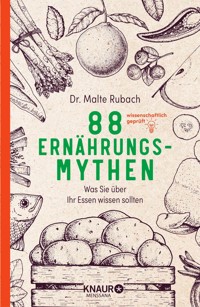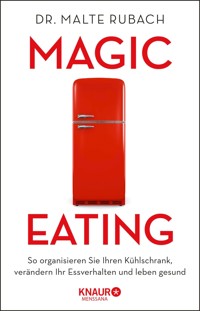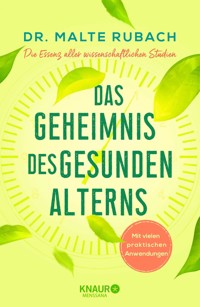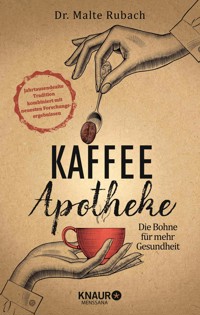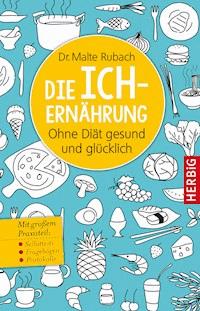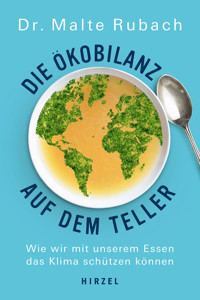
16,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: S. Hirzel Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der ökologische Fußabdruck im Speiseplan
Wie viel CO₂ verursacht eine Portion Spaghetti bolognese? Etwa 1,5 Kilogramm!– Dieses Beispiel führt uns vor Augen, was die Tierwirtschaft und Lebensmitteltransporte für die Ökobilanz unseres Essens bedeuten. Doch ist es mit dem Umstieg auf Fleisch- und Milchalternativen oder Regionalkost getan? Malte Rubach schaut genauer hin und liefert eine Bestandsaufnahme unseres Ernährungssystems sowie von dessen Auswirkungen auf das Klima. Wir leben in einer Gesellschaft, die durch Technisierung und steigenden Ressourcenverbrauch geprägt ist. Rubach plädiert für einen maßvollen Genuss und zeigt, was wir in Deutschland guten Gewissens noch essen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Dr. Malte Rubach
Die Ökobilanz auf dem Teller
Wie wir mit unserem Essen das Klima schützen können
Um an die Quelle zu kommen,muss man gegen den Strom schwimmen.
Stanislaw Jerzy Lec
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1. Teil: Wie wir lebten
Die Natur des Klimas
Der Einfluss des Menschen
Warum wir immer mehr essen
Die Folgen des Lebens
Fazit
2. Teil: Wie wir leben
Deutschland ist nicht die Welt
Ohne Wasser kein Leben
Die üblichen Verdächtigen
Die »Good-Guys«
Tiere essen?
Pflanzen essen!
Essen wegwerfen?
Freiheit
3. Teil: Wie wir leben werden
Fleischalternativen
Milchalternativen
Wie viel von was?
Achtsamkeit
Was passiert danach?
Zusammenfassende Kernbotschaft
Die 6 wichtigsten To-dos, wie jeder mit Ernährung das Klima schützen kann
Danksagung
Literatur
Leseprobe
Vorwort
Ein Buch über nachhaltige Ernährung zu schreiben ist nicht einfach. Vor allem dann nicht, wenn man aus eigener Erfahrung weiß, dass es in manchen Ländern der Welt nicht immer genügend Nahrung gibt und der Begriff »Nachhaltigkeit« höchstens bedeutet, wie lange man von dem Vorhandenen noch satt bleiben kann. Brasilien produziert zum Beispiel mitunter die größten Mengen Lebensmittel für den Weltmarkt, und gleichzeitig ist ein Teil der Bevölkerung immer noch auf Lebensmittelhilfen der Regierung oder von Nichtregierungsorganisationen angewiesen, vor allem Kinder. Und auch das ist wieder kein Vergleich zu dem Lebensalltag, der in manchen Regionen Afrikas oder Südostasiens herrscht. Was bedeutet also Nachhaltigkeit für ein hochentwickeltes Land wie Deutschland? Wir, Marjorie und Malte Rubach, kennen beide Seiten der Medaille, weil je ein Teil von uns aus Brasilien und aus Deutschland stammt. Man kann sich sehr schnell an ein höheres Lebensniveau gewöhnen, wenn man von einer niedrigeren Stufe kommt. Ein funktionierendes Gesundheits- und Sozialsystem und eine gelebte Demokratie sowie Meinungsvielfalt sind wohl mit die wichtigsten Grundpfeiler für einen hohen Lebensstandard ohne Hunger und Krankheit. Eine florierende Wirtschaft ist genauso notwendig, denn sonst gibt es keine Einnahmen, die der Staat für öffentliche Investitionen und der Bürger für den Konsum ausgeben können. Dass dabei nicht die Umwelt Schaden nehmen darf, lernen wir selbst in Deutschland und anderen Industrieländern nur langsam. Warum?
Selbst wenn der Lebensstandard zunimmt und schon auf einem vergleichsweise hohen Niveau liegt, wollen wir als Individuen immer noch ein bisschen mehr als das, was wir schon haben. Weniger ist keine Option. Oder doch? Vor einigen Jahren haben wir angefangen, darüber nachzudenken, was wir im Leben wirklich brauchen. Müssen es immer neue Möbel sein oder tun es auch gebrauchte? Muss es immer ein neues Handy geben, wenn das Display einen Sprung hat? Kann man etwas mehr Geld für biologische und regionale Lebensmittel ausgeben, dafür etwas weniger kaufen? Und kann man bei Bedarf seinen Kleiderschrank nach und nach auch auf ökologisch umstellen? Wir wissen heute, dass es geht. Zugegeben – die Kosten steigen hier ein bisschen, dafür spart man wieder da ein wenig. Wer bereit ist, einen höheren Preis zu bezahlen, spürt trotzdem schnell die Grenzen des Machbaren. Welchen Aufwand kann man schließlich von den Menschen für mehr Nachhaltigkeit verlangen? Wir haben keine Kinder, weil dies nicht zu unserem Lebensentwurf passt. Für manche Menschen wäre das der höchste Preis, den sie zu zahlen nicht bereit wären. Das trifft sowohl auf Industrieländer wie auf weniger entwickelte Länder zu, in denen die Bevölkerungszahl am stärksten ansteigt. Diese Menschen haben kaum eine Alternative, und eine große Kinderschar ist nicht zuletzt eine Absicherung für die Zukunft, weil einigermaßen funktionierende Sicherheitsstrukturen des Staates schlichtweg nicht vorhanden sind.
Auf unseren Reisen durch die Welt sind wir vielen Menschen begegnet, die den einen oder anderen Preis dafür bezahlen, um ihr Leben ein bisschen lebenswerter zu machen. Wer Kinder hat, muss häufig sparen oder lebt sogar ausgerechnet deshalb in Armut. Wer keine Kinder hat, nimmt an bestimmten Formen des gesellschaftlichen Lebens automatisch nicht mehr teil. Wer im Überfluss konsumiert, entwickelt die eine oder andere Form der Sucht. Wer von allem zu wenig hat, ist bereit, über Wüsten, Meere und Gebirge hinweg ein besseres Leben zu suchen. Die Welt ist von so hoher Komplexität geprägt, dass es für den Einzelnen kaum mehr möglich ist, zu wissen, was die »beste« oder »richtige« Entscheidung wäre. Während mit steigender Weltbevölkerung auch Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung zunehmen, wird an immer mehr Stellen Verzicht zur Tugend gemacht. Auf was sollen wir verzichten? Auf was wollen wir verzichten – und auf was können wir nicht verzichten?
Weniger Kinder? Weniger Essen? Weniger Autos? Weniger Internet? Jede in dieser kleinen Auswahl von Möglichkeiten bringt unser gewohntes Leben bereits durcheinander. Orientierung ist deshalb umso wichtiger, wenn es darum geht, was wir hier in Deutschland vor Ort tun können. Essen ist das wichtigste Grundbedürfnis des Menschen, daher sollten wir uns genau überlegen, wie wir ein gesundes und ökologisches Verhältnis zu unserer Ernährung und unseren Lebensmitteln finden können. Dieses Buch soll Ihnen dabei eine Hilfe sein.
Bleiben Sie gesund!Marjorie und Malte Rubach
Einleitung
Ob es das Corona-Virus ist, die Heuschreckenplagen in Afrika oder der Klimawandel: Die Welt steht fast vor dem Untergang. Wie schon so oft in der Geschichte der Menschheit haben wir es mal wieder geschafft. Unsere Gier nach Lust und unsere Völlerei hat uns an den Rand der Hölle gebracht, und die Situation könnte nicht aussichtsloser sein. Was jetzt nur noch helfen kann, ist Läuterung und Reue. Dann lässt die höhere Macht, die alles vorbestimmt, möglicherweise noch Gnade vor Recht ergehen über diese zügellose Menschheit. Ansonsten wird es kein Morgen geben, weder für uns noch die kommenden Generationen!
Was sich hier liest wie eine Vorankündigung der apokalyptischen Reiter, ist der ungefähre Ton der Weltuntergangspropheten im Anthropozän, wie das Erdzeitalter seit Beginn der industriellen Revolution vor gut 170 Jahren genannt wird. Das Wort kommt von »anthropos«, was auf Griechisch »Mensch« bedeutet, und »kairos« – »neu«, und soll andeuten, dass sich der Mensch, angefangen mit der landwirtschaftlichen bis hin zur industriellen Revolution im heutigen Ausmaß, des Planeten derart bemächtigt hat, ihn geformt und verändert hat, wie es sonst nur die Erdzeitalter über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg vermochten. Außer dem Raub an natürlichen Ressourcen sind auch die Veränderungen des weltweiten Klimas ein Zeichen der Auswirkungen der menschlichen Existenz, wie wir sie heute kennen.
Die menschliche Tendenz zur Selbstbezichtigung ist indes nicht neu – schon im 6. Jahrhundert verdunkelte eine unvorstellbar große Aschewolke durch einen Vulkanausbruch weltweit den Himmel derart, dass die Temperaturen absackten, Ernten ausfielen, Menschen starben. Ursachen waren schnell gefunden, irgendetwas im menschlichen Verhalten musste den Zorn der Götter hervorgerufen haben. Über ein Jahrtausend später, im 18. Jahrhundert, bebte die Erde in einem Ausmaß, dass es in Lissabon zu Zerstörung, Krankheit und Tod kam, wie es kein Mensch zuvor gesehen hatte. Wieder war die Schuldfrage auf Seiten geistlicher Weltenlenker trotz Jahrhunderten des Wissensgewinns und des erst beginnenden Zeitalters der Aufklärung schnell beantwortet: Völlerei, Vielweiberei und Zügellosigkeit hatten nach einer gerechten Strafe verlangt. Aufklärerische Philosophen von Voltaire bis Kant witterten bereits, dass es sich womöglich um ein Naturereignis handeln könnte, aber Erkenntnisphilosophie stand in dieser Situation noch nicht im Zentrum des Diskurses. Stattdessen hatten kurze, auf den ersten Blick schlüssige Erklärungen und Schuldzuweisungen wie heute Hochkonjunktur. Die Zukunft wurde schwarzgemalt, aber Prognosen sind ja bekanntlich immer schwierig, besonders dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Zumindest eines hatten beide Naturereignisse mit dem Blick von heute gemeinsam: Weder Lissabon noch die Menschheit ist vom Erdboden verschwunden.
Das wohl größte, Erdzeitalter übergreifende und die Geschicke der Welt beeinflussende Naturereignis aller Zeiten ist aber kein Erdbeben und auch kein Vulkanausbruch. Es ist mit Sicherheit das Klima, das sich schon seit Anbeginn der Erdgeschichte vor Milliarden von Jahren im Wandel befindet. Es wandelt sich immer noch, doch als Ausgang allen Übels der schon heute messbaren und zukünftig zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels ist auch heute schnell ein Schuldiger ausgemacht, wenn man den lauthals schreienden Stimmen glauben darf: die Landwirtschaft. Wäre sie nicht entwickelt worden, wäre heute alles in Butter. Oje, ich bitte vielmals um Verzeihung, so war das nicht gemeint, denn Butter wird ja »als Klimakiller Nr. 1« bezeichnet. Immerhin werden pro Kilogramm Butter bis zu 22 Kilogramm Treibhausgase (so werden wir im Verlauf Kohlenstoffdioxid-Äquivalente der Einfachheit halber bezeichnen) in die Luft geblasen. Butter zählte demzufolge also vor Jahrtausenden schon zu den Übeltätern, heute sowieso, und hätte ebenfalls besser niemals entdeckt werden sollen. So wie die atomare Kernspaltung, Zigaretten, die Luftfahrt, das Schießpulver und was sich sonst noch alles als Gefahr für Menschenleben entpuppt hat. Was hätten unsere Vorfahren nicht schon alles besser machen können, hätten sie es nur besser gewusst!
Ist das wirklich wahr? Wissen wir heute wirklich alles besser? Fest steht, dass wir heute viel mehr wissen, aber noch längst nicht alles und erst recht nicht alles besser. Wir kennen den Status quo, doch die Zukunft ist allenfalls modellhaft berechenbar. Erst im Juni 2020 ergaben zum Beispiel neueste Erkenntnisse von Klimaforschern, dass die starke Eisschmelze am Südpol nicht allein klimabedingt sein kann, sondern ein natürlicher Einfluss vorliegen muss, den wir noch nicht genau beschreiben können. Sind wir also wirklich weiser und klüger als unsere Vorfahren, die uns das Übel ja allem Anschein nach erst eingebrockt haben, mit all ihren Erfindungen gegen die Vernunft? Das Butter-Paradoxon ist nur eines von ziemlich vielen, denen wir uns in diesem Buch widmen werden, wenn es um die Frage geht »Wie wir mit unserem Essen das Klima schützen können?«. Viele Stimmen singen heute im Kanon der Klimaleugner, diesen Chor wollen wir hier nicht verstärken. Genauso viele oder sogar noch viel mehr stimmen aber auch in den Kanon der unterschiedlichen Endzeit-Hymnen ein, die kaum einen anderen Schluss zulassen, als dass es nun endgültig vorbei ist. Jeder wirft dabei mal diese Zahl und mal jene Zahl zur Begründung in den Raum, warum wir dieses oder jenes Lebensmittel nicht mehr essen dürfen. Viele Menschen sind verunsichert, was denn nun richtig ist, und verfallen wahlweise in das eine oder das andere Extrem: die Klimaasketen oder die Lebenslust-Fraktion, von denen Letztere angibt, nur auf ihren Körper zu hören, denn was schon Tausende von Jahren funktioniert hat, kann jetzt nicht plötzlich falsch sein. Oftmals lässt sich der eine oder andere schlicht verleiten, weil ein bekannter Autor, Experte, Aktivist oder Politiker mit starker Medienpräsenz in Talkshows, Büchern, Filmen, Büchern oder im Internet einfach oft und laut genug simple Botschaften verkündet. Die klingen dann so pragmatisch und effektiv, dass es schon fast Selbstaufgabe wäre, wenn man sich jetzt nicht sofort voll Tatendrang dem einen oder anderen Lager anschlösse. Diesen Verzerrungen in der Debatte werden wir uns in diesem Buch immer wieder ausführlich widmen.
Viele dieser Stimmen werden uns im Verlauf des Buches noch begegnen, doch nur, damit wir uns hier mit dem vollen Spektrum aller Perspektiven beschäftigen. Denn das Ziel dieses Buches ist es, dass Sie, liebe Leserin und lieber Leser, wissen, was Sie hier in Deutschland und mit großer Wahrscheinlichkeit auch in den anderen westeuropäischen Ländern essen können, um täglich das Klima zu schützen. Dabei sollen Sie vital und gesund bleiben, genussvoll essen und nicht den Spaß am Leben verlieren, nur weil Ihnen jemand vorgaukelt, ab jetzt müssten Sie mit Kichererbsenbrei und Hafer-Drinks zur Weltrettung beitragen.
Nichts gegen Kichererbsen, Hafer-Drinks und auch sonstige Produktinnovationen, die in den letzten Jahren vermehrt im Supermarktregal stehen; ich nutze die Vielfalt auch selbst sehr gerne. Aber wir werden uns auch hier anschauen, was sie Ihnen wirklich bringen können. Schließlich sind Lebensmittel nicht ursächlich in unser Leben gekommen, um das Klima zu schützen, sondern sie sind Mittel zum Leben. Dabei kommt es auf ihren Nährstoffgehalt an und darauf, in welchem Maß ihre Produktion unsere Ressourcen verbraucht und als Kreislaufwirtschaft selbst wieder zu einer Ressource wird. Beides muss gewährleistet sein, damit nicht nur ein »Überleben« möglich ist, sondern auch ein »Leben«. Bevor wir uns eine herrliche Mahlzeit einverleiben können, müssen auch Böden, Wasser, Dünger sowie Arbeitskraft aufgebracht werden, die nun einmal allesamt auch nur begrenzt verfügbar sind. Durch technische Innovationen werden sie heute effizienter genutzt als jemals zuvor. Es geht also darum, eine möglichst ganzheitliche Betrachtung zu vollziehen, damit wir auch eine optimale Entscheidung treffen können. Hier vor Ort und jetzt. Gehen Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch die Welt auf unserem Teller, und blicken Sie zukünftig über den Tellerrand hinaus. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen, denn Sie müssen keinesfalls in veganer Askese leben!
1. Teil: Wie wir lebten
Beginnen wir mit unserer Entdeckungsreise dort, wo alles Übel seinen Ursprung genommen haben soll. Der bekannte Historiker und Bestseller-Autor Yuval Harari postuliert in seinem Buch »Sapiens«, dass die Erfindung der Landwirtschaft »history’s biggest fraud« war oder auf Deutsch: »der größte Schwindel in der Geschichte der Menschheit«. Wer das Buch liest, darf sich zahlreiche historische Erzählungen zu Gemüte führen, die schildern, warum letztlich erst die Landwirtschaft dazu geführt hat, dass wir vor den heutigen Problemen eines übervölkerten Planeten stehen. Diese Probleme sind so ziemlich alles, was uns in den heutigen Debatten über Ernährung, Nachhaltigkeit und Gesellschaft begegnet, und die nun nach Ansicht Hararis eine Lösung erfahren könnten, indem wir nach und nach, aber in einem stetigen Prozess, auf tierische Lebensmittel verzichten. Wer sich ein bisschen mit Hararis Hintergrund beschäftigt, weiß, dass er Veganer ist. Er vertritt die Auffassung, dass die Nutztierwirtschaft das größte Verbrechen der Geschichte ist und wir uns in ferner Zukunft als Menschheit selber einer noch höheren Klasse von Lebewesen gegenüber in einer ähnlichen Situation befinden könnten. Wir könnten in enge Stallungen eingepfercht und dann gemästet zur Schlachtbank geführt werden. Eine klassische Dystopie, wie sie auch von unterschiedlichen veganen Wortführern verbreitet wird, weniger von der veganen Genuss-Fraktion, die es auch gibt. Ein Szenario des Grauens.
Das ist absolut chic – wer heute keine Dystopie zeichnet, bekommt keine Aufmerksamkeit, wer keine Aufmerksamkeit bekommt, verkauft keine Bücher, sammelt keine Mitglieder, hat keine Follower, erfährt keine Selbstbestätigung. Ich werde hier keine Dystopie zeichnen, auch keine Utopie oder was es sonst noch an -pien gibt. Ich werde Ihnen einen Abklatsch des gegenwärtigen Standes des Wissens liefern, der sich, davon können Sie ausgehen, in den nächsten 30 bis 40 Jahren in kleinen oder großen Schritten erweitern wird. Er wird aber nicht grundlegend die Lage der Welt verändern, so wie es auch schon die Prophezeiungen von Paul Ehrlich, des Club of Rome oder von Bill McKibben, dem US-Umweltaktivisten Nr. 1, in den 70er, 80er und 90er Jahren nicht konnten. Im Großen und Ganzen ist die Welt seither nicht aus den Angeln gehoben worden, auch wenn sich durchaus spürbare Veränderungen ergeben haben. Und wir wissen auch noch nicht, was auf uns zukommen wird. Doch auch die genannten Propheten hatten schon damals nicht etwa unsere Lebensmittel oder tierische Lebensmittel im Speziellen als alleiniges Übel für die gegenwärtig besorgniserregende Lage unseres Planeten ausgemacht, sondern die Überbevölkerung der Welt. Die Konsequenzen gilt es zu benennen und in den gesamten Kontext zu setzen, um ihre Gewichtigkeit einordnen zu können. Eine Zahl, absolut oder in Prozent, sagt gar nichts außer diese Zahl. Wir müssen wissen: Wie groß oder klein war diese Zahl vor einem Jahr oder vor zehn Jahren? Oder sogar vor Tausenden oder Millionen Jahren. Nur so können wir in etwa das bewerten, was wir heute als Realität bezeichnen. Denn die Realität unterliegt ständigen Veränderungen. Und übrigens, auch die Realität von Yuval Harari sieht etwas anders aus, als es sein veganer Lebensstil es erahnen lässt: Er gibt freimütig zu, dass er nicht so ganz zu 100 Prozent vegan lebt, denn auf die Butter im Kuchen seiner Mutter will er einfach nicht verzichten.
Da haben wir es also wieder, das Butter-Paradoxon. Butter ist nämlich nicht nur der angebliche Klimakiller Nr. 1, sondern aus mancher Sichtweise auch der Gesundheitskiller Nr. 1. Sie ist ein Symbol der industriellen Landwirtschaft und der Wohlstandsgesellschaft, fällt sie doch auch oft als sogenanntes Koppelprodukt von fettreduzierten Molkereiprodukten an. Fettreduzierte Produkte kannten unsere Urahnen wohl noch nicht, sie nahmen das Milchfett in seiner Urform auf. Je weiter sich die Welt differenziert, auch unsere Produktwelt, desto weniger werden Rohstoffströme und Auswirkungen auf die Umwelt nachvollziehbar. Wer sich heute mit fettarmen Milchprodukten vermeintlich gesünder ernähren möchte, fördert also unbewusst die Anhäufung von Milchfett, das in Butter enden wird. Schon hier wird klar: Die Lage ist vielschichtiger, als es ein zweifelhafter Titel wie »Klimakiller Nr. 1« vermitteln kann. Das ist nichts weiter als Klimapopulismus, der genauso destruktiv ist wie Populismus-Sprech in allen anderen Lebensbereichen. Das Butter-Paradoxon und andere dieser Art werden uns noch häufiger begegnen, aber es zeigt uns schon hier, was wir immer im Hinterkopf behalten sollten: Nichts ist so, wie es auf den ersten Blick scheint! Selbst bei einem Veganer nicht …
Die Natur des Klimas
»quae omnia pendent« – alles hängt mit allem zusammen, das wussten schon die alten Römer. Was sich im gigantischen Römischen Reich abspielte, bedurfte vermutlich bereits einer sehr guten und sehr genauen Erfassung sämtlicher Vorgänge, die in diesem riesigen Gebiet zeitgleich abliefen. Ohne Internet, ohne Computer und ohne Telefon. Wie haben die das geschafft, die Römer? Sie haben Straßen gebaut. Das klingt etwas simpel, und das ist es auch, wenn die Straßen erst mal fertig gebaut sind. Jeder kann sich vorstellen, dass es schon zur Römerzeit eine echte Herausforderung war, weitere Strecken durch die teilweise wilde Landschaft zurückzulegen. Der Mensch ist ein Faulheitstier, und so erfreuten sich die römischen Straßen schnell großer Beliebtheit. Später wurde es sogar Pflicht, die römischen Straßen zu nutzen, und zwar aus einem Grund: So wie die Landstraßen den Warenhandel jenseits der Wasserstraßen beflügelten, waren sie auch eine ideale Kontrollmöglichkeit, um den Handel zu kontrollieren und Steuern einzutreiben. Letztlich ließ sich so die anwachsende Bevölkerung im expandierenden Reich auch besser erfassen. Die Steuereintreiber des römischen Reiches sammelten die Sesterzen in den Provinzen des Reiches ein und berichteten an die Provinz-Statthalter, die wiederum Rom unterstanden. Dort forderte die Machtelite den Tribut von ihren Statthaltern ein und behielten so auch einen Überblick über die Entwicklung des Reiches, konnten strategisch die besten Entscheidungen treffen.
Über das Klima hatte sich damals noch nicht wirklich jemand Gedanken gemacht, aber was wir von den Römern lernen können, ist, dass eine gute Datenerfassung erst verlässliche Entscheidungen ermöglicht. Bekanntlich scheiterte das römische Imperium am Ende auch an politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen im Zentrum der Macht. Aber wir haben heute eine deutlich bessere Ausgangssituation, um diesem Schicksal zu entgehen. Vor Intrigen und Tragödien sind wir nicht besser gefeit, doch hat sich die Struktur der Vernetzung deutlich verdichtet. Was früher Rom war, sind heute globale Institutionen wie die Weltbank und die Vereinten Nationen, zu der auch die Welternährungsorganisation FAO (Food and Agriculture Organization) gehört, und natürlich auch der Weltklimarat IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Die meisten Länder und Nationen der Erde sind mit diesen Institutionen verbunden und berichten regelmäßig über ihre wirtschaftlichen Entwicklungen oder ihren Ausstoß an Treibhausgasen. Man hat auch hier erkannt, dass alles mit allem zusammenhängt. Handel macht nicht an Ländergrenzen halt, genauso wenig wie Treibhausgase. Die Biologie generell nicht, wie uns die weltweite Corona-Pandemie gelehrt hat. Globale Probleme lassen sich nur durch globale Netzwerke und Zusammenarbeit lösen. Die Umsetzung muss aber regional an die jeweiligen Umstände angepasst erfolgen. Die Frage ist also, was können wir in Deutschland tun? Können wir noch mit gutem Gewissen einen Teller Spagetti Bolognese oder ein Steak essen?
Ressourcen werden in dem einen Land verbraucht, um Waren zu produzieren, die in einem anderen Land konsumiert werden. Menschen reisen oder wohnen hier wie dort und nehmen an einem globalen Wirtschafts- und Rohstoffkreislauf teil. Da ist es schwer für den Einzelnen, den Überblick zu behalten, selbst dann, wenn wie auf den Straßen Roms eine Vielzahl von Daten, Zahlen und Messwerten erfasst werden, die ein einziges großes Bild erschaffen. Der berühmte Nationalökonom Adam Smith hat daher den Begriff der »unsichtbaren Hand« geprägt, weil er davon ausging, dass, wenn jeder Mensch oder Unternehmer für sich nur das Beste im Sinn hat, dann am Ende für alle das Bestmögliche herausspringt. Diese Theorie und die, dass jeder Teilnehmer auch in einem grenzüberschreitenden Wirtschaftssystem – frei nach dem Ökonomen David Ricardo – daraus einen Vorteil ziehen kann, wird von Teilen der Gerechtigkeits-Debatte inzwischen gehörig angezweifelt, allen voran vom Club of Rome. Die Natur des Klimas ist ein noch um Lichtjahre komplexeres Gebilde als unser Wirtschaftssystem, das sich nicht nur anhand von Treibhausgasen beschreiben lässt, sondern vielfältigen Rückkopplungsschleifen unterliegt, sogenannten »Rebound-Effekten«, die natürlicherweise existieren und dazu auch noch durch die menschengemachten Aktivitäten verstärkt oder abgeschwächt werden können. Es darf also davon ausgegangen werden, dass nicht nur bei der Wirtschaftsgerechtigkeit ein Umdenken stattfinden muss, sondern auch bei der Klimagerechtigkeit, wenn wir die Konsequenzen unseres Tuns noch einigermaßen unter Kontrolle haben wollen.
Der Einfluss des Menschen
Alle Wege führen ja bekanntlich nach Rom. Wie der Historiker Kyle Harper von der Universität Oklahoma es in einem Interview mit der ZEIT schildert, war der Untergang Roms nicht nur auf politische und wirtschaftliche Verwerfungen zurückzuführen. Genauso gut könnte man aber umgekehrt sagen, die zivilisatorische Hoch-Zeit Roms war ebenfalls nicht allein auf politischen und wirtschaftlichen Erfolgen gegründet. Nein, beides hing stark mit den natürlichen Veränderungen des Ökosystems zusammen. Bereits vor fast 2000 Jahren waren Teile Südeuropas bestens geeignet, um hohe landwirtschaftliche Erträge zu erzielen. Es war relativ warm, und es gab ausreichend Niederschlag sowie fruchtbare Böden. Das römische Reich entwickelte sich prächtig, doch zwischen dem 2. Jahrhundert nach Christus bis etwa zum 7. Jahrhundert veränderten sich die klimatischen Bedingungen schleichend, aber merklich. Die damalige Abkühlung war allerdings nicht auf menschengemachte Treibhausgase zurückzuführen, sondern vermutlich auf Vulkanausbrüche. Gigantische Staubschleier führten dazu, dass die Energie der Sonnenstrahlen so stark absorbiert wurden, dass sich die Temperatur um ein bis zwei Grad abkühlte. Missernten und Hunger waren die Folge, die Zivilisation geriet aus den Fugen. Das Römische Reich war dem Untergang geweiht. Auch heute lassen sich geopolitische Umschwünge, bei aller Komplexität der Ursachenforschung, zum Teil auf die Verknappung von Nahrungsmitteln zurückführen. Für den Syrien-Konflikt und auch den arabischen Frühling in Ägypten sind die Anzeichen kaum zu ignorieren, dass die Verknappung von Getreide indirekt zur Destabilisierung des politisch-gesellschaftlichen Systems beigetragen hat. Die Nahrungssicherheit war und ist schon immer ein wesentlicher Faktor für gesellschaftliches Fortkommen und Stabilität gewesen. Wir werden deshalb auch immer diesen Aspekt im Auge behalten, wenn es im zweiten Teil des Buches um die konkreten Auswirkungen von Lebensmitteln auf uns und unsere Umwelt geht. Essen muss der Mensch nun einmal als Erstes, dann kommen die anderen Bedürfnisse an die Reihe.
Was wir im 21. Jahrhundert erleben, ist allerdings kein Vergleich zu früheren Zeiten. Dies gilt direkt in zweierlei Hinsicht, denn zum einen ist seit der Kleinen Eiszeit von 1303 bis 1860 eine Zunahme der Temperatur zu verzeichnen, das Ökosystem lieferte also sogar noch bessere Bedingungen für die Lebensmittelproduktion und damit für ein erneutes Wachstum der Bevölkerung. Zum anderen gelang es, insbesondere mit Beginn der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, durch neuartige Technologien in fast sämtlichen Wissensbereichen, weitere Überlebensvorteile zu sichern. Es ist also nicht übertrieben zu sagen, dass eine erwartbare Bevölkerungszahl von weltweit rund 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050 der vorläufige Endpunkt einer Entwicklung ist, wie es sie auf Erden noch nie gegeben hat. Selbst wenn die Prognose nicht zuträfe – wir sind im Jahr 2020 mit einer Erdbevölkerung von über 7,5 Milliarden Menschen in dieser Hinsicht schon sehr weit gekommen. Was das für das Ernährungssystem bedeutet, weiß eigentlich jeder. Oder glaubt es zu wissen; dazu kommen wir im nächsten Kapitel. Doch die schiere Masse an Menschen bedeutet bereits, dass im Vergleich zu den 300 bis 400 Millionen Menschen im Jahr 0 ein immenser Ressourcenverbrauch über Jahrhunderte hinweg stattgefunden hat. Schon um 1900 waren mit 1,6 Milliarden Menschen fünfmal so viele Mäuler zu stopfen, heute sind es 25-mal so viele. Und wenn es 2050 dann 33-mal mehr sein werden, dann wird klar, dass schon vor 2000 Jahren kein weiteres Wachstum möglich gewesen wäre, wenn es der Menschheit nicht gelungen wäre, sich auch die Natur zunutze zu machen. Die Regenerationsfähigkeit biologischer Systeme geht weit über die Grenzen des menschlich Vorstellbaren hinaus. Die Entdeckung von Zuchtmethoden, Genetik, Agrochemie und Biotechnologie haben unser enormes Bevölkerungswachstum erst möglich gemacht, ob wir wollen oder nicht. Weltuntergangsszenarien sind deshalb immer fehl am Platze, denn die Natur wird am Ende immer ein neues Gleichgewicht finden – das tut sie bereits seit Milliarden Jahren mit oder ohne Menschen. Und das wird sie auch weiterhin tun, mit oder ohne Menschen. Schließlich machen wir Menschen gerade einmal 0,01 Prozent der gesamten Biomasse auf Erden aus, Nesseltiere gibt es schon doppelt so viel und Ringelwürmer viermal so viele. Bakterien und Pflanzen machen hingegen 95 Prozent der gesamten Biomasse aus, während es genauso viele Nutztiere wie Nesseltiere gibt. Die Welt wird also auch ohne Menschen weiter existieren.
Wahrscheinlicher ist es aber, dass dies mit Menschen geschehen wird. Die Frage ist nur, mit wie vielen Menschen? Auch wenn uns die endlichen Ressourcen der fossilen Energieträger immer wieder vor Augen geführt werden, so bleibt ein Grundsatz erhalten: Lebensmittel sind der wichtigste Reproduktionsfaktor der Menschheit. Sämtliche technologischen Errungenschaften haben in erster Linie dazu beigetragen, mehr Lebensmittel in kürzerer Zeit und mit weniger menschlicher Arbeitskraft zu produzieren, was wiederum zu einer Steigerung der menschlichen Vermehrungsrate geführt hat. James C. Scott, Koordinator des Programms für Agrarstudien an der Yale Universität in New Haven, Connecticut, beschreibt in seinem Buch »Die Mühlen der Zivilisation: Eine Tiefengeschichte der frühesten Staaten« treffend, dass die Geburtsstunden der großen frühen Zivilisationen in China, Griechenland, im Römischen Reich bis hin zu den Maya allesamt eines gemein hatten: Am Anfang stand eine zuverlässige und in ausreichender Menge verfügbare Nahrungsquelle, und das war zu jenen Zeiten Getreide. Und auch zu unseren Zeiten ist das Korn immer noch ein Grundnahrungsmittel, dessen Verknappung ganze Länder und Regionen in eine Krise stürzen kann, ganz egal, ob Weizen, Reis, Roggen oder Gerste. Selbst wenn das in Zeiten von glutenfreien Lebensmitteln, Low Carb und anderen getreidefeindlichen Ernährungstrends schnell in Vergessenheit gerät, werden Getreide und viele andere Lebensmittel, die auf den Verbotslisten von Ernährungs-Gurus, Veganern und Klimaaktivisten (oft auch allesamt gemeinsam in einer Person vertreten) stehen und auf die wir noch zu sprechen kommen, nicht umsonst als »Grundnahrungsmittel« bezeichnet. Dass diese Lebensmittel wie auch alle anderen Konsumgüter erst einmal erzeugt und hergestellt werden müssen, erklärt sich zwar von selbst, doch trotz dieser Tatsache gibt es die abstrusesten Klimaschutz-Vorschläge, wenn es um die Minderung des persönlichen Klimafußabdrucks geht. Fast scheint es so, als könnten manche Menschen nur von Luft und Wasser leben, wenn es sein muss.
Ratschläge wie die des Bestsellerautors Jonathan Safran Foer, man solle bis zum Abend auf tierische Lebensmittel verzichten, um jeden Tag das Klima zu retten, sind derart alltagsbezogen und einprägsam, dass der Drogerieketten-Gründer Dirk Rossmann sich bewogen sah, das Buch »Wir sind das Klima!« an sämtliche Bundestagsabgeordneten und DAX-Vorstände in Deutschland zu senden und darüber hinaus 25 000 Exemplare gratis über die Websites seines Unternehmens an interessierte Kunden abzugeben. Das Buch stieg in der Folge auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Allein dieses Beispiel zeigt, wie populäre Ratschläge zur Reduktion des Klima-Fußabdrucks medial aufgegriffen und multipliziert werden können. Das trifft sicher auch auf alternative Mobilitätskonzepte oder Energiesparen im Privathaushalt zu, aber die öffentliche Debatte wird allzu oft auf den Faktor Ernährung gelenkt, anstatt den von Klimawissenschaftlern primär gesehenen deutlich größeren Hebel der Primärenergieerzeugung in Bewegung zu setzen, was sich auch sofort auf sämtliche Wirtschafts- und Konsumsektoren auswirken würde. Und noch etwas verfälscht die Debatte: Zahlen werden wahllos von unterschiedlichen Akteuren in Büchern, Ratgebern, Talkshows, Zeitungsbeiträgen und YouTube-Videos in den Raum geworfen, immer dann, wenn sie gerade der eigenen Botschaft nutzen. Auch hier gewinnt oft das Prinzip »Darf’s ein bisschen mehr sein?«, wenn es darum geht, speziell tierische Grundnahrungsmittel in Verruf zu bringen. Dabei kommt es ganz entscheidend darauf an, ob ein Liter Milch in Europa, Südamerika oder der Subsahara-Region erzeugt und verarbeitet wird. Aber wer kann schon zwischen weltweiten Durchschnittswerten unterscheiden, die natürlicherweise größeren Schwankungen unterliegen als eine Schiffsschaukel auf dem Jahrmarkt, und regionalen Daten, die tatsächlich relevant sind, wenn es um unsere eigene Essensentscheidung vor Ort geht?
Schauen wir uns also einmal kurz an, welchen Einfluss der Mensch aufs Klima hat, weltweit und hier in Deutschland. Doch da ist schon das erste Problem, es geht wieder um die Zahlen, die kursieren. Sicher, es gibt eine relativ zuverlässige Quelle für den aktuellen Ausstoß von Treibhausgasen, den Weltklimarat. Doch ich möchte Ihnen hier eine etwas weitere Sicht bieten als den Zeitraum der letzten 30 Jahre, denn der Weltklimarat wurde ja erst Ende der 1980er Jahre gegründet. Auch die in Frankreich 2010 gegründete Denkfabrik »The Shift Project« erstellt mit ihrem Geschäftsführer Matthieu Auzanneau sehr interessante Analysen zum Klimawandel und erarbeitet Lösungsansätze, auf die wir noch zu sprechen kommen. Die Denkfabrik ist gemeinnützig organisiert und macht ihre Sponsoren auf ihrer Homepage publik. Es sind viele Versicherer und Energieanbieter dabei. Wer jetzt eine Verschwörung wittert, möge beruhigt sein, das Ziel von »The Shift Project« ist es, den Übergang von fossiler Energie zu erneuerbarer Energie zu bewerkstelligen, und es gilt eher als »grüner« Think Tank. Also an die Arbeit – was hat die Denkfabrik uns anzubieten?
Zum Beispiel eine sehr schöne Zeitreihe der Emissionen sämtlicher Wirtschaftssektoren von 1851 bis 2016 auf Basis seriöser Quellen wie dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der FAO, dem World Resources Institute (WRI) und der Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR). Allesamt Namen, die das Herz von Klimawissenschaftlern und Klimaaktivisten höherschlagen lassen, während manch ein Klimaskeptiker in Schnappatmung verfallen kann. Damit lässt sich arbeiten: Die Landwirtschaft hatte zu Beginn dieses Zeitraums sage und schreibe einen Anteil von 58 Prozent an den weltweiten Treibhausgasen, die von Menschen gemacht waren. Der Energiesektor schlug mit 29 Prozent zu Buche, gefolgt von Abfallentsorgung (vor allem die viel praktizierte Müllverbrennung) mit 10 Prozent sowie Industrie und Baugewerbe mit rund 3 Prozent. Andere Sektoren waren noch weniger prägend, vor allem der Verkehrssektor entwickelte sich erst mit der Erfindung des Automobils als klimarelevanter Faktor. Nun springen wir ins Jahr 2016, also Science-Fiction für alle, die im Jahr 1851 noch mit Kutsche und Kerze unterwegs waren. Nun haben sich die Verhältnisse umgekehrt, der Energiesektor macht 75 Prozent aller weltweiten Treibhausgase aus, die Landwirtschaft folgt mit 12 Prozent (was übrigens exakt der Zahl des Weltklimarates entspricht). Industrie- und Baugewerbe haben sich auf 9 Prozent verdreifacht, die Abfallentsorgung ist dagegen ökologischer geworden, sie liegt nur noch bei rund 4 Prozent. Alle anderen Wirtschaftssektoren machen weniger als ein Prozent aus. Halten wir fest: Der Anteil der Landwirtschaft an den weltweiten Emissionen ist trotz eines beispiellosen Bevölkerungswachstums und Anstiegs des Nahrungsmittelbedarfs in den letzten 160 Jahren um 80 Prozent gesunken. Mehr Lebensmittel für mehr Menschen haben also anteilig zu weniger Treibhausgasen geführt. Mehr Energie für mehr Menschen verursacht dagegen anteilig mehr Treibhausgase.
Abb. 1.1 Die Verteilung der weltweiten Treibhausgasemissionen im Vergleich zwischen 1851 und 2016 (Datenquelle: The Shift Project).
Gehen wir nach Deutschland. Deutschland hatte schon immer geschäftige Bauern. 1851 lag deshalb der Anteil der Landwirtschaft an den Treibhausgasen auch bereits bei 27 Prozent. Aber auch der Energiebedarf wuchs mit der aufkommenden Industrialisierung, vor allem dem Betreiben von Dampfmaschinen, und machte schon einen Anteil von 55 Prozent aus. Die Abfallentsorgung lag bei 17 Prozent. Das gute alte Feuer hinter dem Haus lässt grüßen und ist heute zum Glück verboten. Industrie- und Baugewerbe machten ein Prozent aus. Bis 2016 stieg der Energiesektor auf 84 Prozent an. Die Landwirtschaft reduzierte die Treibhausgase anteilig auf 7 Prozent (übrigens auch exakt die Zahl, die das Umweltbundesamt nach den Richtlinien des Weltklimarates ermittelt). Ebenso ging der Anteil der Abfallentsorgung stark zurück und macht nur noch ein Prozent der Treibhausgase aus. Industrie- und Baugewerbe haben dagegen einen Anstieg auf anteilig 8 Prozent erfahren, eine Verachtfachung! Dennoch, auch hier bleibt zusammenfassend für die Landwirtschaft festzuhalten: Der Beitrag zu den deutschen Treibhausgasen hat relativ um 75 Prozent abgenommen. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gibt an, dass sich die Anzahl der Menschen, die in Deutschland durch einen Landwirt ernährt werden, seit 1960 bis heute von 17 auf 140 verachtfacht hat. Aus meiner Sicht ist das keine schlechte Nachricht, wenn dabei auch noch die Treibhausgase anteilig gesunken sind, oder?
Abb. 1.2 Die Verteilung der deutschen Treibhausgasemissionen im Vergleich zwischen 1851 und 2016 (Datenquelle: The Shift Project).
Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Jetzt müssen wir uns natürlich vor Augen führen, dass die Herausforderungen des Klimawandels ja real sind und es nichts hilft, nur mit Prozentzahlen um sich zu werfen, um der Landwirtschaft ein vorbildliches Verhalten zu attestieren. Der gesamte Treibhausgaskuchen ist seit 1850 bis heute enorm gewachsen. In Deutschland von 48 Millionen Tonnen Treibhausgasen auf 918 Millionen Tonnen 2016. Das ist eine Steigerung um das 19-fache, wobei wir unseren Treibhausgasausstoß im Jahr 1979 schon einmal auf 1400 Millionen Tonnen hochgefahren hatten. Einen extremen Abfall gab es eigentlich nur nach der Wirtschaftskrise 1929 oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Insgesamt befinden wir uns also in Deutschland seit 1979 auf einem vergleichsweise guten Weg, wenn man das mal so sagen darf, die Treibhausgase zu reduzieren. Weltweit sieht das ein bisschen anders aus. 1850 lag der Ausstoß an Treibhausgasen mit 926 Millionen Tonnen auf fast exakt dem Niveau, das es in Deutschland 2016 gab. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war die Steigerung des Treibhausgasausstoßes noch relativ moderat, doch nach dem Krieg ging es steil bergauf: 2016 lag der weltweite Ausstoß an Treibhausgasen bei 47 200 Millionen Tonnen, der IPCC rechnete in seinem letzten Bericht mit 52 000 Millionen Tonnen. Kleine Einbrüche gab es nur in Zeiten der Ölkrise, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und während der weltweiten Finanzkrise 2008. Die Corona-Pandemie 2020 mit ihren weltweiten wirtschaftlichen Folgen führte mit 17 Prozent weniger Treibhausgasen während der Totalschließung des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft zu dem bislang größten Rückgang. Aber nichts davon konnte den Anstieg auch nur annährend stoppen, nur etwas verzögern. Sobald die Wirtschaft wieder brummt, rauchen die Schornsteine. Auf das ganze Jahr 2020 betrachtet wird der Totalschaden durch einen weltweiten Shut-Down für die Wirtschaft und das persönliche Schicksal von Milliarden Menschen gerade einmal vier Prozent weniger Treibhausgase ausmachen. Wer radikale Einschnitte fordert, kann an diesem Beispiel sehen, wie viel das bringt.
Deutschlands Anteil am weltweiten Kuchen der Treibhausgase liegt bei zwei Prozent. In den TOP-10 der größten Treibhausgasverursacher schaffen wir es damit, je nach Quelle, immerhin auf Platz 7, vor Iran und hinter Brasilien. Allerdings ist China mit 27 Prozent aller Treibhausgase und die USA mit 14 Prozent sowie Indien mit sechs Prozent noch um einige Größenordnungen weiter vorne vertreten. Und auch die Russische Föderation und Japan liegen mit den Plätzen vier und fünf noch vor Deutschland. Aber wie es der Klimawissenschaftler Stephan Rahmstorf in einem seiner Beiträge formuliert hat, sollte niemand aus dem relativ klein erscheinenden zweiprozentigen Anteil Deutschlands am weltweiten Treibhausgaskuchen schließen, dass wir uns aus der Verantwortung stehlen können: »Würde man die gesamte Weltbevölkerung in 50 Gruppen einteilen, von denen jede zwei Prozent der globalen Emissionen verursacht – folgt daraus dann, dass niemand etwas machen muss?«, lautet seine Frage.
Was wir machen können, ist seit Jahren eine heiße Debatte. Was der Beitrag der Ernährung sein könnte, erhitzt dabei die Gemüter vermutlich deutlich stärker als die prognostizierte Erderwärmung um ein bis zwei Grad. Veganer meinen, der komplette Verzicht auf tierische Lebensmittel wäre heute schon das probateste Mittel, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Die Vertreter der Fleisch-, Milch- und Geflügelwirtschaft sehen das natürlicherweise ein wenig anders. Zwischen diesen Standpunkten tut sich allem Anschein nach das weite Tal der Ahnungslosen auf. Oder befindet sich in diesem riesigen Tal womöglich entgegen allen Vermutungen der Stein der Weisen? So etwas wie ein gesundes Mittelmaß, das könnte es doch sein, oder nicht? Um die Fantasie zugunsten einer weniger extremen Position noch etwas anzuregen, wollen wir gemeinsam zum Abschluss dieses Kapitels noch eine kleine Modellrechnung machen.