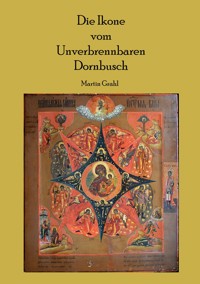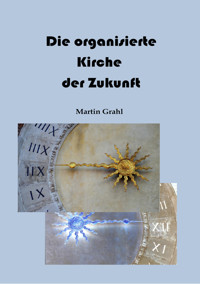
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Kirche sieht sich in einer schwerwiegenden Krise und sucht Lösungen in Anpassung an moderne Kultur. Sie sieht sich unter Erfolgsdruck und versucht, die schwindenden Mitglieder u.a. mit MItteln Digitaler Kultur an sich zu binden. Diese widerspricht jedoch liturgischem Denken, wie sieEugen Rosenstock-Huessy erkannt hat. Zudem zeigt sich ein weiteres Grundproblem: Nach der Trennung von Kirche und Staat haben sich in der Kirche Planungswesen und Bürokratie etabliert. Das widerspricht den Erkenntnissen der Reformation, die einen klaren Trennungsstrich zwischen weltlicher und göttlicher Ordnung gezogen hat. Die Institution Kirche ist nicht gleichbedeutend mit der Kirche gemäß den Bekenntnisschriften, stellt sich aber so in der Öffentlichkeit dar. Allerorten werden Kirchengemeinden zusammengelegt, zentralisiert, zumeist gegen den Willen der Gemeindeglieder. Hauptargument ist der Pfarrer*innenmangel. Im Willen, der Kirche eine Zukunft zu retten, zerstört sie systematisch ihre eigene Grundlage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die organisierte Kirche der Zukunft
Martin Grahl
FEHMARN WEST 2023
© 2023 Dr. Martin Grahl
ISBN Softcover: 978-3-347-92858-9
ISBN E-Book: 978-3-347-92859-6
Druck und Distribution im Auftrag :
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag , zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorweg
Kirche 20.3
Kirche in den Fängen der Kybernetik
Googles Grundsätze
Gott twittert nicht
Gott ist nicht von dieser digitalen Welt
Ordnende Mächte
Recht und Kirche
Kirche als geistliches Kompetenzzentrum
Arbeitsteilung in der Kirche
Kirche und Kultur
Digitalisierte Kirche
Suchmaschine und Internetpräsenz
Kurz und übersichtlich
Deregulierung und Freiheit
Lernkultur
Mediale Öffentlichkeit
Drinnen und draußen, Sein und Nichtsein
Schwarmgeist
Demokratie in der Kirche
Die Grenze des Himmels
Gottes Wort als Datensatz
Kirche und Welt
Computervernunft
Wahrheit und Erfolg
Das Mittel der Aufzählung
Erzählkirche
Argumentation
Perzeption
Netzwerk und Repräsentation
Zeit und Raum
Sünde
Kopie und Echtheit
Informationsflut
Gemeinschaft
Sensationelle Kirche
AIDA
Gottesdienst als Parodie
Theaterkirche
Performance
Präsenz
Kirchenschiff und Bühne
Gottesdienst live
Viva vox
Bedeutendes Reden
Gottes Gegenwart nach Plan
Unbeholfenes Beten
Gott spricht
Das Heil im Glück suchen
Eventkirche
Die Verschiebung des Zentrums
Gott und Mensch
Kirche und die Politische Theologie von Carl Schmitt
Die Kirchengemeinden und ihre neue Obrigkeit
Meine Zeit steht in Gottes Händen
Freunde
Im Labyrinth der Paradigmen
Neuevangelisierung und die ungehorsame Gesellschaft
Liturgisches Denken
Verwendete, zitierte und weiterführende Literatur:
Die organisierte Kirche der Zukunft
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorweg
Verwendete, zitierte und weiterführende Literatur:
Die organisierte Kirche der Zukunft
Cover
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Vorweg
Unsere Kirche ist in den Bann der Planerfüllung geraten. Zutiefst verunsichert durch äußerliches Schrumpfen in den Turbulenzen der Gegenwart versucht sie, sich selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Sie hat Angst vor zunehmender Bedeutungslosigkeit und sucht nach Erfolgsrezepten.
Ich möchte mit meinem Buch keines hinzufügen. Aber ich möchte aufmerksam machen auf Gefahren solcher Vorhaben.
Man könnte meinen, solange der Inhalt kirchlichen Handelns stimmt, sei die Form relativ unerheblich. Aber es gibt keinen Inhalt ohne Form. Sagen wir das Evangelium auf andere Art, als es geschrieben steht, beginnen wir, es zu verändern. Darum feiern wir immer noch Gottesdienste und lesen auch Abschnitte daraus, ohne sie alle und Wort für Wort durch Predigt zu kommentieren. Das Evangelium sieht anders aus, stehen seine Verse in einer Dogmatik, erzählt es ein Roman oder Film, oder wird es als Information bei Wikipedia erklärt.
Man könnte den Gottesdienst für eine Art religiöses Theater halten, für inszenierten Glauben. Aber dann ist er letztlich auch nur Theater. Die Digitale Welt verändert unser Denken in rasanter Weise. Sie saugt alles in sich auf, auch unseren Glauben, so dass wir ihn kaum noch wiedererkennen. Das geschieht weithin unmerklich und scheint nicht schlimm zu sein, dasselbe nur halt in zeitgemäßer Form. Doch unser Verstehen wird ein anderes und es ist immer die Frage, wie weit dabei Missverstehen überhand nimmt. Die Kirchengeschichte ist voll von entsprechenden Beispielen.
Wie soll sich Kirche verhalten? Erfolg verspricht, sich auf all dies Neue einzulassen. Wer nicht im Netz präsent ist, ist schon fast tot. Doch das Netz hat seine Gesetze. Medien sind keine neutralen Instrumente. Sie ordnen, bewerten und mischen unsere Realitäten neu. Es ist eine Kritik der medialen, digitalen Vernunft vonnöten, das sehen Kulturkritiker bereits seit Jahren. Nur in der Kirche ist das kaum ein Thema. Wir sind von öffentlicher Zustimmung abhängig. Mitschwimmen ist angesagt.
Hinter den aktuellen „Reformen“ der Kirche verbirgt sich auch ein rechtliches Grundproblem. Papst und Kaiser waren im Mittelalter getrennt und auch wieder nicht getrennt. Sie waren Spannungspole. Man sprach von zweierlei Recht, dem Kanonischen (kirchlichen, göttlichen) und dem der Obrigkeit und Gesellschaft. Die Reformation wagte einen gewaltigen historischen Schnitt: Über Nacht legte sie das Kirchenrecht beiseite, weil sie es als weltlich erkannten. Der Vermischung von Menschenrecht und göttlichem Wort wollte sie ein Ende machen. Luther verbrannte ein entsprechendes Kirchenrechtsbuch nicht nur, weil er selbst unter Bann stand. Die Evangelische Kirche vertraute ihr Ordnungsrecht hinfort Herzögen und Magistraten an. Weltliche Herrschaften in Bistümern gab sie auf. Die neuen Kirchenordnungen, wenn auch von Theologen verfasst, wurden von weltlichen Regierungen erlassen.
So ergab sich eine Allianz, die eine neue Verquickung von Kirche und Welt ergab. Sie wurde durch die Trennung von Kirche und Staat beendet, mit dem Preis, dass sich Kirche als Institution Öffentlichen Rechts nun seit etwa einhundert Jahren neu organisierte. Jetzt verläuft die Trennungslinie von Geistlichem und Weltlichem mitten durch unsere verfasste Kirche. Diese Linie verschwimmt mehr und mehr. Synoden und Kirchenleitungen regieren in der Kirche. Sie beherrschen zwar niemanden, aber sie lenken, leiten und kanalisieren. Sie nutzen nicht nur Gesetzgebungsverfahren, sondern auch alle möglichen Ordnungen des öffentlichen Lebens wie das Internet mit all ihren Implikationen. Und sie stehen in der erneuten Versuchung, sich als Institution für die Kirche Christi zu halten.
Und so kommen die Probleme zueinander: Mit digitalen und medialen Mitteln, die alles auf die ihr eigene Weise „professionell“ neu ordnen, sucht die Kirche Erfolg oder zumindest eine Art Grundsicherung für die nächsten Jahrzehnte. Sie übernimmt Methoden der Wirtschaft, lässt sich von Ratschlägen der Soziologie und anderer Wissenschaften leiten. Sie legt wert auf Demokratie in ihren Strukturen, obgleich auch dies eine Form von Herrschaft ist. Oft sind Sprachregelungen symptomatisch. So spricht man in der Katholischen Kirche von Neuevangelisierung, Pastoralkonzepten und nun auch im Evangelischen von Pastoralem Raum. In diesem Rahmen erst ist die Rede von (bis zu gewissem Grad noch) „eigenständigen“ Kirchengemeinden, die man aber besser „regionalisiert“, d.h. zentralisiert. Gedacht, geordnet und geplant wird von oben her in Mustern moderner Verwaltung.
Die Institution Kirche möchte noch irgendetwas gelten in einer Gesellschaft, die sehr gut ohne sie auszukommen scheint. Der Gottesdienst schließlich verkommt mehr und mehr zu einer möglichst perfekt inszenierten Veranstaltung, wird zum Theater. Der „Inhalt“, die Botschaft der Kirche, das Evangelium, erscheint als etwas, was man aktualisieren möchte, den Menschen nahe bringen will und politisch korrekt verkündet werden soll.
Doch das Evangelium erweist sich als schlecht verdaulich. Worte wie Sünde, Gnade, Segen, Geist und Seele, Heil, Seligkeit oder auch Gott werden zunehmend als exotisch und erklärungsbedürftig angesehen. Der Wunsch nach Erklärung und Verstehen aber zielt darauf ab, sich gebräuchlichen Denkmustern anzuschließen, und so verändern diese Begriffe auch leicht einmal ihren Sinn. Passen sie sich zu sehr ein, werden sie allerdings erst recht bedeutungslos. Sie sagen nur noch aus, was man ohnehin auch anders sagt.
Es geht mir nicht um ein neuerliches Erfolgsrezept. Es geht mir überhaupt nicht um Zahlen und Erfolg. Ich bin ordinierter Pastor und Teil einer Kirchengemeinde. Mir geht es darum, dem Geheimnis des Gottesdienstes nachzuspüren, das sich besser nicht in modernen Denk- und Handlungsmuster auflöse und so verdürbe. Ich vertraue auf Gottes Geist und nicht auf professionelle Ratschläge von Experten der Zukunftsplanung. Darum bewerte man mich vielleicht als konservativ, aber das bin ich ebenso wenig, wie ich in Sachen Kirche mich für progressiv einschätze. Das Geschichtsmuster vom Fortschritt passt nicht zur Heilsgeschichte.
Unmodern lasse ich mich gern nennen. Das sind auch Künstler und Denker, die sich kritisch gegenüber dem Jetzigen verhalten. Kirche sollte in diesem Sinn grundsätzlich unmodern sein, was nicht bedeutet, sich allem Neuen gegenüber zu sträuben hätte.
Ich trauere nicht der Kirche von 1980 nach. Aber es schmerzt mich, wenn Gottesdienste zur Parodie verkommen.
Dies alles muss ich wohl breiter ausführen und begründen. Dies ist Sinn und Zweck meines Buches.
Kirche 20.3
In seltener Einigkeit machen sich evangelische und katholische Kirchen in Deutschland um ihre Zukunft Sorgen. Kirche 2030, wie sollte, muss sie aussehen? Es riecht nach Überlebenskampf. Wozu sind wir noch gut, und wie bekommen wir das große Abbröckeln gestoppt? Wie können wir uns noch eine Weile behaupten? Christus mag ja eigentlich als unser Haupt gelten, aber eben nicht in dieser Welt?
Es ist ein gewaltiges Projekt, die Kirche in Deutschland im 21. Jahrhundert zukunftsfähig zu machen. Doch ist das nicht das Amt des Heiligen Geistes? Und passen diese Begriffe Satz überhaupt zu dem, was Kirche ist: Projekt, Zukunftsfähigkeit?
Es geht bei entsprechenden Plänen und Ideen um die weltliche Seite der Kirche, um ihre Organisation, Struktur. Man muss sich schließlich anpassen, sonst ginge die Zeit über uns hinweg. Die Kirche sei von vorgestern, konservativ und unbeweglich, da müsse sich vieles schnell tun, denn die uns alle und überall betreffenden Veränderungen überschlagen sich. Wer da nicht mithält, verliert.
Oder schüttet man damit das Kind mit dem Bade aus? Oder plant man eine Art Räumungsverkauf, um im zeitgemäßen Design neu zu erscheinen? In dieser Welt erfinde man sich am besten hin und wieder neu.
Vieles wirkt, als trüge man den Leuten das Evangelium hinterdrein mit der Bitte, doch noch im altehrwürdigen Verein der noch Glaubenden wenigstens als passives, aber zahlendes Mitglied zu verbleiben. Die Völker lehren? Soweit will man sich denn doch nicht mehr vorwagen, schon um Blamagen zu vermeiden. Eher hütet man historisches Erbe und gestaltet das Kirchenmuseum als Erfahrungsraum mit vielleicht doch noch am Rande den Menschen von heute Interesse weckenden Impulsen. Die Völker lehren ganz andere Kulturmächte. Da wollen wir als Kirche wenigstens gute Schüler sein.
Als Zukunft der Kirche galt einst die Eschatologie, die Besinnung auf das Ende aller Zeiten. Auch dieses Thema erfahren wir nun weitgehend säkularisiert. Wir fürchten Weltkrieg, Klimakatastrophen, Vergiftung der Meere, Trinkwassermangel oder Überbevölkerung. Oder kommen am Ende doch noch eine weltweite Demokratie und kulturelle Fortschritte zustande, auch wenn wir zunehmend unsicherer werden, worin diese bestehen und wie Demokratie angesichts der Globalisierung überhaupt aussehen könnte.
In den Augen Vieler hat Kirche ausgedient. Sie stellt sich ihnen als eine religiös-kulturelle Stufe der Gesellschaftsentwicklung dar, auf die man eher zurückblickt. Warum gibt es uns noch als Kirche und auf welcher Reise wohin befinden wir uns? Weiß der Fuchs, wir haben zu tun. Zum Beispiel muss man die Kirche retten. Das muss man wohl, wären die Sache mit Gott und die Ideen von Mose, Jesus und Paulus nur Einbildung, wenn auch auf ziemlich hohem Niveau. Und wer im Grunde nichts Neues mehr zu sagen hat, schweige besser.
Als Paulus in Athen den Menschen begegnete, die stets auf Neues aus waren, bot er ihnen nichts dergleichen. Er verwies auf den Unbekannten Gott, und der ist weder neu noch alt. Er ist lebendiges Gegenüber aller Generationen.
Ich mache mir weniger Sorgen um die Zukunft der Kirche, als dass es mich schmerzt, wie sie in unseren Tagen wieder einmal sich aus Angst anpassend in die Irre stolpert und dabei denkt, endlich alles richtig zu machen. Sie holt sich Rat bei allen möglichen klugen Instanzen, aber zu wenig in dem, was uns als Grund gelegt ist, das Evangelium Jesu Christi. Luther hätte so etwas Vertrauen auf Menschenwitz genannt. Zwar wird die Bibel ständig nicht nur von der Kanzel her zitiert, aber das kann man auch, ohne sich ihr zu stellen. Sich der Gemeinde zuzuwenden, kann auch so zu deuten sein, dass man dem Altar und dem lieben Gott den Rücken zuwendet und die Sache lieber selbst in die Hand nimmt. Das war der große Vorwurf, den Luther der Kirche seiner Zeit machte. So ließ Dostojewskij den Großinquisitor sprechen: Gott, du störst unsere Kreise. Lass uns mal machen. Was weiß Jesus schon von unseren Zeiten!
Sicher übertreibe ich im Folgenden wieder und wieder, doch mit Absicht. Eine Hyperbel ist ein rhetorisches Stilmittel, das der Verdeutlichung dient. So schlimm steht es nicht um die Kirche, wie ich befürchte, oder vielleicht doch?
Es kommt darauf an, woraufhin man schaut. Die kritische und gut meinende Homepage www.unsere-kirche-2030.de möchte eine „moderne Kirche“ haben. Wikipedia definiert den Begriff folgendermaßen: „(Die) Moderne bezeichnet historisch einen Umbruch in zahlreichen Lebensbereichen gegenüber der Tradition, bedingt durch Industrielle Revolution, Aufklärung und Säkularisierung. In der Philosophiegeschichte fällt der Beginn der Moderne mit dem Skeptizismus der Vordenker der Aufklärung (Montaigne, Descartes, Spinoza) zusammen. Die Moderne folgt als Teil der Neuzeit auf die Frühe Neuzeit und dauert je nach Definition bis in die Gegenwart an oder endete im zwanzigsten Jahrhundert.“ Wie sähe demnach „moderne Kirche“ aus?
Um es entsprechend einem literarischen Bild zu sagen, frei nach „Siebenkäs“ von Jean Paul: Nicht Christus verkündet den Tod Gottes, sondern eine Wissenschaft, die das Wort Gottes begriffen und einsortiert hat in ihre sich verändernden Gedankenwelten: Christentum, Version 2023. Wie die Rede von der Trinität gefälligst logisch zu sein hat, um von uns akzeptiert zu werden, soll Kirche sich nach den neuesten Erkenntnissen der Sozialwissenschaft richten und auf Wirtschaftsweise hören. Sonst ist sie der Welt am Ende noch eine Torheit!
Meine folgende Kritik nimmt die aktuelle Kirche beim Wort und beobachtet Tendenzen. Das führt bisweilen zu seltsamen Ahnungen und offenbart auch die eine oder andere Verwirrung.
Kirche in den Fängen der Kybernetik
Wer oder was Kirche ist, dafür gibt es eine jahrtausendelange Geschichte, die sich in der Verfassung der deutschen evangelischen Kirchen in einer Spannung ausdrückt: Einerseits ist die Kirche Versammlung der Glaubenden, also Gottesdienst, zum anderen Organisation ihrer Mitglieder. Taufe wird neben der Zugehörigkeit zu einer Institution zur juristischen Bedingung der „Mitgliedschaft“. Das biblische Bild des corpus Christi, des Leibes mit dem Haupt Christus rückt in den Bereich des Unsichtbaren.
Die Trennung von weltlich und geistlich zieht sich quer durch die Kirche. Aus geistlicher Sicht ist Kirchenmitgliedschaft nur äußerlich. Wer sich da allerdings verweigert, dem steht auch kein Recht zu, zum Beispiel vor dem Altar zu heiraten oder „kirchlich“ beerdigt zu werden. Für die weltliche Seite der Kirche mit ihren Gesetzen sind Taufe und die Bereitschaft Kirchensteuer zu entrichten äußere Bedingungen zur juristischen Teilhabe. Wer unter welchen Bedingungen „in der Kirche“ ist, haben wir festgelegt, wird jeweils demokratisch beschlossen und lässt sich algorithmisch auflisten.
Schleiermacher hatte 1811 in seiner „Kurzen Darstellung des theologischen Studiums“ den Begriff der Kirchenleitung geschaffen. Die dort aufgeführten Gedanken wirken auf uns als Entwurf dessen, wie sich evangelische Kirche heute versteht. Zweck des Kirchenregiments ist die Sicherung und Aneignung der „Idee des Christentums“ in einem bestimmten Territorium. Wurzel aller Theologie ist nach Schleiermacher die „philosophische Theologie“, was seine Nähe zu Hegel deutlich werden lässt. Er sprach von einer entsprechenden „Technik“ für dieses Unternehmen und bezeichnete „praktische Theologie“ als Krone des Studiums. Schleiermacher schrieb das Adjektiv „praktisch“ noch klein, denn es gab noch keine entsprechenden Lehrstühle. Die christliche Kirche war ihm etwas „zu Regierendes“, „Produkt der Vergangenheit und als Keim der Zukunft“. Es ging ihm um eine unter anderen „Organisationen eines gemeinsamen Lebens“ in der Entwicklung der Menschheit. Schleiermacher scheute dabei auch das Wort „Hierarchie“ nicht, das für die Reformation tabu war und er mit dem Wort „Kirchengewalt“ synonym verwendete. Konfession und Ritus begründeten ihm eine „Kirchenpartei“. Eine „Denkungsart“ bestimme die Kirche, die „gebildet“ wird. „Das Wesen jeder kirchlichen Verfassung drückt sich aus durch das Verhältnis, in welchem Laien und Klerus gegeneinander stehen.“ Praktische Theologie war Schleiermacher „Seelenleitung“. Es ging ihm um „alle praktisch theologischen Vorschriften“. Schleiermacher präzisierte „Bildung“ der Kirche im Sinne von Leitung. Kirche ist also machbar, ihre Ausgestaltung liegt in unseren Händen. Entscheidend war ihm für ein „Kirchenregiment“ das „Übergewicht des Einzelnen über das Ganze“. Das zielte nicht etwa auf die Mitglieder, sondern auf die eine Kirche Leitenden. Entsprechend habe sich „eine äußere Autorität constituiert“, von der die gesetzgebende Kirchengewalt ausgeht. Ihr wissenschaftlicher Geist spielt dabei eine zentrale Rolle. Schleiermacher griff auch zum Bild von Krankheit und Gesundheit: Das Kranke sei „auszuscheiden“, mit Hilfe der Kirchenzucht. So brachte er diese alte Bußinstitution in neue, für jedermann verständliche Begrifflichkeit, d.h., er veränderte ihren Sinn. Der „religiöse Sinn“ bestimme den Cultus je nach Ort und Gegebenheit, aber bitte in Gleichförmigkeit.
Eine Kirchengemeinde definierte Schleiermacher als „die kleinste religiöse Organisation“. Der Gottesdienst („Cultus“), da er mit der Kunst verwandt ist, richte sich nach einer „religiösen Kunstlehre“. Da es dabei um Sprache geht, könne man dies auf den „Lehrbegriff“ „reduzieren“. „Ohne Seelsorge“ - in diesem Sinn - könne „eine Gemeinde weder bestehen noch sich reproduzieren.“ Man kann nur ahnen, wie entsetzt Martin Luther über solche Formulierungen wäre. Die „Einzelnen“ betrachtete Schleiermacher als „Gegenstand einer besonderen klerikalen Tätigkeit“, die zum Ziel die Identifizierung der Einzelnen mit der Gemeinde hat. Damit hatte Schleiermacher ziemlich exakt das beschrieben, was man heute Identitätsmanagement (IdM) nennt. Wo dieses Verhältnis gestört ist, spricht Schleiermacher von Krankheit.
Natürlich genießen die Schriften Schleiermachers in der Kirche nicht die Autorität der Schriften der Reformationszeit, insbesondere der Bekenntnisschriften, aber es liegt zu Tage, wie einflussreich sie auf Geschichte der evangelischen Kirchen bis heute waren und sind. Sein Begriff der Kirchenleitung ist zur festen juristischen Größe geworden. Eine erste große Rolle hat „Kirchenleitung“ im Dritten Reich gespielt. Es klang besser als „Kirchenregiment“. Das Wort wirkte harmloser und moderner, damals im Sinne der Führungsmentalität, heute demokratisch. In Mecklenburg ließ sich der Bischof offizell als Kirchenführer ansprechen.
Schleiermacher sprach auch von der Statistik der Kirche. Damit war aber noch nicht gemeint, was wir heute mit diesem Begriff verbinden, sondern Staatswissenschaft. Immerhin hat die Kirche als Körperschaft Öffentlichen Rechtes Gesetzgebungsgewalt. Sie wird zwar demokratisch mit Synoden regiert, aber welcher Regierungsgeist weht in ihnen? Den Heiligen Geist dafür zu benennen, wagt wohl kaum jemand, auch wenn Andachten und Gottesdienste zu solchen Meetings gehören. Bestimmend sind vielmehr „praktische“ Erwägungen aller Art, wenn auch im Rahmen und unter der Voraussetzung der alten Bekenntnisse. Es besteht somit die grundsätzliche Gefahr, dass das Wort Gottes - zumal in großer Auslegungsbreite - nur als ein Argument unter anderen bei anstehenden Entscheidungen gilt.
Der Begriff Leitung ist schillernd. Das deutsche Wort „Führung“ ist durch den Kirchenkampf unbrauchbar geworden. „Leitung“ lässt an Kybernetik denken, wie sie Norbert Wiener 1948 begründet hat nach Analogie der Handlungsweise lebender Organismen. Kybernetik gehört zu den Grundlagen digitaler Kultur. Die digitale Welt ist Maschinenwelt nach dem Muster der Organisation. Man muss nicht allzu viel von technischen Einzelheiten wissen, da wir täglich erfahren, welche Macht neue Entwicklungen, Kommunikationsmuster, Signal verstärkendes Feedback oder mediale Werbung haben. Schleiermachers Theorie passt derart gut zu unserer Art, Leben zu gestalten, dass es kein Wunder ist, dass sie sich zur Zeit in deutscher evangelischer Kirche besonderer Beliebtheit erfreut.
Der Steuermann ist nicht der Kapitän, könnte man einwenden. Christus bleibt das Haupt der Kirche, doch in Zeiten der Toleranz und Pluralität lässt man den Einzelnen nach seiner Façon selig werden, wenn auch mit heißen Empfehlungen versehen, sich hier oder da einzuordnen.
Der eigentliche Steuermann, Gubernator ist jedoch nach 1 Kor 12, 28 Christus. Unser Bild vom Leiten und Steuern wird zunehmend von Techniken überdeckt, die dafür angewandt werden. Das Internet, google-maps und Wissenschaften geben sich neutral. Wir wissen aber, dass dies nicht stimmt. Sie erscheinen lediglich medial, vermittelnd zwischen Parteien, haben aber gewaltigen Einfluss auf Verhalten und Entscheidungen. Sie sind Instrumente mit eigener Macht. Sie verwenden die User als Teile technischer Systeme. Wir mutieren zu Momenten in allen möglichen Prozessen, über die der Einzelne keine Macht mehr hat. Wir verwenden Instrumente, werden aber zugleich von ihnen verwendet. Die sogenannte Digitale Kultur oder Welt hat ihre eigenen Gesetze. Das bedeutet, dass es da eine schwer zu greifende Souveränität gibt, die uns regiert. Die Besen der Zauberlehrlinge akzeptieren keinen Meister, wie einzelne Maschinen es noch taten. Sie sind riesig und komplex, kaum zu stoppen. Sie sind „Too big to fail“.
In diesen Zeiten als Kirche einfach mitschwimmen zu wollen, die vielen faszinierenden Möglichkeiten bedenkenlos auf die analoge Plattform Kirche zu übertragen, erscheint nicht nur bodenlos naiv, sondern ist auch theologisch höchst fragwürdig. Die Lösung heißt freilich nicht, umgekehrt naiv zu trotzen und sich auf eine kulturelle Insel zu begeben, wie Mennoniten und Amish People es tun. Geboten ist ein überaus vorsichtiger Umgang mit digitaler Kultur und aktuellen Konzepten gesellschaftlicher Ordnungen. Diese Vorsicht ist mein Buch gewidmet.
Es geht nicht darum, sich aus allem herauszuhalten und ein Leben nach dem Muster der Amishpeople oder Sekten als alternative Lebensform „Kirche“ zu versuchen. Aber das gesellschaftliche Bild vom Menschen verändert sich gerade massiv, und es hat den Anschein, wir stünden da erst an diversen Anfängen. Weil wir entsprechend Gen 1 nach dem Bild Gottes erschaffen wurden, gilt es aufzumerken. Der Mensch definiert sich gerade neu, und zwar fortlaufend.
Lenin schwebte ein Mensch neuen Typus vor mithilfe einer Mischung von seiner Ideologie und Elektrifizierung. Der „Kommunismus“ war kein Ausrutscher der Geschichte, sondern ein erstes, gigantisch angelegtes Projekt, die Geschichte als Ganzes mit Hilfe der Technik in die Hand zu nehmen. Es ist nicht mehr der homo sovieticus, der beginnt sich zu verbreiten, aber wir werden zu etwas Anderem in einer Weise, wie es zuvor nicht bekannt und undenkbar war. Wir erfahren uns selbst verändert und nicht nur etwas um uns herum, wie wir gerne glauben möchten. Science fiction, ausgedachte Welt wäre den Menschen vor nur einem halben Jahrhundert, was wir heute alltäglich leben. Nur dass sich dies niemand am Schreibtisch oder in einem Parteiklub ausgedacht hat. Wir haben alle Mühe, die vielen Prozesse nachzujustieren. Die Sisyphosfelsen rollen immer mal woanders hin und es wird immer schwerer, wenn nicht gar unmöglich, sie wieder hoch zu stemmen.
Googles Grundsätze
Google verlässt sich auf folgende Grundsätze: „Demokratie im Web funktioniert.“ „Das Bedürfnis nach Nachrichten kennt keine Grenzen.“ Und „man kann Geld machen, ohne Böses zu tun.“ Wir wissen, das sind Täuschungen, wenn nicht gar Lügen. Der aktuelle Populismus ist ohne entsprechende Medien kaum denkbar. Nachrichten sind nicht so objektiv, wie sie vorgeben. Menschen, Algorithmen und Muster wählen Nachrichten aus, akzentuieren, werten, ordnen ein. Auch Bedarf nach allem Möglichen, ob nun Dinge oder Informationen, wird gesteuert, in guten oder weniger guten Absichten, oder auch einfach nur nach Automatismen. Es scheint - wie stets bei der Ökonomie - nur so, als ließe sich Geld vermehren, ohne selbst auch Abstriche bei der Moral zu machen, um nicht zu sagen: böse zu sein. Wir haben den Eindruck, wenn alles funktioniere, sei es auch gut. Nutzen hat sich schon immer gern in den Pelz des Guten gehüllt, man lese nur die Geschichte von Jesu Versuchung. Wir können im Netz und auf dem Markt idealerweise stets und überall auf alles zugreifen und so ein Gefühl von Herrschaft oder Sicherheit mitten in Unsicherheit genießen. Unter dem Schirm der Sicherheit einer Zuschauertribüne aus betrachten wir die Welt und sind zugleich mittendrin als Opfer wie als Akteure. Eine smarte und flexible digitale Logistik ermöglicht das für uns: Man kreiert für uns entsprechende Algorithmen, die dann gleich Geistermaschinen reibungslos wie die in ihnen integrierten Uhren vor sich hinsummen. Zudem verschafft uns die neue Welterfahrung das schöne Gefühl, zu den Guten zu gehören, die wissen, wie man es macht. Schließlich bestimmen wir per Wahl, welche Experten wir zu Wort kommen lassen und uns regieren sollen und dürfen. Unsere Perspektive ist gewissermaßen die von Google Earth, von 11.000 km Entfernung hineingezoomt bis hinein in die Biomaschine Mensch mit ihrem Hirncomputer. Wir haben den Traum absoluter Machbarkeit inmitten weitgehender Machtlosigkeit.
Und da ist dann der Gottesdienst: Nach Schleiermacher (in unser Denken 200 Jahre später übertragen) ist er ein mediales Kunstwerk von Spiritualität unter anderen, nur halt mit dem Prägestempel der Ideen des Juden Jesus von Nazareth. So zu denken ist doppelte Ablehnung von Offenbarung, denn die Juden werden so nicht als Gottes Volk angesehen und die Inkarnation wird als Fiktion oder cleverer Mythos gewertet. Gott und Mensch in Christus untrennbar? Das logische und digitale Denken kennt Gott nicht, so oft von ihm darin auch die Rede sein mag. Es hat nur ein Maschinenherz. Bei ihm entsteht Einmaligkeit nur durch Mischung des Vorhandenen und Wiederholbaren, zeitlich Konkretem. Für die pure Logik ist selbst Gott nicht individuell. Für sie wird auch er zur definierten Variablen. Ob Gott tot ist oder dreifaltig, ist nur Gedankenspiel. Abstrakte Rede abstrahiert, entfernt sich von ihrem Grund, braucht ihren Gegenstand nicht mehr. Gott wird wie alles zum Beispiel. Frömmigkeit wird zur Anwendung einer Idee. Da Gott in der Welt nicht zu finden ist, „gibt“ es ihn auch nicht anders als in Gedanken. Das scheint sich gut in die virtuelle Welt einzupassen, aber dann ist es auch nicht mehr als dies. Glaube erscheint als eine der vielen postmodernen Denkmöglichkeiten, die ihre Wahrheit nur in sich selbst suchen.
Es gibt zwar unter uns nicht mehr das Ständedenken, wie Schleiermacher es sah, wo ein Kleriker seine Gemeindeglieder „behandele“, aber Glaubensexperten, die die Öffentlichkeit, bzw. die eingetragenen Mitglieder seines staatlich organisierten Haufens belehren und mit Spezialwissen beglücken. Beruht die Existenz der Kirche nicht auf der Kompetenz ihrer Gelehrten? In der Welt pflegt das bei ähnlichen Vereinen so zu sein. Gruppen begründen sich durch Konsens. Nach dem Studium weiß der Theologe dann, warum Lukas das echte Jesuswort so verdreht hat, wie der historische „Christus“ Jesus es gar nicht gemeint haben kann. Quellenscheidung ist ein wichtiges Thema für aufgeklärte Katechese und erscheint im Religionsunterricht wichtiger als die Auslegung zum Beispiel des Gebotes vom Feiertag, weil letzteres ja durch Sonntagsgesetze einigermaßen abgesichert ist. Religionsunterricht an den Schulen ist schließlich keine Glaubensvermittlung. Aber wo und wann findet diese dann statt? Nur im Blockunterricht der Konfirmationsvorbereitung? Eltern haben solche Aufgaben zumeist outgesourct und an Bildungseinrichtungen abgegeben. In der Perspektive der Organisation Kirche gehört das in das Kapitel der Mitgliederpflege.
Gott twittert nicht
Glauben kann man im Muster von Information verstehen: Es ist eine oder gar die „Gute Nachricht“, die wir in politisch korrekter Weise für unser Wohl nutzen. Nenne es meinetwegen noch in alter Manier Seelenheil, aber wer kann mit den Begriffen Seele und Heil noch etwas anzufangen? Beides Worte müssen erst noch dem modernen Menschen durch Synonyme ersetzt werden. Nur, dass sie dann nicht mehr sind, was sie waren. In den 70ern war die Reihen theologischer Informationen für die Gebildeten in der Kirche wichtig. Erwachsenenkatechismen glichen populärwissenschaftlichen Abendschullehrbüchern für Akademiker. Jetzt beeilt sich Kirche, das alles professionell medial ins Netz zu stellen. Professionell und kompetent bedeutet, alte Inhalte den medialen Anforderungen, also ihren Gesetzen entsprechend anzupassen, sie umzuformen. Twitter ist dann leider doch etwas zu kurz im Format, aber wenn wir zunehmend im Twitterformat denken?
Auch Gottesdienste sollten möglichst mediale Ereignisse sein mit Publikum und Erkenntnissen der Theaterwissenschaft professionell gestaltet. Alles sollte auf Anhieb leicht verständlich sein, auch das, was Wittgenstein für unsagbar und darum nicht für verhandelbar hielt. Man kann die Gebote einzeln twittern, aber was sind sie dann? Geschwätz, Meinung, Blitzidee, Weisheitsspruch? Gott twittert nicht. Er äußert keine Meinung, noch spricht er in Zwischenrufen, auch wenn die äußere Form der Herrenhuter Losung twittergemäß ausschaut. Gott lässt verkündigen, seine Engel singen und die Propheten lauschten. Darum sollte sich auch die Kirche mit Twittern und Ähnlichem zurückhalten.
Mit so etwas entsteht auch schon mal wegen der Forderung nach Verständlichkeit, ohne die es im Netz keine Existenzberechtigung gibt, im kirchlichen Funkverkehr eine Mischung aus Mystizismus an der Kante zur Esoterik und kinderleichten Glaubenswerten, untermauert mit ethischen „christlichen“ Werten, einer wissenschaftlich gefassten Ethik. Eine Botschaft muss in sich logisch, überzeugend und schlagartig richtig erscheinen. Für die Begründung kann man dann auf Experten verweisen, die mit langen Sätzen und Fachlatein eh der Masse unverständlich sind. Erstaunlich freilich ist, dass die Apostel Fischer oder Handwerker waren, jedenfalls keine „Schriftgelehrten“.
Es ist kein Zufall, wenn in dieser durchorganisierten und nach Sicherheit strebenden Zeit die sogenannte „mittlere Ebene“ der Planung und Verwaltung von Kirche das Zentrum der Kirchengestaltung bildet und möglichst viel in „Kompetenzzentren“ entschieden wird, alles nur zum Nutzen und Wohl der Gemeinden, aber in der Regel an ihnen vorbei.
Entscheidend ist, woran man Erfolg misst: an medialer Präsenz und Statistik. Jesus war dahingehend ein Versager. Als er dann doch auffiel, wollten die einen ihn zum Brotkönig machen und die anderen ihn schlicht beseitigten. Selbst seine Jünger suchten das Weite, als ihre Verhaftung drohte. Erfolg sieht anders aus.
In Bezug auf Statistiken hat man vermutlich auch eine der Hauptlehren nach dem Zerfall des „real existierenden Sozialismus“ vergessen: Einer äußerlich geplanten und geregelten Oberfläche entspricht innere Anarchie, weil nur befragt, nicht aber gefragt wird. Die Ordnung der Kirche durch Leitung muss wieder auf die Füße gestellt werden. Man mag Organisationen leiten, mit dem Geist Gottes und seinen Früchten lässt sich so nicht verfahren. Eine Kirchengemeinde kann top in Zahlen und öffentlicher Erscheinung daherkommen. Doch Glaube lässt sich nicht verwalten und bitte auch nicht lenken und leiten. Exerzitienmeister gehören aus gutem Grund nicht zur Tradition der evangelischen Kirche. Aber diesen Anspruch haben unsere Kirchenleitungen auch nicht. Sie glauben in der Regel, mit schwarzen Zahlen, bzw. erfolgreichen Projekten sei es schon getan. Was schlimmer von beidem ist, lässt sich schwer sagen.
Stellen wir dem allen die einfache Definition von Kirche aus dem Augsburgischen Bekenntnis entgegen: Kirche ist Versammlung der Gläubigen.
Gott ist nicht von dieser digitalen Welt
Wir sind hochgradig verunsichert, worin unser Glaube besteht. Und er zerbricht oder verfälscht zwangsläufig, wenn er sich auf Tradition, Mitgliedschaft oder Wissensstand ausruht, aber den Dialog nicht sucht, den Gott mit uns führt. Gott ist überall und zu allen Zeiten erreichbar, aber in gänzlich anderer Weise als ein Ort bei Google Earth. Der Feiertag ist da, um gegenüber den Koordinaten des Alltags für eine ausgesparte Zeit einen ausgesonderten Ort inmitten der Welt aufzusuchen, um sich Gott und seinem Wort auszusetzen und ihm mit Lob und Dank zu antworten.
Am Feiertag funktioniere nichts wie bei der Arbeit. Das liturgische Geschehen entziehe sich aller Machbarkeit, willkürlicher Organisation und der Planung, hier ist Christus das Haupt. Darum hielt man sich beim Gottesdienst über Jahrhunderte so stur an überkommene Texte und Strukturen, weil man sich selbst hörend und lauschend zurückzunehmen gedachte. Die Reformation reinigte darum die zugewucherte Gottesdienstkultur des ausgehenden Mittelalters. Verständlichkeit ist eine gute Forderung, aber nicht als Simplifizierung des Komplexen. Wenn man in früheren Jahrhunderten von Einfältigkeit sprach, hatte das nichts mit dem zu tun, was wir heute so nennen.
Der Geist Gottes ist klar, aber die Gebote sind weder Informationen einer höheren Macht an die Welt noch Gesetze, wie wir sie systematisch gestalten und beschließen. Sie sind Anspruch an einen Menschen mit Namen und nicht Teil dieser berechenbaren Welt. Die Gebote lassen sich auch nicht in ein Wertesystem überführen und auflösen.
Es ist gleichgültig, wie viele Mitglieder die Kirche hat und wie groß ihre Spendenbereitschaft und damit ihr Marktanteil ist. Theologieprofessoren oder Bischöfe sind nicht gläubiger als „Laien“ oder sich auf ihre Bekehrung etwas einbildende Evangelikale, die alles ganz genau wissen, weil es sich in vereinfachenden Schemen ausdrücken lässt. Es gibt keine Hierarchie in der Kirche, auch nicht die des Wissens oder der Glaubensstärke. Die Taufe begründet kein kanonisches Kirchenrecht, sondern die Ordnung der Kirche folge der Taufe. Noch sind unsere Kirchenverfassungen besser als ihre institutionellen Anwendungen, aber wir sind kirchengeschichtlich (mal wieder) nahe am Kippen der Gewichte. Die fantastischen technischen Möglichkeiten der Kybernetik verführen dazu, die Kirche immer perfekter zu organisieren. Wir merken kaum mehr, dass das nicht sachgemäß ist, denn Organisation und Offenbarung Gottes dürfen nicht einmal in Waage zueinander gesetzt werden.
Auch Google behauptet steif und fest seine Neutralität gegenüber Inhalten. Wer Kirche digital verwaltet, unterwirft sie automatischen Algorithmen. Dagegen sind Kirchenverfassungen und -gesetze regelrecht flexibel.
Kirche hat ihren Ursprung im Gottesdienst und gipfelt auch sogleich darin. Um die geschehende Liturgie herum bildet sich beständig neu Kirchengemeinde. Im Unterschied zu den Konstanten Sakrament und Evangelium ist diese höchst veränderlich. Gemeindeerneuerung geschehe nicht durch Programme, Evangelisierungsfeldzüge, Events oder Projekte, sondern aus dem gesprochenen und gesungenen Wort Gottes heraus. Aber muss man das nicht auch organisieren? Ein Organ ist ein Werkzeug. Werkzeuge haben entscheidenden Einfluss auf die Gestalt eines Produktes. Bei einer Organisation übernimmt der Organisierende die Regie und nutzt Inhalte für seine Zwecke. In dieser Tendenz wird folgerichtig aus Gottes Wort geistiges Material in Händen von Menschen und ihren Ansichten: Wir wissen, wie man die Kirche zum Überleben fit macht. Wenn dieser Punkt erreicht ist, die Kirche vor allem Institution geworden und der Gottesdienst zu ihrer Veranstaltung verkommen ist, sind die Engel aus der Kirche ausgezogen.
Schleiermacher hat die „praktische Theologie“ als Krone dieser Wissenschaft genommen und seine philosophische Theologie diente als Grundlage für die „Glaubenslehre“ der Kirche. In Dogmatiken des 18. Jahrhunderts waren Bibelstellen bisweilen mehr Material und Beispiel als Begründung für dogmatische Sätze, die der menschlichen Vernunft zu entsprechen hatten. Abgewandelt für unsere Situation hieße dies: Wir schauen, was an unserem Christentum noch zeitgemäß ist und lassen die Bibel politisch korrekt in unseren Gottesdiensten sprechen, bauen unsere Filter in diese Maschine ein.
Umgekehrt ist es sachgemäß: Aus der Offenbarung des Dreieinigen Gottes heraus lernen wir zu glauben und wagen uns an die Nachfolge Christi. Das hat auch Schleiermacher nicht geleugnet, aber seine philosophischen Erkenntnisse, die Ordnung seiner Gedanken bestimmten grundlegend die Interpretation der Offenbarung. In der Folge erschienen dann etliche in ihrer philosophischen Ausrichtung unterschiedliche „Theologien“ bedeutender Professoren. Ebenso bestimmen unsere „modernen“ Denkweisen unser Verständnis der Offenbarung, und fälschen sie nur zu leicht auch ab. Digitale Kultur lässt uns neu, anders, in jeweils bestimmter, sich ständig verändernder Weise denken, Sachverhalte ordnen. „Künstliche Intelligenz“ beginnt nicht erst mit Robotergleichen Computern.
Wir bewegen uns in unseren Tagen weithin in Fängen einer segensreichen und doch auch mit Fluch beladenen Kybernetik. Wir brauchen sie, wir genießen sie, sie strukturiert unser Arbeiten, wir nutzen sie, um Auswege zu finden, und zugleich werden wir in ihr benutzt, ausgenutzt. Sie sucht uns beständig in diese oder jene Richtung zu locken und zu verführen, nicht unbedingt aus bösem Willen, sondern vor allem, damit in dieser unsichtbaren Maschinerie alles gut läuft. Die Digitale Welt braucht den Trend zum Perfekten, einfach, weil sie eine Maschine ist.
In der Cyberwelt wird gelogen, dass sich die Balken biegen, sie gaukelt uns Grenzenlosigkeit und tausend Möglichkeiten vor, für die niemandes Zeit reicht,… Wahrheit gehört nicht zu ihren Kriterien, wohl aber Rezeption und Wirksamkeit. Wahrheit verwandelt sich in Passgenauigkeit.
Es ist eine große und überaus verständliche Versuchung, mit diesen ambivalenten, schillernden Mitteln auch Glauben und Kirche gestalten und begreifen zu wollen. Aber Gottes Reich ist nicht von dieser Welt. Wahrheit ist hier oberstes Kriterium, und die ist nicht nur sachlich, sondern personal in besonderer Weise. Ich bin die Wahrheit und das Leben, spricht Christus. Wir tun uns schwer, diesen Satz zu verstehen, er passt nicht in unsere Paradigmen, Denkgewohnheiten.