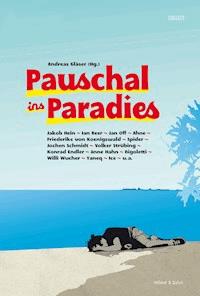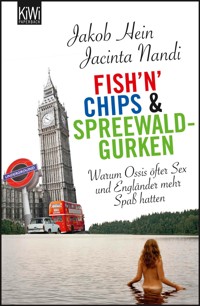9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Orient-Mission des Leutnant Stern - Eine abenteuerliche Reise durch das Europa des Ersten Weltkriegs Mit seinem Roman Die Orient-Mission des Leutnant Stern erzählt Jakob Hein auf fesselnde Weise die wahre Geschichte des jüdischen Leutnants Edgar Stern, der während des Ersten Weltkriegs für Kaiser Wilhelm II. eine geheime Mission durchführen soll: den Dschihad zu organisieren. Dazu schmuggelt er eine als Zirkus getarnte Truppe von 14 muslimischen Kriegsgefangenen von Berlin nach Konstantinopel. Im Sommer 1914 ahnt Edgar Stern noch nichts von dem bevorstehenden Krieg und seiner Rolle darin. Doch schon bald soll er zum Hauptakteur eines abenteurlichen Plans werden, der den Kriegsverlauf entscheidend beeinflussen könnte. Wenn es gelingt, den türkischen Sultan dazu zu bringen, den Dschihad auszurufen und damit alle Muslime zum Aufstand gegen die britischen und französischen Gegner zu bewegen, wäre der deutsche Sieg greifbar nah. Um die Gunst des Sultans zu gewinnen, sollen muslimische Kriegsgefangene in einer feierlichen Zeremonie in Konstantinopel freigelassen werden. Und Edgar Stern ist genau der Richtige, um diese heikle Mission durchzuführen. Mit großer Erzählkunst und einem Hauch von Humor schildert Jakob Hein diese fast unglaubliche, aber wahre Episode aus dem Ersten Weltkrieg. Die Orient-Mission des Leutnant Stern ist ein spannender historischer Roman über eine abenteuerliche Reise, die den Lauf der Geschichte verändern sollte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jakob Hein
Die Orient-Mission des Leutnant Stern
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jakob Hein
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jakob Hein
Jakob Hein, geboren 1971 in Leipzig, lebt seit 1972 mit seiner Familie in Berlin. Er arbeitet als Psychiater. Seit 1998 ist er Mitglied der »Reformbühne Heim und Welt«. Er hat inzwischen 14 Bücher veröffentlicht, bei KiWi u.a. »Wurst und Wahn« (2013) und zuletzt »Kaltes Wasser« (2017).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Der Sommer 1914 begann für den jüdischen Leutnant Edgar Stern im beschaulichen Badeort Coxyde, unweit der französischen Grenze. Niemals hätte er sich vorstellen können, dass in nur wenigen Wochen Krieg ausbrechen könnte, und niemals hätte er sich träumen lassen, dass er in ebenjenem Krieg der Hauptakteur eines kuriosen Plans werden würde, der Deutschland einen schnellen Sieg bringen sollte: Wenn es gelänge, dass der türkische Sultan für das befreundete Deutsche Reich den Dschihad ausruft und sich daraufhin alle Muslime – vor allem die in den Kolonien – gegen die britischen und französischen Gegner erheben, müsste die Schlacht schnell entschieden sein. Um die Gunst des Sultans zu gewinnen, wollte man einige muslimische Kriegsgefangene feierlich in Konstantinopel freilassen. Doch mussten diese Kriegsgefangenen dazu möglichst unauffällig durch halb Europa geschleust werden. Und dazu brauchte man einen wie Edgar Stern.
»Humorvoll, bündig, phantasiereich, ernsthaft — So zeigt sich Jakob Hein in seinem von einer aberwitzigen Vergangenheit erzählendem Buch.« SWR
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2018, 2019, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin
Covermotiv: © Eminön Istanbul Turkey, ca. 1890. Retrieved from the Library of Congress
ISBN978-3-462-31850-0
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Am Strand
Nach Berlin
Aus Megdaz
An der Front
In Marseille
Leipziger Straße
Reserve-Dragoner
Nach Flandern
Der Suez-Plan
Von Tanger
Im Reichskolonialamt
Das Sennelager
Aufstand
Koffer packen
Im Zug
Großer Bahnhof
Allgemeine Electrizität
Brigittenau
Ougadougou
Estrella
Elvetia
Donau
Fliegende Fahnen
Hohe Pforte
Vom Platz
Botschaft
Auf dem General
Unter Deck
Zurück, zurück
Von der Goltz
Halbmondlager
Legationssekretär
Bagdad
Paralipomena
Dank
Stern
Am Strand
Der große Krieg begann für Stern als griechische Vokabel, serviert auf einem Silbertablett in die beschauliche Stille eines Nachmittags in einem abgelegenen belgischen Badeort hinein. Tonie, der Page, hatte ihm das Telegramm seines Vaters in die Bar des Hotels Nynfea gebracht, in dem die Familie immer abstieg, wenn sie an der belgischen Küste Erholung suchte. Stern hatte gerade mit Claus von Below-Saleske im Salon zusammengesessen. Der Generalkonsul wollte gemeinsam mit Stern bei einer Tasse Mokka die Zigarren prüfen, die er sich am Vormittag auf dem Zavelplein gekauft hatte. Die Frauen hatten sich ihrerseits zu Plaudereien zurückgezogen.
In Ostende war das gemeine Volk, und damit so viel Lärm, Dreck und Gestank, dass es gar nicht notwendig gewesen wäre, dafür die Enge der Stadt zu verlassen. Zudem hatte die deutsche Sitte des Strandburgenbaus dort Einzug gehalten, die jedem kulturvollen Menschen die Urlaubslaune verderben musste. Stern fuhr viel lieber hierher nach Coxyde an der französischen Grenze, wo es bei aller Bequemlichkeit und Modernität insgesamt nobler zuging. Hier gab es die besseren Restaurants und seit einigen Jahren sogar ein großzügig gebautes Lichtspielhaus, in dem die neuesten Filme aus aller Welt gezeigt wurden.
Die leichte Patina gehörte zum Charme des Nynfea und die leichte Staubschicht zu den Büchern der kleinen Bibliothek des Salons, dafür waren es von der Terrasse nur ein paar Schritte zum Strand, für die Hotelgäste standen eigene Strandkörbe bereit und, anders als in Ostende, fand man jederzeit eine freie Umkleidekabine. Der Sommer 1914 war bisher ungetrübt gewesen. Die Sonne schien, die Temperaturen waren angenehm, die Möwen standen vergnügt schreiend am Himmel. Stern hatte mit einer auserlesenen Gesellschaft französischer und deutscher Freunde einige sehr erholsame Tage und Nächte verbracht. Ganz abgesehen davon war er das erste Mal mit seiner Verlobten in Coxyde, und da er in ihrer Gegenwart allerorten Glück empfand, fühlte er hier mit ihr Vollkommenheit.
»Die Ostsee«, dozierte Below-Saleske, »bietet angenehmere Bedingungen zum Baden. Aber auch das hiesige Klima ist nicht zu verachten und der Gesundheit äußerst zuträglich.« Da der Familiensitz des Generalkonsuls Saleske war, ein kleiner Ort in Pommern fast direkt an der Ostsee, sah sich der Generalkonsul gewissermaßen in der Pflicht, eine Lanze für seine Heimat zu brechen. Und Stern verdarb ihm diese Pflicht nicht mit dem Einwand, dass es in Pommern keine belgischen Waffeln zum Frühstück gab, keine französischen Austern zum Dîner und keine Zigarren aus den holländischen Überseegebieten. Hier in Coxyde wussten sie sich allesamt glücklich am schönsten Ende der Welt gestrandet, Belgier, Engländer und Holländer, Deutsche und Franzosen.
Später erfuhr Stern, dass es auf dem Frankfurter Telegrafenamt Bedenken gegeben hatte, die ursprüngliche Nachricht des Vaters aufzugeben, zudem hatte man diesem gesagt, dass in der bestehenden Lage nicht mehr davon auszugehen sei, dass die Nachricht vom Amt in Brüssel weitervermittelt werde. Darum hatte sich Sterns Vater einen Trick ausgedacht und gehofft, dass seinem Sohn auch unter dem reformierten, sogenannten Frankfurter Lehrplan am Goethe-Gymnasium genügend Griechisch beigebracht worden war, seine leicht verschlüsselte Botschaft zu verstehen: »Empfehle sofortige Heimkehr – Polemos«. Dass er diese Nachricht als Telegramm aufgegeben hatte, fügte der Nachricht automatisch ein Ausrufezeichen bei.
»Mein lieber Herr Generalkonsul«, sagte Stern, nachdem er das Telegramm zweimal gelesen hatte, »ich fürchte, wir werden unverzüglich abreisen müssen.« Bedauernd legte er die Pintura vorzeitig im Aschenbecher ab, wo sie ausgehen würde, während er seine Koffer packte. Sterns Vater neigte als Besitzer einer großen Textilfabrik mit gut zweihundert Arbeitern nicht zur Übertreibung. Immer wieder ereigneten sich Probleme in der Fabrik, ein kleiner Brand, der ausbrach, ein Lieferant, der falsche oder fehlerhafte Stoffe lieferte, der Ausbruch von Ruhr unter den Arbeiterinnen, der die Produktion für Tage stilllegte. Vater Stern hatte bei solchen Ereignissen niemals Zeichen besonderer Unruhe gezeigt, sondern war immer ruhig zur Tat geschritten. »Schritt für Schritt« war gewissermaßen sein Motto. Dass er nun ein Telegramm verfasste und dies auch noch das griechische Wort für »Krieg« enthielt, ließ bei Stern keinen Zweifel daran aufkommen, dass eiliges Handeln geboten war.
Vor ein paar Wochen war bei ihrem Umstieg im Brüsseler Gare Centrale die Aufregung nach den Schüssen von Sarajevo noch spürbar gewesen. Die Zeitungen überschlugen sich mit den wildesten Gerüchten, die sich wie Epidemien verbreiteten. Aber in der hübschen Bimmelbahn, die sie an der Küste entlang zu ihrem Badeort fuhr, verstummte das wilde Summen spätestens hinter Ostende und machte der guten Luft und der Vorfreude Platz. Warum sollten sich Franzosen und Deutsche schon wieder bekämpfen, wenn man doch so friedlich und freundlich miteinander im Zugabteil sitzen und sich auf seinen Badeurlaub freuen konnte? Es würde schon nichts passieren, seit Jahren rasselten alle möglichen Mächte mit ihren Säbeln und doch war nie etwas Schlimmes geschehen. Kein Grund also den Badeurlaub zu verschieben.
Nun aber war es wohl tatsächlich geschehen. Der Krieg war ausgebrochen. Zwar noch nicht hier in Coxyde, wo Stern und alle anderen Deutschen, die seiner Warnung Glauben schenkten, hektisch die Koffer packten und den nächsten Zug zu erreichen hofften. Vor den Fenstern der schönen Villa des Nynfea wehte immer noch die gleiche Sommerluft wie zuvor vom Meer herüber und aus der Küche drangen wieder die schönsten Düfte nach oben.
Auch die kleinen Orte im Hinterland wie Veume und Diksmuide sahen durch die Zugfenster noch genauso verschlafen aus, wie sie das bei der Hinreise getan hatten. Aber schon als sie in Brügge umstiegen und auf den Zug nach Brüssel warteten, lag etwas Neues in der Luft. Eine unbestimmte Spannung und ungläubige Blicke auf Zeitungsschlagzeilen waren zu einem allgemeinen Gemurmel angeschwollen, junge Männer, noch zivil gekleidet, gaben sich schon wie Soldaten. In Gent füllte sich der Zug weiter mit solchen zukünftigen Soldaten, die ihren Patriotismus in die Hauptstadt trugen.
»Und was werden Sie tun?«, fragte Stern den Generalkonsul diskret auf Französisch. Es schien nicht ratsam, sich hier in ihrer Muttersprache zu unterhalten. Die Frauen schauten angespannt aus dem Zugfenster.
»Ich werde mich zunächst in Kenntnis setzen, wie meine Anweisungen vom Amt lauten«, antwortete Below-Saleske. »Ich nehme an, dass mein Auftrag sein wird, im Namen der Regierung nachzufragen, auf welcher Seite Belgien im Krieg zu stehen beabsichtigt, und dass ich dann bald die Gesandtschaft aufzugeben haben werde.«
»Meinen Sie?«
»Ganz bestimmt wird sich Brüssel nicht auf die Seite der boches stellen. Würde das Land von Flandern aus regiert, wäre das eine andere Frage, aber eine wallonische Haupstadt wird nie auf der Seite von Germanen stehen.«
»Und dann?«
»Was weiß ich? So ein Krieg ist ein großes Unterfangen. Da wird sich sicher auch für mich eine Verwendung finden. Schade ist das eigentlich«, seufzte der Generalkonsul, »nicht mal ein Jahr bin ich dann in Brüssel gewesen. Speziell meine Frau hatte sich nach den Jahren in Bulgarien auf eine Zeit in der Zivilisation gefreut.« Die lächelte nur gequält zu ihnen herüber.
Doch in Brüssel angekommen, schien dort die Zivilisation zumindest eine Pause eingelegt zu haben. »A bas les huns« und »Mort au Kaiser!« skandierten Menschenmassen auf den Plätzen. »Sehen Sie zu, dass Sie heute noch hier herauskommen, junger Freund«, raunte ihm Below-Saleske zu. »Hier werden sich Deutsche nicht mehr lange frei bewegen können.«
»Und was ist mit Ihnen?«, fragte Stern.
»So viel Anstand werden sie sicher noch haben, einem Diplomaten freies Geleit zu gewähren. Aber Sie sollten sich schnellstmöglich in Richtung der Grenze begeben.«
Nach Deutschland fuhren schon keine Züge mehr, aber Stern und seine Verlobte bekamen noch Billetts für die Holzklasse in einem Zug nach Herbesthal, der sicher früher bis nach Eupen durchgefahren war und nun nicht mehr die Grenze passieren sollte. Der ganze Zug war gestopft voll mit Deutschen, die schnellstmöglich das Land verlassen wollten, und es herrschte große Ungewissheit, wie sie über die Grenze kommen würden.
Zum Glück erwies sich das Ganze als wenig problematisch. Schon auf dem Bahnhof in Herbesthal wurden sie von deutschsprachigen Belgiern empfangen, die hier das Geschäft ihres Lebens machten. Diese nämlich, die sich eigentlich als deutsche Landsleute sahen und die als Belgier dennoch bald Kriegsgegner sein würden, brachten die Deutschen für eine Unsumme mit Pferdefuhrwerken aller Art die knapp zehn Kilometer bis nach Eupen, allerdings war in dem Preis der Grenzübertritt an sicherer Stelle eingeschlossen, was natürlich der eigentliche Grund dafür war, dass Stern wie alle anderen die Fahrt in dem mäßig gefederten Kremser buchte.
Als sie wieder auf deutschem Boden waren, sahen sie, dass die ganze Strecke auf deutscher Seite voll mit Zügen stand, Güterwagen beladen mit Pferden, Gespannen und schwerer Artillerie, neben den Mannschaftswagen campierten Soldaten der 1. Armee, alles war gerüstet, bald nach Belgien einzufahren. Das deutsche Militär hatte erkennbar einen Plan. Der Sommer war vorbei.
Dieckhoff
Nach Berlin
Drei Jahre war es nun schon fast her, dass die Welt gefürchtet hatte, in Marokko würde der große europäische Krieg ausbrechen. Überall auf der Welt hatten sie im August und September 1911 demonstriert, weil die Menschen fürchteten, Deutschland und Frankreich würden über den Konflikt in Afrika in einen Krieg miteinander stolpern. Am Trafalgar Square in London hatten die Menschen für den Frieden demonstriert, mehr als 200.000 Menschen hatten sich seinerzeit im Treptower Park versammelt. Doch mit dem Marokko-Kongo-Vertrag hatte man alles noch einmal schön friedlich regeln können, auch wenn viele unzufrieden waren, dass Deutschland damit wenig mehr als den Frieden gewonnen hatte.
Lediglich der Status von Tanger blieb ausdrücklich ungeklärt, sodass Deutschland dort eine Gesandtschaft unterhielt, wo Dieckhoff im Februar 1914 seinen ersten Auslandsposten im diplomatischen Dienst überhaupt angetreten hatte. Dieckhoff war Attaché unter Freiherr von Seckendorff, es war ein ungeheures Glück, dass er es – als nichtadliger Katholik – überhaupt in den diplomatischen Dienst geschafft hatte, zehn Jahre zuvor wäre so etwas noch undenkbar gewesen. Für Bürgerliche war damals überhaupt nur der Konsulardienst infrage gekommen, der ihm langweilig erschien. Aber in diesen modernen Zeiten hatte er vor der Wahl gestanden: Weiter im Straßburger Polizeipräsidium die Leiter nach oben zu klettern oder als Diplomat die große weite Welt zu befahren.
Und nun war er bald ein waschechter Diplomat, alles, was ihm dazu noch formal fehlte, war die Verteidigung seiner Abschlussarbeit über seine Heimat, das Elsass unter dem Regnum des Sonnenkönigs. Von Seckendorff hatte sich erwartet großzügig gezeigt und Dieckhoff völlig unkompliziert die Erlaubnis gegeben, von Ende Mai bis Anfang Juli 1914 seinen Posten in Tanger zu verlassen, damit er im Amt der Berliner Wilhelmstraße seinen Abschluss zu einem guten Ende brächte. »Machen Sie mir keine Schande«, hatte der Gesandte ihm leutselig auf den Weg mitgegeben. Dieckhoff hatte ihn in den letzten Wochen stets tatkräftig und zuverlässig bei seiner Arbeit unterstützt, wiederholt hatte von Seckendorff den jungen Attaché gelobt und immer wieder seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass der junge Kollege alles gut zuwege bringen werde. Der unter dem Adel so verbreitete Dünkel gegenüber Bürgerlichen war von Seckendorff glücklicherweise fremd. Und so war Dieckhoff der Überzeugung, dass seine Reise in die Heimat unter einem sehr glücklichen Stern stand.
Tassaout
Aus Megdaz
Für die Ait Attik bedeutete es nie etwas Gutes, wenn sie vor den Mauern der Kasbah von Megdaz Staub aufsteigen sahen. Das hatte der alte Lahcen immer wieder gesagt, wenn sich die Männer aus Ait Hamza, Ait Ali n’Ito, Fakhour, Tifticht und Imziln versammelt hatten, um über Hochzeiten, die Ernte und die Tiere zu sprechen. Sie tranken Minztee, aßen Walnüsse und Datteln aus der Fint und natürlich war es vor allem der Lehrer, der zu ihnen sprach. Der Levante brachte den Staub und die Dürre nach Megdaz, Tiere und Menschen kamen auf dem Weg entlang des Oued Tassaout zu ihnen herüber. Allein reisende Händler oder die Ait Attik liefen dabei ruhig und kannten die Wege, nur berittene Eindringlinge, die nicht kamen, um sich der allseits gerühmten Gastfreundschaft der Ait Attik zu erfreuen, verursachten Staubsäulen wie der trockene Westwind.
Die Kasbah, deren Tore reich verziert und deren Innenräume nicht nur wegen der blau glänzenden Fliesen angenehm kühl waren, hatten die Urväter vor langer Zeit errichtet, als die Ait Attik ihre Reise aus Syrien, dem Land der Vorväter, beendet hatten, um sich hier im Atlas niederzulassen. Die Kasbah hatte die Ernten und das Volk selbst immer wieder geschützt gegen die Dürre, die wilden Tiere, die Stürme des Winters und gegen kriegerische Eindringlinge. Und sie alle, die Stürme, die Tiere, die Dürre und die Eindringlinge, waren aufgetaucht als Staubsäulen, die von Ifoulou her aufstiegen. Heißes Öl hatten sie auf die Eindringlinge gegossen, so erzählte es Lahcen, Speere auf die Tiere geworfen, sich tief eingegraben in die Verliese, wenn der Sandsturm über Megdaz kam.
Aber was hätten sie tun sollen, als die Franzosen mit ihren vielen Pferden und Gewehren nach oben kamen und forderten, dass Lahcen ihnen fünfzig junge Männer gab, wenn sie nicht die Kasbah und ihre Dörfer brennen sehen wollten? All ihr Öl und all ihre Waffen hätten nicht ausgereicht, um die Franzosen mit ihren Gewehren zu vertreiben. Der alte Lehrer hatte um fünf Tage Zeit gebeten, eine Versammlung der Ait Attik einzuberufen, auf der sie darüber beratschlagen konnten, wie zu verfahren sei. Unterleutnant Bernard hatte ihnen drei Tage gewährt, unter der Bedingung, dass er und seine Expedition in der Kasbah einquartiert und bewirtet wurden. Alle Speisen und Getränke für die Franzosen musste immer zuerst einer ihrer Ältesten kosten, die Franzosen wollten nicht vergiftet werden, dabei teilten die Ait Attik ihre Speise immer mit ihren Gästen, waren diese nun Freunde oder hatten sie sich selbst eingeladen, sie hätten nicht einmal gewusst, wovor die Franzosen sich fürchteten. Der Unterleutnant war ein ruhiger Mann, der nur seinen Auftrag ausführen wollte, keine Hyäne im Körper eines Menschen wie Kapitän Blaive, dem sie später in Merrakec in die Hände fallen würden, der sie alle immer nur salearabes nannte und schlimmer als Tiere behandelte.
Lahcen sagte auf der Versammlung, er habe keine Zweifel an der Entschlossenheit der Franzosen, Dörfer und Kasbah in Brand zu setzen. Er sagte, hinter der Wüste, hinter dem Meer, in der Heimat der Franzosen, sei ein großer Kampf ausgebrochen und die Franzosen würden jeden Mann brauchen, jeden Berber, jeden Araber, jeden Gnawa, alle. Fünfzig Männer sei eine große Zahl, aber besser als das Ende der Ait Attik sei es allemal. Und darum müssten sie den Franzosen das geben, was sie verlangten. Jede Familie solle zwei junge Männer geben, die Ait Attik seien ein mutiges Volk. Zwar sei das schwer für jede Familie, aber die Familien sollten auch nicht traurig sein: Ihre Männer würden den Ruhm der Ait Attik in die ganze Welt tragen und schon bald zurückkehren nach Megdaz, mit vielen Ehren und Schätzen beladen. Denn ein Kampf, in dem die Ait Attik an der Seite der französischen Gewehre kämpften, könne von den Gegnern nicht gewonnen werden.
Tamanart war der älteste Sohn in ihrer Familie, er musste für die Eltern, seine Frau Tamayyurt, für Tanirt, die noch nicht verheiratet war, für das Haus und alle Tiere und Menschen darin sorgen. Also hatte Tassaout, der Zweite, Abschied nehmen müssen, hatte seine Sachen gepackt und sich mit den anderen Männern auf einen der Viehwagen von Unterleutnant Bernard gesetzt, mit denen sie nach Merrakec gebracht wurden, die Rote Stadt, die die Franzosen marrakech nannten. Hier angekommen, trennten sie sofort alle Ait Attik, die Stämme und Familien durften nicht zusammenbleiben.
Zu seinem Glück war Tassaout in seiner Abteilung auf Aderfit getroffen, einen Berber aus Merrakec, der für die Franzosen gearbeitet hatte und neben Tamazigh auch Französisch und Arabisch sprach. Aderfit konnte ihm sagen, welche Befehle und Beschimpfungen die französischen Offiziere ihnen immerfort zuriefen. Aderfit wusste auch, woher die Gnawa, die vielen Schwarzen aus ihrer Gruppe, kamen. Die Marokkaner hatten deren Vorväter, Menschen aus Mali und Senegal, in der alten Zeit geraubt und als Sklaven verkauft. Erst seit wenigen Generationen sei solcher Handel verboten, war der letzte Menschenmarkt von Merrakec geschlossen worden. Zurückgeblieben seien die Gnawa, die nun zwar nicht mehr Sklaven waren, dennoch ohne Land und Besitz in den Städten lebten, im Land ihrer Vorväter unbekannt waren und von den Marokkanern nicht viel besser behandelt wurden als in früheren Zeiten.
»Aber warum sind hier so viele Gnawa, warum so viele Berber? Warum sind kaum Araber unter uns?«, fragte Tassaout.
»Was soll die Frage, mein Bruder?«, sagte Aderfit. »Warum sollte sich der Sultan von seinen eigenen Leuten trennen?«
»Du meinst, Mulai Yusuf gibt den Franzosen mit Absicht keine Araber für den großen Kampf?«
»Den Franzosen ist das doch egal. Die können doch einen Berber oder einen Araber nicht einmal von einem Gnawa unterscheiden, und wäre der so schwarz wie Ruß. Sie verlangen vom Sultan einfach Köpfe. Und er gibt ihnen Köpfe. In den Augen der Franzosen ist Mulai Yusuf auch nicht viel mehr als ihr Sklave.«
»Pass auf, was deine Zunge spricht!«
»Und was sollen sie tun, wenn sie mich hören? Wie wollen sie mich bestrafen? Mich meinem Heim entreißen und an die Franzosen verschenken? Das Schicksal widerfährt mir bereits. Stell dir vor, sie töten einen von uns. Und dann? Brauchen sie wieder einen Mann mehr, den sie den Franzosen geben müssen, und wo sollen sie den hernehmen? Das ist das Schöne an unserer Lage: Es kann nicht mehr schlimmer kommen. Du weißt, wie es bei uns heißt: Es ist besser, Meerwasser zu trinken, als der Unfreundlichkeit der Trinkwasserhändler ausgesetzt zu sein. Nein, so wahr ich hier mit dir spreche, mein Bruder, so wahr ist es, dass Mulai Yusuf uns an die Franzosen verraten hat, weil Mouha Zayani schon Truppen sammelt, um gegen ihn zu kämpfen, um selbst Sultan zu werden. Darum braucht Mulai Yusuf jeden Araber, jeden Mann, der auf seiner Seite kämpft. Und uns und die Gnawa hat er zusammentreiben lassen, als wären wir immer Sklaven geblieben.«
»Du meinst, es kommt auch in Merrakec bald zum Kampf?«
»Eher heute als morgen, mein Bruder. Merrakec soll nicht mehr sicher für den Sultan sein, es heißt, dass er schon bald seinen Palast nach Arbat verlegen wird.«
Von Merrakec marschierten sie in großen Kolonnen nach Anfa, das bei den Franzosen Casablanca hieß, dort trafen sie weitere Alaquiten und Marokkaner und Gnawa. Es schien, als hätten die Marokkaner jeden Schwarzen, den sie finden konnten, den Franzosen überstellt. Sie marschierten zum Hafen und für einen kurzen Moment sah Tassaout zum ersten Mal das Meer, dieses riesige Wasser, das er nur aus alten Märchen der Ait Attik kannte. Aber er hatte keine Zeit, dieses unglaubliche Bild länger zu betrachten, weil man sie alle rasch unter lautem Geschrei in ein riesiges Schiff stopfte.
Die Überfahrt war bei Weitem das Schlimmste, was Tassaout in seinem Leben widerfahren war. Stunden, Tage, Wochen saßen sie in einem übel riechenden, ganz und gar dunklen Raum, der fortwährend schwankte. Sein Leben hatte er unter freiem Himmel, oft stundenlang allein im Gebirge verbracht. Hier war es dunkel und eng, überall hörte man Männer stöhnen und sich übergeben, wohl keiner von ihnen war jemals in so einem großen Boot gefahren. Der muffige Gestank ihres Verlieses verschlimmerte sich von Tag zu Tag durch die Ausscheidungen der Männer. Zweimal am Tag kamen die Franzosen herunter und brachten ihnen Wasser und irgendwelche Nahrung, einer der Gefangenen durfte dann auch herausgehen und die zwei Eimer mit ihren Exkrementen ausleeren. Das waren die Momente, wo etwas Licht in ihr Gefängnis fiel.
Tassaouts einziger Trost waren Aderfit und seine Erzählungen. Er erzählte ihm immerfort vom Meer, dass das Schwanken ihres Schiffs nicht von den Winden, sondern von den Wellen auf dem Wasser kam, und die Gnawa beschworen mit ihren sich immer wiederholenden Gesängen die Geister, die guten, dass sie ihnen beistehen mögen, und die bösen, dass sie die Überfahrt nicht begleiten sollten. Tassaout hätte gern auf das Meer geschaut, aber sie waren hier unten eingesperrt.
Früher, zu Hause, war er schon als Junge mit einem Esel viele Tage durch die Berge geritten bei größter Trockenheit und Hitze. Früher war es ihm geschehen, dass er wochenlang nicht viel mehr als ein paar Nüsse gegessen und sich einmal beim Sturz das Bein gebrochen hatte. Aber im Bauch dieses riesigen Holzungetüms in einer Matte zu hängen, so schlecht gewoben, wie sie kein Kind in Megdaz jemals hergestellt hatte, wo die Frauen kunstvolle Teppiche herstellten, jeder immer anders schön, in dieser Matte, inmitten Hunderter anderer Matten, in denen Hunderte andere Männer aus Marokko mehr hingen als lagen, fühlte er sich wie eine Larve, wie man sie in den kleinen Höhlen finden konnte, kurz bevor aus ihnen die giftigen Hundertfüßer krochen. In Megdaz hatten sie sich in die Trockenheit erleichtert, der Wind hatte jegliche Gerüche davongetragen und im Gegensatz zu den Berbern hatten sie die Exkremente praktisch nie zum Feuern benutzen müssen. Aber hier, im Bauch des Schiffes, war Tassaout den Gerüchen und Ausscheidungen aller seiner Mitgefangenen ausgeliefert, dem Stöhnen, dem Gestank, dem Schwanken des Schiffes. Er übergab sich auch nicht öfter als die anderen und konnte im Lauf der Überfahrt den grün-grauen Brei, der ihnen dort unten serviert wurde, gelegentlich bei sich behalten.
Stern
An der Front
Ein paar Tage später war auch Stern ganz unter den Barbaren angekommen. Von seiner Theodora hatte er gleich nach ihrer Rückkehr Abschied nehmen müssen und sich beim Militär gemeldet. Jetzt war er Offizier im 1. Westfälischen Pionier-Bataillon Nr. 7 und hatte die Aufgabe, am rechten Rheinufer eine zweite Auffanglinie vorzubereiten, falls die Franzosen die Frontlinie durchbrechen sollten. Das bedeutete, für Kabel, Gräben und andere technische Vorkehrungen schöne alte Weinberge, die Resultate von Generationen rheinischer Winzerkunst, in Tagen zu vernichten. Stern konnte ohnehin noch nichts davon begreifen. Seit er denken konnte, war seine Familie so selbstverständlich nach Frankreich wie in die Schweiz gefahren. In Coxyde hatte sie sich mit der Familie des Arztes Victor Boley befreundet und es war dem jungen Stern erlaubt worden, – erst fünfzehnjährig – erstmals auf eigene Faust zur Familie Boley eine Urlaubsreise zu machen.
Bei diesem Aufenthalt auf dem schönen Anwesen in Gespunsart, wo schon die Kinder regelmäßig Wein tranken, hatte Stern auch den ersten Vollrausch seines Lebens erlitten. Dr. Boley hatte ihn gerade noch davor retten können, im Springbrunnen vor dem Schloss zu ertrinken. An den drei folgenden Tagen hatte Stern sich nur von Carbana-Bitterwasser ernährt, aber im Gegensatz zu anderen Frankfurter Jungen, deren erster Rausch meist durch Apfelmost verursacht worden war, konnte sich Stern zeitlebens rühmen, bei seinem ersten Mal durch Champagner in der Champagne betrunken gewesen zu sein.
Magdelaine Boley, die bei seinem ersten Aufenthalt noch ein spindeldürres siebenjähriges Mädchen gewesen war, hatte sich acht Jahre später in ihrem klösterlichen Internat in einen schweren Fall von Verliebtheit in Stern hineingeschrieben. Nahezu täglich erreichten ihn damals verliebte, verzweifelte, schwelgende und schwelende, in jedem Fall aber lange Briefe voller Temperament. Es war so weit gekommen, dass Stern sich gleichzeitig so geschmeichelt und so gedrängt gefühlt hatte, dass er im Jahr 1911 aus purem Anstand bei Dr. Boley um Magdelaines Hand angehalten hatte. Doch zum Glück hatte der die Lage richtig eingeschätzt und Stern nur ausgelacht.
»Edgar, Sie sind mir fast so lieb wie ein Sohn, aber auf dieses Abenteuer wollen wir bitte beide verzichten. Was, wenn sich Deutschland und Frankreich erneut in einem Krieg wiederfinden? Mindestens einen von uns, vermutlich uns beide würde das kreuzunglücklich machen.« Es folgten noch ein paar besonders schmerzvolle Briefe von Magdelaine aus dem Internat im Nonnenkloster, danach aber verlobte sie ihr Vater mit einem Arzt im Jura, was sicher für alle Beteiligten das weitaus Beste war.