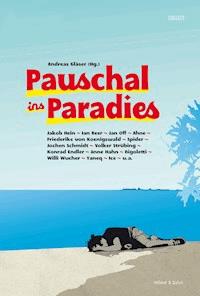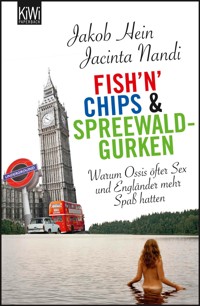9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ein berührender und humorvoller Blick hinter die Kulissen der Psychiatrie von Bestsellerautor Jakob Hein Platz 6 der Sachbuch-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur, Die Zeit & ZDF - Platz 16 der SPIEGEL-Bestsellerliste Der renommierte Schriftsteller Jakob Hein arbeitet seit über zwanzig Jahren mit Leidenschaft als Psychiater. In seinem neuen Buch Hypochonder leben länger nimmt er die Leser mit auf eine faszinierende Reise durch seinen Alltag in der Psychiatrie. Mit Herz und Humor erzählt er von seinen Erfahrungen im Umgang mit Patienten, seiner Skepsis gegenüber starren Diagnosen und der Rolle des Experten. Hein gibt Einblicke in hilfreiche Gespräche, den Einsatz von Placebos und Medikamenten. Vor allem aber vermittelt er, dass jeder Mensch den Schlüssel zu einem erfüllten Leben in sich trägt. Es geht darum, diesen Code immer wieder aufs Neue zu entschlüsseln. Denn die meisten Weisheiten über den Menschen stimmen. Oder auch nicht. Schließlich leben Hypochonder länger! Ein einfühlsames und unterhaltsames Buch, das zeigt, wie wichtig Menschlichkeit und Zugewandtheit in der Psychiatrie sind. Ideal für alle, die sich für Psychologie, Psychotherapie und die Arbeit eines Psychiaters interessieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Jakob Hein
Hypochonder leben länger
und andere gute Nachrichten aus meiner psychiatrischen Praxis
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jakob Hein
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jakob Hein
Jakob Hein, geboren 1971 in Leipzig, lebt seit 1972 mit seiner Familie in Berlin. Er arbeitet als Psychiater. Gründungsmitglied der »Reformbühne Heim und Welt«.
Zu seinen bekanntesten Büchern gehören Mein erstes T-Shirt (2001), Herr Jensen steigt aus (2006), Wurst und Wahn (2011), Kaltes Wasser (2016) und Die Orient-Mission des Leutnant Stern (2018).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Der Schriftsteller Jakob Hein arbeitet seit mehr als zwanzig Jahren als Psychiater. Und er liebt seinen medizinischen Beruf mindestens genauso sehr wie das Verfassen von Romanen. Kein Wunder, denn auf beiden Gebieten kann er das umsetzen, was ihn am meisten ausmacht: seine liebe- und humorvolle Zugewandtheit dem Menschen gegenüber.
In diesem Buch nimmt Jakob Hein die Leser mit auf eine Reise durch seinen Alltag als Psychiater. Er erzählt von den Fragen und Bedürfnissen seiner – und dabei auch von seiner Skepsis gegenüber einengenden Diagnosen und der Geste des Experten. Er berichtet von hilfreichen Gesprächen, Placebos und Medikamenten. Vor allem aber macht er begreifbar, dass jeder Mensch den Code zum Schatz seines Lebens in sich trägt und es immer aufs Neue darum geht, diesen zu entschlüsseln. Und dass die allermeisten Weisheiten zum Menschen stimmen. Oder auch nicht. Denn: Hypochonder leben länger!
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin
Lektorat: Esther Kormann
ISBN978-3-462-30138-0
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Irrenarzt
Der Psychiater, der ich nicht bin
Kennen Sie Argan?
Niedergelassen und niedergeschlagen
Rund um die Uhr
Hypochonder leben länger
Es heißt ja nicht Schweigerecht
Problemlöser
Die Rolle als Arzt
Das Orakel vom Heinrich-Heine-Platz
Zauberkünstler
Die eine Sache, die ich selbst herausgefunden habe
Ein klares und entschiedenes Jein
Ich habe keine Ahnung, was Kurt Cobains Problem war
Ein männlicher Therapeut
Ein »ja«, das ich stets verneine
Experte für Hochbegabung
Pubertät ist nicht heilbar
Für oder gegen Cannabis
Menschenfreund
Warum ich oft die Diagnose meiner Patienten nicht weiß
Tabulose Therapie
Experte
Der folgende Text spiegelt ausschließlich die Meinung des Autors wider. Jegliche verwendeten Namen und Personen sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt. Wird im Text die weibliche Form verwendet, sind in der Regel auch männliche Personen gemeint und umgekehrt.
Für die Idee zu diesem Buch möchte ich der Wissenschaftsjournalistin Kerstin Kullmann danken. Am Rande eines Gesprächs fragte sie mich, warum ich denn nie über meine Arbeit als Psychiater schreibe. Ich antwortete ihr, dass ich dazu keine rechte Lust hätte, weil viele Menschen bereits eine genaue Vorstellung von meinem Beruf hätten ohne den Schatten einer Ahnung.
»Dann schreiben Sie doch einfach Der Psychiater, der ich nicht bin«, schlug sie vor.
Diesen Vorschlag von Frau Kullmann fand ich wunderbar. Er öffnete mir gedanklich eine Tür. Zwar wollte ich immer noch nicht darüber schreiben, was ich für ein Psychiater bin. Aber den Psychiater zu beschreiben, der ich nicht bin, das fand ich einen guten Ansatzpunkt. Und so entstand im Laufe der vergangenen Jahre dieses Buch.
Irrenarzt
»Schwer stelle ich mir Ihren Beruf vor. Sehr schwer!«
Psychiater wollte ich schon in meiner Jugend werden. Damals rollte gerade mal wieder eine Psychowelle durchs Land. In den Zeitschriften gab es Berichte von Experten, die allein aus der Körperhaltung, in welcher ein Mensch im Bett schläft oder wie er sich einen Kaffeekrümel von der Lippe zupft, ablesen konnten, welche sexuellen Fantasien der Krümelzupfer zu verbergen suchte. Insbesondere wussten diese Experten auch das, was die Objekte ihrer Analysen nicht einmal selbst von sich wussten: Wer gern aufräumte, war anal fixiert, wer rauchte, war oral fixiert und wer gern Handball spielte, war vermutlich manual fixiert. Die Experten drückten sich unvorstellbar kompliziert aus und waren in ihren Analysen völlig sicher, frei von Zweifeln. Sie konnten mit letztgültiger Sicherheit die psychische Verfassung ganzer Gruppen von Menschen auf den Punkt bringen.
Da ich so wie viele in der Jugend gerade eine Zeit durchlebte, in der ich auf intensive Weise meine eigene Psyche nicht verstand, erschien mir die Vorstellung, irgendwann nicht nur dieses Dilemma zu lösen, sondern auch noch die Psychen anderer Menschen zu verstehen, äußerst verlockend. Nahezu schon paradiesisch kam mir damals der Gedanke vor, die Psyche von Frauen verstehen zu können. Das hätte mich von allen meinen männlichen Freunden unterschieden und auch von einigen weiblichen. Ein angenehmer Nebeneffekt meiner Begeisterung für die Psychiatrie war, dass ich endlich eine Antwort auf die Frage parat hatte, mit der Jugendliche von Erwachsenen am häufigsten gequält werden. Ich konnte jetzt sagen, dass ich Psychiater werden wolle, aus einem mir nicht bewussten Grund konnte ich diesen Wunsch sogar noch konkretisieren: Ich wollte Kinder- und Jugendpsychiater werden. Das klang kompliziert und spezifisch und schob ungewollten Berufsberatungen auf Familienfesten einen Riegel vor. Sogar unter Gleichaltrigen war mein Berufswunsch auf eine leicht gruselige Art akzeptabel.
Meine Eltern fanden meine Faszination interessant und wesentlich unterstützenswerter als meine vorherige Idee, irgendeine Art von Künstler werden zu wollen. Darum kauften sie mir Bücher zum Thema, Klassiker der psychologischen und psychotherapeutischen Literatur. Mit viel Interesse und oft auch einiger Mühe las ich und las, manchmal verstand ich etwas, häufiger ergaben sich neue Fragen. Und je mehr ich eintauchte in die komplexen Fragestellungen, desto interessanter wurde das Gebiet für mich. Obwohl ich irgendwann sicher war, dass auch der beste Kenner der menschlichen Psyche nicht über eine Art psychologischen Röntgenblick verfügt, mit dem er die Seele seines Gegenübers durchschauen kann, unabhängig davon, ob der das möchte oder nicht, war mein Wunsch, Psychiater zu werden, nicht kleiner geworden, sondern sogar gewachsen.
In der ersten Zeit war ich davon ausgegangen, dass ich für die Ausübung dieses Berufes Psychiatrie studieren müsste. Wie die meisten Menschen hatte ich keine Ahnung von den Unterschieden zwischen Psychologie, Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoanalyse. Irgendwie, so nahm ich an, war das bestimmt alles dasselbe. Meine Eltern kamen aus der Welt von Theater und Film, wo die Grenzen zwischen Dramatiker, Dramaturg, Redakteur und Regisseur auch fließend waren. Alle hatten Germanistik studiert und waren der Meinung, den eigentlich entscheidenden künstlerischen Beitrag geleistet zu haben.
Da ich niemanden kannte, der Psychiatrie studiert hatte und das Fach auch im Fächerkatalog der Uni nicht gelistet war, vermutete ich stark, Psychologie studieren zu müssen, um später Psychiater werden zu können. Warum ich ausgerechnet diesen Beruf anstrebte und nicht Psychologe werden wollte, kann ich heute nicht mehr sagen. Ich bin mir jedenfalls absolut sicher, dass es nicht an einem unbewussten Verlangen lag, Medikamente zu verschreiben.
Irgendwann fand ich heraus, dass ein Psychiater zunächst Medizin studieren muss. Das war eine Überraschung. Warum sollte man dröge Fakten über die Leber und das Sprunggelenk lernen, wenn man doch nur psychisch Kranken helfen wollte? Das erschien mir wie eine merkwürdige Verschwendung von Zeit und Wissen. Dasselbe Gefühl sollte ich übrigens kurze Zeit später bei meinen Kommilitonen wiederfinden, die Chirurgen oder Internisten werden wollten und sich nun fragten, warum sie hier in einem Seminarraum saßen und etwas über Freuds Strukturmodell der Psyche lernen mussten. In jedem Fall fügte ich mich in die Notwendigkeiten und bewarb mich erfolgreich für ein Studium der Humanmedizin.
Das – sagen wir mal: traditionelle – Medizinstudium bereitete mir an seinem Anfang ziemliche Schwierigkeiten. Weitgehend losgelöst von Menschen oder Medizin sollte man die physikalischen, biologischen und biochemischen Grundlagen der Humanmedizin pauken. Diese Zeit, die vor allem aus unfassbar schweren Prüfungen bestand, habe ich auch darüber hinaus als große Prüfung empfunden. Mir kam das Ganze wie ein brennender Reifen vor, durch den alle Medizinstudenten springen mussten, wenn sie auf die richtige Seite des Studiums kommen wollten. Niemand interessierte sich dafür, ob wir vor dem Studium irgendwas gelernt hatten oder vielleicht sogar schon etwas konnten. Zwei Jahre lang ging es nur darum, genügend Fakten auswendig zu lernen, um in der nächsten Prüfung nicht durchzufallen. Erklärtes Ziel war die Note vier. Bekam ich gelegentlich (selten) eine bessere Note, nahm ich das erstaunt zur Kenntnis, war aber innerlich schon wieder damit beschäftigt, die nächste Hürde knapp überspringen zu können.
Wir trafen in der Zeit auf keinen lebenden Patienten und unsere Lehrer gaben sich auch größtenteils keine Mühe, irgendeinen Bezug ihrer Fächer zu einer medizinischen Realität herzustellen. Die wichtigste Begründung für das Auswendiglernen war, dass es eben sein musste. Ich hatte immer das Gefühl, dass wir gewissermaßen Geiseln waren und für jede unqualifizierte Frage eines klinisch tätigen Arztes an eine Biochemikerin oder einen Anatomen büßen sollten. Würden wir erst mal geschafft haben, selbst Ärzte zu sein, dann könnten sie uns nicht mehr unterwerfen, darum schienen sie uns prophylaktisch zu bestrafen.
Viele meiner Freunde studierten irgendwas mit Kunst oder Medien. Wenn ich mich manchmal früher von einer Feier verabschiedete oder nicht zu einem Festival mitkommen konnte, weil ich noch lernen musste, sagten sie oft: »Schade! Wann ist denn die Prüfung?« Wenn ich ihnen dann zu verstehen gab, dass diese Prüfung, auf die ich mich gerade vorbereiten musste, in zwei oder drei Monaten stattfinden würde, änderte sich ihr Gesichtsausdruck. Sie schauten mich entsetzt und enttäuscht an, wie um zu sagen: »Dann sag doch, dass du keine Lust hast mitzukommen, und schiebe nicht irgendeine fiktive Prüfung als Ausrede vor.« Denn wenn sie für eine Prüfung in Kunst oder Medien lernen mussten, dann höchstens ein, zwei Wochen lang. Aber ich lernte über Wochen und Monate. In den schlimmsten Zeiten verließ ich die Wohnung nur, um Lebensmittel zu kaufen. Die Welt da draußen kam mir dann unwirklich, wie die Kulissen eines Filmes, vor.
Zum Glück endete diese Studienphase mit dem Erwerb des Vordiploms. Wir erhielten den Titel candidatus medicinae, abgekürzt cand. med., ein Pseudotitel, der mehr über den Dünkel der Ärzteschaft als über den Träger des Titels aussagt. Bis heute erinnere ich mich an einen Kommilitonen, der erleichtert aufschaute, als er die Nachricht vom Bestehen seines Vordiploms bekam, und zu mir sagte: »Wenn ich demnächst sterben sollte, möchte ich aber auch, dass wenigstens cand. med. auf meinem Grabstein steht.« Noch merkwürdiger als dieser Wunsch erschien mir damals nur, dass ich ihn voll und ganz verstehen konnte.
Danach begann zum Glück der Teil des Medizinstudiums, der diesen Namen auch verdient hatte. Wir sprachen über Krankheiten, trafen Patienten, lernten Diagnosen zu stellen, Laborwerte zu verstehen, Methoden der Bildgebung einzusetzen. Sowohl mein Spaß am Studium als auch meine Zensuren stiegen sofort sprunghaft an. Im Nachhinein verstand ich, wozu wir Anatomie und Biochemie brauchten, und baute mir Kenntnisse auf diesen Gebieten auf. Ich bin überzeugt, dass diese Grundlagen notwendig sind, so wie jedes Haus ein gutes Fundament braucht. Aber wenn man Architekturstudenten zwei Jahre lang mit nichts als Bauvorschriften für Fundamente quält, verliert man vermutlich viele, die womöglich gute Architekten geworden wären.
Besonders schön war für mich, dass ich nach der Rundreise durch alle möglichen Arztberufe wieder zu meinem Ausgangspunkt zurückfand, Kinder- und Jugendpsychiater werden zu wollen. Keinesfalls wollte ich Chirurg werden, weil ich mich davon überzeugen konnte, dass ich dafür keinerlei Talent habe. Nicht viel anders ging es mir mit der Radiologie. In jedem Fall wollte ich direkt mit Patienten zu tun haben, aber lieber etwas weniger direkt als in der Gynäkologie. An der Inneren Medizin gefiel mir das Rauf, Runter, Mit- und Gegeneinander der vielen verschiedenen Medikamente nicht. Ganz klar fand ich die Psychiatrie am interessantesten. Und ich wünschte mir eine Arbeit mit Kindern, weil die sich ihren Witz noch nicht abgewöhnt hatten. Und so entschloss ich mich erneut, Kinder- und Jugendpsychiater zu werden, was für mein Umfeld eine deutlich geringere Überraschung war als für mich selbst.
Der Psychiater, der ich nicht bin
»Für Sie ist das bestimmt alles ganz normal.«
Als Psychiater musst du damit leben, dass die Leute ein klares Bild von deiner Arbeit haben. Genau genommen sind es zwei Bilder: erstens der vollbärtige, mindestens wunderlich zu nennende, ältere Herr, der neben der Couch dämmert, auf der gerade eine Dame mittleren Alters ihre auf eine sexuelle Minderbetätigung zurückzuführende Lebenskrise ausbreitet. Nach drei oder sieben Jahren wacht der Herr kurz aus seinem Dauerschlaf auf, sagt seiner Patientin, worauf ihr Leiden zurückzuführen ist (die sexuelle Minderbetätigung), und schläft dann weiter. Für jede Stunde berechnet er ungefähr neunhundert Euro, eher mehr. Der Mann ist ebenso unfähig wie reich. Sein ganzer Berufsstand ist Ausdruck und Beweis der Dekadenz unserer Welt und könnte ohne Konsequenzen abgeschafft werden.
Das zweite Bild, das die Menschen von der Arbeit eines Psychiaters haben, ist das eines weiß bekittelten Sadisten, der in einem Irrenhaus am Rande der Stadt hinter geschlossenen Türen arbeitet. Die dortigen »Patienten« sind allesamt in mental deutlich normalerer Verfassung als ihre in den Rollen von Ärzten und Pflegern auftretenden Gefängniswärter. Die Tätigkeit des Psychiaters besteht darin, den als Patienten deklarierten, wild schreienden, in Zwangsjacken gefesselten Gefangenen hinterrücks per Spritze oder Zwangsmaßnahmen Unmengen von Psychopharmaka zu verabreichen, die zwar völlig wirkungslos für die psychische Gesundung von Menschen sind, dafür aber ein schier unendliches Spektrum schrecklicher Nebenwirkungen verursachen.
Diese zwei Bilder der Tätigkeit von Psychiatern sind gewissermaßen Tradition, sie werden immer wieder repliziert und voneinander kopiert, in Kunstwerken wiederholt und somit perpetuiert. Seit 1971 vergeht kein Jahr in Deutschland, in dem nicht mindestens ein »Tatort« seinen zehn Millionen Zuschauern eines dieser Klischees über Psychiatrie bestätigt. Bis heute kannst du einer Filmproduktionsfirma kaum eine Geschichte anbieten, in der eine psychische Krankheit vorkommt, wenn nicht mindestens eines der landläufigen Stereotype darin bestätigt wird. Besonders übel ist daran, dass nebenbei auch die psychisch Kranken stigmatisiert werden. Denn in beiden Klischees ist ihre Krankheit nicht echt und nicht behandlungsbedürftig.
Ich war einige Jahre in unserer Klinik als Ansprechpartner für die Öffentlichkeit zuständig. Ich weiß gar nicht, wie viele Anfragen von Produktionsfirmen ich bekam, bei welcher Firma wir denn unsere Zwangsjacken beziehen würden. Im Internet hatten sie wohl nichts gefunden. Wenn ich ihnen sagte, dass ich Zwangsjacken nur aus Filmen über die Psychiatrie, nicht aber aus der Psychiatrie selbst kennen würde, war ihre Enttäuschung fühlbar. Vielleicht dachten sie, dass unsere wahre Bezugsquelle geheim sei. Es ist schon gruselig, wie schlimm sich manche Filme die Psychiatrie wünschen, um sie dann dafür zu verurteilen.
In den Psychiatrien dieser Filme wird nie einem Menschen geholfen. Hier werden nur Gesunde krank gemacht und psychisch Kranke noch stärker in ihr Leid gestürzt. Das alles ist ärgerlicher Unsinn, denn bei allen Schwierigkeiten und Grenzen unserer Arbeit können wir schon sehr vielen Patienten gut und sehr gut helfen. Und wenn nur ein suizidaler Patient wegen dieser Filmklischees und Klischeefilme nicht zum Psychiater geht, dann ist das ein Mensch, dem wir lieber geholfen hätten.
In meiner Familie gibt es Mathematiker und Physiker und vermutlich leben zumindest zusammengenommen genauso viele Mathematiker und Physiker wie Psychiater in Deutschland. Doch ihnen gegenüber hat niemand Vorurteile über ihre Arbeit oder darüber, was für Menschen diese Berufe ausüben. Denn neben Vorurteilen über unsere Arbeit gibt es noch einen Riesensack an Vorurteilen über Psychiater selbst, insbesondere das eine: Wir sind nämlich allesamt selbst verrückt.
Vorurteile haben trotz ihres schlechten Rufs überraschend viele Vorzüge. Auch wenn wir gern anders von uns denken, blickt doch fast jeder von uns mit vielen, vielen Vorurteilen auf die Welt. Statt uns aufgrund der detaillierten Analyse aller vorhandenen Fakten und Informationen unsere Meinung zu bilden, beurteilen wir Personen und Situationen aufgrund vorher gemachter Erfahrungen. Wir grübeln nicht stundenlang, ob wir auf die Argumente eines schwer Betrunkenen eingehen sollen, der gerade die Relativität der Zeit infrage stellt, sondern entfernen uns möglichst weit von ihm. Dabei ist nicht auszuschließen, dass er hochinteressante Erkenntnisse mit uns teilen könnte, aber wir haben Vorurteile ihm gegenüber und dem, was er so in diesem Zustand von sich gibt. Vorurteile sparen jede Menge Zeit, die man sonst für Betrachtung und Analyse verwenden würde.
Ich hatte einmal das Privileg, die Abschlussveranstaltung zum Psychiatriekurs vor einem ganzen Jahrgang von Medizinstudentinnen zu halten. Ich zeigte Filmbeispiele psychischer Störungen aus der Fernsehserie Die Simpsons und erläuterte deren diagnostische Einordnung. Die Idee dahinter war, das in den vergangenen Wochen Gelernte auf humorvolle Weise zu vertiefen. Nachdem sich die Studentinnen über die Veranstaltung gefreut zu haben schienen, bot ich an, noch abschließende Fragen für die bevorstehende Prüfung zu beantworten. Fragen, die sich in den letzten Kurswochen ergeben hätten, ohne dass die Studierenden diese Fragen hätten loswerden können. Nach einem längeren Schweigen ging schließlich eine Hand in die Höhe. Eine Studentin erhob sich in der letzten Reihe und fragte mich: »Wie kommt es eigentlich, dass alle Psychiater immer einen an der Klatsche haben?«
Zur Ehrenrettung des Jahrgangs muss ich sagen, dass die Mehrheit der Studierenden nach dieser Frage peinlich berührt war. Sicher nicht so peinlich wie ich, der ich zunächst einige Sekunden brauchte, meine Emotionen zwischen Wut und Weglaufwunsch wieder in den Griff zu bekommen. Im Grunde hatte sie damit auf vielfältige Weise unter Beweis gestellt, dass sie das Kursziel nicht erreicht hatte. Erstens hatte sie noch nicht genügend Psychiaterinnen und Psychiater kennengelernt, die vollkommen unauffällig durch das Leben gehen, zweitens hatte sie nicht verstanden, dass psychische Krankheiten so wie alle anderen Erkrankungen nicht zum Stigmatisieren der betroffenen Menschen verwendet werden sollten. Und drittens fragte ich mich, ob es nicht heißen musste: » … eine Klatsche haben …« denn zumindest in meiner Jugend war das der Ausdruck für »verrückt sein« und wenn man ohnehin schon »eine Klatsche hat«, was sollte es dann bedeuten, an ebenjener Klatsche auch noch etwas zusätzlich zu haben. Das wäre ja so, als ob man einen Garten an der Datsche hätte, einfach eine Tautologie. Gerade den semantischen Teil meiner Kritik wollte ich mit der jungen Kollegin lieber nicht besprechen, denn das hätte sie in ihrer Einschätzung vermutlich noch bestärkt.
Es gibt wohl kaum Vertreter anderer Berufe, die sich derart unverhohlen plumpe Ressentiments anhören müssen. Außerdem sollte man sich allein in Hinblick auf schriftliche Prüfungen merken, dass praktisch jede Aussage über Angelegenheiten des Menschen, in denen die Worte »immer«, »alle«, »nie« und »keiner« vorkommen, falsch sind. Ich merke es mir so: »Sätze mit immer, nie, alle und keiner stimmen alle immer nie und keiner von ihnen ist richtig.« Das ist zwar wenig elegant formuliert, aber Eselsbrücken mit kleinen Schönheitsfehlern kann man sich leichter merken als solche ohne. Auch das war eben eine Eselsbrücke, aber die mit »immer« und »nie« können Sie sich bestimmt leichter merken, oder?
Ich frage mich natürlich häufig, wie es eigentlich kommt, dass Psychiaterinnen und Psychiater solchen Vorurteilen ausgesetzt sind. Dazu habe ich zwei Hypothesen: Erstens ist das Vorurteil einfach falsch, so wie die meisten gruppenbezogenen Vorurteile im konkreten Fall unzutreffend sind. Und jeder Psychiater, den irgendeiner kennt, vorzugsweise die Cousine der Nichte eines Arbeitskollegen, der sich auffällig verhält oder verhalten hat, wird gern, dauerhaft und überregional für dieses Vorurteil herangezogen. Und es findet natürlich bei Psychiatern besondere Beachtung, wenn sie sich psychisch auffällig verhalten, ähnlich wie einem die schlechte Haut einer Dermatologin sofort ins Auge fiele. Außerdem braucht jeder einen guten Grund, warum er einen bestimmten Dienstleister nicht mehr aufsucht. Der Friseur schneidet die Haare schlecht, das Gemüse des Händlers ist nicht mehr frisch, die Tabletten des Internisten helfen nicht gut, aber was soll man schon vom Psychiater sagen?
Dass man selbst ein ungepflegtes Individuum sein könnte, das die Pflegehinweise des Friseurs in den Wind schlägt, das das wenige Gemüse falsch lagert und nicht isst und lieber vergammeln lässt und das die Tabletten gegen den hohen Cholesterinspiegel vorzugsweise mit Bauernfrühstück oder Sahnetorte verzehrt – wer möchte darüber schon nachdenken? Nur was könnte der Fehler der Psychiaters sein? Er ist natürlich selbst verrückt, darum haben seine Ratschläge gegen die Alkoholabhängigkeit kein bisschen geholfen.
Zweitens glaube ich, dass wir Psychiaterinnen und Psychiater sehr viel mit dem Thema psychische Normalität zu tun haben. Dadurch haben wir gelernt, dass die psychische Normalität viel weiter gefasst ist, als es die meisten Menschen wahrhaben wollen. Ist man beispielsweise überzeugt, ein Gesandter des Planeten Mars auf der Erde zu sein, und folgt aus dieser Überzeugung kein Problem für den Marsmenschen selbst oder seine Mitbewohner hier auf der Erde, außer dem Umstand, dass ihm die Mehrzahl der Erdmenschen widersprechen wird, so ist das aus psychiatrischer Sicht nicht unbedingt ein behandlungsbedürftiger Zustand.
»Na, hören Sie mal, das ist doch nicht normal!«, wird einem der eine oder die andere Angehörige wütend entgegenschnauben. »Da müssen Sie doch was machen. Ich denke, Sie sind Psychiater!«
Doch wir können da nur mit den Schultern zucken. Nach Ansicht der meisten Menschen ist das sicher nicht normal, aber es ist die Art von Unnormalität, für die wir uns nicht zuständig fühlen. Schließlich behandeln wir Patienten, also Leidende, und wenn die Menschen nicht leiden, fühlen wir uns in der Regel nicht bemüßigt, ihnen zu helfen, von welchem Planeten sie nun auch kommen mögen.
Durch unseren Umgang mit der Normalität des menschlichen Miteinanders und ihren Außenbereichen haben vielleicht einige von uns die Schamhaftigkeit gegenüber unseren eigenen Schwächen abgelegt. Ein Kollege von mir kam zum Beispiel täglich mit zwei Hunden der Rasse Mops zu seinem Arbeitsplatz, ich möchte hier auf die sich nahezu zwangsläufig ergebenden Wortspiele verzichten, ich bin mir sicher, dass er sie alle schon mehrfach gehört hat. Ich selbst spiele mit meinen Patienten gern Bop it!, ein Spiel, bei dem man gegen einen ziemlich hässlichen Plastikklotz schlagen muss, und bestimmt habe ich noch weitere Macken, die ich nicht einmal in der Lage bin zu erkennen. Legt man nun eine sehr engherzige Lesart von Normalität zugrunde, so kann man vielleicht tatsächlich zu der Schlussfolgerung kommen, dass Psychiater alle selbst nicht normal seien. Aber das liegt mehr im Auge des Betrachters als im Gegenstand seiner Betrachtungen. Es hängt mit kognitiver Dissonanz zusammen, über die später noch zu reden sein wird.
Wer sind also meine Patientinnen und Patienten, wenn sie weder hobbylose Milliardärsgattinnen noch schreiende Psychomörder sind? Ich bekomme diese Frage oft gestellt und meine spontane Antwort war lange: »Menschen wie du und ich.« Aber ich musste feststellen, dass diese Antwort mein Gegenüber verunsicherte, ich glaube vor allem das Wort »Du« darin. Also versuchte ich es mit: »Ganz normale Menschen.« Dabei scheint es sich jedoch um ein Paradoxon zu handeln, denn warum sollten sich »ganz normale« Menschen in psychiatrische Behandlung begeben?
Wenn es einen einzigen Begriff gibt, mit dem ich als Psychiater ein besonderes Problem habe, dann ist es das Wort normal. Und dabei geht es noch nicht einmal um dieses Wort, gern würde ich Menschen im Allgemeinen und meinen Patienten im Besonderen bestätigen, sie seien normal. Das Problem besteht für mich darin, dass dieser Begriff eine Dichotomie, eine Zweigeteiltheit der Welt impliziert, die ich nicht teile, nämlich in Dinge auf dieser Welt, die normal sind, und eben Dinge, die unnormal sein sollen. Ich finde diese Zweiteilung sehr problematisch und unvorteilhaft. Denn wer genau sollte entscheiden dürfen, wo diese Grenze verläuft? Meiner Meinung nach sollten das weder Politiker noch Psychiater sein. Die Politik sollte definieren, welche Verhaltensweisen nicht akzeptabel für ein verträgliches gesellschaftliches Miteinander sind, und die Psychiatrie sollte denen helfen, die unter ihrem Verhalten oder dem ihrer Mitmenschen leiden.