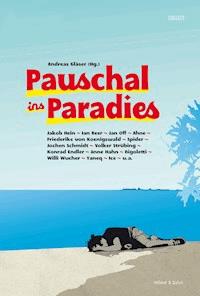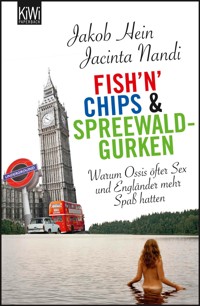9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als hätten sich Felix Krull und Zelig zusammengetan, um Berlin aufzumischen. Friedrich Benders Elternhaus ist nicht eben das spannendste. Und eine Jugend in der DDR nicht unbedingt ein wildes Abenteuer. Aber es kommt Farbe in die Sache, als Friedrich im Ferienlager mit der Tochter von englischen Kommunisten anbandelt, die nicht nur Westlerin ist, sondern – Gipfel der Verruchtheit! – auch noch Punk. In den Augen seiner Mitschüler macht ihn das zum neidisch beäugten Star. Der kleine Haken: Die Punk lady gibt es gar nicht. Friedrich Bender hat sie sich nur ausgedacht. Weil das aber niemand wissen muss, besorgt er sichbeim Briefmarkenhändler in Berlin-Lichtenberg englische Briefmarken und bekommt nun regelmäßig Post von der Insel. Auch die unglaublichen Erfolge des Sozialismus, die er als Agitator täglich vor der Klasse vermelden soll, hat er etwas aufgeschönt oder gleich glatt erfunden. Und während die Wende seine linientreuen Eltern und die meisten seiner Klassenkameraden in jahrelange Schockstarre versetzt, begreift Friedrich die neuen Regeln schnell: Schon bald findet man den Jungen mit dem kreativen Verhältnis zur Realität bei den Wechselstuben am Bahnhof Zoo, wo er sich ein mehr als sattes Star tkapital beschafft. Als Student schrecken ihn überfüllte Hörsäle und zähe Seminare dermaßen ab, dass er sich einen anderen Weg ausdenkt, zum schnellen Studienabschluss zu kommen. Und im Berufsleben des kapitalistischen Westens scheinen Friedrich dann gar keine Grenzen mehr gesetzt ... Jakob Hein hat einen grandiosen Schelmenroman über einen Ostler geschrieben, der der bessere Westler ist. Aber auch über jemanden, der mit erfundenen Geschichten so lange vor sich selbst davonläuft, bis nichts mehr von ihm da ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Jakob Hein
Kaltes Wasser
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jakob Hein
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jakob Hein
Jakob Hein, geboren 1971 in Leipzig, lebt seit 1972 mit seiner Familie in Berlin. Er arbeitet als Psychiater. Seit 1998 ist er Mitglied der »Reformbühne Heim & Welt«. Er hat inzwischen 15 Bücher veröffentlicht, darunter »Wurst und Wahn« (KiWi 1281) sowie zuletzt »Fish’n’Chips & Spreewaldgurken« (KiWi 1321) mit Jacinta Nandi.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Friedrich Benders Jugend in der DDR ist nicht gerade ein wildes Abenteuer. Doch dann bandelt er im Ferienlager mit der Tochter von englischen Kommunisten an, die auch noch Punk ist. Für seine Mitschüler macht ihn das zum Star. Der Haken: Er hat sich die Punklady nur ausgedacht. Die Briefe von der Insel hat er selbst geschrieben. Auch die Erfolge des Sozialismus, die er täglich vor der Klasse vermelden soll, hat er oft glatt erfunden. Nach der Wende begreift Friedrich die neuen Regeln schnell: Schon bald ist er bei den Wechselstuben am Bahnhof Zoo zu finden, wo er sich ein sattes Startkapital beschafft. Er merkt: Für Schwindler ist der Westen das Paradies. Und nun beginnt der Spaß erst richtig …
»Ein temposcharfer, detailgesättigter Schelmenroman mit Querbezügen zu Tom Sawyer, Till Eulenspiegel und Thomas Brussig. Eiserner Vorhang auf und alle Fragen offen. Nichts gilt mehr, also gilt es zu handeln« Sächsische Zeitung
»Immer wieder sehr, sehr komische, sehr, sehr lustige Geschichten.« RBB
»Ein Loblied auf die Erfindung der eigenen Biografie« Tip
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Erforschte Gewässer
Sozialistischer Surrealismus
Aufgaben der Sozialisten
Kunst der Leidenschaften
Umschwünge
Beschlüsse
Tauschgeschäfte
Positionsfindung
Operation Daedalus
Sehenswürdigkeit sein
Allein gestellt
Scheinwelt
Grade der Sterblichkeit
Marian Keechs Uhr
Dramatisches Universum
Durkheims Neigungen
Leicht auf den Füßen
Dogma
Läuterungsberg
Zur Quelle zurück
Für die 10/3 Ursulinum Osnabrück –
Like a Prayer forever!
Erforschte Gewässer
Mein Leben begann als statistische Ausnahme. Denn nach der geplanten Wunschgeburt von Pia wollten meine Eltern kein Kind mehr haben. Sie waren zu sehr mit ihren Karrieren beschäftigt und hatten anlässlich der Geburt meiner Schwester herausgefunden, dass eigene Kinder nicht unbedingt ihre Sache waren, auch wenn sich der Staat, dem sie äußerst wohlwollend gegenüberstanden, von seinen Bürgern zahlreichen Nachwuchs erhoffte. Mein Vater arbeitete Tag und Nacht an seiner Promotion, meine Mutter war viel beschäftigte Kaderleiterin der Halloren Schokoladenfabrik.
Sie bemühten sich redlich, kein weiteres Kind zu bekommen, und redeten sich, was ihr Bemühen um Geburtenkontrolle betraf, damit heraus, dass sich der Staat ohnehin vor allem Kinder aus den Reihen des herrschenden Proletariats wünschte und nicht aus denen der Intelligenz, der sie mittlerweile zugehörig waren. Allerdings war an meinen Eltern vorbeigegangen, dass ebenjener Staat längst festgestellt hatte, dass nur aus den Kindern von Ingenieuren und Forschern die dringend benötigten neuen Forscher und Ingenieure wurden, während aus den vielen Arbeiterkindern zum Teil Arbeiter wurden, zum Teil aber nicht einmal das, sodass also doch auch Kinder von der Intelligenz gewünscht wurden. Sonst hätte meine spätere Mutter vielleicht von vornherein nicht täglich eine dunkelgrüne Tablette nach dem abendlichen Zähneputzen eingenommen, die eigentlich meine Entstehung verhindern sollte.
Nach dem Biologen Raymond Pearl ist ein Index benannt, der berechnet, wie viele sexuell aktive Frauen im Lauf eines Jahres schwanger werden. Ohne jegliches Verhütungsmittel passiert das fünfundachtzig von hundert Frauen, bei der Kalendermethode neun von hundert Frauen, bei regelmäßiger Einnahme von Ovosiston nur einer Frau von hundert. Diese eine brachte mich am Tag der Republik, dem 7. Oktober 1971, im grünlichen Neonlicht des Kreissaals 2 des Klinikums Kröllwitz der Stadt Halle an der Saale zur Welt. Und nannte mich Friedrich. Zwar zog unsere Familie kurz nach meiner Geburt in die Hauptstadt Berlin, aber das änderte nichts daran, dass »Halle« auf meiner Geburtsurkunde dokumentiert wurde. Halle an der Saale – Salzstadt, Hansestadt, westfälische Stadt, preußische Stadt, Bezirkshauptstadt. Oder, für meine Berliner Mitschüler: »Sachsen«.
Mit meiner Schwester hatte ich nie viel zu tun. Sie war zu anders, zu alt. Als Pia schon in der dritten Klasse war, ging ich noch in den Kindergarten. Als ich dann in der dritten Klasse mit Plastikfiguren spielte: Indianer, Cowboys, ein Fort aus kleinen dunkelbraunen, halbrunden Holzstäben, war sie in der siebten Klasse: Schminke, Disko, Jungs. Wenn Pia mal weg war, kramte ich gern in ihrem Schreibtisch herum. Ihre Tagebücher interessierten mich dabei nicht im Mindesten, ich untersuchte mit archäologischem Interesse die fremdartigen Gegenstände in ihrem Zimmer. Ein paar bunte Glaskugeln, schöne Stifte, ein Album mit Lackbildern. Besonders gern hatte ich eine bulgarische Dose aus dunkelbraunem, lackiertem Wurzelholz, verschlossen von einem Deckel mit einem kleinen Kegelgriff, in der Pia ein sogenanntes Natternhemd aufbewahrte, ein Souvenir von einem Urlaub am Schwarzen Meer. Mich faszinierte die Konsistenz der abgestreiften Schlangenhaut, irgendwas zwischen Leder und Papier, und das eindeutig Leblose, das einmal eindeutig zu etwas Lebendigem gehört hatte.
Pia, das große Vorbild. In meiner Erinnerung hatte sie in den zwölf Jahren ihrer Schulkarriere nicht viel mehr als eine oder vielleicht zwei Zweien auf ihren Zeugnissen. Eins, Eins und immer wieder Eins in Deutsch, Mathe, Sport, aber auch in Betragen, Ordnung, Mitarbeit. Jedes Jahr wurde ihr das Abzeichen »Für gute Arbeit in der Schule« vor der versammelten Schülerschaft angesteckt. Gerade als Junge konnte man praktisch niemals so gut sein.
Das widersinnige Ziel der Ostschulen bestand darin, alle Schüler zu überdurchschnittlich guten Leistungen zu führen, und zwar egal wie lange das dauerte. Im Unterricht war es mir oft so vorgekommen, als ob die ganze Klasse warten musste, bis auch Mirko Lehmann so viel vom Thema verstanden hatte, dass er endlich als überdurchschnittlich gut bewertet werden konnte. Trotzdem fanden sich auf meinen Zeugnissen auch Zweien, manchmal sogar eine Drei. Schönschreibung und Sport waren kritische Fächer, später Chemie und Kunst. Nach der Wende waren Einsen seltener auf dem Zeugnis, weil im neuen Schulsystem nur noch eine kleine Zahl von Schülern überdurchschnittliche Leistungen erbrachte. Das war zwar logischer, für mich aber auch bedauerlich. Für Mirko Lehmann wären die Auswirkungen dieser Logik vielleicht noch stärker gewesen, doch er hatte die Schule schon nach der zehnten Klasse verlassen.
Als ich noch nicht einmal ein Jahr alt war, bekam mein Vater eine Assistentenstelle an der Humboldt-Universität in Berlin. Berlin, Hauptstadt der DDR – das große Los! Viele wollten dorthin ziehen, wenigen war es vergönnt. Die sogenannte Versorgungssituation galt in der Hauptstadt als besser. Zwar selten, aber immerhin gab es hier Südfrüchte, Autoersatzteile und sogar Spezialitätenrestaurants. Wer in der DDR etwas werden wollte, landete früher oder später in einer der vierzehn Bezirkshauptstädte, aber die wichtigste Stadt war Berlin, der einzige kreisfreie Bezirk des Landes. Wir zogen in den Ostberliner Osten, in die Charlottenburger Straße in Berlin-Weißensee. Dreistöckige Häuser, viel Grün, drei kleine Seen. Was unser Straßenname zu bedeuten hatte, das wusste damals niemand.
Die Erinnerungen an meine ersten Jahre in Weißensee sind unspektakulär: Kindergarten, Spaziergänge, Ausflüge, Kumpels. Dann Schule, Klassenfahrten, Klingelstreiche. Ich war immer davon überzeugt, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Gern spielte ich »oben«, mein Zimmer war jahrelang ein einziges Westernpanorama, in dem die Indianer einen Sieg nach dem anderen davontrugen. So war das in den Filmen, durch die Gojko Mitić als gutherziger Dakotahäuptling mit zum Horizont gerichtetem Blick ritt, und so war es auch bei mir.
Aber meine Mutter schickte mich mindestens einmal täglich nach draußen, »an die frische Luft«. Hier »unten« auf der Straße spielte ich mit den anderen Kindern Bande oder Kante. Bei »Bande« sprachen wir einander mit Indianernamen an und schossen dann mit Gewehren aus Holz, Plastik oder Luft aufeinander. Wer getroffen war, musste bis zehn zählen und durfte dann wieder weitermachen. Wir stritten natürlich endlos über die Frage, ob jemand tatsächlich bis zehn gezählt hatte oder getroffen worden war, da ausschließlich mit imaginärer Munition geschossen wurde. Es kam nicht nur darauf an, gut zu zielen, sondern auch gut zu argumentieren.
Für »Kante« standen zwei Spieler auf gegenüberliegenden Bürgersteigen. Drei Punkte bekam, wer den Ball so an die gegenüberliegende Bordsteinkante warf, dass er den zurückspringenden Ball direkt wieder auffangen konnte. Nur einen Punkt gab es, wenn der Ball zwischendurch auftippte. Landete der Ball direkt in den Händen des Gegenspielers, konnte dieser Punkte machen. Es gab so wenige Autos, dass es ein viel größeres Problem war, drei Punkte zu machen, als einen geeigneten Straßenabschnitt zu finden. Ganz selten mussten wir ein Spiel unterbrechen, um ein Auto durchfahren zu lassen. Nur waren die wenigen Autos sehr wertvoll, wir mussten unbedingt aufpassen, dass der Ball nicht gegen eines der Autos prallte.
Meine Eltern waren streng, wobei mir das nie besonders schlimm vorgekommen war. Sie hatten klare Leitlinien und wussten, was sich gehörte und was verboten war. Im Haushalt hatte jeder seine Aufgaben: Meine Mutter kochte, mein Vater kaufte ein, wir Kinder waren beide für den Abwasch zuständig und ich noch dafür, den Mülleimer regelmäßig in die von der Braunkohleasche ocker gefärbten Blechtonnen auf dem Hof zu leeren und oben wieder mit altem Zeitungspapier auszuschlagen. Ich durfte Altpapier und leere Flaschen wegbringen und bekam dafür Geld. Einmal in der Woche gab es Brause mit Maracuja-Geschmack, sonst Tee. Dabei war es aus weltanschaulichen Gründen betont gleichgültig, an welchem Wochentag wir Brause tranken, obwohl es dann doch meist der Sonntag war.
Meine Eltern lasen die Parteizeitung und als Familie sahen wir nur das Ostfernsehen. Wenn meine Eltern noch auf der Arbeit oder wir Kinder schon im Bett waren, dann wurden auch die Westsender geschaut, aber zusammen machten wir das nicht. Lediglich Westradio hörten meine Eltern auch vor uns. »Man muss sich ja informieren, was der Klassenfeind so denkt«, kommentierte mein Vater sein Tun, wenn er die Nachrichten im Deutschlandfunk gehört hatte, die immer mit dem Satz endeten: »So weit die Meldungen.« Dieser Satz aus dem Radio in unserer schwach beleuchteten Küche, während ich das Geschirr abtrockne und mein Vater noch auf seinem Platz am Küchentisch sitzt und nach Juno Format 100 Filter und Schweiß riecht – das war meine Kindheit.
Hatten wir Bauchschmerzen oder Durchfall, musterte uns meine Mutter mit ernstem Blick. Wenn es wirklich schlimm war, ging sie mit uns die paar Meter zur Poliklinik in der Schönstraße hinüber.
Als Pia in die dritte Klasse gekommen war und jeden Dienstagvormittag drei Stunden Schwimmunterricht in der Schule hatte, erzählte sie dienstags am Abendbrottisch von den Umkleidekabinen, vom Chlorwasser und von den Schwimmabzeichen. Nach zwei oder drei Dienstagabenden hatte ich genug und begann, auch von meinem Schwimmunterricht zu erzählen, von den Kabinen, dem Wasser und den Abzeichen. Unsere Eltern amüsierten sich zunächst über meine kindlichen Prahlereien und anfangs hörte auch Pia mit einer leicht belustigten Verstimmung zu. Ihr kleiner Bruder ging schließlich noch in den Kindergarten und war nur in den Ferien ein paarmal in der Schwimmhalle gewesen, richtig schwimmen konnte er ganz gewiss nicht. Die Berichte meiner abenteuerlichen Erlebnisse in der Schwimmhalle rückten Dienstag für Dienstag mehr in den Mittelpunkt, gerade weil ich sie so farbenfroh erzählte. Und Pia wurde von Woche zu Woche wütender. Was man bei ihr als Lüge bezeichnet hätte, galt bei mir als Fantasie. Es machte Pia rasend, dass ihr kleiner Bruder nicht von seinen Schwindeleien lassen wollte und es wagte, ihr das allein einer Drittklässlerin zustehende Revier der Schwimmhalle in den Gesprächen am Abendbrottisch streitig zu machen.
Pia begann, Widerspruch einzulegen, mir zu sagen, dass ich mir diese Geschichten nur ausdenken würde. Doch ich ließ mich nicht beirren, beharrte auf meinen Berichten, rückte keinen Millimeter ab, bis Pia eines Abends explodierte: Das alles ginge zu weit. Auch ich müsse einsehen, mit solchen Märchen eine Grenze zu überschreiten, ich sei noch zu klein, um schwimmen zu können, und würde im Wasser ohne Hilfe binnen Kurzem jämmerlich ertrinken. Doch ich sah nichts ein, sodass Pia wutschnaubend forderte, dass wir am nächsten Wochenende gemeinsam zur Schwimmhalle gingen. Ich sollte die Gruppe führen, die Umkleidekabinen zeigen und vor allem meine Schwimmkünste beweisen. Scheinbar völlig gleichgültig stimmte ich zu und auch meine Eltern ließen sich für den Familienfrieden auf diese Lösung ein.
In gewisser Weise begann mein eigentliches Leben an diesem Sonntag, an dem es ebenso gut vorzeitig hätte enden können. Den Weg zur Schwimmhalle in unserem Wohngebiet zu finden, war nicht schwer. Die richtigen Umkleidekabinen zu finden, mich selbstständig auszuziehen und zu duschen, war ebenfalls keine besondere Herausforderung. Wir waren schon oft gemeinsam in der Schwimmhalle gewesen und überall erklärten Piktogramme das Notwendige. Aber am Rand des zwei Meter tiefen Schwimmerbeckens fühlte sich meine Badehose besonders nass und besonders kalt an, drückte mich die hellgrüne Badekappe. Mein Vater stand zwei Meter neben mir, vermutlich bereit für einen Rettungssprung, meine Mutter schaute ängstlich und Pia konnte den Moment ihres Triumphes kaum erwarten.
Ich ließ mich einfach fallen.
Kopfüber warf ich mich in das Schwimmerbecken, selbst gespannt, was passieren würde. Sekundenbruchteile war ich unter Wasser, dann paddelte ich mich hoch und sah meine Familie da stehen. Meine Eltern schauten immer noch bange und Pia hielt die Luft an, als wäre sie und nicht ich ins Wasser gesprungen. Doch ich blieb oben und mehr noch: Ungelenk und technisch unvollkommen, paddelnd wie ein Hund schwamm ich die ganzen fünfundzwanzig Meter der Bahn bis zu ihrem Ende. Ich stieg aus dem Wasser und ließ mir im Gegensatz zu meinen Eltern die Überraschung nicht anmerken. Vater nahm mich stolz in Empfang, meine Mutter war vor Rührung den Tränen nah. Nur Pia kochte vor Wut.
Als meine verdutzten Eltern am nächsten Tag im Kindergarten fragten, ob denn dort ohne ihr Wissen Schwimmunterricht stattgefunden habe, schüttelten die Erzieherinnen nur erstaunt den Kopf. Warum ich plötzlich schwimmen konnte, wurde niemals aufgeklärt. Nicht mal ich selbst habe das jemals herausgefunden.
Sozialistischer Surrealismus
Ging mein Vater morgens zur Arbeit, trug er stets ein Hemd und einen Anzug. Im Sommer waren die Anzüge hellgrau und er trug einen Anorak darüber, im Winter waren es dunkle Anzüge mit einer Jacke aus braunem Leinen mit einem eingeknöpften Kunstpelzfutter. Zu den Anzügen trug er Kunststoffhemden, die man nicht bügeln musste. Dafür aber roch er stark unter den Hemden, wenn er abends nach Hause kam. Er stellte dann seine Aktentasche auf den Stuhl im Flur, legte seinen Hut auf die Ablage der Garderobe und ging in sein Zimmer, wo er das Jackett auf einen Bügel hängte. Vater trug niemals eine Krawatte, er betrachtete sie als Symbol von Bürgerlichkeit und Dekadenz. An den Abenden warmer Tage verbreitete sich im Flur ein beißender Schweißgeruch, sobald mein Vater das Jackett abgelegt hatte. An den Wochenenden trug er karierte Baumwollhemden, über die er im Winter einen Pullover mit V-Ausschnitt zog.
Was der Vater auf der Arbeit machte, verstand ich nicht genau, ich konnte nur den jeweils aktuellen akademischen Grad meines Vaters wiedergeben: Erst war er Assistent, dann Dozent, dann hatte er eine B-Promotion, schließlich war er Professor. Ich verstand es so, dass er ähnlich gut an der Universität sein musste wie Pia in der Schule. Wenn mich andere Kinder fragten, sagte ich einfach, mein Vater sei Professor, und fand, das klang gut.
Meine Mutter blieb auch in Berlin Kaderleiterin, statt den der Hallenser Schokoladenfabrik leitete sie nun den Kader von Berlin Chemie in Adlershof. »VEB ist VEB«, war ihr einziger Kommentar dazu. Kaderleiterin zu sein war eine ziemlich mächtige Stellung. Sie war für die Besetzung der Arbeitsplätze verantwortlich und auch dafür, dass sich die Angestellten politisch konform verhielten. Wenn jemand im Kollegenkreis einen politischen Witz erzählte oder eine allzu kritische Bemerkung machte, musste er zum Gespräch mit dem Parteisekretär des Betriebs und meiner Mutter.
Partei bedeutete die Partei. Obwohl es aus scheindemokratischen Gründen sogar noch ein paar andere Parteien gab, war die maßgebliche Partei, die Partei, die in allen Betrieben, Schulen und Kasernen das Sagen hatte, die Partei der Regierung, die Partei der Karrieristen, die Staatspartei. Die Partei, die man meinte, wenn man von der Partei sprach. Sie war auch die Partei meiner Eltern.
Meine Mutter hatte mir schon als kleinem Jungen erzählt, dass sie mit siebzehn Kandidatin und am Tag ihrer Volljährigkeit volles Parteimitglied geworden war. Das war eine seltene, nur absolut linientreuen Jugendlichen vorbehaltene Ehre. Schon in den ersten Grundschuljahren hatte ich immer wieder Probleme mit der eng begrenzten Duldsamkeit meiner Lehrerinnen, sodass mir persönlich ein besonders konformes Verhalten weder erreichbar noch erstrebenswert erschien. Mein Vater war während seines Armeedienstes in die Partei eingetreten, spätestens mit Beginn seines Studiums hätte er sowieso eintreten müssen, denn Marxismus-Leninismus war ein Studium, für das nur Parteimitglieder zugelassen wurden. Man hatte gewissermaßen den Eingangstest für dieses Studium nicht bestanden, wenn man nicht Parteimitglied war. Außerdem konnten die Studenten auf diese Weise im Notfall immer mit der Parteiräson dazu gezwungen werden, allen philosophischen Ableitungen so zu folgen, wie die Partei sie vorgab.
Genau genommen war Marx ein Philosoph wie Demokrit oder Kierkegaard, aber im gesamten Ostblock wurde seine Philosophie so interpretiert, als müsse man sie als Gebrauchsanweisung für ein Staatswesen verstehen. Die Anhänger dieses Wahrheitsanspruchs nannten sich nicht Marxianer, so wie es Kantianer oder Hegelianer gab, sondern bezeichnenderweise wie Glaubensanhänger Marxisten. Karl Marx selbst hatte noch zu seinen Lebzeiten Wert auf die Feststellung gelegt, kein Marxist zu sein.
Aus den endlosen Erläuterungen meines Vaters bekam ich den Eindruck, dass die Marxisten ein wesentliches Detail übersehen hatten. Schließlich war Marx davon ausgegangen, dass die unterdrückten Proletarier sich im Rahmen einer Weltrevolution auflehnen müssten, um dann eine neue, gerechtere Gesellschaft aufzubauen. Aber diese Weltrevolution hatte doch einfach noch nicht stattgefunden. Wenn man Marx als Gebrauchsanweisung verstehen wollte, hätte man doch zunächst gewissermaßen den Hauptschalter betätigen müssen.
Weil das nicht gelungen war und somit die Marx’schen Thesen nicht in die graue Realität passten, wurden sie eben bis zur Unkenntlichkeit modifiziert – ein wenig so, als ob die kühnen Entwürfe eines Architekten nicht in die gängige Arbeitspraxis der beteiligten Handwerksunternehmen passen, aber trotzdem ein Haus gebaut werden soll. Passt, wackelt und hat Luft. Am Ende steht auf dem Grundstück eine Bude, die nichts mehr mit den Vorstellungen des Architekten zu tun hat. Die Rolle des pragmatischen Bauleiters übernahm Lenin. Und weil die sozialistischen Länder sowieso dem sowjetischen Vorbild nachempfunden werden sollten und genau wie der große Bruder im ständigen Zweikampf mit der schrecklichen Realität standen, kam es dazu, dass »Leninismus« auch in Ostdeutschland ein unverzichtbarer Bestandteil der Staatsideologie wurde.
Lenins Beitrag zur Weltphilosophie scheint darin bestanden zu haben, dass er die berühmteste Feuerbach’sche These von Karl Marx radikal weiterentwickelt hatte: »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie erst zu verändern und dann zu interpretieren.« Der russische Revolutionsführer entwickelte darauf basierend etwas, das man Epiphilosophie nennen könnte: Er schuf zuerst die Realität nach seinen Möglichkeiten und schrieb dann die theoretische Grundlage dazu. Auf diese Weise kam es zu einer nahezu perfekten Übereinstimmung von Theorie und Realität. Nachdem man die Erwartungen massiv heruntergeschraubt hatte, wurde man gelegentlich sogar positiv überrascht. Das war der große Leninismus: Erst wurschtelte man mit dem vorhandenen Baumaterial irgendein Haus auf das Grundstück und bat dann den Architekten, einen passenden Bauplan zu zeichnen, um damit zu belegen, dass der ganze Bau exakt nach Plan gefertigt worden war. Gefahr bestand nur bei Fehlern in der Statik, wenn das Haus zusammenkrachte, war es schwer, auch das noch als geniale Planungsleistung zu verkaufen. Obwohl sie ständig in der Schule davon sprachen, wusste nach meiner Meinung kein Mensch, was Sozialismus ist, und vermutlich würde es auch nie jemand herausfinden, denn unsere eigentliche Staatsform war eben- jener Leninismus.
Meine Eltern waren niemals im Widerstand gegen die DDR und man muss ihnen zugutehalten, dass sie dies, im Gegensatz zu vielen anderen, auch später niemals von sich behauptet haben. Sicher lag es an meinen linientreuen Eltern, dass ich in der dritten Klasse von unserer Klassenlehrerin für das Amt des Agitators vorgeschlagen wurde. Die anderen Wahlämter in der Klasse waren: Gruppenratsvorsitzender, Stellvertreter, Lernbeauftragter und Kassierer. Ich hatte keine Einwände gegen meine Wahl, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen war, dass ich keinerlei Vorstellung davon hatte, was ein Agitator einer Klasse zu tun oder zu lassen hatte. In meinen Ohren klang es vage nach »Agent«, jemand, der sich unter die Feinde mischt und ihre Moral durch geschickt geführte Reden untergräbt. Erst viel später fand ich heraus, dass der Begriff auf einer groben Direktübersetzung aus dem Russischen und falsch verstandener Verbundenheit mit dem ruhmreichen Volk der Sowjetunion beruhte. Vielleicht klang »Agitator« im Russischen schmucklos kämpferisch, im Deutschen klang es pathetisch.
Die Realität des Agitatorlebens bestand leider, wie sich bald herausstellen sollte, nicht in konspirativen Einsätzen im westlichen Ausland, sondern darin, sich über die neuesten politischen Entwicklungen zu informieren und in regelmäßigen Abständen der Klasse eine Art Lagebericht zu geben. Es ging dabei nicht darum, zu berichten, was vermutlich geschehen war, sondern zu berichten, wie die Partei etwas Geschehenes wahrgenommen und auf bewährte leninistische Weise interpretiert hatte. Platons Höhlenmenschen bekamen ihre spärlichen Informationen immerhin auf direktem Weg, aber als Agitator hatte ich nicht darüber zu berichten, dass in China ein Sack Reis umgefallen war, sondern dass der allseitige Aufbau des Sozialismus zukünftig noch schneller vorangehen würde, was deutlich unterstrichen werde durch das gerade erfolgreich vollzogene, vorher jahrelang durch das Zentralkomitee der SED in enger Abstimmung mit den Genossen der KP China geplante Umfallen eines Reissacks in der chinesischen Volksrepublik.
Die einzige notwendige und letztendlich auch die einzige zulässige Quelle für diese sprechende Zeitung, die ich sein sollte, war das Neue Deutschland, Zentralorgan des Zentralkomitees der Partei. Weitere Informationen, schon aus der Berliner Zeitung, einem absolut linientreuen Blatt mit leicht regionaler Einfärbung, waren der Klarheit der Information eher abträglich. Zumal erschwerend hinzukam, dass meine Klassenkameraden alle ausschließlich Westfernsehen sahen und Westradio hörten.
Also nahm ich mir das Neue Deutschland, das meine Eltern als treue Genossen sowieso abonniert hatten, und bereitete meine Vorträge vor der Klasse vor. Damit es nicht zu langweilig wurde, begann ich bald, mich dabei eher auf die kleinen, ungleich interessanteren Nachrichten zu konzentrieren. Die Berichterstattung zu den Titelthemen wie der Sommerernte oder den alle vier Jahre stattfindenden Parteitagen waren derart undurchdringliche Nebelwände aus Worten, dass ich kaum einen Satz davon lesen konnte, ohne von bleierner Müdigkeit befallen zu werden. Denn insbesondere für Parteitage näherte man sich der idealen leninistischen Lösung: Die Delegierten verhielten sich während der Veranstaltung so drehbuchgemäß, dass die Berichterstattung darüber im Neuen Deutschland des nächsten Tages schon im Voraus verfasst werden konnte. Die Delegierten verhielten sich gewissermaßen bereits interpretiert. Selbst wenn der Generalsekretär seine Rede nicht gehalten hätte, hätten die Delegierten gewusst, wie sie diese Rede zu finden hatten und an welchen Stellen sie »nicht enden wollenden Applaus gemischt mit Hochrufen auf die Partei- und Staatsführung« spenden wollten, und selbst wenn sie sich nicht in dieses Muster gefügt hätten, hätte dies kein Jota an der Berichterstattung über die Wirkung der Rede geändert. Letztendlich war es nur noch für Fotos und Fernsehaufnahmen notwendig, dass sich die Abgeordneten zu diesen Ereignissen einfanden.
Wesentliche Informationen wurden damals vermittelt, indem bestimmte Dinge nicht geschrieben wurden. Wenn beispielsweise zur Erntezeit zu lesen war, dass unsere Bauern mit ihrer unendlichen Kraft wieder ebenso viel Ernte wie im Vorjahr eingebracht hatten, konnte man davon ausgehen, dass es eine Missernte gegeben hatte. Denn die Norm bestand in ihrer Übererfüllung.
Naturgemäß war die Berichterstattung über diese stählern festgelegten Inszenierungen ebenso langweilig wie umfangreich. Das Zeug war unlesbar und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass es überhaupt irgendjemand las. Für einen Arbeiter oder einen Bauern musste diese propagandistische Langprosa so verständlich sein wie Scholochow im Original. Und für die ausführenden Genossen war ja schon vorher klar, was gesagt werden würde, also werden auch sie diese Berichte nicht gelesen haben. Einzig die Westmedien und dort arbeitende Ostexperten brachten den Titelseiten des Neuen Deutschland ein gewisses Interesse entgegen und versuchten, zwischen den Zeilen etwas zum tatsächlichen Zustand der Planwirtschaft zu erkennen.
Lediglich die Berichte von der anderen, der dunklen Seite der Welt waren ein wenig interessant, auch wenn sie so vorhersehbar waren, wie die seelische Beschaffenheit eines Cowboys, der in einem alten Wildwestfilm einen schwarzen Hut trägt. Alles dort war schlecht und falsch. Zu dramaturgischen Zwecken wurde manchmal ein winziges Detail der Realität des Westens als scheinbar gut dargestellt, nur um im Laufe der folgenden Zeilen diesen Wahrnehmungsfehler aufzuklären. Schien etwas im Westen gut, dann lag es nur daran, dass man es noch nicht richtig verstanden hatte. Ich las deswegen unheimlich gern Reportagen und Bücher über das westliche Ausland, über das Kennedy-Attentat oder über die Verstrickung amerikanischer Geheimdienste in Bürgerkriege auf fernen Kontinenten, weil in diesen Texten genussvoll und ausführlich absurde Verschwörungstheorien ausgebreitet wurden.
Meine Berichte vor der Klasse begann ich regelmäßig mit der Bemerkung, dass ich davon ausgehen würde, dass die Schüler bestens über das aktuelle Großereignis informiert seien, schließlich würden sowohl die Aktuelle Kamera wie auch alle Zeitungen und Radiosender täglich berichten. Darum wolle ich auch keine Eulen nach Athen tragen. Oder fühle sich einer der Schüler noch nicht ausreichend über Parteitag|Ernte|Staatsbesuch informiert? Natürlich meldete sich niemand. Denn auch wenn wir alle keinen blassen Schimmer vom Parteitag oder der Tagung des RGW hatten, ging es doch immer darum, an der richtigen Stelle zu nicken und nicht etwa unnötige Fragen aufzuwerfen.
Selbst wenn mich die Klassenlehrerin gebeten hätte (warum hätte sie dies tun sollen), doch etwas zum Parteitag zu sagen, hätte ich eben ein paar Sätze über den unglaublichen Erfolg des Sozialismus und die führende Rolle der Partei gesagt. Niemand hätte mir widersprochen, denn das hätte bedeutet, den Erfolg des Sozialismus oder die führende Rolle der Partei infrage zu stellen. Als Agitator konnte ich nicht verlieren. Zum Inhalt meines persönlichen Lageberichtes machte ich dann gern Meldungen von den hinteren Seiten der Zeitung: neu errichtete Fabriken in Angola oder die immense Produktionssteigerung einer Jungaktivistenbrigade im VEB Textilwerk Palla Glauchau. Niemand außer mir las diese Meldungen, sodass ich völlige erzählerische Freiheit hatte.
Damit meine Schilderungen über die angolanischen Fabriken besser ankamen, würzte ich sie mit spannenden Hintergrundgeschichten: Wie freche FRELIMO-Rebellen die Lastkraftwagen angegriffen hatten, die eine Fahrradfabrik mit Ersatzteilen beliefern sollte, und wie der todesmutige Arbeiter Mesfin Nehertu sich in letzter Minute vor die feindliche Kugel der FRELIMO warf, wodurch die Fertigstellung der Fahrräder gesichert wurde, Mesfin aber für den Aufbau des Sozialismus in unserem Bruderland mit seinem Leben bezahlte. Ihm zu Ehren würden die Arbeiter dort von nun an doppelt so fleißig arbeiten und eine Jungaktivistenbrigade in Glauchau trüge nun seinen Namen. Sicher hatte nichts über Mesfin Nehertu in der Zeitung gestanden, aber wenn die ganze Zeitung voll war von leninistischen Gleichnissen, warum sollte ausgerechnet ich darauf verzichten? Ich sah es als meine Aufgabe, die Klasse für die Sache des Sozialismus zu gewinnen und nicht darin, sie für immer vom Lesen einer Zeitung abzuhalten. Also lernte ich, die Berichte großzügig mit Leben zu füllen.
Bald reichte mir die Herausforderung nicht mehr, aus den kleinen Meldungen von Seite fünf oder sechs menschliche Dramen zu machen. Ich stellte mir eine neue, schwierigere Aufgabe: zwei beliebige Meldungen durch eine möglichst kurze leninistische Argumentskette miteinander zu verbinden. Wie hing die Sicherung des Friedens durch die Stationierung von Atomraketen in der Tschechoslowakei mit dem Produktionsrekord im Braunkohletagebau Löbau zusammen? Worin bestand die Verbindung zwischen dem Wahlrecht für Ausländer bei ostdeutschen Kommunalwahlen und der kubanischen Zuckerrohrernte? Ich spann gedankliche Fäden zwischen diesen Meldungen über die Sicherung des Weltfriedens, überwand Kontinente durch die Notwendigkeit des sozialistischen Aufbaus, zeigte die Gemeinsamkeit des Kampfes gegen den Imperialismus in kleinen wie in großen Gesten. Zunehmend erfand ich dabei nicht nur kleine Details dieser Geschichten, sondern ganze Meldungen. So kam es zu Aufständen der Stahlarbeiter in Venezuela, Wahlerfolgen der kommunistischen Partei Islands und zur Enttarnung amerikanischer Geheimagenten in Forschungslabors der Jugoslawischen Volksrepublik.
Bisweilen fragte ich mich dabei, was ich da tat und ob das nicht eine Art Satire war und ich mich mit diesem sozialistischen Geflunker auf gefährlichem Grund bewegte? Aber selbst wenn eine meiner Mitschülerinnen am häuslichen Abendbrottisch vom Aufstand der kommunistischen Stahlarbeiter von Caracas erzählt hätte, was wäre das Problem gewesen? Schließlich vertrat ich immer den richtigen Klassenstandpunkt, so wie die leninistischen Erfindungen in den gedruckten Zeitungen liefen auch meine Erfindungen immer auf den Sieg des Sozialismus hinaus. Sie unterschieden sich nicht wesentlich von den vielen zurechtgebogenen und erfundenen Meldungen aus dem Neuen Deutschland, nur waren sie in der Regel viel interessanter. Was ich erzählte, war unterhaltsam, wenn es auch vornehmlich meiner eigenen Unterhaltung diente.
Aufgaben der Sozialisten
Was auch immer das ostdeutsche Staatswesen war, mir erschien es immer wie eine übellaunige Mutter, eine Mutter mit ordentlich eingerichteter Wohnung voller staubgewischter Regale mit Sammeltassen und kleinen Figuren, in der strenge Regeln galten und die einem zudem ständig den Vorwurf machte, sie habe all das nur für uns, ihre Kinder, eingerichtet, zahlreiche Entbehrungen in Kauf genommen und empfinde daher den Mangel an Dankbarkeit wie eine tiefe Wunde mitten im Herzen. Die Kinder sollten sich an dem Mobiliar erfreuen, ihre Zimmer immer aufräumen, das Bett ordentlich machen und pünktlich zu Hause sein. Die Kinder sollten nicht die Beine auf den Tisch legen, die Möbel verrücken oder sich mit Freunden treffen, von denen Mutti keine gute Meinung hatte.
Tatsächlich wurden wir von unseren Lehrern schon dafür getadelt, wenn wir in der Pausenzeit ruhig auf den Schulbänken saßen und uns unterhielten. Sag mal, macht ihr das etwa zu Hause auch? Dann werde ich mal zu euch nach Hause kommen und mich da auf den Tisch setzen. Mal sehen, was deine Mutti dazu sagt.
Die Schule zielte darauf ab, uns Schüler zu Museumsexponaten zu machen, zu gut ausgeleuchteten Objekten ohne Schattenseiten und ohne Eigenleben. Natürlich war klar, dass dieses Ideal nicht ganz erreicht werden konnte, aber als Ziel wurde es dennoch angestrebt. Unser Unterricht war museal: Russisch wurde wie eine tote Sprache gelehrt, Geschichte, Musik, Kunst und Literatur, selbst Geografie waren gewissermaßen abgeschlossene Kapitel der Menschheit. Mit dem Sieg des Sozialismus war der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte erreicht, die menschliche Entwicklung mithin vollendet. Im Unterschied zu diesem Schulunterricht, der ausschließlich von vergangenen und bevorstehenden Siegen handelte, war das Universum, das ich in meinen Berichten als Agitator für die Klasse entwarf, lebendig, vielfältig, wandelbar und nie vorhersehbar.
Und doch überraschte es mich, als meine Klassenlehrerin Ende der neunten Klasse das Gespräch mit mir suchte. Ich hatte nach der letzten Stunde bei ihr den sogenannten Ordnungsdienst zu verrichten, musste also nach dem Unterrichtsschluss den Klassenraum kurz ausfegen.
Es gab den Blumen-, den Tafel- und den Ordnungsdienst. Das Fegen war das Unangenehme am Ordnungsdienst, das Lustige daran war, am Morgen wie ein Feldwebel vor der Klasse zu stehen und ihr nach dem Läuten der Schulklingel ein »Stillgestanden« entgegenzubrüllen, um dann an die Lehrerin Meldung zu machen: »Frau Bauer, ich melde, die Klasse 9c ist zum Unterricht angetreten. Es fehlen Mandy wegen Erkältung und Enrico wegen Angina. Wir beginnen den Unterricht mit dem Gruß der Freien Deutschen Jugend: Freundschaft!«
Gerade fegte ich den Kreidestaub unter der Tafel zusammen, als mich Frau Bauer wie zufällig ansprach. Erst später würde ich wissen, dass dies einer der wenigen Tage war, an dem ich in der Schule etwas für das Leben lernte: Die schlimmsten Gespräche beginnen fast immer als beiläufiges »Ach übrigens« im Gang oder an der Kaffeemaschine. Auf große Aussprachen kann man sich vorbereiten, formalen Kritiken mit Formalität begegnen, verklemmte Andeutungen ignorieren. Die scheinbar zufälligen Vieraugengespräche waren das schärfste Florett auf dem ewigen Fechtplatz der menschlichen Kommunikation.
Im kommenden Schuljahr, erklärte mir Frau Bauer, solle ich doch bitte nicht mehr für das Amt des Agitators kandidieren. Die zehnte Klasse sei ein wichtiger Schritt im Leben aller Schüler, die Entscheidungen über die erweiterte Oberschule stünden an, so könne es nicht weitergehen. Es ginge nicht darum, irgendetwas im Nachhinein schlechtzureden, aber es sei Zeit, ein neues Kapitel anzufangen.
Schon bei ihrem ersten Satz war mir schlagartig klar, dass mich Frau Bauer immer durchschaut hatte. Meine Hände schoben weiter mechanisch verkrampft den Besenstiel hin und her, während ich starr in den Dreck schaute, den die Borsten vor sich herschoben. Ich fühlte mich wie ein Kind, das monatelang immer wieder heimlich in die Keksdose gelangt hatte, am ersten Tag konnte es noch sicher sein, dass die Eltern nichts bemerken würden, am zweiten Tag schmeckte der Keks noch besser und am dritten Tag begann es schon, ein Gewohnheitsrecht zu werden. Aber irgendwann, am vierzigsten oder fünfzigsten Tag, war selbst die größte Keksdose ziemlich leer und es war klar, dass der Betrug auffliegen musste, wenn nicht ein Wunder geschah.