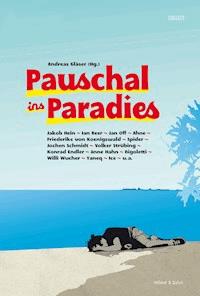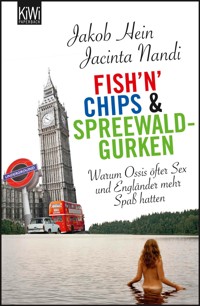8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit den Kumpels hinter einem Glas Cola-Weinbrand in der Klubgaststätte »Kalinka« zu hocken, bis das nächste Stück von »The Cure« kam: Das war schon okay. Wirklich cool aber waren die Momente mit Sarah. Sarah war die Frau seines Lebens. Sicher würde sie das auch bald rausfinden. So lange fand Sascha sich damit ab, nur der Vollidiot zu sein, der daneben stand, während Sarah mit »Dose« zusammenkam, dem Sänger von »Productive Cough«. Bis ihm klar wurde, dass er sein Leben nicht für die Liebe einer Unbelehrbaren wegschmeißen konnte. Dann vielleicht doch Doreen aus Treptow, die Ex von Olli. Irgendwann würde es ihm gelingen, hinter das Geheimnis der Frauen zu kommen. – Ostdiscos, die letzten Jahre der DDR und die Peinlichkeiten des Erwachsenwerdens. Zum Lesungsvideo auf www.zehnseiten.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
1. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-96889-8
© 2009 Piper Verlag GmbH, München Covergestaltung und -illusttration: Cornelia Niere, München Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Als die große Martha Graham 1992 starb, begann eine bittere juristische Auseinandersetzung um ihre künstlerische Hinterlassenschaft. Grahams Haupterbe Ronald Protas vertrat die Auffassung, die Tänze seien sein Eigentum, während die Martha Graham Dance Company argumentierte, die Tänze gehörten dem Ensemble. Dabei standen die Juristen vor der großen Herausforderung zu klären, was überhaupt ein Tanz im juristischen Sinne ist und ob man eine Bewegungsfolge besitzen kann.
Nach zehn Jahren entschied ein Bundesgericht, dass Protas nur ein Tanz (»Seraphische Dialoge«) gehöre, während mehr als fünfzig Tänze dem Ensemble gehörten, da Martha Graham diese im rechtlichen Sinne als Auftragsarbeiten für die Company inszeniert habe. Weitere zehn Tänze würden der Öffentlichkeit gehören, weil diese Tänze durch Film und Fernsehen allgemein bekannt seien.
Um meinen Erben ähnliche Auseinandersetzungen über mein tänzerisches Erbe zu ersparen, möchte ich meine diesbezüglichen Angelegenheiten im Folgenden regeln.
A.P.
Prolog oder: Der Jimmy Glitschi
Beigebracht wurde uns die Bewegung zur Musik im Kindergarten. Wir mussten uns im Kreis aufstellen, und ein Bi-Ba-Butzemann tanzte um unser Haus herum, der Regen fiel, Frau Sonne lachte. Wie wir uns dazu bewegen durften, gab die Kindergartentante vor. Wir nannten die Kindergartentanten bei ihren Nachnamen, die besonders freundlichen erlaubten uns, sie trotzdem zu duzen. Das klang so wie heute im Kaufhaus: »Du, Frau Becker, guck mal!« Meine Kindergartentante hieß Frau Kant. Sie war dick, kurzatmig, schlecht gelaunt und trug eine Kittelschürze aus Nylon über ihren Stützstrümpfen. Bewegung zu Musik machte sie mit uns nur, weil es Vorschrift war, weil in ihrer offiziellen Bedienungsanleitung für Kinder geschrieben stand, dass eine Kindergärtnerin mindestens zweimal monatlich mit den ihr unterstellten Kindern Tanz- und Singspiele einüben musste.
Frau Kant hasste Musik und Bewegung, und Musik und Bewegung hassten Frau Kant. Alle paar Augenblicke griff sie in die Kitteltasche, holte ein Stofftaschentuch heraus und wischte sich damit den Schweiß von der hochroten Stirn. Die Sonne waren zwei Arme, die wir von unten kreisförmig nach außen bringen mussten. Wenn sich ein Kind im Überschwang der Gefühle spontan anders als vorgeschrieben bewegte, brüllte Frau Kant herum. Bei wiederholtem Abweichen gegen die Bewegungsmuster drohten Nachholstunden. Mit Tanzen hatte das nichts zu tun.
Auf dem Spielplatz gab es Chauli und Jimmy Glitschi, unsere selbst erfundenen Sagenfiguren. Chauli, das war der Kumpel, der robuste Kämpfer, der verlässliche Gefährte mit Bauarbeiterhelm oder Polizeimütze, Jimmy Glitschi war niemand. Er war nur ein sagenumwobener Held aus einem umfangreichen Gedichtzyklus, der ausschließlich aus Zweizeilern bestand und auch sonst von ungeheuerer formaler Strenge gekennzeichnet war. Die erste Zeile war immer gleich. Sie lautete: »Jimmy Glitschi, der Mann ohne Knochen.« Auch die zweite Zeile kannte nur minimale Abweichungen. Es variierten lediglich die Tätigkeit und der Körperteil, den sich Jimmy angeblich gebrochen hatte. Ein typisches Beispiel:
»Jimmy Glitschi, der Mann ohne Knochen,
hat sich beim Furzen den Hintern gebrochen.«
Trotz der stets tragisch endenden Geschichten entbehrten die Gedichte über Jimmy Glitschi nicht einer gewissen Komik, die sich vor allem Menschen unter acht Jahren erschloss.
In meinen ersten Sommerferien verschifften mich meine Eltern ins Ferienlager. In einem Brief, den ich ihnen am zweiten Tag schickte, schrieb ich über das Ferienlager: »Alles Scheißdreck«, mein Befinden beschrieb ich mit den Worten: »Es geht mir scheiße.« Dann kam die erste Diskothek meines Lebens. Der dicke Harald hatte seinen Koffer mit Tonbandkassetten in den Esssaal getragen und zwei Kassettenrekorder mit den Lautsprechern auf volle Lautstärke gedreht. Da brach es aus mir heraus: Ich bewegte meine Gliedmaßen im Takt der Musik, allerdings jeden meiner Arme, jedes Bein in seinem eigenen Rhythmus, die Augen hinter den Brillengläsern fest geschlossen und den Mund leicht geöffnet. Für einen Außenstehenden mag es vielleicht so ausgesehen haben, als hätte ich gerade einen Krampfanfall, aber ich tanzte den Jimmy Glitschi. All mein Heimweh und meine Wut ließ ich aus mir heraus und identifizierte mich in meinem Tanz mit dem berühmten Helden, der sich der Legende nach beim Beischlaf sein Geschlechtsteil gebrochen haben sollte.
Ich sah bestimmt schrecklich aus, ich sah bestimmt lächerlich aus, ich sah erbärmlich aus, aber ich fühlte mich großartig. Denn an diesem Nachmittag, hinter den geschlossenen Gardinen des Gemeinschaftsraums, entdeckte ich die Kraft des Tanzes, wie Musik die Seele dazu bringen kann, in direkte Verbindung zum Körper zu treten, um durch Bewegungen Dinge auszudrücken, die der Mund nicht sagen kann.
Danach wurde alles besser.
Als meine Eltern, aufgeschreckt durch meinen Brief, drei Tage später vor dem Ferienlager standen, um mich vorzeitig abzuholen, schaute ich sie nur verständnislos an.
Stillstand des Systems
Unsere politische Bildung wurde durchgeführt, indem wir vom ersten Grundschuljahr an einerseits täglich, andererseits mit einer gewissen Lustlosigkeit indoktriniert wurden. Der Lehrplan war voll von sozialistischen Phrasen, die sich in den Jahrzehnten niemand herauszustreichen getraut hatte. Die Realität hatte das meiste davon längst überholt, aber die Verabreichung der Phrasen an die Kinder war zu einer folkloristischen Tradition geworden, von der man sich nicht trennen wollte. Gelangweilt verlangten unsere in Westklamotten gekleideten Lehrer, dass wir den allseitigen Sieg des Sozialismus im Kampf der Systeme verkündeten. Nur dafür gab es die Note Eins. Der Sozialismus stellte sich uns als eine Art atheistischer Konfession vor, bei der lieber niemand mehr fragte, ob man denn wirklich glaube, sondern wo es darauf ankam, die zentralen Glaubenssätze an der richtigen Stelle wiedergeben zu können.
Ute zum Beispiel, von der es hieß, dass sie in der Kirche sei, sollte sich nicht aus allen gesellschaftlichen Fragen heraushalten dürfen und wurde deswegen zur Klassenverantwortlichen für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft gemacht. Und theoretisch hätte nun das christliche Mädchen Ute diese Position nutzen und ausbauen können, um einen Spitzenplatz in den Annalen des politischen Kampfes Minderjähriger einzunehmen. Sie hätte Schulen in unserer sowjetischen Partnerstadt anschreiben können, sie hätte Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges auf Kosten des Staates zu Pioniernachmittagen einfliegen lassen und Super-8-Filme vom letzten Parteitag der KPdSU im Heimatkundeunterricht zeigen können. Niemand hätte sie daran hindern können, die Lehrer hätten sie sogar unterstützen müssen. Doch solche Ambitionen lagen Ute fern. Sie beschränkte die Erfüllung ihrer Aufgabe darauf, einmal jährlich im März eine Mark zwanzig von jedem Mitschüler einzusammeln und dann die zwölf Monatsmarken zum Einkleben ins blaue DSF-Mitgliedsbuch auszuhändigen. Wer sein Geld zum Stichtag vergessen hatte, für den legte Ute erst mal aus.
Jeder konnte, ja jeder sollte geradezu ein bisschen Macht ausüben. Es erinnerte an ein gemeinschaftlich begangenes Verbrechen, bei dem sich noch das kleinste Bandenmitglied auch die Hände schmutzig machen sollte, damit später niemand vor Gericht auf unschuldig plädieren könnte. Die Lehrer drängten uns auch, angeblichen Eliteorganisationen beizutreten, in denen nichts von uns erwartet wurde. Wer etwas bewegen wollte, wurde als Störer empfunden. Der gesellschaftliche Kompromiss beruhte auf einer allgemeinen Ambitionslosigkeit.
Gleichzeitig konnte jeder auch über seine Ohnmacht und den allgemeinen Stillstand jammern. Wenn etwas nicht funktionierte, die Bahn zu spät kam, der Schnürsenkel zerriss oder die Milch sauer wurde, brüllte man sofort: »So ein Osten!«, und wenn etwas gut war, sagte man gern: »Das ist ja wie im Westen!« Wer wirklich grundlegend etwas gegen den Staat hatte, konnte einen Ausreiseantrag stellen. Offiziell war das das Schlimmste, was man tun konnte, aber wenn die so Verbannten zwei Monate später Postkarten von der Cotê d’Azur schickten, wirkte diese Strafe wenig bedrohlich.
Diese Lethargie, den Stillstand verkörperte ich auch in meiner neuen Tanzinstallation vor der inzwischen vertrauten Kulisse meines Ferienlagers im Vogtland. Sicher spielte dabei auch eine Rolle, dass die Mädchen in den vergangenen zwei Jahren zunehmend über meinen »Jimmy Glitschi« gekichert hatten, und ich vermutete, dass das Kichern nicht den Erlebnissen des Jimmy galt, sondern darin möglicherweise ein Tropfen der Häme über mich gemischt war. Also schaute ich mir den Tanz ab, mit dem man kein Aufsehen erregte, und nahm ihn in mein Repertoire auf. Und so sah das aus: auf die Tanzfläche gehen und Grundstellung einnehmen, bis der dicke Harald, der natürlich immer noch unser Diskotheker war, seinen coolen Spruch beendet und die Play-Taste gedrückt hatte. Dann: die Arme anwinkeln, ein Gesicht machen, als säße man auf der Toilette, und: rechtes Bein nach rechts, linkes Bein neben rechtes Bein, linkes Bein nach links, rechtes Bein folgt. Nach einigen Minuten versuchen, im richtigen Takt zum Lied zu tanzen, nach dem Drücken der Stopp-Taste wieder Grundstellung einnehmen und abwarten. So tanzte ich ganze Abende hindurch, leistete meinen Beitrag pflichtgemäß, trank meine vorgesehene Ration Cola und tat, was ich tun konnte. Freude oder Trauer gab es nicht. Wenn ich noch ein paar Jahre so durchgehalten hätte, dann hätte mir als verdientem Tänzer des Volkes eines Tages vielleicht eine Hellerau-Schrankwand mit beleuchteter Glasvitrine zugestanden.
Die richtige Richtung
In der sechsten Klasse hatte ich eine Zeit lang Nora Zielinski geliebt, die Udo Burgstetter aus der siebten liebte, der wiederum ausschließlich Udo Burgstetter selbst liebte. Nora hatte lange, wehende schwarze Haare, große, sensible Augen, eine sanfte Stimme, und sie hörte , was von den damals verfügbaren Möglichkeiten für Sechstklässlerinnen das Originellste war. Udo stand zwei Jahre lang in jeder Pause auf dem Schulhof, las weithin sichtbar in einer alten Taschenbuchausgabe von Sartres und strich sich dabei die Haare aus der sorgenumwölkten Stirn. Klar, dass er Schwarm aller Mädchen war, sie wollten ihn retten. Ich versuchte, Noras Liebe zu gewinnen, indem ich ihr immer ein verständnisvolles Ohr lieh, wenn sie mir von ihrer Liebe zu Udo Burgstetter erzählte. Irgendwann würde Nora einsehen, dass mein Einfühlungsvermögen und meine Sensibilität viel liebenswerter waren als Udos überhebliches Draufgängertum. Zusätzlich hatte ich Nora mit Postern und Aufklebern ihrer Lieblingsband beschenkt, damit ihr in einer schlaflosen Nacht ein Licht aufginge, wer eigentlich ihr Innerstes wirklich verstand.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!