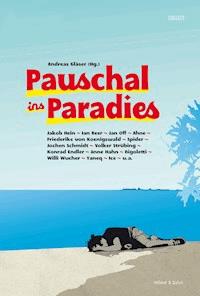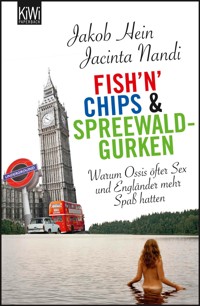
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Warum Ossis öfter Sex und Engländer mehr Spaß hatten Das Land der Ossis: Nacktbaden in der Ostsee, jedes Kind war ein Pionier – vor allem aber: ganz viel Sex im Ferienlager! Der helle Wahnsinn, findet die in Berlin lebende Engländerin Jacinta Nandi. Schade nur, dass ihre Ossi-Freunde nichts davon erzählen wollen. Bis auf Jakob Hein. Ob die legendäre Bananenschlange im Juni '78, der irrwitzige Versuch, Rock'n'Roll in die DDR zu bringen, oder die rätselhaften Erziehungsmaßnahmen der ostdeutschen Gastwirtschaft – nichts entkommt seinem beißenden Spott, wenn er den schrägen Osten beschreibt, auch nicht die Tatsache, dass London damals als das Gelobte Land galt. Seit gut einem Jahr tauschen sich die Surfpoetin Jacinta Nandi und der Autor Jakob Hein über das wahre Ossitum aus und amüsieren sich dabei königlich bzw. sozialistisch. Zeit, uns endlich daran teilhaben zu lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Jakob Hein / Jacinta Nandi-Pietschmann
Fish ’n’ Chips & Spreewaldgurken
Warum Ossis öfter Sex und Engländer mehr Spaß haben
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jakob Hein / Jacinta Nandi-Pietschmann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jakob Hein / Jacinta Nandi-Pietschmann
Jakob Hein, geboren 1971 in Leipzig, zog 1972 mit seinen Eltern nach Berlin. Medizinstudium in Berlin, Wien, Stockholm und Boston. Seit 1998 Mitglied der Reformbühne Heim & Welt. Zuletzt erschien von ihm Wurst und Wahn (KiWi 1281). Jakob Hein lebt mit seiner Familie in Berlin.
Jacinta Nandi wurde 1980 in London geboren und kam mit zwanzig nach Berlin, sie schreibt für das englischsprachige Stadtmagazin Exberliner und ist Mitglied der Lesebühnen Rakete 2000 und Surfpoeten. 2011 erschien ihr erstes CD-Buch Deutsch werden: Why German people love playing frisbee with their nana naked. Sie lebt mit ihrem Freund und ihrem Sohn in Neukölln.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Das Land der Ossis: Nacktbaden in der Ostsee, jedes Kind war ein Pionier – vor allem aber: ganz viel Sex im Ferienlager! Der helle Wahnsinn, findet die in Berlin lebende Engländerin Jacinta Nandi. Schade nur, dass ihre Ossi-Freunde nichts davon erzählen wollen. Bis auf Jakob Hein. Ob die legendäre Bananenschlange im Juni 78; der irrwitzige Versuch, Rock ’n’ Roll in die DDR zu bringen, oder die rätselhaften Erziehungsmaßnahmen der ostdeutschen Gastwirtschaft – nichts entkommt seinem beißenden Spott, wenn er den schrägen Osten beschreibt, auch nicht die Tatsache, dass London damals als das Gelobte Land galt.
Seit gut einem Jahr tauschen sich die Surfpoetin Jacinta Nandi und der Autor Jakob Hein über das wahre Ossitum aus und amüsieren sich dabei königlich bzw. sozialistisch. Zeit, uns endlich dran teilhaben zu lassen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2013, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture/Gallery Stock (Frau); © Imagebroker RM/F 1 online (Underground); © Imre Cikajlo/iStockphoto (Trabi), MasterLu-Fotolia.com (Big Ben)
Autorenfoto: © Susanne Schleyer
ISBN978-3-462-30700-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Wie mir eine Engländerin die DDR erklärte
Gesellschaft und Kritik
Die Exotik
Wir hatten ja nur das richtige Leben, was wussten wir schon vom falschen
Kein Spaß
Übernatürliche Kräfte waren die einzige rationale Erklärung
Tabu
Wir fühlten neben unserem Schmerz ein wenig auch den ihren
My Favourite Feiertag
Wir konnten nicht einschätzen, was die meinten, wenn sie von Alkoholproblemen sprachen
Aprilscherz
Arm dran und Bein ab
Das Bild der Frau
Vielleicht betrieben sie Tauschhandel
Unsere feierlichen Schwüre zur Jugendweihe hatten wir hingegen schnell vergessen
Sex und Einsamkeit
Die Enttäuschung
Wir hätten es auch gern getan, wenn wir es gut genug gekannt hätten
Damals in der Disko
Erinnerungen an einen unbekannten Ort
Bildung und Verblödung
Fantasie
Warum brachten sie uns nicht auch noch bei, wie man Austern isst, die gab es nämlich auch nicht
Quadratische Waffeln
Das Leben brachte uns auch ohne den Unterricht schon genügend bei, das wir lieber nicht gewusst hätten
Freizeit und Stress
Bei den Pionieren
Dass es sich zudem noch um einen kirchlichen Verein handelte, war uns nicht einmal klar
Uns wurde erklärt, dass man sich von seiner großen Liebe auch keine Pause wünschen würde
Unsere Träume flogen nicht bis zur Südsee, unsere Körper durften ja noch nicht einmal bis zur Nordsee fahren
Dienen und Bedienung
Es gab dieses Lied von Adam & The Ants, das hieß »Stand and deliver«
Nach Marzahn Ziehen
Die Nutztiere, von denen die Mahlzeiten stammten, können sie nicht schlechter behandelt haben
Das Essen
Wir mussten uns nicht verkaufen, aber dafür wurde uns auch nichts verkauft
Wassermangel
Gut gekauft, gern gekauft
Westpakete aus der Zukunft
Nur unsere Herzen, die konnte niemand reparieren
Sport und Gesundheit
Sie verglichen uns immer mit den vertrocknenden Ästen an einem Baum, die schließlich auch irgendwann abgeschnitten werden würden
Dr. Jenner und die Milchmagd
Sport oder frei
Ausfragen
Wie mir eine Engländerin die DDR erklärte
Manche Menschen nähern sich in kleinen Schritten, Jacinta Nandi war eines Tages plötzlich da. Viele hatten sie schon mal gesehen, etliche mit ihr gesprochen, einige waren mit ihr aufgetreten und wenige angeblich seit Jahren mit ihr befreundet.
»Wer ist eigentlich Jacinta Nandi?«, war eine Frage, die ich mich nicht mehr zu stellen traute, weil ich offensichtlich der Letzte war, der noch nicht wusste, was los ist. Unauffällig versuchte ich wenigstens herauszufinden, wie man ihren Namen richtig aussprach, was nicht so einfach war, denn jeder betonte ihn anders und versuchte dabei einen Gesichtsausdruck größter Selbstverständlichkeit zu machen, so als ob Jacinta Nandi ein Name war wie Heinz Müller, der Torwart vom 1. FSV Mainz.
Zum Glück kam sie irgendwann zur Reformbühne Heim & Welt, der Lesebühne, in der ich seit Jahren aus meinen Texten vorlese. Das hatte zwei Vorteile: Einerseits konnte ich auf unserer Gästeliste lesen, wie Jacinta richtig geschrieben wird und andererseits hatte ich das Glück, sie selbst zu treffen und zu hören. Dazu muss man wissen: Jacinta ist eine äußerst freundliche, eher schüchtern wirkende Frau, von der man auf den ersten Blick vielleicht Lyrik über Sonnenuntergänge vor Tanganjika erwartet. Ich hatte tatsächlich Angst, sie könnte neben uns erfahrenen Bühnenhasen baden gehen. Doch dann las sie zu meiner Überraschung sehr lustige und vor allem ziemlich explizite Texte vor, und das mit großer Ruhe und einnehmendem Charme – während ich, ein braver Junge aus gutem Hause, manchmal nicht wusste, ob ich mich schämen sollte oder noch lachen durfte.
Wir verstanden uns gleich sehr gut, vor allem, weil ich mich entschieden hatte, ihren Namen so deutsch wie möglich auszusprechen, was Jacinta anscheinend besser fand, als die vielen Deutschen, die sich an Betonungen abmühten, die irgendwie englisch oder indisch klingen sollten, um bei einer Art Karl-May-indianisch zu enden.
Im Normalfall habe ich keine Lust mehr, den Leuten zu verraten, ob ich eine Ost- oder eine West-Biografie habe. Ich erzähle mittlerweile manchmal, ich würde aus Westerkappeln kommen und sei dort in die evangelische Schule gegangen. Aber mit Jacinta war das was anderes. Sie interessierte sich total für die DDR aus ihrer Londoner Perspektive. Seit mehr als zehn Jahren wohnt sie in Kreuzberg, was für sie ein Kulturschock gewesen sein muss. Denn, wie sie mir erklärte, interessiert man sich in London für nichts, was auch nur einen Zentimeter außerhalb der Stadtgrenze Londons passierte. In ihren Kreuzberger Jahren hat sie nicht nur ihren allgemeinen Horizont rasant erweitert, sondern auch sehr viel über einen kleinen Staat erfahren, der früher einmal direkt vor ihrer Kreuzberger Haustür gelegen hat.
Jacinta hat sehr viele Theorien über diesen kleinen Staat. Sie glaubt zum Beispiel, dass der Zufallssex dort besser gewesen sein muss, weil man sich während des Zufallssexes keine Gedanken darüber machen musste, ob man den Sexualpartner am nächsten Morgen anruft oder nicht. Man konnte sich einfach und unreflektiert der körperlichen Begegnung hingeben, weil ohnehin niemand Telefon hatte. (Außerdem glaubt sie übrigens auch, dass Ostdeutsche die hemmungsloseren oralen Liebhaber seien, und kann das auch ziemlich überzeugend begründen.) Die DDR, von der Jacinta erzählte, erschien mir auf jeden Fall ein viel interessanteres Land als der dröge Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden, in dem ich aufgewachsen bin.
»Schreib doch mal ein Buch über deine DDR«, riet ich ihr.
»Ach, ich schreibe doch kein Buch. Dazu bin ich viel zu undiszipliniert«, winkte sie nur ab. »Das klappt höchstens, wenn wir das Buch zusammen schreiben. Ich schreibe über die DDR und du schreibst über London.«
»Was soll ich über London schreiben? Wir wussten nichts über London. London war ein sagenumwobener Ort. Wir hatten einen Ossi, der es bis ins Weltall und wieder zurück nach Morgenröthe-Rautenkranz, seinem Heimatort im Vogtland, geschafft hat. Aber nie hatte man von jemandem gehört, der bis nach London und wieder zurück in die DDR gereist wäre. Es ist wie in diesem Witz: Was ist ein Trio? Ein DDR-Symphonieorchester nach einer London-Reise.«
»Echt? Was fandet ihr denn so gut an London?«
»Was wir an London so gut fanden? Wir fanden dort alles gut: die Kleidung, die Leute, die Musik. Alles!«
»Auch das Essen?«
»Davon wussten wir nicht so viel«, sagte ich ausweichend.
»Also dann machen wir das«, sagte Jacinta. »Wir schreiben immer abwechselnd. Ich eine Geschichte über die DDR und du eine über London.«
»Dann machen wir das«, sagte ich. Wer könnte ihr schon widersprechen?
Gesellschaft und Kritik
Die Exotik
Wenn man selbst für andere Menschen exotisch ist, dann hat man nie Sehnsucht nach dem Exotischen. Oder vielleicht doch. Aber vielleicht sind für uns Exoten einfach ganz andere Sachen exotisch.
»Ich schreibe ein Buch«, erzähle ich einem Kumpel, »gemeinsam mit Jakob Hein.«
»Ach, stimmt, das hat er mir erzählt«, antwortet er. »Und dass du immer zu viel über Sperma schreibst und ihm ist das peinlich und du sagst ihm dann: ›Entschuldigung für das viele Sperma!‹ Und dass es das erste Mal für ihn ist, dass ein Mädchen sich bei ihm entschuldigt hat fürs Sperma.«
»Ich schreibe überhaupt nicht viel über Sperma«, sage ich. »Oder kaum. Unser Buch geht überhaupt nicht um Sperma.«
»Und worüber schreibt ihr dann? Worum geht es in dem Buch?«
»Du darfst dreimal raten«, sage ich.
»Um Indien«, sagt er.
Ich runzle meine Stirn. »Um Indien?«, frage ich erstaunt. »Was werde ich wohl über Indien schreiben können? Ich war nie dort.«
»Okay, okay. Dann um Juden.«
Ich runzle meine Stirn noch mehr. »Um Juden?«, rufe ich total schockiert. »Was werde ich über Juden schreiben können? Ich habe nicht mal mit einem Juden geschlafen.«
»Ach was, bist du Antisemitin oder was jetzt?«
»Ach, doch«, korrigiere ich mich. »Ich habe einmal mit einem Israeli geschlafen. Der war bestimmt Jude, oder? Der war bei der Armee gewesen.«
»Ja, man kann davon ausgehen, dass ehemalige israelische Soldaten Juden sind, glaube ich.«
»Ach ja, und auch einmal mit einem deutschen Juden, ein Student. Der hat irgendwas studiert. Philosophie oder Medizin oder Literatur oder so was. So was Altes und Schwieriges. Nix mit Computern.«
»Ich weiß, worüber euer Buch ist«, sagt mein Kumpel. »Ich darf noch mal raten, oder? Ihr schreibt über deutsch-englische Sex-Geschichten. Also, du beschreibst jeden One-Night-Stand, den du je mit einem Deutschen gehabt hast.«
»Nee, nee, nee«, sage ich, und seufze wehmütig. »Dann wär’s ein sehr kurzes Buch. Ich habe viel zu selten mit Deutschen gevögelt. Dann wär’s nur ein dünnes Büchlein.«
»Na klar. Also, jetzt musst du’s sagen. Ich habe dreimal geraten. Jetzt sagst du es mir.«
»Es geht um das Exotische«, sage ich.
»Um was?«
»Um das Exotischste, was es überhaupt geben kann, in diesem Leben«, sage ich.
Jetzt runzelt mein Kumpel seine Stirn.
»Ihr schreibt ein Buch über Avocados und Mangos?«
Ich schüttele meinen Kopf. »Nee«, sage ich. »Ich schreibe über die DDR.«
Mein Kumpel lacht. »Ach ja«, sagt er. »Die exotische DDR.«
»Ja«, sage ich. »Wenn du so groß geworden bist wie ich, dann ist die DDR das Exotischste, was man sich überhaupt vorstellen kann.«
»Na klar«, sagt er und lächelt amüsiert.
»Doch«, sage ich. »Wenn du so groß geworden bist wie ich – britische Arbeiterklasse, ganz langweilig und normal – du aber halb-indisch aussiehst, halb-anders, dann bist du schon exotisch für die anderen Menschen – alle wollen von dir ein Yogi-Tee-Rezept oder kostenlosen Yoga-Unterricht. Wenn du so aufgewachsen bist, was kann es dann für dich noch Exotisches geben – außer der DDR?«
Meine Kindheit war eine ziemlich normale, langweilige Britische-Arbeiterklassen-Kindheit. Alles im Haus meiner Eltern war braun, so ein sanftes, leichtes orangenes Braun. Braune Sofas, braune Tapeten, braune Vorhänge. Spießiger Krimskrams überall. Sogar unsere Badewanne war orange und braun. Alles so spießig und klein und normal und englisch. Anders als bei meinen Großeltern: Da war es zwar auch spießig und orange-braun und langweilig – aber ihr Krimskrams war exotisch. Statt kleiner Teller oder einer Fingerhütesammlung oder Porzellanschornsteinfegern hatten sie türkisfarbene Elefanten und diese Göttin mit den Armen. Bei ihnen war eine Atmosphäre, wie ich sie komischerweise hier in Deutschland nur von türkischen Familien kenne, obwohl deren Krimskrams wieder ganz anders ist. Es ist vermutlich diese überwältigende Spießigkeit und dann: unerwartet ein paar Tropfen Farbe. Und außerdem, ich weiß nicht warum, haben meine Großeltern auch andere Sachen gemeinsam mit den türkischen Familien: Plastikpflanzen zum Beispiel, und ein Sofa, das sie nie auspacken aus der Plastikverpackung, und dann diese durchsichtigen Plastikteppiche auf dem Boden. Aber bei meinen Großeltern – genauso wie bei den Türken – ist es irgendwie nicht exotisch. Das ist das Gegenteil von Exotik. Das ist Spießigkeit pur, die Atmosphäre, die man da spürt.
Jedenfalls: Es ist überhaupt nicht exotisch gewesen bei meinen Großeltern. Es war langweilig. Total langweilig. Wenn auch nicht so langweilig, wie die Fragen, die man immer von Deutschen gestellt bekommt, wenn sie mitkriegen, dass man indische Wurzeln hat:
»Kannst du eigentlich indisch kochen, Jacinta? Guckst du gerne Bollywood-Filme? Kannst du indisch? Meditierst du manchmal? Machst du Honig in deinen Chai-Tee? Oder nicht? Gehst du immer noch zum Tempel? Hörst du gerne Bhangra-Musik? Darfst du Rindfleisch essen?«
»Ach«, sagt mein Kumpel. »Die DDR war nicht exotisch. Indien ist exotisch, Jacinta. Du bist innerlich blockiert. Irgendwann mal gehst du nach Indien, dann wirst du erkennen, wie exotisch du bist.«
»Aber jemand kann sich selbst nicht exotisch finden, oder?«, sage ich. Aber ich merke, dass wir uns nicht mehr so richtig konzentrieren können, auf das Gespräch. Als mein Kumpel weggeht, um Zigaretten zu holen, sitze ich allein da und denke darüber nach, was ich alles exotisch finde. In einem Schwarztaxi herumzufahren, denke ich mir, und bei den Pionieren sein zu dürfen, und in Läden zu gehen, in denen man nichts kaufen kann. In einem Trabant an die Ostsee fahren, und wenn du am Strand bist, FKK machen, ja, FKK machen und dabei Spreewaldgurken essen, ja und überhaupt der Spreewald. Und dann, wenn du in der Schule bist, Micky-Maus-Sticker vor deiner Lehrerin verstecken zu müssen. Meine Freundin hat mir mal erzählt, wie eine Lehrerin mal eine Razzia gemacht hat bei den Schulsachen. Sie hatte gerade einen Micky-Maus-Sticker von ihren Westverwandten bekommen und ihn auf ihre Federmappe geklebt. Jetzt wollte die Lehrerin aber diese Kontrolle machen. Sie war eine ganz strenge Lehrerin und meine Freundin wusste, dass, wenn sie den Micky-Maus-Sticker sieht, sie nicht zur Uni gehen dürfte. Während die Lehrerin also durch das Klassenzimmer lief, langsam und streng, hat meine Freundin leise den neuen Micky-Maus-Sticker von der Federmappe weggekratzt. Es muss so schrecklich gewesen sein. Aber für mich … ist es auch … ein bisschen … exotisch.
Wir hatten ja nur das richtige Leben, was wussten wir schon vom falschen
Wir hatten eigentlich immer eine gute Zeit, damals in Ostdeutschland. Klar, es war anders als heute, schon allein dadurch, dass wir mit der großen Gabe des Nichtwissens gesegnet waren, die uns in einen Zustand von dauerhaftem Glück versetzte. Man kann dem repressiven, diktatorischen, ideologieverstrahlten ostdeutschen Unrechtsregime vorwerfen was man will, mit Nichtwissen versorgte es uns immer gern und reichlich. Schnaps, Zigaretten und Nichtwissen waren die wesentlichen Güter, die niemals knapp in den ostdeutschen Einkaufsregalen wurden. So war es organisiert, dass die Ostdeutschen erst dann frei reisen durften, wenn Altersdemenz und Lebenserwartung schon so weit fortgeschritten waren, dass die Systemstabilität durch die mitgebrachten Reiseeindrücke nicht mehr gefährdet werden konnte, einmal abgesehen davon, dass Kreislaufprobleme und Krankheiten des Bewegungsapparats den Aktionsradius der Reisenden stark einschränkte. Der Schraubstock der Biologie gewährleistete, dass die Zange der Ideologie gefahrlos gelockert werden konnte. Doch so wie das westdeutsche Rentensystem durch die zunehmende Langlebigkeit der Rentner gefährdet wird, genauso gefährdete die Beibehaltung der Reiseregelung für Rentner mit der Zeit auch unseren seligen Frieden der Ignoranz. Auch unsere Rentner wurden rüstiger und kehrten zurück voller Erinnerungen und Eindrücke. Ihre Reisen führten sie nicht mehr nur bis Spandau und Gießen, sondern auch nach Walsrode, München oder Kiel. Immer klarer konnten sie sich an das Gesehene erinnern, immer länger lebten sie, um ihren Enkeln und Kindern von ihren immer häufigeren Reisen zu erzählen. Kamen einst die Omis aus Westberlin zurück, dann blieb ihnen meist nur noch ein wenig Zeit für verwirrte Reden über den Weltkrieg und für einen Herzanfall, nun jedoch schritten sie mit prall gefüllten Taschen über die Grenze und luden zu ausgedehnten Diaabenden ein. Die Förderung des Sports war vielleicht für den olympischen Medaillenspiegel der DDR gut, für das systemstabilisierend rechtzeitige Ableben ihrer reisenden Rentner war sie Gift. Ehemalige Läuferinnen erkundeten den Kurfürstendamm, Bahnradweltmeister machten die Fußgängerzonen Hessens unsicher, Gewichtheberlegenden schleppten legendär schwere Taschen über die innerdeutschen Grenzbefestigungen. Natürlich mag es ein Zufall sein, aber es war im August 1989, als sich erstmals ein Rentnerehepaar aus Neubrandenburg aufmachte, eine Reise nach London und wieder zurück zu unternehmen. Ein sicheres Zeichen dafür, dass das Ende seinen Anfang genommen hatte.
Zurück zu unserer Jugend, die wir noch im glücklichen Zustand der Unwissenheit verbrachten. Auch wenn wir es nicht so empfanden, hatten wir damals viel weniger Freizeit als heute. Praktisch nur jeden ersten Samstag des Monats sowie am Nationalfeiertag, am Tag der Metallurgen und am Tag der Nationalen Volksarmee konnten wir von 7 Uhr bis 8.30 Uhr vormittags und von 14 Uhr bis 17.30 Uhr nachmittags, ab dem sechzehnten Lebensjahr sogar bis 20.30 Uhr abends machen was wir wollten! Sicher klingt das nach einem strengen Leben, man darf nicht vergessen, dass in der atheistischen Republik natürlich Weihnachten, Silvester, Ostern und andere religiöse Feste nicht gefeiert wurden und persönliche Feiertage wie Geburtstag oder Hochzeit als Relikte des Kleinbürgertums abgeschafft worden waren. Dennoch konnten unsere Eltern über den Lebenswandel ihrer verwöhnten Kinder nur staunen. In ihrer Zeit war das, was Freizeit noch am ehesten entsprach, der Tag der Nationalen Volksarmee zwischen 11 Uhr und 12 Uhr vormittags, wenn sie sich aussuchen konnten, ob sie lieber Kugelstoßen oder Rhythmische Sportgymnastik spielen wollten. Da ging es uns natürlich um vieles besser. In den großen Städten wie Berlin, Leipzig oder Dresden gab es sogar sogenannte Fetenscheunen, das waren aus Sauerkohlplatten zusammengenagelte Bauten, in denen Schalmeienkapellen oder russische Estradenorchester zum Tanz aufspielten. Wie war es da gemütlich in diesen »Schuppen«, wie wir zu sagen pflegten. Weil Glas sehr teuer war und die gesamte Glasproduktion der DDR aus den Siebziger- und Achtzigerjahren im Palast der Republik verbaut worden war, weil man hatte einsehen müssen, dass Asbest allein nicht reichen würde, gab es in den Fetenscheunen keine Fenster. Während die gelbe Sonne des späten Nachmittags durch die Lücken zwischen den Sauerkohlplatten schien, kuschelte man sich an seine Tanzpartnerin oder man holte sich an der Bar zwei Gläser vergorenen Rübensaft. Die Bars sahen etwas anders aus als heute, insofern sie einfach aus zwei umgekehrt aufgestellten Bretterkisten für Rübensaft bestanden. Der eine oder andere hatte etwas getrockneten Spitzwegerich dabei, aus dem wir uns Zigaretten rollten und genüsslich den Rauch in die Lungen sogen. So genossen wir unsere Jugend und unsere Freiheit an diesen schönen Vor- bzw. Nachmittagen.
Zusätzliche Informationen machten uns nicht unbedingt glücklicher und doch gierten wir danach. Irgendeiner hatte immer einen Transistor, eine Flachbatterie und ein Potenziometer zusammengelötet, um die feindlichen Sender abzuhören. Komischerweise konnten damals alle löten, man fragt sich, wo diese Fähigkeit heute geblieben ist. Über die Feindwelle hörten wir von Rollerpartys in London, wir stellten uns vor, wie die Tänzerinnen und Tänzer Hand in Hand zur Musik über die Tanzfläche rollten. Klar, das wollten wir auch probieren! Die Frage war nur, wie. Wir besaßen keine Roller mehr, die hatten wir längst unseren kleinen Brüdern vererbt oder den jüngsten Kindern unserer ältesten Schwester, wenn wir selbst kleinste Brüder waren, denn in der DDR gingen den Kaninchen die Augen über angesichts der hohen Reproduktionsraten der Menschen. Wer selbst schon Kinder hatte, durfte nicht mehr in den Fetenschuppen, um Platz zu machen für die nächste Generation der Nachwuchsanbahnung. Also überredeten wir die kleinen Jungs, uns ihre Roller für den Tanz auszuborgen. Zwar sahen die Roller albern aus mit ihren kleinen Wimpeln auf dem Schutzblech des Vorderrads – doch egal! Wenn die coolen Londoner das machten, dann müsste es auch bei uns gut aussehen. Das Problem war, dass die Fetenscheunen keine Fundamente hatten. Die Jugendlichen selbst hatten sie in der Regel erbaut, indem sie vier Baumpfähle im Rechteck in den Boden rammten und die Lücken mit den Sauerkohlplatten vernagelten. Dadurch war der Boden in diesen Vergnügungslokalen nicht übermäßig glatt. Außerdem waren die Roller nicht für den Einsatz bei einem coolen Tanzvergnügen für schlaksige Jugendliche, sondern für das ausgelassene Rollen von Vorschulkindern gebaut. Um die Wahrheit zu sagen, gestaltete sich das Tanzvergnügen seinerzeit ausgesprochen mühevoll. Während die Kapelle den großen Erfolg »Der Kolchosen goldene Weizenfelder wogen im sozialistischen Sommerwind« von Juri Petruschenko spielte, eine schöne Polka mit schwungvollem Trompetensolo, versuchten wir Hand in Hand über den lehmigen Boden der Fetenscheune Pankow zu kariolen. Dabei stießen wir einander, verloren unsere Tanzpartnerinnen, flogen der Länge nach in den Matsch und verloren die Roller unserer jüngsten Familienmitglieder.
Das Leben der coolen Londoner blieb uns lange Zeit ein Rätsel. Natürlich war der tatsächliche Inhalt dieser Geheimschatulle nicht ein Viertel so schön, wie das, was wir vor der Wende darin zu finden dachten, ja, die Frage ist sogar, ob nicht unsere Sehnsucht selbst schöner war als die Wirklichkeit.
Kein Spaß
»Gott, als Teenies hattet ihr sicher damals Langeweile«, sage ich meinem Bekannten, »damals, zu Ostzeiten.«
»Warum?«, fragt er.
»Weil ihr nix gehabt habt, was Spaß macht«, sage ich.
»Was zum Beispiel?«, fragt er.
»Telefone«, sage ich. »Ihr hattet keine Telefone, oder? Das muss total langweilig gewesen sein. Weil bei uns, bei uns in England, haben wir immer, wenn wir Langeweile hatten, zum Telefon gegriffen und irgendwelche Leute angerufen. Zum Beispiel in der Mittagspause haben wir den Ehemann der Kantinenleiterin angerufen und ihm erzählt, dass die Vibratoren, die sie bestellt habe nur in Rosarot und nicht in Schwarz zur Verfügung standen. Wir wussten, dass er Rentner war und auf sie gewartet hat. Oder wir haben beim Sozialmedizinischen Kindernotruf angerufen und erzählt, dass unser Mathelehrer immer Orgasmen kriegt bei Algebra und wir uns Sorgen um ihn machen würden. Und in den Sommerferien haben wir bei der Soziologielehrerin angerufen und ihr gesagt, dass Michael Harrison in sie verliebt sei und nicht sicher wäre, ob er die sechs Wochen durchhalten könne, ohne sie zu sehen. Und oft haben wir auch bei der Auskunft angerufen. Wir haben bei der Auskunft angerufen und gefragt, mit wem sie lieber schlafen würde: mit Tiffany aus Eastenders oder Annalise aus Neighbours?Eastenders spielte in England, Neighbours in Australien«, erkläre ich kurz. »Und wenn sie Annalise gesagt haben, sagten wir dann: ›Oh, aber da bist du ganz schön unpatriotisch.‹«
Mein Bekannter lächelt gequält. »Bescheuert wart ihr«, sagt er. »Völlig bescheuert.«
»Und einmal«, erzähle ich, »einmal haben wir die Auskunft angerufen und gefragt, was für eine Ausbildung man benötigen würde, um bei der Auskunft arbeiten zu können. Weißt du, was der Typ gesagt hat? Er hat gesagt: ›Fick mich, meine Liebe, eigentlich brauchst du gar keine.‹«
Mein Bekannter guckt skeptisch.
»Das hat er gesagt?«, fragt er.
Ich sage es noch mal auf Englisch und zwar in meiner besten schottischen Aussprache:
»›Fook me, love, you don’t really need any.‹«
»Echt«, sagt er. »Das hat er echt gesagt?«
»Und manchmal haben wir versucht, mit denen Telefonsex zu machen. Es hat fast nie geklappt. Wir haben gesagt: ›Oh, ich habe meinen Schuluniformrock an und keine Höschen drunter, weil ich beim Sportunterricht so geschwitzt habe!‹ Und normalerweise haben sie immer nur zugehört und desinteressiert gesagt: ›Brauchst du die Nummer von einem Unterwäscheladen oder was?‹ Aber einer hat mal mitgemacht. Er hat gesagt: ›Erzähl vom Duschen, mich interessieren eure Duschgewohnheiten, duscht ihr in Gruppen? Benutzt ihr viel Waschgel?‹ Nachher haben wir Unmengen von Beschwerdebriefen geschrieben. Wir haben geschrieben: ›Wissen Sie, was für perverse Kranke Sie bei der Auskunft eingestellt haben?‹«
»Aha. Das hat bestimmt Spaß gemacht«, sagt mein Bekannter.
»Aber du Armer«, sage ich. »Hinter dem Eisernen Vorhang weggesperrt! Bei euch hatte man keine Telefonanschlüsse, stimmt’s? Was habt ihr gemacht, wenn ihr Langeweile hattet? Das muss so langweilig gewesen sein.«
»Du hast nicht ganz recht«, sagt er. »Es gab einen Jungen in unserer Clique, der einen Telefonanschluss hatte. Wir sind zu ihm gegangen und haben dann bei Leuten angerufen und ihnen gesagt, dass ihr Trabi endlich da sei. Oder ihr Kühlschrank.«
Ich lache. »Ach, das muss lustig gewesen sein. Viel besser als das mit den Vibratoren eigentlich, weil alle so lange auf alles Mögliche warten mussten. Das muss richtig lustig gewesen sein.«
»Siehste«, sagt er.
»Aber bei euch gab es auch keine Penner«, sage ich. »Oder? Keine Penner. Weil alle eine Arbeit hatten. Also war auch niemand bereit, für euch Alkohol zu kaufen. Bei uns haben wir immer die Penner damit beauftragt, für uns Alkohol zu kaufen, und sie durften dafür aus der Flasche ein bisschen was trinken. Manche von ihnen wurden richtige Freunde. Wir haben sie manchmal extra bezahlt, damit sie für uns strippen oder singen oder im Einkaufswagen auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt ein Wettrennen machen. Aber ihr hattet ja keine echten Supermärkte, oder? Mit Parkplatz davor und so? Ihr hattet nur Kaufhallen.«
»Jacinta«, sagt mein Bekannter. »Ein Supermarkt und eine Kaufhalle sind beide große Lebensmittelgeschäfte, in denen man Lebensmittel kaufen kann.«
»Was?«, frage ich.
»Auf Ostdeutsch heißt ›Supermarkt‹ ›Kaufhalle‹.«
»Was?«
»Ja, Kaiser’s ist eine Kaufhalle. Hast du das nie bemerkt? Ostler sagen immer Kaufhalle, die Westler immer Supermarkt. Aber das Prinzip ist dasselbe. Natürlich haben wir keine riesengroßen monströsen Tempel gehabt, wie ihr in London, wo alle ihre Kinder an sich binden müssen, weil, wenn sie sie verlieren würden, das für immer wäre. Aber wir hatten schon Supermärkte.«
»Ich dachte, ihr hattet nur Kaufhallen, und die waren zwar wie Supermärkte, aber sozialistisch und klein, und alles grau, und die Mitarbeiter waren alle Beamte und so, und Alkohol war verboten, und ihr habt nur mit Lebensmittelgutscheinen bezahlt, und alle durften nur eine Packung Zucker pro Woche bekommen – oder pro Monat – eine Packung Zucker pro Monat – oder Quartal – ja, jedes Quartal eine Packung Zucker – und es gab immer nur eine Art Senf – oder? Das hast du mir erzählt, mit dem Senf – nur eine Art Senf – sozialistischer Senf – und dann eine Regalreihe voller Gläser mit Spreewaldgurken. Das hat mir echt so leidgetan. Dass ihr immer nur eine Art Senf gehabt habt. Ich hoffe, er war zumindest lecker.«
»Habe ich dir das erzählt mit dem Senf?«
»Ja«, sage ich.
»Kann sein. Jacinta, weißt du, ich war einmal in London in eurem Tescos-Dings da, das ist lächerlich groß, und ihr habt es wirklich übertrieben mit dem Senf, ja. Es gab Senf aus allen Ländern der Welt. Braucht man wirklich Senf aus der Schweiz und der Mongolei und Sambia, um glücklich zu werden?«
»Nee«, sage ich.
»Also«, sagt er.
»Aber«, sage ich.
»Was«, sagt er.
»Wenn es nur eine Art von allem gab, dann muss es viel schwieriger gewesen sein, was zu klauen. Wenn es nur eine Art Senf gibt, dann merken das die Verkäufer sofort, wenn du was klaust. Bei uns gab es immer so viel von allem, dass die ganz schnell den Überblick verloren haben.«
»Verstehe«, sagt mein Bekannter.
»Verstehst du?«, frage ich. »Und das war mein drittliebstes Hobby als Teenager. Das erste: Leute anrufen, das zweite: Penner erniedrigen, und das dritte: Sachen klauen. Gott war ich gut beim Klauen. Ich habe so viel geklaut. Bei uns heißt SchleckerSuperdrug, ja? Ich habe die Hälfte des Superdrug in Ilford in meiner Jackentasche mitgenommen. Ich erklärte meiner Mama immer, dass es das im Sonderangebot gab. Denn sie hat sich schon darüber gewundert, wie gut ich mit Geld umgehen konnte. Sie erzählte immer: ›Die Jacinta kriegt es wirklich gut hin, so viel wie möglich für ihr kleines Taschengeld zu kaufen.‹ Und ich sagte: ›Ja, ich achte auf die Sonderangebote.‹ Aber in Wirklichkeit habe ich nur auf den Sicherheitsmann geachtet.«
»Wenn du über deine Jugendzeit redest«, sagt mein Bekannter, »kriege ich immer ein bisschen Angst.«
Ich ignoriere seine Angst. Ich denke nur mitleidsvoll an seine langweilige Jugend.
»Aber es muss so langweilig für euch gewesen sein. Total schwierig zu klauen, weil es so wenig gab, dass die Verkäufer immer alles sofort bemerkt haben, und sowieso: Wenn die Verkäufer es mal nicht bemerkt haben, wer ist schon wirklich heiß drauf, Senf zu klauen? Hattest du damals Bock Senf zu klauen?«
»Nee«, sagt mein Bekannter.
»Ich habe nie in meinem Leben Bock gehabt, Senf zu klauen«, sage ich.
»Wir hatten andere Läden«, erklärt er mir dann. »Intershops. Da bekam man Westprodukte.«