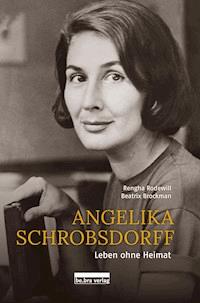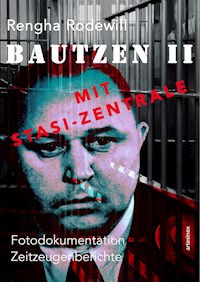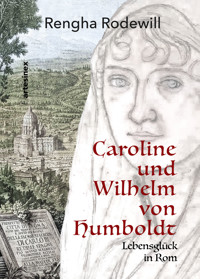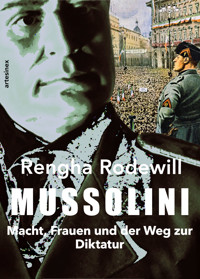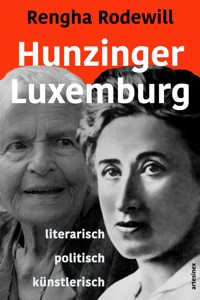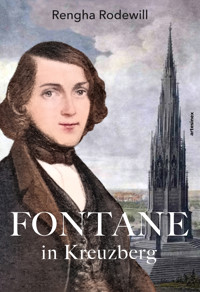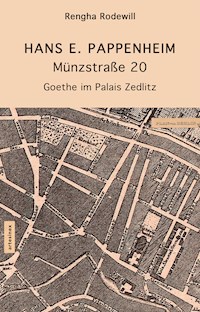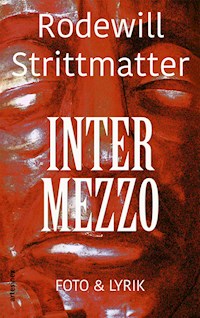Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Kinder sind anders Eine christliche Familie jüdischer Herkunft zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Berlin. Der Gymnasialprofessor Karl Pappenheim und seine Frau Erna bewohnen die Beletage in der Söhtstraße 1 in Gross-Lichterfelde, heute: Berlin-Lichterfelde. Der Sohn Hans wird 1908 geboren und Erna Pappenheim beginnt die täglichen Ereignisse in ihrem Tagebuch niederzuschreiben. Das sind u. a. Erlebnisse während der Sommerfrische in Krummhübel, i. Riesengebirge, heute: Karpacz (Polen). Man trifft sich dort mit der Berliner Freundin der Familie, der Komponistin und Pianistin der Spätromantik, Anna Teichmüller, die einen größten Teil ihres Lebens in der von Carl und Gerhart Hauptmann um 1890 gegründeten Künstlerkolonie im benachbarten Schreiberhau, heute: Szklarska Poręba verbringt. 1911 werden die Zwillinge Inge und Ursel geboren und Erna Pappenheim beobachtet und beschreibt die Entwicklung ihrer Kinder. Sie ist sehr vertraut mit dem Verhalten von Mädchen und Jungen, denn der Schwiegervater, der Fröbel Pädagoge Dr. Eugen Pappenheim hat sein Engagement für die »Fröbelbewegung« an seine Töchter Anna und Gertrud weitergegeben. Herausragend war Tochter Anna, die zum Kreis der Pädagoginnen zählte, die Kindergärten gründete und leitete. Als Clara Grunwald, Initiatorin und Protagonistin der Montessori-Bewegung in Berlin, die Dottoressa Maria Montessori für einen Vortrag 1922 nach Berlin einlädt, werden Gertrud Pappenheim und ihre Schwester Anna Wiener-Pappenheim, vermutlich Maria Montessori auch getroffen haben. Erna Pappenheims Tagebücher sind ein bemerkenswertes Dokument aus der Zeit des Berliner Bürgertums zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir erfahren auch von der katastrophalen Ernährungssituation der Zivilbevölkerung im »Hungerwinter« 1916/17, die selbst im Großbürgertum als äußerst schmerzhaft empfunden wurde. Neben den Aufzeichnungen sehen wir private Fotografien der Familie aus Gross-Lichterfelde, den Ferien in Krummhübel und Längenfeld im Ötztal in Tirol.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GiovanniundFelicia
Rengha Rodewill
Die Pappenheims
Aus den Tagebüchern einer Berliner Familie1910–1920
Friedrich FröbelMaria Montessori
Revolutionäre Ideen von Kindheit
Rengha Rodewill geboren in Hagen (Westfalen) ist eine deutsche Fotografin, Autorin und Publizistin.
Publikationen (Auswahl): »Zwischenspiel« mit Eva Strittmatter, Plöttner Verlag Leipzig, 2010; »Hoheneck – Das DDR-Frauenzuchthaus«, Vergangenheitsverlag Berlin, 2014; »-ky’s Berliner Jugend« mit Horst Bosetzky, Vergangenheitsverlag Berlin, 2014; »Leben ohne Heimat« mit Angelika Schrobsdorff, btb Verlag München, 2019; »Hunzinger – Luxemburg«, artesinex verlag Berlin, 2019; »Bautzen II – Mit Stasi-Zentrale«, artesinex verlag Berlin, 2019; »Intermezzo« Foto & Lyrik mit Eva Strittmatter, artesinex verlag Berlin, 2019; »Hans E. Pappenheim Münzstraße 20 – Goethe im Palais Zedlitz«, artesinex verlag Berlin 2021.
Der Tagebuchtext, verfasst von Erna Pappenheim, entspricht der einheitlichen Rechtschreibung und Zeichensetzung von 1903. Grammatikalisch-stilistische Eigenheiten blieben erhalten, übliche Abkürzungen wurden beibehalten. Eigene Ergänzungen oder ausgelassene Textteile wurden mit eckiger Klammer kenntlich gemacht.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten: Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen der Urheberrechtsgesetze ist ohne Zustimmung vom artesinex verlag unzulässig und strafbar. Dies gilt hauptsächlich für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, sowie für Copyright-Verstößen auf Internet-Plattformen.
© artesinex verlag Berlin (Germany), Juli 2022
Herausgegeben von: Rengha Rodewill und Micaela Porcelli
Autorin: Rengha Rodewill
Beiträge von Erna Pappenheim: Nachlass der Fam. Pappenheim (artesinex verlag)
Künstlerisches Gesamtkonzept: Rengha Rodewill www.rengha-rodewill.com
Titelgestaltung: © Rengha Rodewill unter Verwendung eines Fotos aus dem Tagebuch
Fotografien: Rengha Rodewill 2014–2022 © VG Bild-Kunst Bonn; © Bildrecht, Wien
Historische Fotografien: Nachlass der Fam. Pappenheim, Angaben in Bildunterschriften, Ida-Seele-Archiv, Privatarchiv
Layout: Shaya Schwartz
Lektorat: Tovi Brunner
artesinex verlag
Stuhmer Allee 1a
D-14055 Berlin
www.artesinex.com
ISBN 978-3-9820572-3-1 (epub)
ISBN 978-3-9821614-1-9 (pdf)
Inhaltsverzeichnis
Tagebuch Erna Pappenheim
Gross-Lichterfelde
Tagebuch Erna Pappenheim
Längenfeld i. Tirol und Gross-Lichterfelde
Tagebuch Erna Pappenheim
Gross-Lichterfelde
Friedrich Fröbel
Bertha von Marenholtz-Bülow
The German Kindergarten
Elizabeth Palmer Peabody
The Forty-Eighters
Pestalozzi-Fröbel-Haus
Anna Wiener-Pappenheim
Gertrud Pappenheim
Dottoressa Maria Montessori
Tagebuch Erna Pappenheim
Krummhübel i. Riesengebirge und Berlin-Lichterfelde
Fotocollage Krummhübel und Lichterfelde
Rädda Barnen
Die Pappenheims
Kurzbiografien
Familientafel Uschner – Pappenheim
Anmerkungen
Prolog
Es war drei Uhr morgens im Dreikaiserjahr, als am 6. Oktober 1888 in der Alexandrinenstraße 109 in der Haupt- und Residenzstadt Berlin ein Kind geboren wird, evangelisch getauft auf die Namen Erna, Hilma und Minna. Der Vater, Tischlermeister Ernst Nagel betreibt eine gut gehende Tischlerei und legt gesteigerten Wert auf die Schulausbildung seiner Tochter. Von frühster Jugend hegt Erna den Wunsch, Kindergärtnerin und Pädagogin zu werden. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das deutsche Bildungssystem offener zum Vorteil von Frauen, die anfingen, für den Staat zu arbeiten und an Schulen zu unterrichten. Sie standen vor einer bedeutsamen Entscheidung: Beruf oder Familie. Beamtinnen im Deutschen Kaiserreich war es gesetzlich verboten zu heiraten, im Sprachgebrauch als der »Lehrerinnenzölibat« bekannt. Erna Nagel wollte nicht ›Fräulein‹ bleiben, sie plante eigene Kinder und eine Familie, was bedeutete, dass sie eines Tages heiraten musste. Nach erfolgreichem Abschluss der Schule beginnt Erna eine Ausbildung im »Berliner Fröbel-Verein«, dieser befand sich im damaligen Pankower Ortsteil Niederschönhausen und bildete Kindergärtnerinnen aus, die nach den Fröbel’schen Prinzipien arbeiten sollten. Die Leiterin des Kindergartens ist die Kindergärtnerin und Fröbelpädagogin Anna Pappenheim, deren Vater der Gymnasialprofessor und Fröbelpädagoge Dr. Eugen Pappenheim ist, der zum »christlich-konservativen Kreis getaufter Juden« zählt.
»Eine glückliche Kindheit ist ein Grundstein für ein erfülltes Leben.« Vor über 180 Jahren, derweil sich der Pädagoge Friedrich Fröbel dafür einsetzte, wurde er von seinen konservativen Gegner als unchristlich und sozialistisch diffamiert, von fortschrittlichen Geistern gefeiert. Am 28. Juni 1840 eröffnete Fröbel den ersten »Allgemeinen Kindergarten« im thüringischen Bad Blankenburg. Die Pädagogik Fröbels fand in der Zeit der Revolutionsbewegung von 1848 immerfort mehr Anhänger, und binnen weniger Jahre wurden vielerorts Kindergärten eröffnet. Um seine Erziehungsideen qualifiziert umsetzen zu können, gründete Fröbel eine Schule zur Ausbildung von Kindergärtnerinnen. Nach dem Scheitern der Revolution erließ 1851 das preußische Kultusministerium ein Verbot der Fröbel’schen Kindergärten, 1860 wieder aufgehoben und seine Kindergartenidee verbreitete sich erfolgreich – vor allem in Amerika. All das hat Friedrich Fröbel nicht mehr erlebt. Er starb am 21. Juni 1852. Heute ist sein Werk in über 40 Sprachen übersetzt, das Wort ›Kindergarten‹ erwuchs zum weltweiten Idiom. Fröbels Erkenntnis über die Bedeutung des Spiels für die menschliche Entwicklung veränderte die erzieherische Praxis und machte ihn zum einflussreichsten Pädagogen des 19. Jahrhunderts. Im Fröbel’schen Verständnis gründete sich jede wirkliche Erziehung zunächst auf Religion. Für ihn war eine Erziehung, die sich in der Religion begründet sieht, eine wirkende, erzeugende und schaffende, eine produktive Erziehung. Unter Religion verstand Fröbel das Wechselverhältnis von Gott und Mensch, wobei er Gott als den Grund und die Einheit aller Dinge und den Menschen als Geschöpf Gottes definierte.
Für Maria Montessori ist der Ausgangspunkt für Erziehung weniger die Religion, sondern sie wünscht sich eine Erziehung, die vom Kind ausgeht. Die Kenntnis über das menschliche Leben sollte der Ausgangspunkt für eine Erziehung sein, die das Leben als Zentrum betrachtet. Sie konzentriert sich in ihren Arbeiten mehr auf die Kinder und schenkt den Erwachsenen kaum Aufmerksamkeit. Im Gegensatz zu Fröbel geht es ihr nicht um eine allgemeine Menschenerziehung, sondern um Kindererziehung. Ihre Anthropologie entwickelt sie bis zur abgeschlossenen Stufe der Kindheit. In dieser Zeit werden die grundlegenden Voraussetzungen für die gesamte weitere Entwicklung der Menschen im Voraus bestimmt.
Auf einem Sommerfest 1906 wurde die erst 18-jährige Erna Nagel, Dr. Karl Pappenheim vorgestellt. Karl ist Gymnasiallehrer an der 1896 in der Ringstraße gegründeten »Realschule zu Gross-Lichterfelde«, der späteren Oberrealschule und dem heutigen »Lilienthal-Gymnasium«. Der 23 Jahre ältere Karl Pappenheim und Erna heiraten im März 1907. Ihr erstes Kind wurde 1908 geboren, es war ein Junge, den sie Hans Eugen nennen. Drei Jahre später gebar Erna Zwillinge, die ›Mädis‹ Inge und Ursel. Mit der Geburt ihres Sohnes ›Hansl‹ beginnt Erna Pappenheim, die täglichen Ereignisse in einem Tagebuch festzuhalten.
Erna Pappenheims Tagebücher sind ein bemerkenswertes Dokument aus der Zeit des Berliner Bürgertums zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir erfahren von der katastrophalen Ernährungssituation der Zivilbevölkerung im »Hungerwinter« 1916/17, die im Großbürgertum schmerzhaft empfunden wurden. Neben den Aufzeichnungen sehen wir private Fotografien der Familie aus Gross-Lichterfelde, Freunde und Bekannte der Pappenheims, zahlreiche Eindrücke von Familienurlaubszielen, wie Krummhübel i. Riesengebirge (Schlesien) sowie Längenfeld i. Tirol (Österreich). Über einen Zeitraum von zehn Jahren lernen und erfahren wir einiges über eine assimilierte jüdische Berliner Familie in bewegten Zeiten.
Erna Pappenheim mit ihren Kindern Hans, Ursel und Inge, 1916
Erna Pappenheim, 1910
In der hinteren Häuserzeile das Geburtshaus von Erna Pappenheim, Alexandrinenstraße Kreuzberg, 1888
Die St. Jacobikirche ist eine 1844/45 im Stil einer alt-christlichen Basilika erbaute evangelische Kirche – entworfen vom maßgebenden preußischen Baumeister Friedrich August Stüler in der südlichen Luisenstadt. Die Kreuzberger Oranienstraße führte in den 1840er Jahren durch ein gerade entstehendes Vorstadtviertel, die Luisenstadt, 1802 so benannt nach der Gemahlin Friedrich Wilhelms III. 1843 wurde die St. Jacobi-Kirchengemeinde von der Luisenstadtgemeinde abgetrennt. Es war 1888 die Taufkirche von Erna Pappenheim und 1866 des Operettenkomponisten Paul Lincke, der Vater der Berliner Operette. Es handelt sich um die älteste Kirche Kreuzbergs.
Grabstätte von Taufpfarrer Albert Przygode Friedhof der St. Jacobi-Gemeinde Karl-Marx-Straße Berlin-Neukölln, 2017
Tagebuch Erna Pappenheim
Gross-Lichterfelde
Erna Pappenheim »Aus dem Tagebuch vorlesend«, Bleistiftzeichnung, 1916
18. Mai 1910
Hansl schlüpfte unter das Deck u. schaut wieder vor und erklärt: »Ich gehe unter – ich bin die Sonne.« Von sich sagt er, »Hansl ist ein kleiner Junge.« Durch unsere Beeinflussung allerdings hängt H. mit Vorliebe allen Wörtern ein »l« an (Hundl, Sterndl). Sein naturwissenschaftliches, botanisches Interesse ist sehr ausgeprägt. Tausendschönchen, die er vom Balkon kennt, entdeckt er auf der Strasse und macht mich aufmerksam: »Mutti da ist ein Schönchen und 1000 Schönchen.« Gänseblümchen sind ihm von der Wiese her bekannt, ebenso erkennt er Maiglöckchen wieder und fragt, ob sie ebenso schön riechen wie auf dem Balkon und im Schulgarten. Die Schneeglöckchen im Frühjahr erregen stets seine Bewunderung, wie auch die Veilchen, die er jedesmal eifrig im Garten suchte und die er, wenn er nicht zärtlich veranlagt war eine Veile nannte, dann sparte er sich das chen. Hansl ist ein ganz modernes Kind, er telefoniert mit seinen Grosseltern und spielt telefonieren, indem er seine gewölbte Hand an das Ohr legt und in irgendeine Zimmerecke hineinruft, wo er ein ausgedachtes Telefongespräch führt: »und ’n Tag Ida, - wo ist Ahnst (Ernst) - Da. - ja.« und »Tag Ahnst. Geht es dir gut? – Hast du Durst? Ich habe hier in die Hand ein feiner Beihicht (Bleistift). Hast du auch ein kleines Messer – Grüße schön Ida - Ida, komm ½ 4 Kaffee - Adiö - adia - Auf Winzehn (Auf Wiedersehen). Barf ich nudeln?« Darf ich abklingeln? soll das heissen. Hansl hört gern Erzählen, ganz gleich ist ihm, was er zu hören bekommt; ob er es schon öfter erzählt bekam oder es miterlebt hat und doch ist man manchmal um Stoff verlegen. Da bringt er mich oft selbst mit seinen Wünschen auf gute Gedanken, wie er mich z. B. neulich beim Spargel schälen bat: »erzähl mir von den Spargel« und darauf erfolgte eine feine Spargelgeschichte die vom kleinen Spargelinen im Winter in der Erde, vom 1. Sonnenschein, vom neugierigen Spargelkopf, vom Spargelstechen, von den Bauersfrauen, von Spargels Eisenbahnfahrt und von Frau Schulze auf dem Markt erzählte, bis zuletzt eine Dame die Spargel kaufte. Da der Schmerz über das Ende der schönen Geschichte so gross war, hat Frau Schulze der Dame, rasch noch mal die ganze Sache erzählt. So ist das Gemüseputzen für Hansl eine fröhliche Stunde und wenn’s auch mal keine Geschichte gibt, dann finden wir soviel anderes Feines. Da darf der Junge helfen, er darf auch das geputzte Gemüse in den Gemüseeimer tun oder bis Mutter sie braucht, von den Kohlrabis einen Garten bauen, doch die schönste Aufgabe ist Bohnen brechen. Auch anderswo weiss er sich nützlich zu machen. Durch ihn verursachte Unordnung muss er beseitigen, was er meist als selbstverständlich tut. Von nun an hat Hansl ein fröhliches Amt, nämlich Blumengiessen. Das ist der Glanzpunkt des Tages, der von Mutter leider immer noch nicht lange genug ausgedehnt wird. Hansl nimmt sein Amt sehr ernst. Des Morgens ist seine erste Behauptung: »meine Blümchen haben Durst.« Beim Begiessen versichert er mir immer wieder: »Mutti, ich giesse auch den Pursichbaum« (ein Pfirsichbaum den ich mir vor drei Jahren gepflanzt habe). Mit besonderer Liebe behandelt er seine 3 kleinen Blumentöpfchen, mit Teppichbeetpflanzen, die haben schon schwer unter seiner Liebe gelitten. Im Garten kommt sich Hansl als ganz grosser Mensch vor, wenn Vater den Wasserhahn aufdreht und der Hansl mit dem grossen Schlauch gerade wie der Spritzenmann oder Spritzenfrau (wie H. sie nennt) die vorne im Garten sind, die Blumen sprengen darf. Doch wenn Hansl dann nachher nach hause kommt, braucht er mir kaum erzählen, wo er war und was er getan hat, davon zeugen schon seine Kleider, so nass sind die, und ein neues Paar gelbe Sandalen haben wir ganz verdorben dabei. Nun der Streit über Mutters Verwunderung war bald vergessen, denn dafür ist das Wasserspiel viel zu schön. Neulich sagt er: »Mutter ich feue mich (er freut sich) bald ist Sonntag und denn kommt Onkel Alfek und Tante Alfek, nein mit Tante Alfek – (Tante Anna heisst es) – Man schnell alles sauber machen.« Wenn unten die Haustür klingelt, rafft er all seine Spielsachen zusammen u. ruft: »au wei jetzt kommt einer, schnell Ordnung machen.« Und wenn’s auch allerlei gibt, was er als seine Pflichten gegen die Mitmenschen erkennt, scheint’s ihm doch recht gut bei uns zu gefallen; denn neulich sagt er beim Spinatverlesen zu mir: »Ach is schön bei Mutti.« Das Spazierengehen auf der Strasse, mag es noch so langweilig sein, viel Interessantes erleben wir doch dort; z.B. da gehen wir eben noch in der Sonne, plötzlich ist um uns herum alles dunkel, das fällt dem Hansl auf, aber er hat sich auch nicht lange zu besinnen, wie das gekommen ist. Er antwortet: »Das ist weil der Baum da so gross ist.« Einmal stehe ich in der Sonne, da ruft er ganz erfreut: »ach gucke doch, Mutti ist sonnig.« Auf dem Loggiatisch werfen die Vergissmeinnicht Schatten, es waren wunderhübsche Silhouetten; auf meine Frage, wer die schwarzen Blümchen auf den Tisch gelegt hat, antwortet er: »na die Sonne.« Wir gehen wiedermal spazieren da begegnet uns ein Spreng- oder Wasserwagen, als wir ihn nicht mehr sahen fragt er: »Wo ist bloss der Wasserwagen? Ach ich weiss schon, immer weiterfahren ganz hinten nach Bahnhof West, wo man nach Grunewald fahrt« (In der Richtung war es ganz recht). Als wir den Strassendamm gehen sagt er: »Jetzt gehen wir über den Dampf.« Mit Vorliebe gebraucht Hansl das Fürwort »man«. Darf man da hinsetzen?
Original-Küchenausstattung der Pappenheims aus der Söhtstraße 1 mit dem Kochbuch »Das ABC der Küche« von Hedwig Heyl; Widmung: »Meiner lieben Erna 20. Nov. 06«
10. Juni 1910
Musik und Reim machen ihm Freude. Lange Zeit hat er das Klavierstimmen nachgeahmt. Auf dem Klavier tippt er überhaupt zu gern herum und freut sich, wenn er bekannte Töne trifft. Neulich läuft er barfuß umher, setzt sich ans Klavier und als er mit den Händen ein paar Töne gespielt, ruft er triumphierend: »Ich kann schon barfuss Mumik spielen!« Er singt Folgendes, anfangs recht gesungen, zuletzt geht’s in Sprechen über: »Schlaf Kindl schlaf, da daussen stehn fei Schaf. Ein fazes und ein weisses und wenn das Kind nicht schlafen will, dann wird es wieder munter.« So lautet sein Text. Da hat er 2 Liedertexte zusammengeworfen, aber der Inhalt war ihm jedenfalls ganz aus der Seele gesprochen, denn Schlafen gehört ja zu den bösesten Dingen auf der Welt, ebenso das Waschen. In heissen Tagen haben wir auf der Loggia gebraust, um das Waschen zu ersparen, aber selbst das passte ihm nicht. »Aber nicht spritzen und nicht douchen, lieber waschen, ich weine aber doch.«
Ringstraße 8a Lichterfelde, 2022
Dadurch, dass wir auf dem Balkon die Vögel füttern, kennt der Hansl viele von ihnen. Meise ist ihm ganz geläufig, doch bekommt er sie häufiger zu hören wie zu sehen. Er hat selbst herausgefunden und bezeichnet die Meise die im Schulgarten singt: »hüpüpe hüpüpe.« Krähen sieht er fliegen u. weiß dass sie krah rufen. Spatzen und Grünfinken fressen sich bei uns satt und sind uns gut bekannt, ebenso die Buchfinken. Tauben spazieren auf dem Schulhof umher und jedes Mal ist H. von Neuem enttäuscht, wenn sie plötzlich auffliegen, als er sie gerade greifen wollte. Hühner und Enten haben unsere Freunde Jossmanns1 in grossen Mengen und das Hübscheste bei solcher Hühnerzucht ist, dass wir die Küken vom 1. Lebenstage an betrachten können. Die Enten haben Hansl immer noch mehr interessiert. Einen Storch kennt er aus dem Zoologischen Garten2 und seine langen Beine sind ihm unvergesslich, immer ahmt er auch den Storchengang nach. Einen Zeisig haben wir im Zimmer und er erkennt auch seinen Gesang auf der Strasse von Weitem, wenn dieser auf dem Balkon ist. – Sein Spiel besteht jetzt hauptsächlich aus Sandspiel, Betätigung im Garten: Giessen, Pflanzen, Graben usw. Käfer finden, die er natürlich immer wieder laufen lassen muss. Er ist ganz furchtlos, fasst Tiere jeglicher Art an. Ab und zu wird vielleicht mal ein kleines Weilchen auf dem Balkon gebaut, am ehesten noch in Verbindung mit dem Sandtisch. Das Bilderbuch ist beinahe vergessen. Neulich baute er aus lauter Pfennigstücken eine Eisenbahn. Bei folgender Figur sagt er: »Jetzt macht die Eisenbahn eine Ecke.« Wir haben vergessen zu erzählen, dass uns im Mai ein Maikäfer ins Zimmer geflogen ist, dass hat uns viel Spaß bereitet. Zuletzt haben wir das Fenster aufgemacht und da ist er durch die Luft auf den nächsten Baum geflogen. Das Wort ›Luft‹ gebraucht Hansl oft. Er zeigt um sich herum und sagt: »das ist alles Luft.« Er winkt aus dem Fenster und als ich frage, wem er winkt, antwortet er: »ich winke die Luft.« Mit grosser Treffsicherheit setzt er allen Wörtern die richtigen Artikel z.B. sagt er: der Maikäfer, ein kleiner Maikäfer, ein kleines Maikäferlein, viele, kleine Maikäferlein, nur beim einem Wort (bei Rad) wusste er es nicht richtig, da sagte er, ein Rad und der Rad; weil man meistens von ein Rad redet. Die Geschichte von Maikäfer Fritz hat ihn lange beschäftigt. Der Maikäfer Fritz, der auf dem Baum sass und von den Kindern runtergeschüttelt wurde. In dem dunklen Kasten war’s traurig und er weinte, bis er einschlief usw. Hansl erzählt diese Geschichte nach und zwar folgendermaßen: »Da war mal ein Maikäfer Fritz, der sitzte auf dem Baum und da rumpeln die Kinder und da fällt der Maikäfer Fritz runter und in dunklen Kasten war’s schlecht und Maikäfer Fritz weinte und denn mehmte (nahm) er sich sein Däumchen und denn mehmte er sich seine Locke und denn schlafte er« (H. nimmt nämlich zum Schlafen sein Däumchen u. eine Locke).
Hansl auf dem Balkon Ringstraße, 1910
11. Juni 1910
Wir haben einen Kaffeebesuch bei Frl. Saniter3 gemacht und in der Laube im Garten Kaffee getrunken. Hansl Milch mit Kuchen, wofür er aber wie immer freundlich dankte. Frl. S. war bange, dass er sich bei uns Erwachsenen langweilte. Da war sie aber sehr im Irrtum. Da fand er 1. eine Giesskanne ohne Wasser, an der man aber die Brause abdrehen konnte. Da war an der Gartenpforte ein winziges Schloss, das hatte es ihm angetan. Und nachdem er oben und um sich herum alles angeschaut hatte, durchstöberte er Tisch u. Bänke unterhalb und da gab’s nun erst Herrlichkeiten. Eine Harke uvm. hatte er entdeckt und forderte nun Frl. S. auf: »Tante Saniter, stehe mal eben auf und hole mir die Harke von die Erde auf.« Für eine so hochachtbare Lehrerin eine dreiste Zumutung – Sie aber war von H’s Schlagfertigkeit und Zutraulichkeit ganz begeistert. Nachdem wir im Garten alles ausgekundschaftet hatten, es blieb nichts mehr zum Erörtern, sogar das Gras hat der H. berochen und festgestellt, dass es nicht riecht, gingen wir in die Wohnung hinauf. Eine fremde Wohnung ist ja Kindern immer das Interessanteste. »Tante Saniter wohnst Du hier? Hast Du auch eine Wasserleitung? Ist das hier das Badezimmer? Tante Saniter, ist hier in die kleine Tür dein Toilettchen?« u.a.m. Das Fragen nahm kein Ende. Auf dem Balkon tranken wir Citronenlimonade, wobei ihm die tanzenden Kerne Spass machen. »Tante Saniter warum tanzen die Kerne von Deine Citrone?« Essen sollten wir Bananen u. Cäks. Als Frl. S. ihm die Banane abzog, bat er sehr bestimmt: »Aber bitte nicht das Faule.« Als sie ihm Cäks anbot, sagte er: »nein ich danke, Herr Francke.« Dauernd wollte er Citronenwasser trinken, da ich das nicht leiden wollte, meint Frl. S.: »Das Kind hat doch Durst.« Als ich ihm nach einer Weile das Trinken wieder verweigere, sagt er: »das Kind hat doch Durst. Tante Saniter, guck mal, ich habe eine Ohrmuschel, Du auch? Tante Saniter was hast Du da für Blumen, die kenne ich nicht« (Geranien). Als ihm Frl. S. den Hut aufsetzt, sagt er: »Du hast es da mit den Hut nicht richtig gemacht« (das Gummiband hinter d. Ohren gemacht). Alle seine Bemerkungen waren so sehr niedlich und von ihm selbst gesprochen klingen sie ganz anders als hier banaus niedergeschrieben. Frl. S. ist jedenfalls den ganzen Nachmittag nicht aus dem Lachen herausgekommen und nur sehr gut, dass den Hansl anderer Leute Amusements nicht im mindesten in seiner Unbefangenheit stört. Ein Schalk ist der Hansl. Ich verbiete ihm energisch das Alles – sage zu ihm: »Wer Affe sagt, kriegt einen Klaps.« Nach ein paar Tagen verkündet er ganz laut und unaufgefordert: »Meine Mutti hat gesagt, wer Affe sagt, kriegt ein Bonbon.« Danach schaut er uns alle nacheinander an, um dann seinem Herzen durch kräftiges Lachen Luft zu machen. Solche Ausfälle ignoriert man am besten oder weist seine Dummheit ganz entschieden ab.
»Hansl’s Eisenbahn fährt um die Ecke« 1 Pfennig Kupfer Münzen, Deutsches Kaiserreich (1892).
Hansl hört was von Bratkartoffeln zubereiten und sagt ganz ärgerlich: »Ach nein, nun schon wieder Bratkartoffeln, denn geht ja schon wieder die Sonne unter« (Schlafenszeit). Wir glücklichen Menschen in Lichterfelde sehen nämlich noch Himmel und somit auch den tägl. Weg der Sonne, nachdem wir dann lieber als nach der Uhr, unsere Tätigkeiten bestimmen. »Ich bin so schwer« sagt er, als er lange Zeit in unbequemer Stellung gesessen u. gespielt hatte. H. hat gehört, dass ich zum Zahnarzt war, da kriegt er mich bei der Nase zu packen, reist mir den Mund auf und sagt: »na zeig mal, ist er nu raus?« Als ich mir nun endlich den Zahn habe ausziehen lassen, war er rührend mitfühlend und seine 1. Frage am nächsten Morgen war: »Vati, blutet’s noch, bei Mutti oben am Zahn?« Er hat in letzter Zeit soviel von Zahnarzt und Zahnleiden gehört, dass, als er sich neulich mit einem Löffel gegen den Zahn schlug und wir ihn teilnehmend fragten, welcher Zahn es gewesen wäre, er mit bitter ernster Mine antwortete: »da oben, der pumbierte« (der plombierte).
20. Juni 1910
Grossvater [Nagel] besucht uns und Hansl fragt: »Grossvater, gehst Du heute Abend wieder weg?« Daraufhin möchte Grossvater gern über Nacht bleiben und fragt, ob er nicht mit in Hansl Bett schlafen kann, doch H. verneint dauernd. Schliesslich bequemt er sich zu dem Geständnis: »Grossvater kann nicht in mein Bett auch mit schlafen, ich hab da alles eingebüxt u. nassgepunkelt« (eingebüxt, ein Grossmutter Nagel Ausdruck).
Söhtstraße, im Hintergrund die »Realschule zu Gross-Lichterfelde« heute: Lilienthal-Gymnasium, 1910
Söhtstraße, li. das ehem. Wohnhaus der Familie Pappenheim, im Hintergrund das Lilienthal-Gymnasium, 2022
Die erste elektrische Straßenbahn der Welt wurde 1881 in Betrieb genommen – Strecke zw. Hauptkadettenanstalt und Anhalter Bahnhof (Gross-Lichterfelde).
Erna Pappenheim, Hansl, Werner Müller mit seinen Eltern. Im Hintergrund die Königlich Preußische Hauptkadettenanstalt, 1909
Eingang zur Königlich Preußischen Hauptkadettenanstalt. Im Hintergrund die Kuppel über der Kirche im Direktionsgebäude Waldstraße, 1910 heute: Altdorfer Straße.
Grabstätte J.A.W. von Carstenn-Lichterfelde, Friedhof an der alten Dorfkirche Lichterfelde. Carstenn verstarb im »Maison de Santé« in Schöneberg, einer »Kur- und Heilanstalt für Gemütserkrankungen«.
Der in den Adelsstand erhobene Kaufmann Johann Anton Wilhelm Carstenn-Lichterfelde (1822–1896), kaufte die »Güter Lichterfelde«, lies diese parzellieren, Plätze und Alleen anbauen und schrieb eine Villenbebauung vor. Um den Verkauf aussichtsreicher zu machen, schenkte Carstenn-Lichterfelde dem Preußischen Staat 21 Hektar Land zum Bau einer neuen Kadettenanstalt, da die angesehene Anstalt ein großer Imagegewinn bedeutet und die Nachfrage nach Grundstücken, durch die im Deutschen Kaiserreich fast ausschließlich aus adeligen Familien stammenden Offiziere verstärkt würde. Die Königlich Preußische Hauptkadettenanstalt in Gross-Lichterfelde bei Berlin, wurde von 1882 bis 1920 die zentrale Kadettenanstalt der Preußischen Armee. Mit dem Schenkungsvertrag verpflichte sich Carstenn zur Herstellung eines Verkehrsanschlusses. Die erste elektrische Straßenbahn weltweit ist 1881 entstanden, sie ist nur 2,5 Kilometer lang, die Strecke zwischen Kadettenanstalt und Anhalter Bahnhof (heute: Bahnhof Berlin-Lichterfelde Ost). Äußerlich wie ein kleiner Pferdewagen konzipiert, setzt sich der Zug zum Erstaunen der ersten Zaungäste »ohne sichtbare Bewegungs-Ursache« in Gang, um dann »schnell dahin rollend« den Blicken der Gesellschaft zu entschwinden. Damit war das Konzept so erfolgreich, dass das »Villenviertel Lichterfelde« bis heute von der ursprünglich durch die Kadettenanstalt angezogenen preußisch-konservativen Oberschicht geprägt ist. Bis zum Inkrafttreten des »Groß-Berlin-Gesetz« am 1.10.1920 wurden Gross-Lichterfelde (ab 1913 Berlin-Lichterfelde) und Charlottenburg bis her als Vororte von Berlin bezeichnet, das änderte anlässlich der umfassendsten Stadterweiterung in der Geschichte Berlins und »Grundsteinlegung für das moderne Berlin des 20. Jahrhunderts.« Damit war Berlin zur flächenmäßig zweitgrößten Stadt der Welt, nach Los Angeles – und nach der Einwohnerzahl, hinter London und New York, zur drittgrößten Stadt der Welt geworden. Nördlich des »Villenareals Lichterfelde«, im 15 km entfernten Viertel um den Friedrich-Karl-Platz, heute: Klausenerplatz, ist der Alltag und das Leben der Menschen gegensätzlich zu dem der Bewohner der Villenkolonie in Gross-Lichterfelde. In dem im privaten spekulativen Mietkasernenbau zwischen 1890 und 1910 wuchs die bis 1920 selbstständige Stadt Charlottenburg um das 15-Fache auf über dreihunderttausend Bewohner. In die vorwiegend ein- bis zwei-zimmrigen Wohnungen niedrigen Standards zogen, im Gegensatz zum sonst bürgerlich bis großbürgerlich geprägten Charlottenburg, Arbeiter, kleine Angestellte, kleine Beamte und kleine Selbstständige.
Postkarte Gross-Lichterfelde, 1898
Alte Dorfkirche und Pauluskirche Hindenburgdamm, 1917
Ev. Pauluskirche Hindenburgdamm, 2022
Schiller Gymnasium Gross-Lichterfelde, 1884 gegründete Höhere Knabenschule; 1885–1943 Progymnasium für Jungen.1917 Einschulung Hans (Hansl) Pappenheim auf der »Schillerpenne«.heute: Oberstufenzentrum Bürowirtschaft I, Berlin.
Realschule zu Gross-Lichterfelde, 1900
Seit 1938 ist der deutsche Luftfahrtpionier Otto Lilienthal Namensgeber der Schule. Die Luftfahrt war fester Bestandteil des Schulprogramms. Obwohl Otto Lilienthal in Lichterfelde wirkte und wohnte und sich auch der künstlich aufgeschüttete »Fliegeberg« nur wenige Kilometer entfernt befindet, besteht keinerlei Verbindung zwischen ihm und der Schule. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor der Namensgeber für die Schule zunehmend an Bedeutung. Unterricht zum Thema Luft- und Raumfahrt wird an dem Gymnasium inzwischen nicht mehr erteilt, heute ist der Schwerpunkt Kommunikation und Medien.
Schulnamen seit Gründung: Realschule zu Gross-Lichterfelde 1896–1930; Hindenburg-Oberrealschule 1930–1938; Lilienthal-Oberschule für Jungen 1938–1951; Lilienthal-Gymnasium seit 1951, im Rahmen der Koedukation in Deutschland werden auch Mädchen aufgenommen.
oben, Augustastraße Ecke Chausseestraße, 1913 rechts die Zahnklinik, in der auch Erna Pappenheim behandelt wurde unten, Augustastraße Ecke Hindenburgdamm, 2022
Lilienthal-Gymnasium Lichterfelde Haupteingang mit Bronze-Büste vom Flugpionier Otto Lilienthal (Bildhauer Olaf Lemke), die ursprünglich 1932 am Fuße des »Fliegeberges« aufgestellt worden war.Im Hintergrund das Wohnhaus Söhtstraße Ecke Wüllenweberweg, 2022
Tagebuch Erna Pappenheim
Längenfeld i. Tirol und Gross-Lichterfelde
Längenfeld i. Tirol (Österreich) mit den Ötztaler Hochalpen, um 1952
Längenfeld, Juli–August 1910
Am 1. Juli reisen wir ab. Hansl fühlte sich gleich sehr wohl in Erwartung und sagte: »nun fahren wir nach Tante Hasenknopf4«. Er wollte auch gleich einen Koffer an das Fenster gesetzt haben, um rauszuschauen, wie wir es im vorigen Jahr getan haben. Von ½ 8 mrgs. bis ½ 6 Uhr hat er fein geschlafen, sonst während der Fahrt ganz gut gegessen. In München hat er mir sogar mein weniges Mittagsbrot, was es überhaupt gab, aufgegessen. In Innsbruck hatte er den nächsten Morgen etwas Brechreiz, war dabei ganz fidel und nach trocken Brötchen und Honig fand der Magen sein Gleichgewicht. Während der Fahrt war er brav und hat uns und die Mitreisenden durch seine Gespräche unterhalten. Sehr dankbar habe ich empfunden, dass Trude5 und Frau Schulrat Stier6 mit uns in einem Zuge fuhren, dadurch hatte H. mehr Bewegungsfreiheit, lief von einem Abteil ins andere und fand überall Interessantes. Frau Schulrat hatte aber auch in ihrer Ledertasche zu viel feines: Eine »Cologne« einen Bleistift, eine kleine Seife, Schokolade, einen kleinen Haken, ein Messer und noch viel mehr für ein Hanslherz. Manchen unabsichtlichen Witz hat er geliefert. Während er sonst so leise spricht, dass man ihn kaum verstehen kann, schreit er Sachen in die Welt hinaus, die sich anschicken, geflüstert oder am besten ganz verschwiegen zu werden: »Vati musst Du auch um die Ecke?« Vaterchen passiert’s nicht oft verlegen zu werden, doch diesmal verschwindet er samt Jungen. Kaum ist das überwunden und Vater erscheint mit ihm wieder auf der Bildfläche, erzählt H. seine Erlebnisreise: »Also erst hat Vati ›zugelappt‹ (den Deckel nämlich) und dann hat er gedrückt und denn ist lauter Wasser rausgekommen.« So verging uns allen die Fahrt lustig und gut. Um 12 Uhr in München schnell Mittagbrot, wobei Hansl guten Appetit entwickelte, in Kufstein Kaffee, in Innsbruck übernachtet. Immerzu fragte er: »Mutti wo sind wir nun, ist hier nun Kufstein usw.« So kamen wir durch Verzollungs-Unregelmässigkeiten erst um ½ 7 Uhr abends in Längenfeld an, und von Anna7 und Alfred8