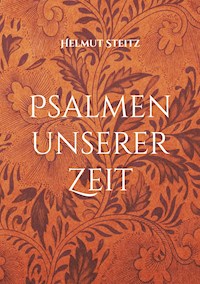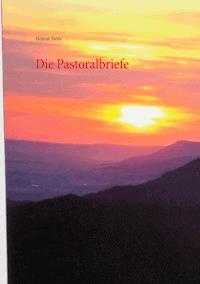
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Pastoralbriefe sind ein wichtiger Bestandteil des Neuen Testaments. Der Inhalt ist ebenso spannend, wie lehr- und segensreich. Und dies nicht nur für Pastoren, Älteste oder Gemeindeleiter - im Gegenteil. Dem Schreiber dieser Briefe war es wichtig, dass die ganze Gemeinde über Gottes Weisungen und Anordnungen Bescheid wusste. So waren die Empfänger der Briefe gehalten, diese der ganzen Versammlung nahe zu bringen, denn Gottes Wort geht uns alle an!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Der Schreiber
Die Empfänger
Der 1. Timotheusbrief
Der 2. Timotheusbrief
Der Titusbrief
Abschlussbemerkungen
Vorwort
In den sogenannten Pastoralbriefen1 des Paulus eröffnet uns Helmut Steitz leichten Zugang zu köstlichen Perlen des christlichen Gemeindelebens durch gesunde Lehre, ausgewogene Verwaltung und kraftvollem Dienst.
Mit einer wunderbaren Frische und Relevanz nimmt er den Leser mit hinein in die Schatzkammern Gottes und präsentiert ein Dienst-Manual für das Amt des Pastors, für seine Qualifikationen und Pflichten. Jeder, dem die Gemeinde Jesu am Herzen liegt, wird in diesem Kommentar auf eine Fundgrube stoßen, die ihn einlädt, Faszination Gemeinde besser zu verstehen, zu genießen und mitzumachen.
Dieses Buch ist ein Ruf zum Aufbruch. Helmut Steitz, mein lieber Freund und Mitglied der Volksmissions-Gemeinde in Geislingen/Steige, will aufzeigen, dass wir hier eine inspirierende Kombination des erhabenen Glaubens im Geheimnis der Gottseligkeit antreffen, gepaart mit profunder praktischer Weisheit zur Führung einer geisterfüllten Gemeinde. Genau, was unsere, etwas verrutschte Zeit braucht, nämlich einen gottwohlgefälligen Gottesdienst, gesundes Unterscheidungsvermögen und ein Leben in der Hingabe an Christus.
Ich wünsche diesem wichtigen Buch eine weite Verbreitung.
Herbert Ros
1 P. Anton gab den Briefen an Timotheus und Titus im Jahre 1726 den Namen "Pastoralbriefe"
Der Schreiber
Saul von Tarsus in Zilizien, trug, wie es in neutestamentlicher Zeit häufig üblich war, den zweiten, römischen Namen Paulus. Er hatte von seinem Vater das römische Bürgerrecht geerbt und besaß somit die jüdische und römische Staatsbürgerschaft. Aus frommem, jüdischem Hause stammend, wurde er ein strebsamer Schüler der Thora. Er war stolz auf seine hebräische Abstammung, auf die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Pharisäer, sowie auf seine Gerechtigkeit und seine Arbeit innerhalb der jüdischen Gemeinde. (vgl. Phil.3,5-6) Paulus war durch und durch Jude. Und er hätte jeden für verrückt erklärt, der ihm gedeutet hätte, dass ausgerechnet er einer der wichtigsten Führer der sogenannten Sekte der Nazarener werden würde. Sein damaliger Lehrer hieß Gamaliel (Apg22,3) und war einer der berühmtesten Rabbiner seiner Zeit.
Im Alter von kaum dreißig Jahren wohnte Saul zum ersten Mal in der Ausübung seines Amtes einer Steinigung eines Christen bei, um ihren ordnungsgemäßen Vollzug zu beaufsichtigen. (Apg.7,57) Eine solche Aufgabe durfte nur von einem voll ausgebildeten Schriftgelehrten ausgeführt werden.
Durch die Steinigung des Stephanus wurde Saul in dem Glauben bestärkt, diese Sekte und deren falsche Lehren, dass der vor kurzem hingerichtete Jesus von Nazareth tatsächlich der von Gott verheißene Messias war, durch Verfolgung und wenn nötig auch Tötung dieser irrgläubigen Menschen, zum Stillstand zu bringen sei. Ausgerüstet mit der Bevollmächtigung durch den Hohenpriester machte sich Saul mit einer Schar Bewaffneter zur Verfolgung bzw. Verhaftung der Christen weiter nach Damaskus auf. Dicht an Damaskus herangekommen, umstrahlte ihn plötzlich um die Mittagszeit ein helles Licht vom Himmel.
Eine Stimme fragte den zu Boden gesunkenen: „Saul, Saul, was verfolgst du mich?“ Auf seine Gegenfrage: „Wer bist du, Herr?“ sprach die Stimme: „Ich bin Jesus, den du verfolgst!“ Als er sich erhob, um nach Damaskus zu gehen, musste er feststellen, dass er erblindet war. Als völlig gebrochener Mensch führte man ihn in die Stadt, wo er zuerst drei Tage unter Gebet und Fasten das Erlebte zu begreifen und zu erfassen suchte. (Apg.9,3-9) In diese Stille sandte Gott am dritten Tag den Christen Ananias, welcher ihm in Gottes Auftrag verkündete, dass ausgerechnet er, der vorher nur das Ziel der Auslöschung dieser Sekte kannte, von Gott als sein Werkzeug, zur Verkündigung und Verbreitung des Evangeliums von Christus unter den Heiden auserkoren war. Ananias legte Saul die Hände auf, worauf dieser sofort wieder sehend wurde und führte ihn in die christliche Gemeinde von Damaskus ein. Dort ließ sich Saul auch taufen.
Durch diese Christusbegegnung brach in Saul alles zusammen, was er ursprünglich für heilig und erstrebenswert hielt. Von diesem Moment an wurde Jesus Christus ihm zum Mittelpunkt des Lebens und somit seines ganzen Denkens und Handelns. Entschieden ging er nun gegen jede Praxis oder Lehre vor, die nicht diesen Christus zum Mittelpunkt hat, egal, ob dies Auseinandersetzungen bedeutet, oder nicht. Er gründete neue Gemeinden und war für bestehende die tragende Säule, wenn diese aufgrund vieler Meinungsverschiedenheiten zu zerbrechen drohten. Sein von vielen Dornen und menschlichem Unrecht durchsetzter Weg endete in römischer Gefangenschaft, aus der er aber - den Pastoralbriefen zufolge - noch einmal frei wurde und Griechenland, Kreta und Kleinasien besuchte.
Nach der Überlieferung der römischen Gemeinde, wurde Paulus unter Nero durch das Schwert hingerichtet.
Die Empfänger
Er war einer der treuesten Mitarbeiter des Paulus und führte viele und wichtige Aufgaben im Auftrag des Apostels aus. Beide begegneten sich zum ersten Mal in Lystra, als Paulus auf seiner zweiten Missionsreise dorthin kam (Apg.16,1). Der Vater des Timotheus war Grieche, wird aber in der Bibel namentlich nicht erwähnt. Seine Mutter, Eunike (vgl.2.Tim1,5), war Jüdin. Als Sohn einer jüdischen Frau war Timotheus dem Gesetz der Beschneidung untergeordnet. Da diese bis zur Begegnung mit Paulus noch nicht vollzogen war, beschnitt ihn Paulus, damit er bei den Juden keinen Anstoß erregte. (Apg.16,3)
Mit Timotheus als neuen Begleiter zogen Paulus und Silas dann durch Kleinasien nach Mazedonien. Paulus verließ Mazedonien und ging nach Athen. Timotheus und Silas ließ er zurück. Nach einem Wiedersehen in Athen, sandte Paulus seinen Mitarbeiter noch einmal nach Thessalonich zurück.
Eine Zusammenarbeit, Seite an Seite war erst später in Korinth wieder möglich (vgl. Apg.17,14; 18,5; 1.Thes.3,1-2; 2.Kor.1,19). Auch auf der dritten Missionsreise des Paulus war Timotheus sein Begleiter, jedoch ging er nicht mit ihm nach Rom. (Apg.27,2) Timotheus besuchte Paulus später dort, wie wir aus Kol.1,1 und Phim.1 ersehen können.
Als Paulus den ersten Brief an seinen Mitarbeiter schrieb, befand sich dieser in Ephesus. (1.Tim.1,3) Timotheus sollte dort vieles in Vollmacht ordnen, was dem offensichtlich noch jungen Mitstreiter nicht immer leicht gemacht wurde. (1.Tim.4,12) Paulus schätzte Timotheus sehr. Denn ihm sandte er sein geistliches Testament, und nach ihm hatte er in seiner zweiten römischen Gefangenschaft Verlangen. Deshalb rief er ihn von Ephesus nach Rom. (2.Tim.4,9-21)
Timotheus führte das Amt eines Evangelisten aus (2.Tim.4,5). Für dieses Amt war er durch Weissagung bestimmt worden und hatte dazu besondere Gaben durch Handauflegung des Paulus und der Ältesten empfangen (1.Tim1,18; 2.Tim1,6). Seine Mutter und seine Großmutter, mit Namen Lois, führten ihn schon von Jugend an in die Kenntnisse der Schrift ein (2.Tim.1,5; 3,15). Seine weitere geistliche Formung geschah vor allem durch Paulus.
Titus
Über diesen Mitarbeiter, den Paulus für wichtige Aufgaben einsetzte, wird uns zunächst nichts berichtet. Eine Theorie besagt, dass Titus der Bruder des Lukas gewesen sei, und daher nicht erwähnt wurde. Dies bleibt aber pure Spekulation.
Im Galaterbrief tritt Titus zum ersten Mal in Erscheinung, indem er als Heidenchrist Paulus nach Jerusalem begleitete (Gal.2,1). Anschließend sandte ihn Paulus nach Korinth, wo in der dortigen Gemeinde völlig verwirrte Zustände herrschten. Titus gelang, was Paulus selbst nicht erreichte. Denn als sie sich in Mazedonien wieder trafen, konnte Titus berichten, dass in Korinth wieder alles geordnet sei (2.Kor.2,13; 7,6,13+14). Paulus erteilte Titus danach den Auftrag, seinen zweiten Brief an die dortige Gemeinde zu überbringen. Später erfahren wir, dass Titus von Paulus auf Kreta zurückgelassen wurde, damit er die dortige Gemeinde ordnete (Tit.1,5).
Paulus, der seinen Mitarbeiter als „Sohn unserer beider Glauben“ bezeichnete (Tit.1,4), schätzte Titus sehr. Immer wieder setzte er ihn ein, um die Gemeinden von Irrwegen wieder auf den rechten Weg zu führen, was Titus auch immer wieder von Neuem gelang. (vgl.2.Tim.4,10)
Der erste Brief des Paulus an Timotheus
Die drei Briefe, welche Paulus an Timotheus und an Titus richtete, wurden und werden als Pastoralbriefe bezeichnet. Sie unterscheiden sich in dreifacher Hinsicht zu den anderen Paulusbriefen:
Sie gehören zu den letzten, von Paulus verfassten Briefen und spiegeln die Sorgen und Anliegen des Apostels, am Ende seines Missionsdienstes.
Sie sind ausdrücklich an keine Gemeinde, sondern an zwei junge Männer gerichtet, welche pastorale Funktionen in den jungen Gemeinden innehatten. Selbstverständlich wurde der Inhalt der Briefe auch in den dortigen Gemeinden verlesen, aber die Empfänger waren zunächst die Schüler des Paulus selbst.
Alle drei Briefe sind sehr persönlich und gleichzeitig praktisch gehalten. Sie befassen sich mit Angelegenheiten der Kirchenordnung, auf die Paulus bisher noch nie explizit eingegangen war.
Klärung der Verfasserfrage
Jeder der drei Briefe wird durch den klaren Hinweis eingeleitet, dass Paulus der Verfasser der folgenden Zeilen ist.
Liberale Gelehrte jedoch begannen im frühen 19. Jahrhundert die Verfasserschaft des Paulus anzuzweifeln.
Diese Lehrmeinung ist in diesen Theologenkreisen bis heute vertreten. Dort geht man davon aus, dass nicht Paulus selbst, sondern einer seiner Anhänger, ein bis zwei Generationen nach Paulus, diese Briefe schrieb.
Wäre dies so, dann hätten wir in der Bibel nicht die Lehre des Paulus selbst niedergeschrieben, sondern die, seiner Nachfolger!
Doch, für alle ins Feld geführten Argumente, welche Paulus als Verfasser der Briefe ablehnen, stehen alle wichtigen paulinischen Themen entgegen.
Die dabei unterschiedlich auftretenden Behandlungen der Probleme, lassen sich zum Einen durch den unterschiedlichen Charakter der Briefe, sowie die unterschiedlichen Gemeindesituationen erklären!
Kap.1:
V.1:
Paulus stellt sich, wie in fast all seinen Briefen üblich, als Verfasser zunächst vor und nennt auch gleichzeitig seine Amtsbezeichnung.
Paulus selbst war nicht aus eigenem Entschluss in dieses Amt gekommen, sondern hatte es durch einen göttlichen Befehl übernommen (vgl. Gal.1,11-2,2).
Diese „Berufung durch den Willen Gottes“ hebt der Apostel auch in mehreren seiner anderen Briefe hervor (1.Kor.1,1; 2.Kor.1,1; Eph.1,1).
Dies tat er nicht etwa, um sich über andere zu stellen, sondern deshalb, weil er seine Autorität, die ihm von Gott dem Vater und Gott, dem Sohn verliehen war, immer wieder gegen Angriffe verteidigen musste.
Ferner nennt der Verfasser Jesus Christus als unsere Hoffnung.
Diese Aussage unterstreicht die Tatsache, dass niemand als Jesus Christus selbst, die Erfüllung des Heilsplanes Gottes darstellt (vgl.Kol.1,27).
V. 2:
Auch wenn der Brief zweifellos dazu bestimmt war, laut vor der Gemeinde in Ephesus verlesen zu werden, so ist er doch zuerst an Timotheus gerichtet.
Paulus war es zwar nicht selbst gewesen, der Timotheus zum Glauben an Jesus Christus geführt hatte (vgl.2.Tim1,5), jedoch war er es, der den jungen Missionar „ordiniert“ hatte (vgl.2.Tim.1,6). Somit nahm Timotheus einen besonderen Platz im Herzen den Paulus ein.
Auch an Timotheus ergeht die übliche Grußformel des Paulus: Gnade, Barmherzigkeit, Friede.
V.3:
Paulus hat Timotheus bereits mündlich gebeten in Ephesus zu bleiben. Durch diesen Brief drängt er Timotheus förmlich zum zweiten Mal. Offensichtlich stand Timotheus kurz bevor, die Gemeinde in Ephesus zu verlassen, um Paulus auf seiner Reise zu begleiten. Die Aufgabe des Zurückbleibenden war es, einigen in der Gemeinde, die andere Lehren (vgl.1.Tim.6,3) als die Paulinische vertraten, Einhalt zu gebieten.
V.4:
Diese falschen Lehren orientierten sich an Fabeln und Geschlechtsregister.
Was es genau damit auf sich hatte, wird nicht ausgesagt, jedoch ist am ehesten davon auszugehen, dass der Ursprung aus dem Judentum stammte (vgl. Tit.1,14).
Es ging dabei wohl um die jüdischen Reinheitsvorschriften. Damit wollten sich diese Irrlehrer vor alle anderen stellen und diese somit aus der Gemeinde ausgrenzen.
Da dies alles aber nur zu puren Spekulationen und zu Streitigkeiten führt, sind sie zu vermeiden, weil sie dem Ratschluss Gottes nicht dienen. Dieser kann allein durch den Glauben, und nicht durch Menschliche Vorstellungen begriffen werden.
Der Vers endet mit einem für Paulus typischen Satzbruch (Andere Bsp.: Rö.2,17; 5,12; 8,12; 9,22; Gal.2, 4).
Zu beachten ist:
Paulus hatte dafür Sorge getragen, dass er weiterziehen konnte.
Jede(r) Mitarbeiter(in) muss im wahren Glauben gegründet und weise sein!
Jede(r) Mitarbeiter(in) soll prüfen, was Jesus dient und den anderen (V5).
V.5:
Anders, als ziellose Vorstellungen und Grübeleien, zielt die Anweisung des Paulus an Timotheus auf die vollkommene Liebe, welche die "Erfüllung" des Gesetzes ist. (Rö.13,10; Mt.22,37-40)
Diese Liebe ist Ausdruck einer Reinheit und Integrität, und entspricht dem Urbild der Liebe Gottes.
Ein reines Herz (= Sitz des Willens!) und gutes Gewissen (gereinigt durch Jesus: Hebr. 9,14) bedeutet, dass auf die Reinheit der Motive großer Wert gelegt wird. Diese Reinheit ist nur in dem Maß in uns, in dem wir Jesus in unserem Leben Raum geben und dafür unser eigenes Leben (Vorstellungen, Gedanken) abgelegt haben.
Gottes Wahrheit reinigt den Geist des Menschen, eine Irrlehre hingegen lässt ihn verkommen!
V.6:
Durch das Verlassen dieser Liebe (s. V.4-5) sind einige abgeirrt (wörtl: verfehlten das Ziel) und haben sich bewusst oder unbewusst von dieser Liebe abgewandt.
Das Resultat ist unnützes, leeres Gerede. Daher ist ihre Lehre nichtig und nutzlos.
Mögliche Gründe
:
Unwissenheit, keine Standhaftigkeit bei Trübsal, Verfolgung oder Sorgen, sowie durch den Betrug des Reichtums
(Mt. 13,21-22; Spr. 12
,15;
21,2; 26,12)
V.7:
Sie spielen sich zu Kennern der Gesetzeslehre auf, ähnlich den jüdischen Rabbinern. Aber, im Grunde haben sie keine Ahnung von was sie reden, ja sogar anmaßende Behauptungen aufstellen. Paulus erkennt, dass hier eine ernste Gefahr für die Gemeinde besteht, da sie viele täuschen und irreführen können.
Um ein Lehrer zu sein, braucht man göttliche Erleuchtung (Apg.9), göttliche Berufung (Eph.4,11) sowie eine Bestätigung geistlicher Leiter (Gal.2,9).
V.8:
Mit "wir" meint Paulus gut unterrichtete und geistgetaufte Gläubige. (1.Joh.2 27)
Und damit seine abfälligen Äußerungen über die Möchte-Gern-Lehrer des Gesetzes nicht falsch verstanden werden, unterstreicht Paulus hier eindeutig, dass das mosaische Gesetz „gut“ ist.
Denn durch das Gesetz wird das Evangelium unterstützt und ergänzt, indem es alles verbietet, was der heilsamen Lehre entgegengesetzt ist.
Der Fehler liegt nicht bei Gott, sondern bei all denen, die sein Gesetz nicht so anwenden, wie Gott es beabsichtigt hat. Denn Gottes Plan war und ist es, durch das Gesetz die Übeltäter zu überführen.
Da der Gerechte (Aufrichtige, Ehrliche, Anständige) aus Glauben (Hab.2,4) lebt, (Gewissen + Hl. Geist), ist für ihn die akribische Anwendung des Gesetzes überflüssig. Denn für einen Gläubigen ist es eine Selbstverständlichkeit, die gesetzlichen Bestimmungen(und mehr) zu erfüllen, da er das Gesetz (die Gerechtigkeit) in seinem Herzen trägt.
Mit „Übeltäter“ sind all jene gemeint, denen sittliches Bewusstsein und die Ehrfurcht vor Gott nichts sagen. Sie lehnen die Heiligkeit Gottes ab, sind weder um das Wohl der Familie besorgt, noch um zwischenmenschliche Beziehungen.
Aufrichtigkeit und auch sexuelle Reinheit sind ihnen fremd.
Die Folge hieraus ist ihr Lebenswandel, den Paulus kategorisch ablehnt.
V. 9-10:
Der Sinn des Gesetzes ist es, den Menschen ihre Sündhaftigkeit vor Augen zu führen. Daher ist das Gesetz nicht für diejenigen gemacht, welche bereits ihre Sünden erkannt und sich zu Jesus Christus bekannt haben. Wer sich zu ihm hingewandt hat, steht nicht länger unter dem Gesetz, sondern wandelt von nun an im Geist (vgl.5,13-26).
Mit der weiteren Darstellung, die er bewusst an die Zehn Gebote anlehnt, nennt Paulus hier ungeschminkt die einzelnen Übertretungen, in ihren schlimmsten Auswüchsen.
In den Vatermördern und Muttermördern ist die äußerste Steigerung der Verletzung des fünften Gebots erreicht. In den Mördern (Totschlägern) die des sechsten Gebots.
Knabenschänder (Männerschänder; NKT); bezieht sich auch auf das weibliche Geschlecht! (vgl.Rö.1,26-28)
Somit bezieht sich diese Aussage auf das achte Gebot.
Hier beruft sich Paulus auf das neunte Gebot.
Was den Prinzipien der Gesetze und Gebote Gottes entgegensteht ist automatisch entgegen dem Evangelium Gottes!
V.11: