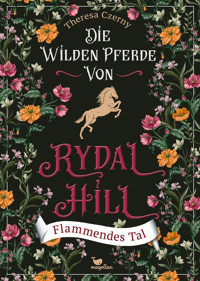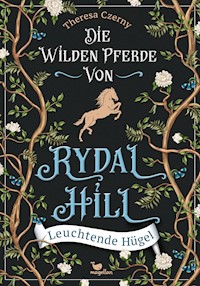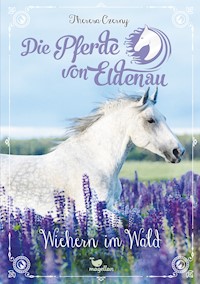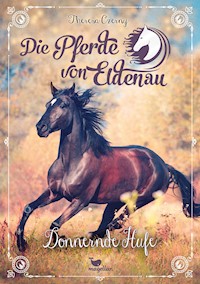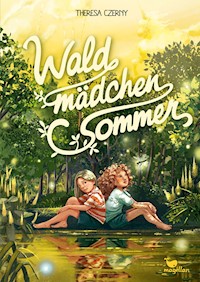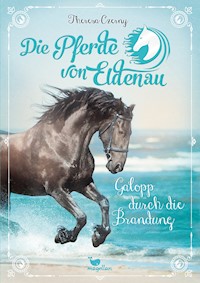
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Magellan Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Pferde von Eldenau
- Sprache: Deutsch
Jannis' Turnierambitionen sind im Moment auf Eis gelegt, denn Dari, sein vielversprechendes Springpferd, lässt sich nach einem traumatischen Erlebnis nicht reiten. Stattdessen hilft er Frida, ihr Pony Liv für das alljährliche Strandderby fit zu kriegen. Das Derby hat Tradition: Seit Jahren ist es das Ereignis für Gut Eldenau, daher stürzen sich alle begeistert in die Vorbereitungen. Doch dann wird bei einem Reitunfall ein Mädchen verletzt und die Pferde des Guts geraten in Verruf. Sogar das Strandderby wird abgesagt. Ihre Ponys sollen unberechenbar sein? So ein Quatsch, findet Frida. Irgendwie müssen Jannis und sie das Gegenteil beweisen und damit nicht nur das Ansehen des Guts, sondern auch das Strandderby retten. Mit wem sie sich dabei anlegen, können sie ja nicht ahnen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Pferde von Eldenau
Band 1: Mähnen im Wind
Band 2: Galopp durch die Brandung
Band 3: Donnernde Hufe
Band 4: Wiehern im Wald
Theresa Czerny
Galopp durch die Brandung
Inhalt
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Frida
Jannis
Möglichst unauffällig trat ich von einem Bein aufs andere. Seit einer halben Stunde standen wir hier oben im schneidenden Wind am Aussichtspunkt, und ich hatte schon vergessen, wie es sich anfühlte, Zehen zu haben. Fridas Vorfahren schienen aus Grönland zu kommen, oder ihre Stiefel waren mit Angora gefüttert, jedenfalls machte ihr die Kälte nichts aus. Ihr Atem bildete weiße Wölkchen in der klaren Luft, sonst hätte ich mir vielleicht Sorgen gemacht, dass sie schon zu Eis erstarrt war.
Wir warteten auf die Herde. Also, die Herde. Auch nach einem halben Jahr hatte ich die Erkenntnis noch nicht ganz verkraftet, dass ich in der Nachbarschaft von Wildpferden lebte. Immerhin waren wir nicht in Arizona, sondern an der Ostsee.
Frida ging mit dieser Wildwestsache irgendwie cooler um, aber sie wohnte ja auch schon ihr ganzes Leben hier an der Küste. Da gewöhnte man sich wahrscheinlich an die verrücktesten Dinge.
Nur jetzt im Frühling standen ihr Herzchen in den Augen, wenn es um die Wildpferde von Eldenau ging: Die Koniks hatten nämlich Fohlen. Das hatte Frida jedenfalls gehört, und seit Tagen löcherte sie mich damit, dass ich sie ins Naturschutzgebiet begleiten sollte. Heute Nachmittag hatten wir endlich beide mal Zeit gehabt und so standen wir hier in der Eiseskälte und bibberten. Das heißt, ich bibberte. Frida hatte sich anscheinend jedes Kälteempfinden abtrainiert.
»Kannst du mal ruhig stehen bleiben?«, maulte sie, aber eigentlich hatte sie gar keine Aufmerksamkeit für mich übrig. Wenn sie noch eine Weile guckte, ging der Waldrand in Flammen auf.
Kaum eine Minute später kam die Sonne raus. Sie hatte es nicht leicht bei all den Wolken, die der Wind vom Meer herüberwehte, doch die paar Strahlen reichten, damit ich mich nicht mehr ganz wie ein Schneemann fühlte. Immerhin hatten wir schon April, auch wenn letzte Woche an Ostern noch Schnee gelegen hatte.
Und da waren sie. Nicht vorsichtig witternd zwischen den Bäumen, sondern als Gruppe am Strand. Frida seufzte leise, als sie die drei Fellknäuel entdeckte: Zwei waren graubraun, das dritte fast schwarz. Ganz kurz riss sie ihren Blick von den Pferdchen los und lächelte mich an, mit roten Wangen und blitzenden Augen, dann lehnte sie sich auf das Geländer und beugte sich nach vorn, als könnte sie so besser sehen.
Die Jährlinge waren gut drauf und lieferten sich Scheingefechte, keilten nach den anderen aus oder rannten um die Wette. Anscheinend tauten sie im Sonnenschein auch auf. Die Fohlen verhielten sich noch schüchterner, doch je wilder es die großen Geschwister trieben, desto mutiger wurden sie. Bald machten sie Bocksprünge und spielten zwischen ihren Müttern Verstecken.
Fridas Grinsen wurde immer breiter und zwischendrin aahte und oohte sie verzückt. Es war so süß, wie sie sich über die Kleinen freute, dass ich sie kaum aus den Augen lassen konnte, auch wenn sie in den Fohlen ernsthafte Konkurrenz hatte.
Gerade als ich mich fragte, ob ich noch ganz richtig tickte – Frida war Frida, meine Güte! –, hoben erst die Leitstute und der Hengst den Kopf, dann fast gleichzeitig der Rest der Herde. Ihre Ohren drehten sich mal zum Wald, dann zum Strand, und ein nervöser Schauer lief durch die Gruppe, von einem Pferd zum anderen, als wüssten sie nicht, wohin sie sich wenden sollten.
Ich spürte Fridas Anspannung, doch bevor ich sie fragen konnte, ob sie eine Ahnung hatte, was los war, schwenkte die Herde nach Osten und preschte den Strand entlang, dass der Kies in alle Richtungen flog. Für die Fohlen war es schwierig, auf den Steinen nicht auszurutschen, aber sie hielten mit.
Von irgendwoher hörte ich ein tiefes Brummen, das, während es näher kam, immer wieder wild aufheulte. War es das, was die Pferde aufgeschreckt hatte?
Zehn Sekunden später hatte ich meine Antwort, denn drei, vier Motorradfahrer, alle in Schwarz, alle auf schwarzen Maschinen, brachen durch die Büsche am Waldrand. Frida schnappte nach Luft.
Ich merkte, wie meine Hände feucht wurden. Was hatten die da unten verloren? Das war ein Naturschutzgebiet, verdammt, nicht mal Spaziergänger hatten dort abseits der Wege etwas zu suchen! Davon hatten diese Biker entweder noch nie was gehört oder es war ihnen einfach mal gepflegt egal. Sie drehten zwischen Strand und Bäumen ihre Kreise und scherten sich nicht darum, dass sie Meerkohlstauden umknickten und tiefe Furchen in den Boden rissen.
Frida war geistesgegenwärtiger als ich. Sie hatte längst ihr Smartphone in der Hand und schoss Fotos, was das Zeug hielt. Ich hatte noch nicht in meine Tasche gegriffen, um meines ebenfalls herauszuholen, als vom Strand Wiehern herübergellte.
»Was zum …« Weiter kam ich nicht, denn da stob schon die Herde heran.
»Was machen die denn?«, rief Frida, aber das wurde uns klar, als hinter den Pferden drei weitere Motorradfahrer auftauchten. Sie trieben die Herde genau auf die anderen zu.
Als die Leitstute die Biker vor ihnen entdeckte, schwenkte sie nach links Richtung Wald, doch gegen die Motorräder hatte sie keine Chance. Sie kesselten die Tiere ein, und wann immer die große graubraune Stute oder der Hengst versuchten, aus dem Ring auszubrechen, schoss eine der Maschinen auf sie zu.
Die Herde war in einem Strudel aus Chaos gefangen. Immer enger zogen die Motorradfahrer den Kreis. Sogar von hier oben konnte ich das Weiß in den weit aufgerissenen Augen der Pferde erkennen. Sie stolperten und prallten gegeneinander und ihr schrilles Wiehern hallte mir in den Ohren. Wie eine Druckwelle breitete sich ihre Panik bis zu uns herauf aus und brachte meinen Magen zum Flattern.
Frida starrte mit aschgrauem Gesicht auf die johlenden schwarzen Gestalten hinunter. Sie hatte ihr Handy sinken lassen, also zog ich es ihr aus den Fingern, riss es hoch und startete die Videoaufnahme. Was die mit den Pferden trieben, war so grausam, so verrückt, das glaubte uns sonst keiner. Und wir konnten nichts tun. Wir waren zu weit weg, als dass sie uns über dem Motorenlärm gehört hätten. Nicht mal die Polizei konnten wir rufen, weil es hier auf den Klippen der Landspitze kein Netz gab.
Frida packte meinen Arm und deutete nach unten. »Siehst du das?«
Im ersten Moment begriff ich nicht, was sie meinte. Dann entdeckte ich den einzigen ruhenden Punkt in dem Gewimmel aus Pferden und röhrenden Maschinen. Die Leitstute war stehen geblieben. Sie hielt immer noch den Kopf hoch, aber ihr Ausdruck hatte sich verändert. Sie wartete.
Auf den richtigen Augenblick.
Und dann war er da. Die Stute hatte ein wenig Raum gewonnen, und als der nächste Biker hinter ihr vorbeifuhr, schlug sie aus. Frida krallte ihre Finger in meinen Oberarm, doch ich spürte es kaum. Durch die Wucht der Hufe geriet die Maschine ins Schlingern und rutschte unter dem Fahrer weg, er schlitterte ein Stück mit ihr dahin.
Die übrigen Biker wurden langsamer. Sie wirkten unschlüssig und diesen Moment nutzte die Leitstute. Die anderen Pferde ließen die Graubraune nicht aus den Augen, und als sie jetzt durch den Kreis der Motorradfahrer brach, stürmten sie hinter ihr her. Ich glaubte fast, das Donnern ihrer Hufe durch den Boden zu spüren, während sie über die Heide davonpreschten und zwischen den Kiefern auf der anderen Seite des Baches verschwanden.
Alarmiert von aufheulenden Motoren fuhren Frida und ich zu den Bikern herum. Ich glaube, sie hatten der Herde auch nachgestarrt, doch jetzt hatten sie sich wieder halbwegs gefangen, und die sechs, die noch auf ihren Maschinen saßen, umringten den gestürzten Fahrer.
Der hatte sich mittlerweile aufgerappelt, stand aber gekrümmt da und hielt sich das Knie. Hatte er was abbekommen? Ohne das Wiehern der Pferde und den Motorenlärm war es fast still am Kiesstrand und ich konnte immer wieder ein »Scheiße!« oder einen Schmerzenslaut hören.
Die Typen diskutierten eine Weile, und nach einigem Hin und Her half einer der Motorradfahrer dem gestürzten Biker, seine Maschine hochzuziehen. Er stieg wieder auf, und nach einer vorsichtigen Proberunde rauschte er über den Strand davon, dicht gefolgt von seinen Kumpels.
Kaum waren sie um die Landzunge verschwunden, griff Frida nach ihrem Handy und stapfte zu ihrem Rad.
»Wo willst du hin?«, fragte ich verdutzt.
»Zur Polizei.« Im Gehen drehte sie sich um. »Na los, worauf wartest du?«
Frida
Stopp mal.« Jannis war mit drei Schritten bei mir und zog mir das Smartphone aus der Hand.
Ich hatte den Mund schon offen, um zu protestieren, als er das Video aufrief. Selbst durch meinen maximal schlechten Lautsprecher konnte ich die Panik aus dem Wiehern der Herde heraushören, die Angst und Hilflosigkeit. Ich brauchte die Bilder dazu nicht zu sehen, sie spielten sich in meinem Kopf ab, immer wieder, doch nach ein paar Sekunden hielt Jannis mir das Display hin.
»Ich glaube nicht, dass uns das Video bei der Polizei hilft.«
»Was?« Hektisch griff ich nach dem Handy, weil ich befürchtete, dass etwas mit der Aufnahme nicht stimmte, dass die Kamera gestreikt hatte, aber das Geschehen war klar und deutlich zu erkennen. Die sieben Motorräder, die die Pferde einkesselten. Diese Rücksichtslosigkeit. Ich guckte Jannis an. »Ist doch alles drauf. Was willst du denn noch?«
Er deutete auf das Telefon. »Man sieht nichts außer ein paar verdreckten Geländemaschinen. Da kann ich dir gleich sagen, wie die Polizei das einschätzt.«
Ich schaute noch mal genauer hin. Als ich auf Pause drückte, kapierte ich, was er meinte: Die Motorräder hatten zwar Kennzeichen, doch die waren so mit Schlamm bespritzt, dass man sie nicht entziffern konnte. Aber deswegen konnten wir nicht einfach nichts tun.
Ich sah auf. »Das heißt doch nichts. Wir bringen das zur Polizei, und dort werden sie schon wissen, wie man solche Typen findet. Es geht nicht, dass sie hier so eine Hetzjagd veranstalten und damit durchkommen! Das war reines Glück, dass nichts passiert ist. Beim nächsten Mal verletzt sich vielleicht ein Pferd oder … Schlimmeres.« Ich biss mir auf die Lippe. Was alles hätte geschehen können, wollte ich mir lieber nicht vorstellen.
»Frida …« Jannis klang mitleidig, so als wäre ich irgendwie zu dumm für die Realität. »Wenn die keine Nummernschilder haben, machen sie nichts. Du weißt doch, wie sie auf der Wache drauf sind. Die sind ja nicht mal wegen Marcel in die Hufe gekommen.«
Ich legte den Kopf in den Nacken und schnaufte. »Ach nee, ne? Nicht schon wieder die Geschichte! Das war doch was völlig anderes!«
»Das war nichts anderes. Das war ein Tierquäler, wir hatten Beweise und die Polizei hat nichts unternommen. Die haben ihn nicht mal dafür drangekriegt, dass du dir seinetwegen die Hand verstaucht hast!«
Weil du ihn nicht angezeigt hast. Er musste den Satz nicht aussprechen, das hatte er den Winter über oft genug getan. Aber eine Anzeige hätte nichts gebracht, weil ich durch Marcels Stoß nicht schwer genug verletzt gewesen war, jedenfalls hatten sie das bei der Polizei behauptet. Außerdem hätte sich Dari dadurch auch nicht schneller wieder erholt.
Trotzdem hatte Jannis mich verunsichert. »Irgendwas müssen wir machen«, sagte ich langsam. »Wir können sie doch nicht davonkommen lassen.«
»Tun wir auch nicht.« Jannis grinste. »Wir stellen ihnen eine Falle.«
Oje, einer von Jannis’ Plänen. Ich bemühte mich, nicht zu stöhnen, aber es war schwer.
»Und wie soll die aussehen?«
»Na ja …« Er fuhr sich durch die Haare. »Wir könnten Drähte spannen, und wenn sie stürzen, ziehen wir ihnen die Helme vom Kopf und machen Fotos. Hm … gibt vielleicht Ärger. Aber …« Sein Gesicht hellte sich wieder auf. »Wir könnten ihren Reifenspuren folgen und hätten so ihre Adressen!«
Ich verschränkte die Arme. »Den Spuren können wir genau bis zur nächsten Asphaltstraße folgen, danach erkennen wir nichts mehr.«
»Dann … dann treiben wir sie eben in die Enge. Irgendwo, wo sie nicht mehr wegkönnen.«
»Wir treiben sie in die Enge? Auf unseren Fahrrädern oder mit den Pferden?«
»Boah, echt, Frida.« Jannis kniff die Lippen zusammen und starrte mich aus schmalen Augen an. Doch ich konnte ja auch nichts dafür, wenn seine Pläne so halb gar waren. Schmeichelhaft ausgedrückt.
Ich steckte mein Handy ein. »Überleg du dir ruhig weiter eine Falle, ich geh jetzt zum Bürgermeister und zeig ihm das Video. Vielleicht tut die Polizei was, wenn er sich einschaltet.«
Als ich mich umdrehte, mein Fahrrad aufhob und es den Pfad entlangschob, spürte ich seinen Blick im Rücken. »Spielverderberin« war wahrscheinlich noch das freundlichste Wort, mit dem er mich bedachte.
*
Frau Ebert sah auf, als ich das Gemeindesekretariat betrat. »Ja, hallo, Frida, das ist ja eine Überraschung. Kann ich etwas für dich tun? Geht’s um das Derby? Elisa ist jetzt schon ganz aufgeregt.« Sie lächelte mich an.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, deswegen bin ich nicht hier. Ich möchte einen Vorfall im Naturschutzgebiet an der Landspitze melden.«
Sie zog ihre Brille aus den drahtigen Locken und guckte mich scharf an. »Das klingt ernst. Was ist denn los?«
Es verging eine halbe Stunde, während sie sich das Video anschaute, dann einen Kollegen vom Ordnungsamt dazuholte, der wiederum die Naturschutzbeauftragte von Eldenau, Frau Lewandowski, anrief. Zu dritt standen sie um mein Handy und spielten mittlerweile zum bestimmt achten Mal den Film ab.
Die Aufregung wuchs mit jeder Runde. »Unglaublich«, »So ein Skandal!«, »Die armen Tiere«, »Wie kann man nur?« waren die häufigsten Kommentare, die sie regelmäßig wiederholten.
Irgendwann setzte sich der Tatendrang durch. Allerdings vergingen noch einmal zwanzig Minuten, in denen sie versuchten, das Video von meinem Smartphone auf einen Computer zu »überspielen«. Meine vorsichtigen Einwürfe ignorierten sie. Als der Mann vom Ordnungsamt, der sich als Herr Carstens vorgestellt hatte, mich halb verzweifelt bat, nach Hause zu fahren und das entsprechende Kabel zu holen, reichte es mir. Demnächst kamen die noch auf die Idee, das Handy zu beschlagnahmen.
Ich hockte mich vor den Rechner – was wahrscheinlich nicht ganz mit den Vorschriften der Gemeindeverwaltung in Einklang war –, schaltete Bluetooth an und startete die Übertragung.
Die technische Ausrüstung im Rathaus war eindeutig moderner als ihre Mitarbeiter. Zu Frau Eberts Einschätzung »Ist ja beeindruckend« sagte ich lieber nichts. Frau Lewandowski lobte mich für meinen Mut, wobei ich mich fragte, wieso es Mut brauchte, drei überforderten Erwachsenen eine Stunde lang bei der Arbeit zuzusehen, und Herr Carstens verabschiedete mich mit: »Der Herr Bürgermeister wird so schnell wie möglich davon erfahren. Wir fangen noch heute an, nach den Rowdys zu suchen.«
Dann stand ich wieder vor der Tür.
Was bedeutete das jetzt? Konnten sie etwas gegen die Motorradfahrer ausrichten? Oder hatte Jannis recht und den Bikern würde wegen der verdreckten Kennzeichen nichts passieren?
Seufzend schloss ich mein Rad auf. Uns blieb nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass ihnen die Gegenwehr der Stute die Lust auf neue Ausflüge ins Naturschutzgebiet ausgetrieben hatte.
Jannis
Dass der Bürgermeister etwas unternahm, um den Bikern auf die Spur zu kommen, würde ich erst glauben, wenn ich es sah. Während ich also darüber nachgrübelte, was wir selber tun konnten, machte ich mich ein bisschen über den Motorradtyp schlau. Frida hatte mir das Video geschickt, und anfangs tippte ich auf Motocrossräder, doch anscheinend hatten wir es mit Enduros zu tun, die zwar genauso geländegängig waren, aber anders als Motocrossräder auch eine Verkehrszulassung und damit ein Kennzeichen bekamen.
Frida schaute nach ihrem Besuch im Rathaus noch vorbei. Sie quittierte meine Entdeckung mit einem herzhaften »Ja und?«, doch als ich ihr erklärte, dass Endurofahrer genau wie Motocrosser auf extra ausgewiesenen Geländestrecken trainierten, wurde sie hellhörig. »Du meinst, man könnte da mal rumfragen, ob sie Fahrer kennen, die gern abseits der Strecken unterwegs sind?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich bin mir nicht sicher, ob eine Krähe der anderen ein Auge aushackt, aber warum sehen wir uns nicht einfach selber um? So viele von diesen Strecken wird es bei uns in der Gegend schon nicht geben.«
Da lag ich falsch. Bei uns in der Gegend gab es überhaupt keinen dieser Übungstrails. Wir googelten wie die Verrückten, bei mindestens fünf Suchmaschinen, suchten in Foren und bei Onlinemagazinen – das Ergebnis blieb gleich: Im Umkreis von achtzig Kilometern gab es keine öffentliche Trainingsstrecke. Auf eine verdrehte Art erklärte das, warum die Biker im Naturschutzgebiet unterwegs gewesen waren, aber damit fehlte uns wieder ein Anknüpfungspunkt.
»Woher kannst du das eigentlich?«, fragte ich Frida. In der vergangenen halben Stunde hatte ich mehr über Internetrecherche gelernt als in den vierzehn Jahren zuvor.
»Im Netz suchen? Ach, da hab ich mir viel von Linh abgeguckt. Die ist da wie ein Spürhund. Wenn sie eine Fährte aufgenommen hat, ist sie nicht zu stoppen.« Ihre Wangen waren ganz rosa, als wäre sie wirklich auf der Jagd gewesen, doch jetzt wirkte sie nachdenklich. »Ich werde ihr das Video auch schicken. Vielleicht kann sie was damit anfangen.«
»Also bist du dir nicht mehr so sicher, dass die bei der Gemeindeverwaltung was unternehmen?«, hakte ich grinsend nach.
»Doch, eigentlich schon.« Sie zog die Nase kraus und grinste zurück. »Aber in meine beste Freundin habe ich eben mehr Vertrauen.« Ihr Handy piepste, und noch während sie die Nachricht las, stand sie auf. »Ich muss los. Mama fragt schon, wo ich bin. Bleibt es bei morgen Nachmittag?«
Ich nickte. Wir hatten uns zu einer Runde Bodenarbeit mit Dari verabredet. »Sollen wir vor dem Training bei der Herde vorbeischauen?«
Frida überlegte einen Moment. »Lass uns die Pferde mit ins Gelände nehmen. Papa meint, im Westwald wären bei dem Sturm neulich eine ganze Menge junge Birken umgekippt. Uns fällt bestimmt was ein, was wir mit den Stämmen machen können.«
*
Warmes Licht fiel durch die Scheiben von Mamas Büro auf das Pflaster im Hof, während ich eine halbe Stunde später Selma vorbeiführte, um sie zu Dari auf den Sandplatz zu bringen. Wegen der Aufregung über diese Vollidioten war ich heute nicht dazu gekommen, ernsthaft mit Dari zu arbeiten. Deswegen wollte ich sie wenigstens noch ein bisschen laufen lassen, bevor ich mir meine beiden Berittpferde vornahm. Selbst durch die geschlossenen Fenster konnte ich Gelächter und das Röhren von Mamas neuer italienischer Kaffeemaschine hören.
Als sie das Teil angeschleppt hatte, meinte sie, man müsste sich hin und wieder einen kleinen Luxus gönnen, doch wahrscheinlich hatte sie eher an die Zeitersparnis gedacht. Sie brauchte jetzt nicht mehr bis zum Haus zu laufen, um sich einen Kaffee zu machen. Sie trank in der letzten Zeit viel Kaffee. Und sie war viel im Stall.
Anscheinend war gerade jemand bei ihr, der ihren Espresso zu schätzen wusste, sonst hätte sie auch kein Problem damit gehabt, Tütencappuccino anzubieten.
Dari sprang mit einem freudigen Brummeln auf, als sie uns bemerkte, und begrüßte Selma fröhlich. Sie hatte sich schon ausgiebig gewälzt und ihr schwarzes Fell war nur noch am Kopf zu erahnen. Aber sie durfte das. Natürlich durfte sie das.
Grinsend lehnte ich mich gegen die Umzäunung. Botticelli musste warten. Mit dem konnte ich auch noch in die Halle, wenn die letzten Einsteller weg waren. Ich hatte einfach zu viel Spaß dabei, Dari und Selma zuzugucken. Wenn ich daran dachte, wie eingeschüchtert Dari noch vor ein paar Monaten gewesen war, kroch mir die Gänsehaut den Rücken hinauf. Und jetzt sprang sie herum wie ein Fohlen. Auch wenn sie sich immer noch nicht reiten ließ: Ich wusste, dass ich verdammtes Glück gehabt hatte.
»Hallo, Jannis.« Florian kam auf mich zu und stellte sich neben mich an den Zaun.
»Hallo. Ich wusste gar nicht, dass du heute kommst. Gibt’s Probleme mit einem Pferd?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, alles okay. Ich war nur vorhin drüben auf dem Gut, und da dachte ich, ich bringe euch die Rechnung für den letzten Monat gleich vorbei.«
Ich lachte. »Machst du das bei jedem Kunden? Tierarztrechnungen sind ja nichts, worüber man sich besonders freut. Den Ärger würde ich mir sparen.«
Er zögerte kurz, dann antwortete er grinsend: »Das mache ich auch nur, wenn ich guten Kaffee bekomme.«
Ach so. Klar, für den Tierarzt ließ Mama natürlich den teuren Espresso springen.
Florians Gesicht wurde ernst. Er deutete mit dem Kinn auf Dari. »Sie sieht gut aus. Wie läuft’s mit ihr?«
Ich merkte, wie sich ein Grinsen auf meinem Gesicht ausbreitete. »Super«, sagte ich stolz. »Wir sind zwar noch immer nicht über Bodenarbeit hinaus, aber sie ist supereifrig dabei.«
Er drehte sich halb zu mir. »Und wie sieht das aus?«
»Morgen ist zum Beispiel Stangenarbeit dran. Oder eher Baumstammarbeit. Wir gehen in den Wald und üben mit den umgestürzten Birken.«
»Das ist gut.« Anerkennend nickte er. »Damit stärkt ihr ihren Muskelapparat. Gerade für den Rücken ist das wichtig, wenn du sie nach der langen Pause wieder reiten willst.«
Ich seufzte. »Das möchte ich, so schnell es geht. Aber Frida meint, Dari ist noch nicht wieder so weit.«
Nachdenklich wiegte Florian den Kopf. »Da kann sie recht haben. Umso wichtiger ist es, dass ihr sie vorher langsam wieder aufbaut. Slalomtraining ist dafür auch gut, weil ihr die Rückenmuskulatur durch den ständigen Richtungswechsel mobilisiert.«
Verblüfft sah ich ihn an. Das war ja cool von ihm. Die Zeit, mir so was zu erklären, hätte er sich wirklich nicht nehmen müssen.
»Okay, das klingt sinnvoll. Was können wir noch machen?«
Er gab mir ein paar Tipps, wie wir die Bauch- und Rückenmuskulatur und die Sprungkraft trainieren konnten.
»Die Bauchmuskulatur wird oft vergessen«, erklärte er, »dabei braucht es das Zusammenspiel von Rücken und Bauch, damit das Pferd die Wirbelsäule aufwölben kann.«
Einen Moment lang musste ich mir auf die Lippe beißen. »Du klingst wie ein Fachbuch.«
Leise lachte er. »Tja. Gelernt ist gelernt.« Dann zeigte er auf Dari. »Ich muss los. Wenn du Fragen hast, komm jederzeit vorbei. Vielleicht hab ich den einen oder anderen Tipp.«
Ich grinste. »Verlass dich drauf. Das werde ich.«
Frida
Und was jetzt?«
Wir hatten gerade eine Dreiviertelstunde im einzigen ernst zu nehmenden Buchladen von Buddenwalde zugebracht (die anderen beiden hatten keine Pferdefachbücher im Sortiment). Die letzten zwanzig Minuten davon (so groß war die Pferdebuchauswahl dann auch nicht) hatte ich Linh dabei zugesehen, wie sie mit konzentriert gerunzelter Stirn den größeren Teil ihrer vorausgewählten Bücher zurück ins Regal stellte, einzelne wieder herausholte und andere einsortierte.
Gerade nahm sie mit einem zufriedenen Lächeln, als hätte sie richtig was geleistet, den Stoffbeutel mit ihren vier Errungenschaften in Empfang, drehte sich zu mir und sagte: »Jetzt brauche ich eine Stärkung.«
Gegen einen Eisbecher hatte ich trotz der gefühlten zehn Grad minus draußen nichts einzuwenden, also machten wir uns auf den Weg zu unserer Lieblingseisdiele, die am anderen Ende der Fußgängerzone lag. Sie war wie immer ziemlich voll, aber wir bekamen noch einen Minitisch am Fenster.
»Lass mal sehen, was du gekauft hast.« Linh griff nach meinem Rucksack und zog die beiden Bücher heraus. »›Neue Ideen für die Bodenarbeit‹ und ›Anatomie von Pferd und Reiter‹.« Sie zog die Augenbrauen hoch.
»Was denn?«, verteidigte ich mich. »Zu Pferdeverhalten hatten sie nichts Neues da.«
Linh lachte. »Frida, du bist echt süß. Aber willst du nicht mal was Normales lesen?«
»Was ist an Pferdeliteratur nicht normal?« Ich sah auf, als der Kellner an unseren Tisch kam, und sagte: »Drei Kugeln Erdbeereis mit Sahne, bitte.« Nachdem Linh einen Cappuccino und einen Schokoeisbecher bestellt hatte, fügte ich grinsend hinzu: »Außerdem zwingst du mich sowieso, deine Lieblingsbücher zu lesen. Da vertraue ich doch gleich auf die Expertin.«
Linh verdrehte die Augen, schmunzelte aber. »Kannst du auch. Trotzdem muss dir dieses Zeug doch mal langweilig werden. Du weißt doch schon alles über Pferde.«
Ich schnaubte. »Bitte! Über Pferde kann man gar nicht alles wissen. Dasselbe könnte ich von dir behaupten. Du weißt doch auch alles über das Leben von Teenagern.«
Weil der Kellner gerade unsere Bestellung brachte, verkniff sie sich ein Kichern, doch kaum war er verschwunden, verzog sie das Gesicht. »Schön wär’s. Aber bloß weil ich ein Teenagerleben habe, heißt das nicht, dass ich dafür Profi bin.«
Gespielt entsetzt schaute ich sie an. »Nicht? Wen soll ich denn sonst um Rat fragen, wenn ich mal wieder gar nichts kapiere?«
Sie boxte mir gegen die Schulter. »Für deine Probleme reicht’s noch.« Ihre Augen wurden schmal, als ihr Blick von meinem Gesicht zu meiner Brust wanderte. »Und eines rate ich dir ganz dringend: Du brauchst einen neuen BH.«
Ich war so unvorsichtig gewesen, mir einen großen Löffel Eis in den Mund zu schieben, deswegen dauerte es einen Moment, bis ich einigermaßen deutlich sagen konnte: »Ich habe mich gerade verhört, oder?«
»Ist so!«
Anscheinend machte ich ein ziemlich komisches Gesicht, denn Linh bebte vor unterdrücktem Lachen.
»Frida«, gurrte sie, »du wirst jetzt zur Frau.«
Möglichst unauffällig sah ich an meiner Vorderseite nach unten. Hm. Hatte Linh womöglich recht?
Ihr war mein Blick natürlich nicht entgangen. »Sei doch froh, bei dir tut sich wenigstens was.« Sie seufzte tief. »Mein Busen hat Erbsengröße.«
»Na ja.« Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und musterte sie aus zusammengekniffenen Augen. »Rosenkohl.«
Keuchend holte sie Luft und warf in einem Moment der Sprachlosigkeit ihre Eiswaffel nach mir. Grinsend fing ich sie auf und biss hinein, und irgendwie löste das bei ihr einen Lachflash aus, der erst in einem Schluckauf endete.
Als sie sich wieder beruhigt und die Tränen aus den Augen gewischt hatte, legte sie mir einen Ellbogen auf die Schulter, beugte sich zu mir und guckte mich mit flatternden Lidern an. »Biiiiitte. Bitte lass uns einen BH kaufen gehen.«
*
Die Verkäuferinnen in dem Unterwäscheladen blickten alarmiert auf, als Linh und ich immer noch kichernd zur Tür hereinkamen. Sie schienen kurz zu diskutieren, dann löste sich die jüngste aus der Gruppe. Sie war klein, dunkelhaarig und ziemlich kurvig, und sie machte ein Gesicht, das deutlich ausdrückte, wie viel Lust sie hatte, uns zu bedienen.
Sie ging auf uns zu und versuchte sich an einem freundlichen Lächeln. »Was kann ich für euch tun?«
Angesichts der zwei Millionen Wäscheteile, die hier in Reih und Glied an den Kleiderstangen hingen, war die Frage wahrscheinlich rhetorisch gemeint. Linh kriegte aber sofort die Kurve und legte ihr seriösestes Verhalten an den Tag.
»Meine Freundin hier«, sie deutete auf mich, als würde noch ein Dutzend Mädchen um sie rumstehen, »trägt bisher ausschließlich Sport-BHs und sucht nun etwas … Fraulicheres.«
Ich musste mir auf die Lippe beißen, um die Fassung zu wahren, aber Linh hatte die Verkäuferin mit diesem Satz schon auf ihrer Seite. Ihre Augen leuchteten auf.
Sie führte uns zu einer Abteilung, in der offensichtlich die nicht ganz so teuren Modelle hingen – im Vorbeigehen hatte ich mal auf ein Preisetikett gelinst: neunundsechzig Euro! –, und dann begannen sie und Linh ein Fachgespräch über mit und ohne Bügel, Pads und Push-ups, Microfaser und Tüll, bei dem ich mich fragte, wie lange Linh das Thema schon beschäftigte. Baumwolle war doch auch okay.
Die beiden verfrachteten mich in eine Umkleidekabine und reichten mir gefühlt fünfzig verschiedene Modelle hinein. Bei den ersten musste ich mich mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass sie mich zur öffentlichen Begutachtung aus der Kabine zerrten, weshalb Linh schließlich hereinkam und sich auf den Stuhl neben dem Spiegel setzte und die Verkäuferin immer wieder höflich hüstelte, wenn sie wissen wollte, ob sie gucken durfte. Am Ende hatten sie vier Favoriten ausgewählt, aus denen ich gnädigerweise die zwei aussuchen durfte, für die mein hart erspartes Taschengeld draufgehen sollte.
Alles in allem war diese Unterwäschekaufaktion weniger peinlich verlaufen, als ich sie mir ausgemalt hatte. Das dachte ich jedenfalls bis zu dem Moment, in dem die Verkäuferin mir die kleine Tragetasche hinhielt, mich anlächelte und sagte: »Die sehen wirklich sexy aus. Dein Freund wird Augen machen.«
Ich hatte das Gefühl, meine Ohren würden explodieren. Kalt blickte ich sie an. »Das kann schon sein. Aber ich habe die BHs gekauft, weil sie bequem sind. Immerhin muss ich die Dinger rumtragen, da soll nicht auch noch was kneifen.«
*
Vier Stunden später hatte Linh aufgehört, sich über »meine Dinger« kaputtzulachen, wir hatten Falafel gegessen und waren im Kino gewesen. Müde und zufrieden saßen wir auf der Rückbank von Herrn Phams Auto und ließen uns nach Hause fahren.
Als er bei uns im Hof wendete, umarmte Linh mich und sagte: »Das war schön. Das machen wir bald wieder.«
Ich drückte sie und grinste. »Ja. Das nächste Mal, wenn dein Freund in Köln ist und seinen Vater besucht.«
Mein neckender Ton prallte völlig an ihr ab. Treuherzig lächelte sie mich an. »Von Max soll ich dich übrigens schön grüßen.« Während ich lachend ausstieg, meinte sie noch: »Lass uns morgen wegen deinem Video telefonieren. Vielleicht habe ich dann mehr herausgefunden.«
Einen Augenblick lang kapierte ich gar nicht, dass Linh über die Biker redete, so unwirklich kam mir ihr Auftritt im Naturschutzgebiet mittlerweile vor. Ich nickte knapp, dann winkte ich Herrn Pham zu und bedankte mich. Mit langen Schritten lief ich durch den eisigen Wind die paar letzten Meter zur Haustür.
Das Erste, was mir entgegenschlug, als ich aufschloss, war ein durchdringender Geruch nach Pizza und Zwiebeln, das Zweite noch durchdringenderer Gesang.
»… or this could be hell.«
Mama besuchte übers Wochenende Luise in Neubrandenburg, anscheinend hatten Papa und Theo die Gelegenheit für eine ihrer Jamsessions genutzt. Allerdings … Es klang, als wäre noch eine dritte Stimme dabei.
Ich schlüpfte aus meinen Schuhen, hängte Mantel und Schal an die Garderobe und schlich Richtung Wohnzimmer.
»Welcome to the Hotel California …«
Verblüfft blieb ich im Türrahmen stehen, als ich Jannis zwischen Papa, Theo, ihren Gitarren, Pizzaschachteln und Schüsseln voller Chips auf dem Boden sitzen sah.
Theo blickte auf, fing an zu grinsen und machte eine einladende Armbewegung, ohne mit dem Singen aufzuhören. »What a nice surprise …«
Ich zögerte, doch als Jannis mir zunickte und Papa mich endlich bemerkte und mit einem energischen Winken neben sich beorderte, hockte ich mich im Schneidersitz auf den Teppich und griff nach einer Wasserflasche.
Immer wieder wanderte mein Blick zu Jannis. Ich konnte kaum glauben, was ich hörte.
Papa hatte echt eine Hammerstimme, aber Theo war auch nicht schlecht, und mit dem hielt Jannis locker mit. Wie lang kannte ich ihn jetzt? Ein halbes Jahr? Und er hatte mir nie gesagt, dass er so singen konnte?
Der blöde Idiot. Ritt wie ein Weltmeister, war gut in der Schule, sah super aus und dann hatte er auch noch so eine Stimme. Also, das mit dem super Aussehen war natürlich nur, was alle sagten, aber vermutlich würden sie ihn auch nicht hässlicher finden, wenn sie ihn mal singen hörten.
Der Song war zu Ende und Papa lächelte mich an. »Na, meine Große, alles gut bei dir? War’s schön in der Stadt?«
Ich nickte und deutete auf das Schlachtfeld. »Ja. Sehr schön. Und ihr lasst es hier krachen, solange die Katze aus dem Haus ist?«
Theo grinste. »Exakt.« Er hielt mir einen Pizzakarton hin. »Magst du ein Stück?«
Mein Blick fiel auf die zerrupften Reste und ich schüttelte den Kopf. »Hab schon gegessen.«
Er zuckte mit den Schultern und schob sich einen der Teigfetzen in den Mund.
»Was habt ihr gemacht?«, fragte Jannis.
Tja, das würde ich ihm sicher nicht auf die Nase binden. »Nichts Besonderes. Mädchenkram eben.«
»Eis essen, BHs kaufen und über Jungs lästern?«, kam es undeutlich aus Theos vollem Mund, weshalb Papa und Jannis so tun konnten, als hätten sie ihn nicht verstanden.
Hoffentlich tat der Blick, den ich ihm zuwarf, weh. »Echt, wenn das deine Vorstellung ist, brauchst du dringend eine Freundin.«
Theo grinste breit, was selbstredend kein schöner Anblick war. »Deswegen nicht.«
Jannis prustete, und Papa warf laut ein: »So, und was spielen wir jetzt?«
Ich funkelte Theo an, doch er beugte sich nur lachend zu mir herüber und drückte mich. »Lass dich nicht ärgern. Große Brüder müssen so sein.«
Bevor ich antworten konnte, lenkte mich Papas nächste Songauswahl ab. Mein Kopf schnellte zu ihm herum. Er spielte die ersten Akkorde von »Sweet Child o’ Mine«. Den Song liebte er, er hatte ihn uns dreien ganz oft vorgespielt, als wir klein waren. Theo und ich sahen uns an, und ich weiß nicht, ob Jannis es merkte, aber plötzlich war es warm und heimelig, und über dem Zwiebelgeruch lag der Duft von Heu und sauberer Wäsche. Theo ruckelte seine Gitarre zurecht und setzte in das Intro ein.
»She’s got a smile that, it seems to me …«, begann Papa mit seiner schönen vollen Stimme, und Theo und Jannis sangen, ein bisschen jünger und ein bisschen rauer, mit: »… reminds me of childhood memories …«
Papa hatte ja immer viel zu tun, und auf dem Gut halfen ihm meistens Luise oder Theo, sodass wir nicht oft etwas gemeinsam machten, doch jetzt, wo die beiden erwachsen waren, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es unser Lied geworden war. Dass ich ihn in diesem Moment nicht teilen musste. Seine Augen, die so viel dunkler waren als meine, hielten mich, und wie von selbst stupste meine Hand gegen seine besockte Fußspitze.
Er lächelte, dann guckte er auf seine Gitarre und räusperte sich leise, bevor er wieder mit einstimmte: »… I’d hate to look into those eyes and see an ounce of pain …«
Es dauerte, bis ich daran dachte, dass wir nicht allein im Zimmer waren, aber im selben Moment wurde mir ganz heiß. Wie konnte ich bloß so unsensibel sein? Ich präsentierte Jannis hier meinen Vorzeigevater, während er versuchte, jeden Gedanken an seinen eigenen zu vermeiden. Wie musste er sich jetzt vorkommen?
Verstohlen guckte ich ihn an, doch anscheinend machte es ihm gar nichts aus. Er fing sogar meinen Blick auf. Von dem Ärger oder der Traurigkeit, die ich erwartet hätte, war in seinen Augen nichts zu erkennen, aber bevor ich den Ausdruck darin benennen konnte, sah er weg.
Trotzdem war ich froh, als der Song zu Ende ging. Irgendwie fühlte es sich seltsam an, dass Jannis den Text mitsang, so als würde er mich auch meinen, denn das war ja wohl absurd. Jedenfalls atmete ich erleichtert auf, als sie das nächste Stück spielten, irgendwas von Springsteen, was auch Jannis nicht so gut kannte.
Danach war wieder alles ganz normal. Theo stand auf, um aufs Klo zu gehen, und brachte noch was zu trinken mit, Papa fragte Jannis, ob er dies oder das kannte. Dann fiel sein Blick auf die Uhr.
»Musst du nicht mal Eva Bescheid geben, dass du noch bei uns bist?«
Fast hätte ich gelacht. Wenn ich um Viertel vor zwölf noch nicht Bescheid gegeben hätte, wo ich war, hätte Papa längst eine Suchmannschaft losgeschickt.
Jannis schüttelte den Kopf. »Die hat heute Abend was vor. Das wird spät.«
Oh. Das klang nach einem Date. Schon wieder.
Papa meinte: »Du kannst auch gern über Nacht bleiben. Schreib ihr einfach eine Nachricht, dass du hier schläfst.«
Äh, was?
»Klar. Du kannst bei mir auf der Couch pennen«, bot Theo enthusiastisch an.
Hallo, was war denn jetzt los? Ich musste nicht annähernd so schockiert aussehen, wie ich mich fühlte, weil selbst ein Klotz wie Jannis sonst gemerkt hätte, dass meine Vorstellungen von dem Thema sehr weit mit denen der Männer meiner Familie auseinandergingen. Er guckte mich nur kurz an und nickte dann.
»Okay. Super, danke. Das ist cool.«
Das wurde ja immer besser. Anscheinend interessierte es keinen, ob es komisch für mich war, wenn Jannis sich in unserem Familienleben breitmachte, aber ich konnte ihn auch schlecht rauswerfen. Dafür war ich die Erste, die aufsprang, als Papa den Abend für beendet erklärte und uns ins Bett schickte.
Die Jungs überließen mir das Bad, auch wenn es natürlich ohne einen Spruch von Theo nicht ablief. Dabei brauchte ich allerhöchstens dann länger als er, wenn ich meine Haare waschen musste. Deswegen stand ich auch schon nach wenigen Minuten gewaschen, mit geputzten Zähnen und im Schlafanzug vor Theos Zimmertür, hinter der es rumpelte, als würden sie die komplette Einrichtung umstellen.
Ich klopfte und sagte: »Bad ist frei. Gute Nacht!«, doch da riss Jannis schon die Tür auf, als hätte er direkt davorgestanden.
»Danke. Wir haben’s hier auch gleich, dann ist Ruhe.«
Ich konnte sehen, dass er sich bemühte, aber letztendlich schaffte er es doch nicht, seinen Blick in meinem Gesicht zu behalten.
Ich verschränkte die Arme (wofür ich mir innerlich einen Tritt verpasste – da hätte ich ja auch gleich einen Wegweiser aufstellen können), sagte: »Okay«, und noch einmal: »Gute Nacht«, dann ergriff ich die Flucht in Richtung meines Zimmers.
»Gute Nacht!«, kam es mir zweistimmig hinterher.
Ein bisschen lauter als beabsichtigt schloss ich die Tür hinter mir und lehnte mich dagegen. Für einen kurzen Moment musste ich die Augen zukneifen. Ich konnte nur hoffen, dass Linh und diese Unterwäscheverkäuferin nicht doch recht hatten und ich noch keinen BH brauchte.
Jannis
Uuund Beine heben.«
Ich wusste nicht, ob Dari mich bei dem pfeifenden Ostwind hören konnte, der uns hier oben am Steilufer beinahe vom Weg pustete, doch sie stieg aufmerksam über die freigelegten Baumwurzeln hinweg und setzte ihre Hufe sicher auf.
Wahrscheinlich brauchte sie meine Warnung gar nicht mehr, so oft, wie wir diesen Winter auf der Landspitze unterwegs gewesen waren. Wie meistens fragte ich mich, warum ich nicht einfach im Wald blieb, wo uns die Bäume wenigstens ein bisschen von der klirrenden Kälte abschirmten. Aber heute hatte ich immerhin eine Mission.
Am Morgen hatte Frida mich gebeten, den Kontrollgang zu den Wildpferden zu übernehmen, weil sie etwas vorhatte, und natürlich hatte ich zugesagt. Nach der Ich-glotze-Frida-auf-die-Brüste-Aktion gestern Abend hätte sie auch verlangen können: »Ziehe aus und töte den Drachen!«, und ich hätte meine Faschingsritterrüstung vom Dachboden geholt (falls Mama die aufgehoben hatte) und wäre losgeritten. Obwohl sie ganz normal geklungen hatte, fingen meine Ohren allein bei dem Gedanken daran an zu glühen. Und das trotz der Kälte.
Eine Bö zerrte an uns, und ich biss die Zähne zusammen, damit sie nicht klapperten. Bevor ich hierhergezogen war, hatte ich immer geglaubt, dass die Winter an der Küste mild wären, doch drei Monate Temperaturen unter null hatten mit dieser Vorstellung aufgeräumt. In meinem Kleiderschrank hingen nur noch Klamotten, die auch als Polarausrüstung durchgegangen wären.
Ich zog mir den Schal über die Nase. Vor Daris Nüstern waberten Dunstwölkchen, aber ihr schien die Kälte nichts auszumachen, jedenfalls wirkte sie ziemlich vergnügt. Ihr Kopf nickte entspannt, sie guckte hierhin und dorthin und ihre Ohren drehten sich wie kleine hyperaktive Satellitenschüsseln. Es gab Tage, da wünschte ich mir, dass meine Stute ein bisschen weniger Spaß an unseren Ausflügen in die Wildnis hätte, doch der Glanz in ihren Augen, die sie vor einem halben Jahr ständig panisch aufgerissen hatte, machte das Bibbern und Zähneklappern wieder wett. Ich hob die Hand und kraulte ihren Mähnenkamm und sie prustete zufrieden.
Wir kamen vom Aussichtspunkt, wo wir zwanzig Minuten auf die Konikherde gewartet hatten. Heute waren die Pferde aber nicht aufgetaucht, also hatte ich mich entschlossen, nach Hause zu gehen, bevor wir noch festfroren. Dass ich Frida nichts berichten konnte, nahm ich in Kauf. Immerhin hatten sich auch die Biker nicht blicken lassen und das war ja schon mal was.
Mittlerweile führte der Pfad deutlich bergab und machte eine kleine Kurve, sodass der Strand in Sicht kam. Daris Ohr drehte sich nach rechts und fast im selben Moment nahm sie den Kopf hoch und sah interessiert nach unten. Sie brummelte. Ich hielt sie an. Nach einem schnellen Blick war mir klar, wen sie entdeckt hatte: ihre beste Freundin Liv. Die Rappscheckstute war auch schwer zu übersehen, vor dem hellen Sand zeichneten sich ihre schwarzen Flecken selbst aus dieser Entfernung deutlich ab. Auf ihrem Rücken saß Frida. Ihr roter Pferdeschwanz wehte wie eine Fahne hinter ihr her.
Das also hatte sie vorgehabt. Warum hatte sie mir von dem Ausritt nicht einfach erzählt? Und mich gefragt, ob ich mitkommen wollte? Nahm sie mir meine Stielaugen gestern doch übel?
Je länger ich mir die Sache anschaute, desto weniger kam mir das wie ein Ausritt vor. Die beiden waren nämlich in einem Wahnsinnstempo unterwegs. Liv sah richtig wild aus, wie ihre Mähne da im Wind flatterte, wild und hübsch. Sie war zwar nur ein Pony, aber die Lewitzer konnten das arabische Vollblut in ihrem Stammbaum nicht leugnen. Obwohl sie in vollem Galopp durch den Sand pflügte, war ihr die Anstrengung nicht anzumerken. Dass Frida perfekt ausbalanciert im Sattel saß, half bestimmt auch.
Livs Galoppsprünge waren gleichmäßig und geschmeidig, und selbst hier oben auf dem Küstenpfad konnte ich die Freude spüren, mit der sie lief. Dann waren die beiden auf unserer Höhe – und vorbei. Wenn Dari und ich unten am Strand gestanden hätten, hätte es bestimmt »Zisch!« gemacht. Wow.
Als sie aus unserem Blickfeld verschwanden, führte ich Dari nach Hause. Wir kamen gerade auf dem Hof an, als Mamas Polo um die Stallecke rollte. Sie ließ das Fenster herunter.
»Hallo, mein Großer«, begrüßte sie mich in blendender Laune. »Hattet ihr Spaß gestern?«
Ich nickte. »Du ja anscheinend auch. Kommst du jetzt erst heim?«
Sie grinste. »Das ist der Vorteil am Erwachsensein, Sohn. Ich darf das.« Ihr Blick fiel auf Dari. »Wenn du sie in die Box gebracht hast, könntest du ins Büro laufen und mir den roten und den blauen Ordner mitbringen? Dann muss ich nicht aussteigen.«
»Geht klar.«
»Super.« Sie lächelte, dann hielt sie eine Papiertüte hoch, die neben ihr auf dem Beifahrersitz gelegen hatte. »Frühstück in einer Viertelstunde? Es gibt frische Brötchen.«
Ich nickte. Sie war so gut drauf, da musste ich ihr ja nicht sagen, dass ich schon gegessen hatte. Und ein zweites Sonntagsfrühstück hatte noch keinem geschadet.
Sie winkte mir zu und ich führte Dari zum Stall.
Meine Mutter war also über Nacht weg gewesen. Ich wollte gar nicht so genau darüber nachdenken, was das bedeutete. Als ich die Boxentür hinter Dari zuschob, wurde mir klar, dass ich es wahrscheinlich genießen sollte, solange wir am Sonntag beim Frühstück noch zu zweit waren.
*
»Hallo, Eva. Hi, Jannis.« Luise stand im Eingang des Gutshauses und winkte uns hinein. »Geht gleich ins Esszimmer durch. Es sind schon fast alle da.«
Hinter uns drückte sie die Tür ins Schloss.
»Das heißt, Frida braucht noch einen Moment. Die war am Strand trainieren und hat anscheinend die Zeit vergessen.«
Schon wieder? Das war jetzt das zweite Mal in drei Tagen, dass Frida ohne mich zum Strand ritt.
»Was trainiert sie denn?«, fragte ich Luise, während Mama schon durch eine Wolke aus Gewürzdüften Richtung Esszimmer vorauslief.
»Nicht dein Ernst, oder?« Luise sah mich ungläubig an. »Sie hat dir nichts erzählt?«
Ich hob nur fragend die Augenbrauen, doch Luise schüttelte grinsend den Kopf.
»Keine Chance. Frag sie mal schön selber.«
»Okay«, sagte ich mit einem Schulterzucken, auch wenn mir die Antwort längst nicht so gleichgültig war, wie ich tat. »Was machst du eigentlich hier mitten in der Woche?«
»Ähm, feiern? Die Uni kommt auch ohne mich klar.« Luise lachte und deutete mit einer Kopfbewegung den Flur hinunter. »Theo und ich sind bis Sonntag da. Ich weiß ja nicht, wie das in Berlin ist, aber hier an der Küste ist ein Siebzigster ein Dorffest. Heute feiern wir in kleiner Runde, morgen kommen der Bürgermeister, ein paar Gemeinderäte und Vereinsvorsitzende und die Pastorin, am Donnerstag sind die Nachbarn zum Kaffee eingeladen und ab Freitag trudelt die Verwandtschaft ein.«
Ich atmete tief ein und nickte. »Nicht schlecht. Aber so, wie sich das anhört, besteht die kleine Runde aus mindestens zwanzig Leuten.«
Sie grinste. »Mit dir und Eva sind wir dreizehn. Du weißt doch mittlerweile, wie es bei uns zugeht. Und Annelie und Florian konnten noch nicht mal kommen, weil Basti erkältet ist.«
Bevor ich fragen konnte, ob es was Schlimmeres war, blickten wir auf, weil eilige Schritte die Treppe herunterkamen. Frida hatte ein Kleid und Ballerinas an, aber diesmal war es kein Problem, mich auf den Bereich über ihrem Hals zu konzentrieren, weil sie ihre Haare offen trug. Ein frischer Shampoogeruch wehte mir entgegen, doch das war bestimmt nicht das Faszinierende daran. Ich kannte niemanden, der einen solchen Wasserfall aus roten und goldenen, kupfer- und honigfarbenen Wellen auf dem Kopf hatte. Schon krass.
»Hi«, sagte Frida und dann: »Was ist?«, weil ich anscheinend nicht geantwortet hatte. Ich guckte mich nach Luise um, doch die hatte sich verdrückt. Frida griff nach meinem Arm und zog mich ins Esszimmer. Die Leute waren alle so in ihre Gespräche vertieft, dass sie nicht mal aufsahen, als wir hereinkamen. Ich machte sowieso erst mal große Augen, weil der Raum ganz schön beeindruckend war. »Speisesaal« hätte es eher getroffen.
Normalerweise aß Fridas Familie ja an dem riesigen Tisch in der Küche, aber das hier war schon eine andere Nummer. Bodentiefe Fenster gaben den Blick auf eine mit Laternen beleuchtete Terrasse frei, an der Stirnseite hing ein monströses modernes Gemälde, das ziemlich teuer aussah, und der Esstisch war gefühlte fünf Meter lang. Die Benekes hatten das Haus total gemütlich und zweckmäßig eingerichtet, sogar der ehemalige »Salon« war ein stinknormales, wenn auch überdimensioniertes Wohnzimmer. Aber hier im Esszimmer konnte das Gut seine adlige Herkunft nicht verleugnen.
Frida kriegte meine Verblüffung gar nicht mit, sondern ging mir voraus zu Heinrich, umarmte ihn und gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Tut mir leid, ich war noch am Strand«, erklärte sie knapp. »Alles, alles Gute.«