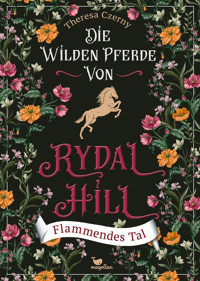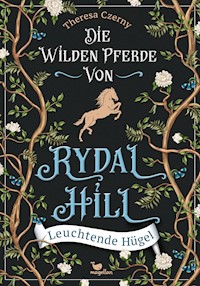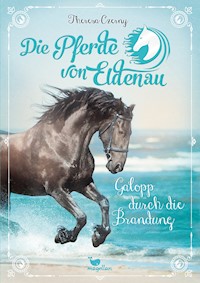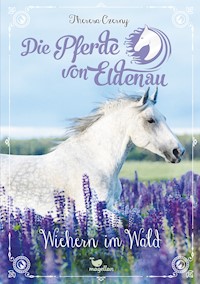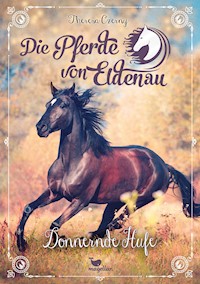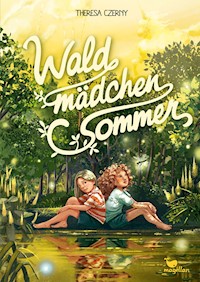12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Magellan Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die wilden Pferde von Rydal Hill
- Sprache: Deutsch
Ein packender Jugendbuchroman vor der traumhaften Kulisse des englischen Lake Districts Valerie hat sich entschieden, im neuen Schuljahr in England zu bleiben. Sie könnte glücklich sein mit Ben, aber über allem schwebt die Gefahr, die sein Vater Gordon ihnen eröffnet hat: Auf den Aldringhams scheint ein Fluch zu liegen – ein Fluch, der nicht nur die Pferde, sondern auch Menschen betrifft. Gemeinsam mit ihren Freunden forschen Valerie und Ben nach, was an den alten Geschichten dran ist. Je tiefer sie in die Geheimnisse der Vergangenheit eintauchen, desto mehr Hinweise finden sie, dass Gordon die Wahrheit gesagt haben könnte. Und die Zeit drängt: Während sie einen Weg suchen, den Fluch zu brechen, stößt der frei lebenden Herde immer mehr Unerklärliches zu. Und plötzlich stehen nicht mehr nur Pferdeleben auf dem Spiel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Frida
1
Das war’s.«
Ein letztes Mal ließen wir unseren Blick durch den Schäferwagen schweifen. Anfangs hatte alles darin ein wenig unpersönlich gewirkt, aber jetzt, nach drei Monaten, entdeckte ich überall Bens Spuren. Die Kiste mit Putzzeug unter dem Tisch, Fachbücher über Pferde in einem Korb neben dem Bett, Führstricke an dem Haken hinter der Tür. Hier und da hingen Schnappschüsse von uns an den Wänden. Ben hatte den Sommer über hier gewohnt und Fairview war für uns beide eine Zuflucht geworden.
Einatmend drehte er sich zu mir um und lächelte ein bisschen wacklig. Auch wenn sich Albie neben mir lautstark durch ein paar letzte saftige Grasbüschel arbeitete, ließ ich ihm seinen Willen und schlang stattdessen die Arme um Ben.
»Wir kommen zurück«, nuschelte ich in seine Jacke. Er brummte zustimmend und zog mich nah an sich.
In den letzten Wochen war er mir so vertraut geworden. Nicht nur, wie er seine Arme um meine Schultern legte oder wie gut mein Kopf in die Kuhle an seinem Hals passte, wie er unter der Seife und dem Waschmittel roch und wie sich die Schwielen an seinen Händen anfühlten, wenn er mein Gesicht umfasste. Ich wusste auch, was ihm jetzt durch den Kopf ging: die Nachmittage, die wir in der Spätsommersonne auf der Bank vor dem Schäferwagen verbracht hatten, neben uns je eine Tasse Tee und ein Stapel Bücher. Die Abende, an denen wir aneinandergekuschelt auf seinem Bett lagen und die Schatten beobachteten, die das Feuer in seinem kleinen Holzofen an die Wände warf, und über unsere Pläne, unsere Wünsche und Träume redeten. Die Momente im grauen Morgenlicht, in denen wir lächelnd aufwachten, einfach nur, weil wir zusammen waren.
Denn dass ich hier war, war noch vor wenigen Wochen alles andere als selbstverständlich gewesen. Nach langen Diskussionen hatte sich meine Mutter letztlich einverstanden erklärt und jetzt würde ich meinen Schulabschluss in England und nicht an meiner alten Schule in Deutschland ablegen. Dass ich dabei nicht nur meine beste Freundin, sondern auch eine Menge andere Leute vor den Kopf gestoßen hatte, wusste ich. Ich war dabei, Abbitte zu leisten, aber es war nicht leicht. Nicht nur, weil sich Jette meine Entscheidung mehr zu Herzen genommen hatte, als ich geglaubt hätte, sondern auch, weil es mir schwerfiel, mich für etwas zu rechtfertigen oder gar zu entschuldigen, was sich so richtig anfühlte.
Doch daran wollte ich jetzt nicht denken. Ich wollte ein letztes Mal den Sommer mit Ben hier auf den Fells aufleben lassen, und sei es nur in meinem Kopf: die sonnenbeschienenen Hügel, die violette Heide, Baum und Fels und Weite und die Ponys. Vor allem die Ponys. Um sie drehte sich seit Wochen jeder Gedanke, für den wir neben der Schule Zeit hatten. Um sie und das furchtbare Erbe, das Ben in die Wiege gelegt worden war.
Albie zupfte an seinem Führstrick, anscheinend hatte er alles Gras in Reichweite aufgefressen. Als das Zupfen in ein energischeres Ziehen überging, löste ich mich seufzend von Ben.
Sein Blick streifte das schwarze Fell-Pony mit einem leisen Vorwurf, aber dann glitt er weiter über den Schäferwagen, dunkelgrau mit roten Fensterrahmen, der einen ganzen Sommer lang Freiheit für ihn bedeutet hatte. Jetzt war Oktober, der Wind fegte raschelnd durch die braunen Farnwedel an den Hängen und bald würde es nachts in den Bergen empfindlich kalt werden. Es war Zeit, zurück nach Renwick zu ziehen, in das Haus seines Vaters.
»Dann los.« Ben nahm meine Hand und wir kehrten Fairview den Rücken zu. Ein neuer Sommer würde kommen, einer, der hoffentlich weniger Streit brachte und weniger Sorgen.
Während wir Albie zu dem Pfad führten, der nach ein paar Hundert Metern Richtung Rosley abzweigte, fiel mir auf, dass Bens Bewegungen ihre alte Energie zurückgewonnen hatten. Bei einem Sturz Ende August hatte er sich eine Rippe angeknackst, aber die Vorsicht, die er sich daraufhin angewöhnt hatte, war verschwunden. Ich drückte seine Hand und lächelte ihn an. Wie so oft zog sich mein Herz zusammen, als seine grünbrauen Augen auf meine trafen.
Wir liefen am nördlichen Rand von Ellondale entlang. Das Tal hatte auch nach Monaten nichts von seinem Zauber verloren. Der Bach, der sich zwischen lichten Wäldchen hindurchschlängelte, die Schafweiden, die kleinen Tümpel, die Mauern und Hecken – ich schien mich nie an ihnen sattzusehen. Ein Stück weiter westlich lag der Bauernhof meines Bruders und seiner Freundin. Von hier aus konnte ich die ersten Wiesen, die zu Ellonby gehörten, schon erkennen. Und hinter ein paar hohen Bäumen versteckte sich das alte Farmhaus, das so schnell zu meinem neuen Zuhause geworden war.
Eine Bewegung rechts von uns erregte meine Aufmerksamkeit. Auf einem Hang ein Stück von uns entfernt waren Ponys aufgetaucht. Ich stutzte, doch im nächsten Moment begriff ich, dass es nicht Bens Herde war.
Natürlich hatte er die Tiere längst bemerkt.
»Weißt du, wem die gehören?«, fragte ich. Es kam nicht oft vor, dass in Ellondale eine fremde Gruppe auftauchte, aber da es in den Höhenlagen der Fells keine Zäune oder Mauern gab, wanderten manche Herden hin und wieder über ihre üblichen Routen hinaus.
Ben nickte. »Das sind die Blencarn-Ponys.« Er sah mich an. »Die Herde von Lainis Eltern.«
Ich grinste. »Dann gehören sie ja praktisch zur Familie.«
Er lachte leise. »Deine Schwägerin teilt ja vielleicht ihr Haus mit dir, aber bei ihren Ponys wäre ich vorsichtig.«
»Ach, bisher gab’s noch keine Klagen.« Ich klopfte Albies Hals. Sein linkes Ohr, das auf die anderen Ponys gerichtet gewesen war, drehte sich zu mir, und er schnaubte.
In den vergangenen Wochen waren Albie und ich zu einem Team zusammengewachsen. Ich hatte begonnen, mich mehr um Lainis kleine Ponyherde zu kümmern. Neben der Farmarbeit war ihr dafür immer weniger Zeit geblieben, und jetzt, als ihr Babybauch enorme Ausmaße angenommen hatte, war es selbstverständlich, dass wir die Aufgaben auf Ellonby neu verteilten. Nur dass ich die Ponys versorgte, war nicht selbstverständlich. Noch vor wenigen Monaten hätte mich allein die Vorstellung ins Schwitzen gebracht.
Ben griff hinter meinem Rücken nach Albies Widerrist und kraulte ihn an einer Stelle, die er besonders mochte. »Ich find’s gut, dass die Hammonds das durchziehen. Es werden sowieso immer weniger Züchter, die ihre Ponys noch auf den Fells halten.«
Während mein Blick der kleinen Herde folgte, fragte ich mich bestimmt zum hundertsten Mal, wieso diese uralte Tradition langsam ausstarb. Es gab nichts Schöneres, als den schwarzen Ponys dabei zuzusehen, wie sie sich ihren Weg über die Berge suchten, auf sich allein gestellt, unabhängig und selbstbewusst. Sie lebten, wie die Natur es vorgab und nicht die Bequemlichkeit der Menschen.
Seufzend wandte ich mich ab. Da hatte ich meine Antwort. Es gehörte viel Wissen – und Vertrauen – dazu, eine Herde in den Bergen zu halten. Und für Pferde, mit denen gearbeitet wurde, war es einfach zu unpraktisch.
Ben holte mich aus meinen trüben Gedanken. »Sollen wir morgen ganz früh zur Herde? Nächste Woche schlägt das Wetter um.« Er lächelte mich ein bisschen bedauernd an. »So oft werden wir das dieses Jahr nicht mehr machen können.«
Während wir die Abzweigung hinunter nach Ellonby nahmen und Albie voller Vorfreude auf seine Kumpel und einen Armvoll Heu seine Schritte beschleunigte, sah ich Ben an. »Du glaubst doch nicht, dass ich mir das entgehen lasse, oder?«
*
Auf Ellonby half mir Ben, Albies Packzeug abzuladen und in den Schuppen zu verfrachten. Den Rucksack nahm er selbst, den Rest seiner Sachen würde die Gutsverwalterin seines Vaters, Jo, in den nächsten Tagen abholen.
»Bis morgen«, flüsterte er, nachdem wir uns so ausgiebig verabschiedet hatten, wie Albie es in seiner Ungeduld, auf die Weide zu kommen, zugelassen hatte. Dann schwang er sich auf sein Rad und winkte mir an der letzten Kurve, wo ich ihn noch sehen konnte.
Lächelnd kratzte ich Albies Hufe aus und führte ihn zum Gatter, wo ihn sein bester Kumpel Ray schon erwartete.
»Aber mich beim Knutschen stören«, murmelte ich, während die beiden sich begrüßten, als wären sie drei Jahre statt drei Stunden getrennt gewesen.
Neugierig, wie sie war, trottete Bee aus dem Schatten der großen Esche herüber, um nachzusehen, was der Tumult zu bedeuten hatte. Nell und Penny hatten anscheinend Angst, etwas zu verpassen, wenn sie sich nicht auch zu uns gesellten, und plötzlich stand ich umringt von fünf Ponys da, tätschelte Nasen und kraulte Widerriste.
Und das Beste war: Es ging mir gut dabei.
Als klar war, dass ich außer Streicheleinheiten nichts zu bieten hatte, zockelte erst Bee davon, dicht gefolgt von den beiden anderen Stuten, und schließlich trollten sich auch die Wallache. Penny ließ sich von den Jungs zu einem kleinen Wettrennen überreden, und ich musste lachen, als sie zu dritt über die Wiese bockten wie eine Bande Fohlen.
Immer noch lächelnd wandte ich mich nach Westen, schloss die Augen und genoss die Abendsonne auf meinem Gesicht, dann öffnete ich das Gatter und schlüpfte hindurch.
Unentschlossen blieb ich stehen. Mein Magen knurrte, und in meinem Zimmer warteten Hausaufgaben auf mich, aber ich wollte noch nicht hineingehen. Ben hatte gesagt, dass bald das Wetter umschlagen würde. Es würde nicht mehr viele goldene Abende wie diesen geben.
In meiner Tasche vibrierte mein Handy. Als ich es herauszog, musste ich schlucken. Eine Nachricht von Jette.
Ich atmete tief ein und öffnete sie.
Nach den ersten Vorwürfen Anfang September, als ich ihr gebeichtet hatte, dass ich in England bleiben würde, war sie recht schnell dazu übergegangen, mir kommentarlos Fotos oder Videos zu schicken von Dingen, die ich verpasste. Am schlimmsten waren die von ihrem achtzehnten Geburtstag gewesen, an dem sie sich geweigert hatte, meine Glückwünsche entgegenzunehmen. Stattdessen hatte ich Unmengen an Selfies bekommen von ihr und all unseren Freunden und mit einem Jungen, den sie wild küsste. Ich wusste bis heute nicht, wie er hieß und ob es etwas Ernstes zwischen den beiden war.
Trotzdem konnte ich ihr nicht böse sein. Mir war klar, dass ich sie enttäuscht und viele unserer gemeinsamen Pläne zunichtegemacht hatte.
Und das ließ sie mich auch heute wieder spüren.
Das Video, das sie geschickt hatte, zeigte einen Prospekt. Sie blätterte darin, und auch ohne den Text hätte ich an den Bildern sofort erkannt, worum es sich handelte: Die Fotos in der Broschüre zeigten Oslo und verschiedene norwegische Fjorde. Über einem Bild blieb die Videoaufnahme hängen: Ein Orca erhob sich halb aus dem Meer.
Wieder schluckte ich. »Du hast es geschafft!«, tippte ich als Antwort. »Herzlichen Glückwunsch! Drück dich!«
Die Antworthäkchen blieben transparent. Also steckte ich das Handy wieder ein, straffte die Schultern und lächelte Zach entgegen, der über den Hof zu mir schlenderte.
»Schlechte Nachrichten?«, fragte er in seinem australischen Akzent, der mich immer wieder zum Schmunzeln brachte, weil er zwischen all der nordenglischen Knurrigkeit wirkte wie ein Strandurlaub.
Ich brummte unbestimmt und lehnte mich neben ihm ans Gatter.
»Nur Jette. Meine beste Freundin aus Deutschland, du weißt schon.« Er nickte und sah mich auffordernd an. Ich hatte ihm erzählt, dass sie noch immer nicht mit mir redete. »Wir wollten nach dem Abi ein halbes Jahr für eine Walschutzorganisation in Norwegen arbeiten. Sie hat mir gerade geschrieben, dass sie das jetzt allein macht.«
Zach stupste mich mit dem Ellbogen an und seufzte. »Manche Leute kommen nicht gut klar mit Entfernungen. Gib ihr noch eine Weile.«
Ich schob die Unterlippe nach vorn. »Bei deiner Freundin hat das auch nicht geholfen.«
Er lachte. »Nein. Aber mit Cassie wäre es früher oder später sowieso vorbei gewesen.«
Ich hob die Augenbrauen. Als er mir die Geschichte erzählt hatte, hatte das noch anders geklungen. Er war verständlicherweise ziemlich verletzt gewesen, dass Cassie, nur eine Woche nachdem er auf Europareise gegangen war, per Nachricht mit ihm Schluss gemacht hatte. Anscheinend war er mittlerweile über sie hinweg.
»Was ist?« Fragend sah er mich an. Ich hatte zu grinsen begonnen.
Ich deutete Richtung Haus, wo hoffentlich das Abendessen schon auf uns wartete. Gemächlich schlenderten wir los. »Du kennst doch Darcie, oder?«
»Die vom Buchladen?«
Ich nickte. »Sie hat mit ihrem Freund Schluss gemacht.«
Zach presste die Lippen aufeinander. »Und was willst du mir damit sagen?«
Ich wiegte den Kopf. »Gar nichts.«
Jetzt musste er lachen. »Ich glaube nicht, dass so eine kluge Frau was mit einem Farmgehilfen anfangen kann.«
»Awww.« Ich zog ein mitleidiges Gesicht. »Muss ich dein Selbstbewusstsein aufpäppeln?«
Kopfschüttelnd betrachtete Zach mich. »Wann bist du so frech geworden?«
Ich grinste. »War ich schon immer.« Dann streckte ich die Hand aus und drückte seinen muskulösen Oberarm. »Und zufällig weiß ich, dass Bücher verdammt schwer sind.«
»Sag mal!« Er blieb stehen, aber ich wartete nicht auf seine Antwort, sondern rannte lachend zum Haus.
»Händewaschen nicht vergessen!«, rief ich noch, dann war ich sicher außer Reichweite.
*
Die Küche auf Ellonby war so gemütlich, wie man es sich nur vorstellen konnte. Vor den Fenstern hingen karierte Vorhänge, auf der Eckbank lagen haufenweise Kissen, und in den Regalen stapelten sich Lebensmittel, die auf die sehr unterschiedlichen Essgewohnheiten der englischen und deutschen Bewohner hindeuteten.
Laini und Silas standen an der Arbeitsplatte. Als ich die Tür aufriss, trat Silas hastig einen Schritt zurück und widmete sich betont konzentiert der Salatschüssel.
»Es ist euer Haus«, sagte ich, während ich den Küchenschrank öffnete und Geschirr herausnahm. »Lasst euch von mir nicht stören.«
»Zu gnädig«, antwortete Laini, aber ihre Ohren waren rosa angelaufen. Ehrlich, wie oft hatten die beiden Ben und mich schon zusammen erlebt? Konnte ihnen da wirklich noch etwas peinlich sein?
»Wir haben heute eure Ponys gesehen. Oben auf dem Fell«, erzählte ich munter, um das Gespräch in eine unverfängliche Richtung zu lenken.
Zach betrat die Küche, hielt die Hände hoch und wackelte mit den Fingern. Wir mussten beide grinsen, als ich anerkennend einen Daumen in die Höhe hielt. Er nahm mir die Teller ab und begann, den Tisch zu decken.
»Die Blencarn-Herde?« Laini sah von dem Kartoffelgratin auf. »Diese alten Streuner. Wenn Gracie sie erwischt, gibt’s Ärger.«
Hastig trat ich zur Seite, als Laini die heiße Auflaufform zum Tisch trug. »Wenn du mit den Stuten wirklich züchtest, lässt du sie dann auch auf den Fells laufen?«
Während sie das Gratin auf vier Teller verteilte, antwortete sie: »Das muss ich mir noch überlegen. Vielleicht.« Sie sah mich an. »Es ist eine große Verantwortung. Du hast es im Sommer selbst erlebt, wie unvernünftig manche Leute sind. Irgendein Wanderer kommt vorbei, steckt den Ponys Futter zu und schon haben sie eine Kolik. Oder Schlimmeres.«
Ich erinnerte mich. Während ich auf meinen Platz rutschte und wir zu essen begannen, versuchte ich, nicht an die grauenvollen Stunden zu denken, als Ben und ich befürchteten, Viv würde nicht überleben.
Anscheinend hatte meine Frage Laini ins Grübeln gebracht.
»Ich fände es ja wichtig«, fuhr sie nach einer Minute fort. »Die Fell-Haltung gehört zu der Gegend, genauso wie die Seen und die Schafe …«
»… und die schlechten Straßen«, murmelte Silas. Zach grinste zustimmend.
»… aber es gibt immer mehr Widerstände. Viele Umweltschützer wollen die Ponys gar nicht mehr in den Bergen haben.«
»Echt?« Davon hatte ich noch nie gehört. »Warum denn das?«
Laini schenkte sich ein Glas Wasser ein. »Es hat was mit dem Klimaschutz zu tun. Die offenen Flächen auf den Fells sind ja erst durch Viehhaltung entstanden. Aber um den natürlichen Zustand wiederherzustellen, müssten die Hochtäler aufgeforstet werden. Mit Ponys – und Schafen – ist das schwierig.«
»Weil sie die jungen Bäume fressen würden?«
Sie nickte. »Das ist ein ewiger Streit zwischen Ponyhaltern und den Behörden.«
»Hast du nicht auch mal erzählt, dass es Diebstähle gab?«, fragte Silas an Laini gewandt. Auffordernd hielt er mir die Salatschüssel hin und ich griff danach.
»Im Ernst? Hier in den Lakes?«
Laini schmunzelte. Sie fand es witzig, dass mir der Lake District immer noch wie das Paradies auf Erden vorkam. Ich zog eine Grimasse.
»Ja, hier in den Lakes. Es ist schon ein paar Jahre her. In der Nähe von Kendal war das. Zumindest haben sie die Diebe damals geschnappt.«
Nachdenklich starrte ich meinen Kopfsalat an. Es gab noch eine Menge mehr Gefahren auf den Fells, als mir bewusst gewesen war. Ich musste Bens Vertrauen wirklich bewundern, dass er seiner Herde trotz allem ihre Freiheit ließ.
Das Gespräch nahm eine andere Richtung, und ich bekam kaum mit, worum es ging, bis Silas mich fragte: »Willst du morgen nach Sedgwick mitkommen?«
Ich sah auf und schluckte. »Kann nicht, ich bin …«
»… mit Ben unterwegs«, beendeten die drei meinen Satz wie aus einem Mund.
Bestimmt lief ich jetzt knallrot an, und es dauerte einen Moment, bis ich in das Lachen der anderen einstimmen konnte.
2
Es war ein Tag wie verzaubert. Die Sonne war gerade aufgegangen, als Ben und ich die letzte Steigung nahmen und den Fell erreichten. Vor uns breitete sich glitzerndes Gras aus, sanft gewelltes Heideland, wo in den Kuhlen noch silberblaue Schatten ruhten, aber als wir uns umdrehten, blickten wir hinunter auf eine dichte Wolkendecke, die Ellonby, Rosley und Whinfell Water vor uns verbarg.
Inversionswetterlagen, hatte Ben mir erklärt, kamen im Herbst in den Lakes häufig vor. Während es im Tal trist und grau war, schien auf den Gipfeln die Sonne.
»Dann bin ich am liebsten hier oben«, sagte er leise, während wir beobachteten, wie die Sonne an den Rändern der Wolken knabberte und den Dunst allmählich auflöste. »Im Tal ahnt niemand, was für ein schöner Tag es ist, dass die Ponys in der Sonne dösen und der ganze Stress meilenweit entfernt ist. Die Fells gehören praktisch mir allein. Es ist wie eine andere Welt.«
Lächelnd zog ich eine Schnute und schlang die Arme um seine Mitte. »Und jetzt musst du das alles mit mir teilen.«
Sein Griff um meine Schultern wurde einen Moment fester, so als wolle er mich tadeln, dann lehnte er seinen Kopf an meinen. »Mit dir würde ich alles teilen.«
Jetzt zog ich ihn näher an mich. Das hier, das war unser Zauberreich. Die Wolken verbargen uns vor den Blicken der Welt, und einen Moment lang wünschte ich, es könne immer so bleiben. Da fiel mir wieder ein, dass die Welt uns vielleicht nicht finden würde, aber der Fluch – der Fluch würde uns einholen. Auch hier oben. Gerade hier oben.
Ich verdrängte die dunklen Gedanken, zumindest eine kleine Weile. Dafür waren das Herbstlicht zu golden, die Hänge auf der anderen Seite des Tals zu malerisch und das Wolkendach zu wattig.
Doch wir konnten nicht ewig hier stehen bleiben. Immerhin wollten wir nach der Herde sehen. Es war erstaunlich, dass die Ponys nicht schon längst aufgetaucht waren.
Ben schien zu derselben Erkenntnis zu kommen, denn er seufzte leise und schob mich von sich weg. Ohne ein Wort hielt er mir die Hand hin, und wir wandten uns Richtung Südosten, wo wir die Herde heute Morgen vermuteten.
Nach einigen Minuten erreichten wir eine der wenigen geschützten Stellen der Hochebene. Ein Dornengestrüpp hielt den schlimmsten Wind von einer kleinen Kuhle ab und mehrere Bäume boten Schutz vor Regen. Je näher wir kamen, desto länger wurden Bens Schritte.
»Was ist?«, fragte ich, als mir sein Stirnrunzeln auffiel.
»Weiß nicht. Hab ein komisches Gefühl.« Er kniff die Augen zusammen. »Siehst du, wie zertrampelt das Gras ist? Und da an der Esche … liegt da was?« Einen Moment zögerte er, dann fluchte er: »Scheiße.«
Er ließ mich los und begann zu rennen. Verwirrt starrte ich ihm nach, dann kam ich in die Gänge und folgte ihm. Ben steuerte einen Punkt ein wenig abseits der Kuhle an, wo ich jetzt einen dunklen Fleck auf dem Boden erkannte. Eine Krähe pickte daran herum. Als sie Ben bemerkte, flog sie krächzend auf. Mir wurde kalt.
Sekunden später erreichte Ben die Stelle, guckte und wandte sich wieder ab. Er legte den Kopf in den Nacken und fuhr sich wild durch die Haare. Als ich an ihm vorbeiwollte, hielt er mich am Arm zurück.
»Val, es ist nicht schön.«
Wir schauten uns an. Nach einer Sekunde kam die Botschaft an, er nickte und ließ mich los.
Schön war es wirklich nicht. Im Gegenteil: Auf dem Boden lag ein blutiger Klumpen, vielleicht so groß wie ein Kaninchen. Aber es war kein Kaninchen. Obwohl es noch so klein war, konnte ich die Beine, den Kopf und den Hals gut erkennen.
Es war ein winziges Pony. Ein Fohlen, viel zu früh geboren.
»Oh, Ben.« Ich drehte mich zu ihm um und nahm ihn in die Arme. Er fühlte sich ganz steif an, so als hätte der Schock jetzt eingesetzt, und er gab keinen Ton von sich. Während mir die Tränen übers Gesicht rannen, hielt ich ihn, wiegte ihn hin und her, einfach nur, um ihm zu zeigen, dass ich da war.
Irgendwann lehnte er sich nach hinten und betrachtete mein Gesicht. »Bist du okay?«, flüsterte er.
»Ich schon.« Forschend sah ich ihm in die Augen. Er wirkte schockiert, traurig, alles, was ich auch war, aber dahinter lag noch etwas. Panik flackerte in seinem Blick. Da endlich stellte ich die Verbindung her, die er längst gezogen hatte. »Du glaubst, es hängt mit dem Fluch zusammen!«
Hilflos zuckte er mit den Schultern. »Ich kenne die Herde seit sechs Jahren. In der ganzen Zeit gab es keine Fehlgeburt und Henry hat nie von einer erzählt.« Er schluckte. »Du weißt, was Dad gesagt hat: Diese schlimmen Dinge passieren erst, seit die Ponys mir gehören.«
Mein Herz schlug schmerzhaft schnell, und ich erkannte, dass Ben dieselben Gedanken umtrieben.
Schon als er es fragte, schüttelte ich den Kopf. »Glaubst du, es wäre besser gewesen, die Herde an Lady Sibyll zu verkaufen?«
»Nein!«, antwortete ich heftig. Ich legte eine Hand an seine Wange und sagte ruhiger: »Nein. Diese Ponys gehören zu dir. Sie vertrauen dir. Und du weißt nicht, ob die Stute vielleicht krank war. Fehlgeburten kommen vor.« Er wollte widersprechen, doch mit aller Überzeugung schloss ich: »Wir werden diesen Fluch brechen. Und in der Zwischenzeit tun wir alles, um die Herde zu beschützen.«
»Aber du siehst doch, dass es nicht reicht!«
Gegen meinen Willen wanderte mein Blick zu dem blutigen Häufchen im Schatten der Esche. »Was wäre die Alternative, Ben? Wenn die Herde im Tal gewesen wäre, jedes Pony für sich in einer Box, vielleicht wäre dir aufgefallen, dass etwas mit der Stute nicht stimmt.« Ich sah ihn an. Ich dachte an das Gespräch gestern beim Abendessen und wusste, dass das, was ich sagen musste, hart klingen würde. »Aber hier oben? Du hast dich entschieden, ihnen ein freies Leben zu ermöglichen. Dafür zahlst du einen Preis. Du bist der Einzige, der entscheiden kann, ob er zu hoch ist.«
Bens Lippen waren schmal. Ein paar Herzschläge vergingen, dann schloss er für einen Moment die Augen und stieß den Atem aus. »Okay.« Vorsichtig ließ er mich los und ging ein paar Schritte auf und ab. »Aber wir brauchen Ergebnisse! Wir suchen seit Wochen und sind nicht schlauer als im Sommer. Bisher haben wir gar nichts!«
Leider stimmte das, beinahe zumindest.
Er atmete tief ein, als ich nichts darauf entgegnete. »Du musst allein zurück. Ich sehe nach der Herde und dann bringe ich das … das Fohlen zur Tierklinik. Die müssen untersuchen, ob ein Virus die Ursache war.«
»Könnten sonst noch mehr Fohlen in Gefahr sein?« Daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
Ben wirkte plötzlich müde. »Ja. Aber hoffen wir das Beste.«
»Ich begleite dich. Keine Widerrede. Wir müssen dafür nach Sedgwick. Die Praxis in Rosley hat am Sonntag bestimmt nicht geöffnet.« Ich nahm meinen Rucksack ab und griff in eine der Seitentaschen.
»Was hast du vor?«
Ich zog die Regenhülle aus dem Fach und sah zu Ben hoch. »Du willst das Fohlen doch wohl nicht in deiner Jacke rumschleppen, oder?«
Bens Mundwinkel hob sich, dann nahm er mir die Hülle aus der Hand. »Lass mich.«
Dagegen hatte ich nichts einzuwenden. Allein der Gedanke, den kalten Klumpen durch das Plastik zu spüren, jagte mir eine Gänsehaut über den Rücken.
»Welche der Stuten war es, glaubst du?«, fragte ich, als wir uns auf die Suche nach der Herde machten.
Ben richtete den Blick in den Himmel, wo eine Krähe kreischend über uns hinwegflog. »Wir werden es bestimmt gleich wissen.«
*
Es war Molly. Ihre Hinterbeine waren voller Blut, aber auch ohne dieses untrügliche Zeichen wäre ich mir ziemlich sicher gewesen. Sie wirkte benommen und gleichzeitig aufgedreht, so als habe sie etwas verlegt und könne es jetzt nicht finden. Ihr Schweif schlug unruhig, und jedes Mal, wenn eine der anderen Stuten Kontakt aufnehmen wollte, legte sie die Ohren an und scheuchte sie weg.
Es war herzzerreißend.
Ich hielt mich im Hintergrund, und nach einer Weile gelang es Ben, auf ein paar Meter an sie heranzukommen. Er betrachtete sie lang, und schließlich hatte ich den Eindruck, als würden sich seine Schultern senken. Doch meine Aufmerksamkeit wurde abgelenkt, denn Fern kam zu mir und drängte sich an mich, so als wüsste sie genau, dass einer von ihnen heute etwas Schlimmes zugestoßen war. Kurz darauf folgte Millie. Ich streichelte und kraulte sie, und ich war mir nicht sicher, wer daraus mehr Trost zog, sie oder ich.
*
Beinahe eine ganze Woche verging, ohne dass wir etwas aus der Tierklinik hörten. Zumindest blieb uns nicht viel Zeit, über die möglichen Ergebnisse nachzudenken, weil der Schulstoff ungeahnte Ausmaße annahm. Das hielt Ben natürlich nicht davon ab, sich Sorgen zu machen. Er ging fast die Wände hoch, weil er nur am Mittwoch Zeit fand, die Herde zu besuchen. Wir waren beide erleichtert, dass Molly gesund wirkte, auch wenn sie Ben noch immer nicht an sich heranließ.
Am Freitag allerdings war das Stirnrunzeln auf Bens Gesicht tiefer, als ich bei der Aussicht aufs Wochenende erwartet hätte. Er lächelte, als er mich am Tor zum Schulhof auftauchen sah, doch mir war sofort klar, dass etwas passiert sein musste.
»Hey«, begrüßte er mich, bevor er mich küsste.
»Guten Morgen«, gab ich zurück. »Was ist los?«
Sein Lächeln vertiefte sich, auch wenn der aufgewühlte Ausdruck in seinen Augen blieb. »Dir entgeht nichts, was?«
Ich brummte unbestimmt. »Abgesehen von der Hausaufgabe für Englisch.« Ben hob eine Augenbraue, aber ich winkte ab. »Hab ich beim Frühstück erledigt. Schieß los.«
Eine Gruppe Jungs lief an uns vorbei. Sie nickten uns zu, einer hob sogar grüßend die Hand und ich lächelte. Das war definitiv eine Verbesserung zu den ersten Schultagen, als Ben von allen Seiten skeptisch beäugt worden war.
Ben zog mich zu der Eiche, die in einer ruhigen Ecke des Schulhofs stand. Ein paar Zwölfjährige sahen uns kommen und räumten zügig ihre Plätze auf der Holzbank darunter, sodass wir uns setzen konnten.
»Hast du heute Nachmittag was vor?«, fragte Ben leise.
Ich schüttelte den Kopf. Es gab da zwar noch diesen Aufsatz in Französisch, aber den würde ich garantiert nicht an einem Freitag erledigen. Wir konnten also tun, worauf wir Lust hatten.
Oder was nötig war, wie sich herausstellte.
»Gut. Dann lass uns zur Historischen Gesellschaft gehen. Heute Nachmittag ist das Archiv geöffnet.«
»Von zwei bis sechs. Ich weiß.« Prüfend musterte ich Ben. Die Dringlichkeit in seiner Stimme und die Art, wie seine Haare wirr vom Kopf abstanden, konnten nur eins bedeuten. »Hat die Klinik angerufen?«
Ben nickte.
Mit einem Mal war ich hellwach. »Und?«
Er zuckte mit den Schultern. »Nichts. Sie konnten keine krankhafte Veränderung feststellen. Was die Ursache für die Fehlgeburt war, wissen sie nicht. Vielleicht hat Molly etwas Giftiges gefressen oder sich überanstrengt.« Er seufzte. »Oder vielleicht war es der Fluch.«
Ich setzte mich so hin, dass ich mich ebenfalls anlehnen konnte. Der Schulhof war beinahe leer, viel Zeit bis zum Klingeln blieb uns nicht mehr. »Und deswegen probieren wir es heute noch mal im Archiv?«
Ben sah mich an. »Wenn du willst. Ich weiß, dass die Chancen minimal sind, dass wir etwas finden.«
Ich griff nach seiner Hand. »Natürlich will ich.« Ich drückte seine Finger. »Es muss eine Lösung geben.«
Er schnaubte. »Ja, aber wie soll die aussehen? Wo sollen wir noch suchen? Und wer sagt uns, dass wir sie rechtzeitig finden? Bevor die Herde …«
Er beendete den Satz nicht, aber das war auch nicht nötig. So gern ich eine Antwort gehabt hätte, ich konnte nichts darauf antworten. All diese Fragen hatten wir uns schon hundertmal vergeblich gestellt.
Ben schnaubte. »Wir haben einfach keine Ahnung, Val. Wenn es so weitergeht, suchen wir noch, wenn wir in Rente gehen. Mum hat jahrelang recherchiert.«
Ich stand auf und hielt ihm eine Hand hin. »Vielleicht. Aber deine Mutter war auch allein.«
Langsam hoben sich Bens Mundwinkel, dann ließ er sich auf die Füße ziehen.
»Müssen wir jetzt wirklich in Mathe?«, fragte er leise, als er einen Arm um meine Taille schlang und mich an sich zog. Seine Stimme war ein bisschen heiser und hatte genau den Tonfall angenommen, der mir zuverlässig eine Gänsehaut verpasste. Und leider wusste er das.
Mit äußerster Willensanstrengung schob ich ihn von mir weg. »Ja, mein Lieber. Daran führt kein Weg vorbei. Aber …«, fuhr ich fort, als er ein übertrieben enttäuschtes Gesicht aufsetzte. »… das Archiv der Historischen Gesellschaft ist nicht besonders gut beleuchtet. Bestimmt findet sich da ein schnuckeliger dunkler Winkel.«
Ben lachte leise. »Man kann von deinem Pflichtbewusstsein ja halten, was man will. Aber mir gefällt, dass du das Angenehme mit dem Nützlichen verbindest.«
*
Seit vier Wochen ging ich jetzt auf eine englische Schule, komplett mit Uniform und allem Pipapo, und nach den ersten holprigen Tagen hatte ich mich ziemlich schnell eingewöhnt. Das lag an Ben, natürlich, aber auch Emmy, Grayson und der Rest ihrer Clique sorgten dafür, dass ich mich zurechtfand. Ich hatte keinen einzigen Kurs, in dem ich niemanden kannte.
Dafür waren die Anforderungen mörderisch. Das ganze System war so anders als in Deutschland, dass der Einstieg im Abschlussjahr nicht gerade ein Zuckerschlecken war. Aber ich hatte nicht vor, mich davon entmutigen zu lassen. Jetzt, da meine Sportkurse wegfielen, hatte ich viel mehr Zeit für den Schulstoff. Es würde schon klappen.
Das hoffte ich auch in anderer Hinsicht. Als ich nach Schulschluss in den Geografieflur bog, wo unsere Schließfächer waren, stand Ben mit mehreren Jungs aus dem Rugby-Team zusammen. Sie wechselten ein paar Sätze, dann nickten sie sich zu und die vier wandten sich Richtung Ausgang. Sofort wurde ihre Unterhaltung lauter.
Ich seufzte leise. Als ich Ben kennengelernt hatte, war er mir wie ein Außenseiter vorgekommen – unnahbar, aufbrausend und ein bisschen trotzig. Dass hinter dieser Fassade so viel mehr steckte, hatte ich erst verstanden, als wir gemeinsam Zeit bei den Ponys verbrachten.
Doch meine Meinung zählte hier nicht. Obwohl er sich der Clique gegenüber wieder etwas mehr geöffnet hatte, schien er seinen Platz an der Schule noch nicht wieder gefunden zu haben. Es fühlte sich falsch an, dass Ben, der für mich so sehr zu diesem Ort, dieser Gegend gehörte, immer irgendwie am Rand zu stehen schien.
»Alles in Ordnung?« Ben sah mir stirnrunzelnd entgegen.
Schnell lächelte ich. »Na klar.« Ich trat zu ihm und gab ihm einen schnellen Kuss, dann drehte ich mich weg, öffnete meinen Spind, legte meine Bücher hinein und sah ihn wieder an. Nach einem kurzen Rundumblick, um mich zu vergewissern, dass wir mittlerweile fast allein waren, zog ich ihn am Hemd zu mir.
»Alles in bester Ordnung«, flüsterte ich, als ich mich an ihn schmiegte und tief ausatmete.
Ich konnte seine Verwirrung spüren, aber sie dauerte nur einen Moment, bevor er die Arme um mich schlang und näher an sich zog. So blieben wir stehen, auch als jemand vorbeiging und ein würgendes Geräusch machte, sogar noch, als der Hausmeister einen Karren vorbeirollte und sich räusperte.
Es spielte keine Rolle, was die Leute von uns dachten. Nicht solange wir zusammen waren.
Irgendwann lehnte ich mich zurück und sah ihm ins Gesicht. »Ich wäre dann so weit«, sagte ich mit meiner muntersten Stimme. »Sollen wir los?«
*
Von der Schule bis zum Archiv der Historischen Gesellschaft brauchten wir keine fünf Minuten. Wir hielten uns gar nicht mit dem eisernen Türklopfer auf, sondern gingen ohne Ankündigung hinein.
In der Eingangshalle saß – wie meist am Freitag – Mrs Bader hinter dem überladenen Schreibtisch und warf uns nur einen flüchtigen Blick über ihre Lesebrille zu.
»Ihr wisst, wo ihr alles findet, ja?«, fragte sie, wandte sich aber schon wieder einer ihrer endlosen Listen zu.
Zumindest wussten wir, wo wir suchen mussten. Gefunden hatten wir in den vergangenen Wochen, in denen wir das Archiv unsicher gemacht hatten, noch nichts Bahnbrechendes. Doch das konnte Mrs Bader natürlich nicht wissen. Sie glaubte, wir würden Bens Familiengeschichte recherchieren, und ganz falsch lag sie damit auch nicht. Bisher hatte in all den Artikeln über die Aldringhams, die wir in der Lokalzeitung gefunden hatten, nichts über einen Fluch oder irgendetwas in die Richtung gestanden. Verwunderlich war das nicht, aber wir hatten unsere Suche auch weiter gefasst – Todesfälle, Unglücke, seltsame Vorkommnisse, wir sammelten alles. Bisher ergab nur nichts einen Sinn.
Immer wieder hatten wir uns deswegen gefragt, ob wir nicht einfach nur unsere Zeit verschwendeten. Immerhin hatten wir keinen einzigen Beweis, und nur durch Bens Vater wussten wir überhaupt davon, dass er und seine Pferde in Gefahr schwebten. Sicher, Gordon war nicht der Typ, der sich Dinge zusammenspann. Aber ein Fluch? So etwas gab es nicht, nicht außerhalb von Märchen und Filmen. Zufall, Pech, unglückliche Umstände – wir hätten viele Namen finden können für all die schrecklichen Dinge, die Bens Familie und seinen Ponys zugestoßen waren, hätten mit den Schultern zucken und nie wieder an den Abend auf dem Carrock denken können. Und trotzdem blieben wir dran. Trotzdem erlaubten wir uns den Gedanken, dass sein Vater die Wahrheit gesagt hatte. Denn gegen Zufälle war man machtlos … aber einen Fluch konnte man brechen.
Deswegen schob ich Ben einige Minuten später seufzend von mir. Er hielt die Augen geschlossen und murmelte etwas von »Noch nicht«, doch wir konnten nicht den ganzen Nachmittag hier in dieser schummrigen Nische herumstehen und knutschen. Zumindest nicht, wenn wir Fortschritte machen wollten.
Ich wollte mich an ihm vorbeiquetschen, aber Ben hielt mich fest und lehnte die Stirn gegen meine. »Danke«, flüsterte er. »Dass du den Fokus behältst. Ohne dich hätte ich längst alles hingeschmissen.«
»Blödsinn. Es geht um deine Zukunft. Um deine Ponys. Natürlich würdest du dich kümmern.« Ich begann zu grinsen. »Ohne mich wärst du vielleicht ein bisschen weniger abgelenkt.«
Ich nahm seine Hand und zog ihn hinter mir her.
»Aber ich lasse mich gern von dir ablenken.«
Ich warf einen Blick über meine Schulter. »Eins meiner vielen Talente.«
Seine Arme schlossen sich von hinten um mich. Einen Moment lehnte ich mich an ihn und er hielt mich. Der kahle, düstere Kellerraum schrumpfte auf ihn und mich zusammen, eingehüllt in … Ich wusste nicht, wie ich es nennen sollte. Oder vielleicht wusste ich es, aber ich traute mich nicht, zu groß klang das Wort. Ich wusste nur, es war warm und golden und größer als Ben oder ich. Aber zu Ben und mir, zu uns zusammen, da passte es.
Er ließ mich los. Als ich an das Regal trat, wo wir beim letzten Mal mit unserer Suche aufgehört hatten, fing ich seinen Blick auf, und wie ein gleißender Lichtblitz breitete sich das Wissen in meinem Körper aus, dass ich alles, alles tun würde, um den Fluch, wenn es ihn gab, zu brechen. Niemand schrieb uns vor, was wir zu fürchten hatten.
*
Eine Stunde später saßen wir vor unseren aufgeschlagenen Archivordnern und blätterten Zeitungsseite um Zeitungsseite um. Wir waren auf ein paar Erwähnungen von Bens Familie gestoßen, aber meist drehten sie sich um Wohltätigkeitsveranstaltungen oder Schirmherrschaften der Aldringhams. Ich verstand völlig, warum Bens Haare mittlerweile wirr vom Kopf abstanden und seine Hand immer öfter ihren Weg in die Chipstüte fand, die wir neben uns auf den Tisch gelegt hatten. Denn die Wahrheit war: Wir waren nicht einmal sicher, ob wir am richtigen Ende anfingen. Wer sagte uns, seit wann der angebliche Fluch auf den Aldringhams lag? Wie sollten wir das herausfinden? Unsere Erkenntnisse konnten längst die Antwort beinhalten oder, im Gegenteil, komplett nutzlos sein. Wir wussten einfach viel zu wenig.
Meine Aufmerksamkeit hatte nachgelassen, sodass ich mich bei einem Bericht festlas, der von einer Pferdeauktion handelte, und auch Ben war mit den Gedanken woanders, sonst hätten wir vielleicht gehört, dass sich Schritte näherten.
Stattdessen fuhren wir beide zusammen, als jemand rief: »Aha!«
Bens Hand steckte gerade in der Chipstüte, sodass er vor Schreck den Inhalt über den halben Tisch verteilte. Im nächsten Moment kapierte ich, wer sich da angeschlichen hatte.
»Seid ihr wahnsinnig?« Sarah kreischte fast, dabei waren höchstens ein oder zwei Chips auf den Zeitungsseiten gelandet. Hastig wischten wir sie weg.
»Entspann dich«, meinte Ben daher auch, aber Sarah dachte nicht daran.
»Leute, im Ernst? Was, wenn das alle machen würden? Man kann doch nichts essen, wenn man wertvolle historische Dokumente liest!«
Ob sich uralte Ausgaben des Sedgwick Herald als wertvolle historische Dokumente qualifizierten, bezweifelte ich, aber wir verstanden ihr Argument. Wortlos griff sich Ben die Tüte und fegte die Chips hinein, während ich mit einem Taschentuch auch den letzten Fettfleck von der Tischoberfläche polierte. Dann lehnte ich mich zurück und musterte Sarah. Schließlich war Angriff die beste Verteidigung.
»Was machst du überhaupt hier?«, fragte ich sie.
So richtig ging die Taktik nicht auf, immerhin verbrachte sie mehr Zeit in der Historischen Gesellschaft als sonst irgendjemand, den ich kannte. Mrs Bader eingeschlossen.
Dementsprechend maß sie mich auch mit einem selbstgefälligen Blick. »Die Frage ist doch eher: Was macht ihr hier? Und fangt gar nicht erst davon an, dass ihr für ein Projekt recherchiert. Mrs Bader hat erzählt, dass ihr seit Wochen immer wieder da wart.«
Gab es nicht so was wie eine Schweigepflicht für Archivarinnen? Das konnte doch nicht erlaubt sein, dass unsere Privatsphäre so rücksichtslos verletzt wurde.
Aber letztlich lag es jetzt an Ben. Er musste entscheiden, ob er Sarah und damit auch Emmy und Grayson einweihen wollte. Das war eine Frage, die uns seit dem Ende der Ferien umtrieb.
Als er den Mund aufmachte, erwartete ich schon, dass er sie mit einem knappen »Das geht dich nichts an« abkanzeln würde, stattdessen hörte ich: »Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Aber kurz gesagt: Auf meiner Familie liegt ein Fluch, und wir suchen einen Weg, um ihn zu brechen.«
»Witzig.«
Als weder Ben noch ich etwas erwiderte, verzog Sarah das Gesicht.
»Okay, dann behaltet eure Geheimnisse für euch.« Sie deutete auf die Chipstüte. »Aber bitte, bitte esst hier unten nichts mehr.«
Für Ben war es anscheinend wichtig, dass sie uns glaubte. Es lag eine neue Dringlichkeit in seiner Stimme, als er beteuerte: »Ich mein’s ernst, Sarah. Auch wenn es unwahrscheinlich klingt: Wir versuchen, einen Fluch zu brechen.«
Ihre Augenlider flatterten. Sprachlos starrte sie Ben an, als wartete sie auf die Pointe, dann schaute sie zu mir, bittend fast, als könnte ich zurücknehmen, was Ben gerade gesagt hatte. Ich erinnerte mich genau an den Moment auf dem Carrock, als wir auf Renwick hinuntergesehen hatten und Gordon uns von dem Fluch erzählt hatte. Die vergebliche Hoffnung, dass jemand zu lachen anfing und sich über meine Gutgläubigkeit lustig machte …
Aber wir fingen nicht an zu lachen.
Sarah schluckte, dann zog sie einen Stuhl vom Tisch weg und ließ sich schwer darauf fallen. »Ein Fluch?«, krächzte sie.
Ben nickte.
»So richtig mit schwarzer Magie und hundert Jahre schlafen und in wilde Tiere verwandeln?«
Ich konnte fühlen, dass Ben genauso erstarrte wie ich. Wir sahen uns an und da, endlich, lachten wir los. Wir mussten so sehr lachen, dass uns die Tränen kamen.
Als ich wieder einigermaßen klar sehen konnte, erkannte ich Sarahs Verwirrung.
»Im Prinzip schon«, japste ich, »auch wenn die Gefahr, dass Ben sich in ein zottliges Ungeheuer verwandelt, eher gering ist.«
Sarah lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. »Was dann?«, fragte sie leise, und ich rechnete es ihr hoch an, dass sie so schnell bereit war, uns zu glauben.
»Wir wissen es nicht«, antwortete Ben, leider ziemlich wahrheitsgemäß. »Es hat mit den Ponys zu tun. Aber wie und warum? Keine Ahnung.«
Eine Weile ruhte Sarahs Blick auf ihm. Dass die Ponys betroffen waren, schien ihre letzten Zweifel auszuräumen. Ben machte keine Witze auf Kosten seiner Herde, das war ihr ebenso klar wie mir. Schließlich ging ein Ruck durch sie. Sie deutete auf die Zeitungen, die aufgeschlagen vor uns lagen.
»Und was macht ihr da?«
Ben seufzte schwer. »Wir suchen nach Erwähnungen meiner Familie. Skandale, Streitigkeiten, Ärger unter Nachbarn. Irgendetwas muss den Fluch ja ausgelöst haben.«
»Flüche werden nicht ausgelöst, aber lassen wir es mal so stehen.« Sarah verschränkte die Arme und hob eine Augenbraue, also schien sie wieder in ihrem Element zu sein. Ihr Blick wanderte zu mir. »Ben weiß so was nicht, dafür müsste er ja mal was recherchieren, aber du? Wieso vergrabt ihr euch hier unten, wenn es die Zeitung auch digital gibt?«
Ben, der einen Moment etwas genervt gewirkt hatte, fing an zu grinsen und drehte sich zu mir. »Ja, Val, wieso vergraben wir uns hier unten?«
Ich boxte ihn gegen die Schulter, schaute aber Sarah weiter an. »Was meinst du?«
»Na, ich erinnere mich genau, dass du dabei warst, als uns Mrs Bader erzählt hat, dass der Herald digitalisiert wurde.«
»Und das digitale Archiv ist frei zugänglich?«
Sie nickte. »Mit einem Suchwort bist du dabei.«
Einatmend lehnte ich mich zurück und wandte die Augen zur Decke. Also hätten wir uns Stunden in diesem Kellerverlies sparen und die Recherche bequem vom Sofa aus erledigen können.
Ben lehnte sich zu mir und drückte mir einen Kuss auf die Wange. »Mach dir nichts draus. Ich erkunde gern alte Gemäuer mit dir.«
Trotz allem musste ich lachen. »Okay. Dann brechen wir hier die Zelte ab. Über deinen Laptop …« Ich grinste Ben an. »… können wir jederzeit Chips krümeln.«
Ben lächelte schmal, während sein Blick zurück zu Sarah wanderte. »Also glaubst du uns?«
Sie verzog den Mund. »Na ja, glauben … Das klingt schon abenteuerlich. Aber ihr beide … Wenn das von Emmy käme, wäre ich deutlich skeptischer.« Nach einer kleinen Pause fragte sie: »Soll ich euch helfen? Die Onlineabfrage kriege ich allein hin und die Ergebnisse kann ich euch schicken. Es sei denn … es sei denn, ihr wollt das zu zweit durchziehen.«
Ben schüttelte den Kopf. »Das war nicht der Grund, warum wir nichts gesagt haben. Aber ein Fluch? Wir dachten, ihr glaubt uns eher, wenn wir schon was dazu in der Hand haben.«
»Und bisher habt ihr nichts gefunden?«
Ich schüttelte den Kopf. »Wir haben einfach zu wenig Ansatzpunkte. Nichts Konkretes, nur Vermutungen. Wenn wir irgendwo mal etwas als gesetzt festlegen könnten …«
Sarah nickte und stand auf. »Gebt mir bis morgen. Ich bringe die Zeitungsberichte mit, und dann erzählt ihr mir, was ihr wisst. Einverstanden?«
Ben und ich sahen uns an, dann nickte er. »Morgen um zwei auf Renwick? Und …« Er zögerte einen Moment. »… am besten gebe ich Emmy und Grayson Bescheid. Es ist sowieso nur eine Frage der Zeit, bis Emmy merkt, dass was im Busch ist.«
3
Braucht ihr noch was?« Charlottes Hand lag am Türknauf. Wie immer wirkte sie mühelos stylish in ihrem langen, schmalen Rock und einem Wollpullover, dem man ansah, dass er teuer gewesen war.
Bens Blick glitt über die Snackauswahl, die Flapjacks, den Tee und die Getränke, die gerade so auf den Sofatisch passten. Er schüttelte den Kopf. »Glaube nicht. Danke.«
Das glaubte ich auch nicht. Selbst mit doppelt so vielen Leuten wären wir mit den Bergen an Essen ausgekommen. Aber Ben und Charlotte, Gordons Freundin, hatten gerade zu einer vorsichtigen Höflichkeit gefunden, die keiner von ihnen aufs Spiel setzen wollte. Das galt vor allem, seit Charlotte von dem Fluch der Aldringhams erfahren hatte. Genau wie wir schien sie nun besser zu verstehen, was Gordon umtrieb, und seine beinahe krampfhafte Vorsicht, was Ben anging, in einem neuen Licht zu sehen. Gordon selbst war kein geborener Aldringham, also betraf ihn der Fluch nicht. Aber dass er Angst um seinen Sohn hatte, erklärte sich nun nicht mehr nur aus dem frühen Unfalltod seiner Frau, Bens Mutter.
Charlotte nickte uns zu, dann schloss sie die Tür hinter sich und ihre Schritte entfernten sich.
Aufatmend drehte sich Ben zu mir um. »Meinst du, es ist richtig, die anderen einzuweihen?«, fragte er, während er die Arme um mich schlang.
Da musste ich nicht überlegen. »Ja. Du hast Sarah gehört. Wochenlang haben wir gesucht und nichts gefunden. Allein kommen wir nicht weiter. Und zwar nicht nur, weil Sarah das Recherche-Mastermind ist.« Ich sah ihm ins Gesicht. »Wir haben uns schon festgedacht, ein paar frische Meinungen können nur helfen.«
Ein Schauer lief durch Bens Körper und erschrocken legte ich eine Hand an seine Wange.
»Was ist?«
Er schüttelte den Kopf, aber ich konnte den Schatten in seinen Augen sehen. »Ich weiß nicht … Eigentlich sollte ich froh sein, dass wir nichts finden«, begann er zögernd. »Das müsste doch heißen, dass Dad einen an der Waffel hat und an der ganzen Sache nichts dran ist.« Dass ich darauf nicht antwortete, deutete er richtig. »Genau. Ich wünschte, ich könnte das glauben, aber dafür … dafür ist im Sommer zu viel passiert. Zu viel, wofür es keine Erklärung gibt.«
Ich war mir sicher, dass seine Gedanken genau wie meine zu dem Tag Ende August wanderten, als wir ein zappelndes Fohlen von einem Geröllfeld gerettet hatten. Vorsichtig strich ich über seine Seite, wo gerade eine angebrochene Rippe verheilt war. Er lächelte.
»Und da ist noch mehr«, flüsterte er. Er suchte meinen Blick. »Val … irgendwie weiß ich es. Natürlich sind mehr Fragen entstanden, als er mit der Geschichte beantwortet hat, aber …« Er suchte nach Worten. »Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr merkwürdige Dinge fallen mir ein. Einmal … Das ist Jahre her, damals waren wir vielleicht acht oder neun, da wollten Grayson und ich ausreiten. Ich hatte mein Pony schon fertig gemacht, als Grayson aufgefallen ist, dass der Sattelgurt zur Hälfte durchgerissen war. Wahrscheinlich wäre ich gestürzt, im besten Fall schon beim Aufsteigen, aber wenn es dumm gelaufen wäre, mitten auf den Fells im Galopp.«
Es war eine der wenigen Gelegenheiten, dass er über seine frühere Freundschaft mit Grayson sprach, doch ich hakte nicht nach. Ich wusste, dass sich die beiden entfremdet hatten, aber warum, würde er mir sicher noch erzählen. Mit den Gedanken war er sowieso schon weiter.
»Und einmal hat Henry gerade noch verhindert, dass ich ein paar Zweijährige mit Rattengift füttere.«
Verblüfft starrte ich ihn an. »Was?«
Ben nickte. »Es war keine Absicht. Natürlich nicht«, schob er grinsend hinterher, als er mein Gesicht sah. »Am Tag zuvor war die Dose mit dem Rattengift kaputtgegangen und Henry hatte es in einen leeren Behälter für Mineralfutter umgefüllt. Ich war total erkältet, sodass ich nicht gemerkt habe, dass das Pulver nicht im Geringsten nach Futter roch. Und gerade als ich es in die Raufen kippen wollte, fiel mir Henry in den Arm und nahm mir den Eimer weg.«
»Puh.« Das war wirklich eine heftige Geschichte, aber ob übernatürliche Kräfte dahintersteckten? »Solche Fehler passieren überall, Ben. Da muss es keinen Zusammenhang geben.«
Eine Weile betrachtete er mich. Es war dieser Blick, den ich mittlerweile gut kannte – so intensiv, dass ich beinahe sehen konnte, was er wahrnahm: blaue Augen, dunkle Haare, eine Nase, die direkt unter der Wurzel einen winzigen Höcker hatte. Ein Mund, der hier im Lake District immer ein bisschen röter war, als ich das von Deutschland gewohnt war. Es war, als müsse er sich mein Gesicht immer wieder von Neuem einprägen, damit er es auf keinen Fall vergaß.
»Und wenn doch?«, flüsterte er schließlich.
Ich wusste nichts zu antworten, deswegen war ich fast erleichtert, als es an der Eingangstür läutete.
Ben holte Luft und brüllte: »Kommt rein!«
Keine Sekunde später hörten wir Emmys leicht kratzige Stimme, die aber gleich verstummte.
»Wir sind im Salon!«, rief Ben Richtung Halle.
Ich grinste in mich hinein. Salon. Auf Englisch drawing room. Beim nächsten Mal durfte ich mein Stickzeug nicht vergessen.
Emmys dunkler Schopf mit den blauen Spitzen tauchte in der Tür auf. »Hey.« Sie winkte uns zu, dann wanderte ihre Augenbraue nach oben.