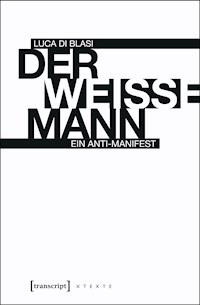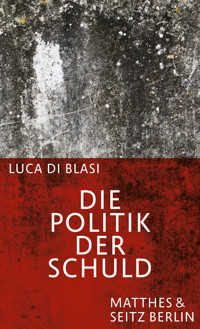
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Spätestens seit dem 7. Oktober 2023 rücken namhafte kritische Intellektuelle von der lange unumstrittenen, ja als vorbildlich erachteten deutschen Erinnerungspolitik ab. Sie sei »übergeschnappt« (Susan Neiman), von Rechten gekapert worden, habe in letzter Zeit autoritäre und identitär-ausschließende Züge angenommen – eine Entwicklung, die laut Luca Di Blasi keineswegs überraschend ist. Ihm zufolge konnte eine nach 1945 diskreditierte und unhaltbar gewordene Volksgemeinschaft im Namen der Schuld als »Tätervolksgemeinschaft« überwintern. Denn in der Rede von der »deutschen Schuld« waren nicht nur die Weichen für eine progressive, für kollektive Opfer von Diskriminierung und Verfolgung attraktive Identitätspolitik gestellt. Auch eine Alternative für ehemalige Komplizen und Mitwisser auf Täterseite schien auf: die Bewahrung einer kollektiven Identität im Namen der anerkannten Schuld. Diese »negative Identitätspolitik« wurde im Nachkriegsdeutschland wirksam. Anknüpfend an Sigmund Freuds Rekonstruktion unterschiedlicher Formen des Umgangs mit kollektiver Schuld in Judentum und Christentum zeigt Di Blasi, wie Schuldanerkennung nach 1945 zu einer neuartigen Form nationaler Identitätspolitik avancierte, – und wie wir ihre Krise überwinden können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 719
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Politik der Schuld
Luca Di Blasi
Die Politik der Schuld
Eine Durchquerung
Wieder für Johanna
Inhalt
Vorwort
Einleitung
TEIL I. VON DER ERBSÜNDE ZUR KOLLEKTIVEN SCHULD
1. Große Politik der umgewerteten Schuld (Nietzsche)
1.1 »Aktive Sünde«
1.2 Genealogie welcher Moral? Nietzsches Kratodizee-Problem
1.3 Herrenaufstand gegen die Moral
1.4 Philosophische Virologie
1.5 Große Politik der Entschuldung
1.6 Radikalisierung und Implosion
2. Eigentliche und uneigentliche Kollektivschuld (Heidegger)
2.1 Fall ohne Sünde
2.2 Schuld jenseits der Moral
2.3 Eigentliche und uneigentliche Kollektivschuld
2.4 Ursprüngliche Schuld, ursprüngliche Scham, negative Identitätspolitik
3. Die Kollektivschuld der Söhne – und ihre Folgen (Freud)
3.1 Retroaktive Schuld und ihre Gemeinschaft: Die Menschheit
3.2 Kollusive Schuld und ihre Gemeinschaft: Judentum
3.3 Konfessionale Schuld und ihre Gemeinschaft: Christentum
3.4 Die psychoanalytische Gemeinschaft als Nachfolgerin der Religionen
3.5 Freuds anti-antipatriarchale Kehre
3.6 Die psychoanalytische Gemeinschaft zwischen kollusiver und konfessionaler Schuld
TEIL II. DEUTSCHE IDENTITÄTSPOLITIK DER SCHULD
4. Nazideutschland als kollusive Schuldgemeinschaft
4.1 Mann Moses, Manns Moses, Moses Mann
4.2 Bund und Bande (Kris)
4.3 Von der Sündenbocktheorie zur deutschen Kollektivschuld (Neumann)
4.4 »Organisierte Schuld« (Arendt)
5. Anfänge einer negativen Identitätspolitik
5.1 Je m'accuse! Negative Identitätspolitik als Verschwindendes (Sartre)
5.2 »Solidarität der Schuld«: Nationalprotestantisches Schuldbekenntnis
5.3 »Deutsche Schuld« (Jaspers)
5.4 Auschwitz und die Spaltung des »Nie wieder!«
5.5 Politische und kollektive Verantwortung statt »deutscher Schuld« (Arendt)
6. Das wiedervereinigte Deutschland als konfessionale Schuldgemeinschaft
6.1 Die 68er und ihr Kampf um eine zurechenbare Unschuld
6.2 1979
6.3 Anti-Antizionismus und deutsche Schuld
6.4 Integration der Nachschuldgenerationen als Konstitution der Erinnerungsgemeinschaft
6.5 Rücksprünge zum anfänglichen Tabu: »Eure Schuld!« als kollektive Anrufung
7. Schuldpolitische Zeitenwende
7.1 Deutsche Leitkultur der Schuld
7.2 Grenzen einer westlichen Identitätspolitik der Schuld
7.3 Säkulare und postsäkulare Genealogien der Schuld
7.4 Christliche Grundlagen einer Politik der Schuld
Nachwort
Anmerkungen
Literatur
»Wenn wir sagen, daß wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.«
1 Joh 1,8–9
»All dieses Beamtenwesen und diese Sentimentalität, das ist wohl ein guter Kleister; aber es gibt noch einen besseren Kunstgriff: Bereden Sie vier Komiteemitglieder, das fünfte zu ermorden, unter dem Vorgeben, dieses sei ein Denunziant, und sofort werden Sie sie mittels des vergossenen Blutes wie mit einem Strick zusammenknoten. Sie werden Ihre Sklaven werden und nicht wagen, sich zu empören oder Rechenschaft zu fordern. Ha-ha-ha!«
Fjodor Michailowitsch Dostojewski1
»Immer wieder zu formulieren: das Schuldbekenntnis der Deutschen nach der Niederlage des Nationalsozialismus 1945 war ein famoses Verfahren, das völkische Gemeinschaftsempfinden in die Nachkriegsperiode hinüberzuretten. Das Wir zu bewahren war die Hauptsache.«
Max Horkheimer2
»Historical Reckoning Gone Haywire«
Susan Neiman3
Vorwort
Gelegentlich suchen sich Themen ihre Autoren, nicht umgekehrt. Und verraten ihnen erst allmählich und gleichsam als Entschädigung für die Mühen, warum gerade sie gewählt wurden. So ging es mir mit dem vorliegenden Buch. Mir war nicht von Anfang an klar, warum mich gerade das Thema der Schuldpolitik in den Bann gezogen hatte. Erst die Niederschrift des Buches zeigte mir, warum ich in die engere Wahl potenzieller Autoren gehört haben musste: Weil gerade Menschen meines Alters, meiner Herkunft, auch meines Geschlechts, von Fragen nicht-individueller Schuld begleitet worden waren.
In die prägenden Jahre meiner Generation fiel die Serie »Holocaust«. Sie gilt als ein Wendepunkt in der deutschen Erinnerungspolitik, weil erstmals die Perspektive der Opfer der Schoah in den Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit rückte. Die intellektuell wichtigen ersten Jahre meines Studiums in Wien fielen mit der folgenreichen Wahl Kurt Waldheims zum österreichischen Bundespräsidenten, mit dem Aufstieg eines Vorläufers des gegenwärtigen Rechtspopulismus, Jörg Haider, und mit erinnerungspolitischen Kämpfen rund um den 50. Jahrestag des sogenannten »Anschlusses« Österreichs an das »Dritte Reich« zusammen. Gleichzeitig erfolgte in Deutschland die entscheidende Weichenstellung für eine Politik der Anerkennung von Schuld, die vierzig Jahre lang in Deutschland (und mit Einschränkung im Westen überhaupt) dominierte und erst jetzt vor einem tiefgreifenden Umbruch zu stehen scheint.
Rückblickend wurde mir klar, dass schon mein Buch Der weiße Mann. Ein Anti-Manifest von 2013 indirekt von einer Politik der Schuld handelte, geschrieben aus der Position, die in besonderer Weise von intersektionellen Schuldgeschichten betroffen war. Dieses Buch stellte den Versuch dar, eine Antwort auf eine im Grunde unmögliche Positionalität der Schuld zu finden: eine Position, die sich weder in die Gemeinschaft der Minoritäten einfügen konnte noch in eine – heute offenbar dominant werdende – ressentimentale und reaktionäre Schuldabwehr drängen lassen wollte, und für die auch der Rückzug in eine ironische Distanz und Selbstinvisibilisierung zunehmend verschlossen schien.
Noch etwas hat mir die Niederschrift des vorliegenden Buchs bewusst gemacht: Die Frage der Politik der Schuld ist von religionsphilosophischen und politisch-theologischen Fragestellungen nicht zu trennen. Im (westlichen) Christentum kommt der Schuldpolitik eine grundlegende Bedeutung zu. Das vorliegende Buch bietet Ansätze zur Klärung des Verhältnisses von Schuld, Politik und Religion, die über gegenwärtige und zeitgeschichtliche Perspektiven hinausreichen.
Diese Schrift behandelt nicht nur Fragen kollektiver Schuld; mit ihrer Niederschrift habe ich mich auch individuell verschuldet, insbesondere gegenüber Johanna, die Leidtragende der unzähligen Wochenenden und Urlaubszeiten wurde, die der Arbeit an diesem Buch zum Opfer fielen. Es ist kaum zu ermessen, wie viel ärmer dieses Buch ohne die unzähligen Gespräche mit ihr und ihre Korrekturen wäre. Ihr schulde ich daher besonderen Dank. Herzlich danke ich aber auch Christoph Kerwien für seine ebenso enthusiastische wie intensive Lektüre und für viele wertvolle Anregungen. Elad Lapidot bot mir nicht nur in den schwierigen Fragen rund um Israel und den (Anti-)Antisemitismus wertvolle Orientierung. Magdalene E. Frettlöh danke ich für ermutigende Rückmeldungen aus theologischer Kennerinnenschaft. Ein herzliches Dankeschön gilt auch Beate Krethlow, David Fankhauser und Leo Pinke für wertvolle Korrekturarbeiten. Nicht zuletzt danke ich dem Verlag Matthes & Seitz Berlin für sein Vertrauen und der UniBern Forschungsstiftung sowie der Burgergemeinde Bern für großzügige Druckkostenzuschüsse.
Bern, den 23. August 2025
Einleitung
Schon vor der zweiten Wahl Donald Trumps durchzog ein tiefer Riss die westliche Welt. Auf beiden Seiten spielten und spielen Schuld und Schuldnarrative eine zentrale Rolle. Einmal ist es die Geschichte des Antisemitismus, die im Holocaust kulminierte, das andere Mal die des Kolonialismus und Rassismus. Obwohl nicht notwendig unvereinbar, sind beide Schuldgeschichten schon seit den späten 1960er-Jahren auf Kollisionskurs. Vor allem an Israel entzweien sie sich, nehmen als israelbezogener Anti-Antisemitismus und israelbezogener Antikolonialismus Gestalt an und wenden sich gegeneinander.
In Deutschland zeigte sich dies in einer Serie zunehmend schärferer Konflikte: Der Anti-BDS-Beschluss des Bundestags 2019, die Achille-Mbembe-Debatte 2020, der zweite Historikerstreit 2021, die Antisemitismusdebatte der documenta fifteen 2022 und die vielen Zerwürfnisse, die auf den 7. Oktober 2023 folgten, einschließlich jener um die 74. Berlinale 2024. Dass gerade in Deutschland diese Konflikte in besonderer Schärfe ausgetragen werden, ist kein Zufall. Die Ende der 1980er-Jahre etablierte deutsche Gedenkgemeinschaft wurde im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte immer enger mit Israel verschränkt. Im Zuge dessen erschien eine in Westdeutschland von Anfang an bestehende Solidarität mit Israel nicht nur als (rechtlicher Bindung entzogenes) Staatsinteresse (»Staatsräson«), sondern auch als Lehre aus der deutschen Geschichte. Der Postkolonialismus wiederum trug zur gleichen Zeit dazu bei, dass das öffentliche Bewusstsein für die deutsche koloniale Schuld deutlich wuchs. Und eine Leugnung oder Relativierung dieser Schuld verstieße gerade hier gegen eine grundlegende »Lehre aus der Geschichte«: das Postulat des Erinnerns, der Anerkennung der Schuld. Der gleiche Postkolonialismus aber wirft auch negatives Licht auf Israel und den Zionismus. Und in diesem Moment konfligiert er mit einer unbedingten Solidarität mit Israel.
Dieser Riss, der die Politik der Anerkennung von Schuld durchzieht, wird zum Einfallstor für eine andere, fundamentalere schuldpolitische Spaltung: für eine Kaperung durch eine geschichtsrevisionistische Rechte, die von (eigener) Schuld nicht mehr viel wissen will. Dieser andere Riss bewegt sich nicht innerhalb einer Schuldanerkennung, sondern spaltet den politischen Umgang mit Schuld in zwei grundsätzliche Formen: Schuldanerkennung und Schuldleugnung. Dieser Gegensatz steht hinter zwei Gegenwartstendenzen, die seit den 1980er-Jahren deutlicher erkennbar geworden sind und die man mit Begriffen wie (kulturelle) Linke und Rechtspopulismus oder, neuerdings, »Wokismus« und »libertärer Autoritarismus« bezeichnen kann. Und wenn nicht alles trügt, werden wir gerade Zeitgenossen eines epochalen Umschlags: Je angefochtener die westliche Machtstellung in der Welt wird, umso mehr schwindet die Bereitschaft, eigene vergangene Schuld anzuerkennen. Die zweite Wahl Donald Trumps steht, mehr als die erste, auch für eine schuldpolitische Zeitenwende: Die jahrzehntelang marginalisierte und verworfene Leugnung westlicher kollektiver Schuld gewinnt wieder an Boden und beginnt, etablierte und routinierte Formen schuldpolitischer Anerkennung in die Defensive zu drängen.
Auch dieser zweite Riss zeigt sich in Deutschland in besonderer Weise. Eine immer engere Verschränkung von Antisemitismus und Kritik an der Politik des Staates Israel1 ermöglicht auch die 2004 verfasste und kurz nach dem Höhepunkt der »Flüchtlingskrise« 2016 von der zwischenstaatlichen Organisation »International Holocaust Remembrance Alliance« angenommene IHRA-Antisemitismus-Definition. Diese konnte auch als ein legitim erscheinender Hebel zur Regulierung von Einbürgerungen und Aufenthalten muslimischer Migrantinnen fungieren. Genau das haben deutsche Rechtspopulistinnen schnell begriffen. Die gleiche »deutsche Schuld«, in deren Namen sie selbst aus der deutschen Erinnerungsgemeinschaft ausgeschlossen blieben, wurde von ihnen spätestens 2018 als Instrument gegen eingewanderte Muslime (»importierter Antisemitismus«) und einen »linken Postkolonialismus« entdeckt. Und es war die AfD, die seitdem den Kampf gegen einen »israelbezogenen Antisemitismus« forcierte. Mit dieser unausgesprochenen neuen erinnerungspolitischen Querfront bröckelt in Deutschland ein tragendes Element der »Brandmauer nach rechts«. Die Richtung dieser Entwicklung wurde dabei immer deutlicher: Im Namen der deutschen Geschichte würde sich eine neue deutsche Leitkultur bilden unter Einschluss der Rechtspopulistinnen und dem Ausschluss israelkritischer Kräfte, zu denen insbesondere Muslime, aber auch viele Jüdinnen gehören.
Angesichts dessen sprach Mathieu von Rohr von einer »neuartige[n] Form deutscher Identitätspolitik«.2 Das ist nicht ganz falsch, aber doch nur die halbe Wahrheit. In der Tendenz einer identitären Schließung kommt die deutsche Erinnerungskultur nämlich zugleich auch zu sich selbst. Eine identitäre Dimension war der Anerkennung »deutscher Schuld« stets zu eigen, – weshalb ich, um diese nationalidentitäre Dimension sichtbar zu machen und nicht unkritisch zu reproduzieren, diese Wendung konsequent in Anführungszeichen schreibe. Die Anerkennung der Schuld als Mittel der Bewahrung der Volksgemeinschaft bildete das verborgene, gleichsam blutige Komplement zum »blutlosen« Verfassungspatriotismus.3 Um diese Dimension zu erfassen, ist eine grundlegende Beschäftigung mit einer Politik der Schuld notwendig. Ihr widmet sich das vorliegende Buch.
Die deutsche Identitätspolitik nach 1945 bildete sich in der Dialektik aus Ablehnung und allmählicher Anerkennung einer Schuld des nationalsozialistischen Deutschlands, die im Holocaust kulminierte. Diese Dialektik zeigt sich deutlich anhand der Spannung zwischen zwei verwandten Begriffen: Während der Begriff der »deutschen Schuld« allmählich affirmiert wurde, wurde der ursprünglichere Begriff der »deutschen Kollektivschuld« von Anfang an leidenschaftlich abgelehnt. Letzterem haftet bis heute der Ruch eines Vorwurfs von außen an. Tatsächlich aber war die »deutsche Kollektivschuld« zunächst eine deskriptive Kategorie, mit der kurz nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion und dem Beginn der Schoah versucht wurde, die ungeheuerlichen Dimensionen der nazideutschen Verbrechen zu begreifen.
Dieser Begriff der Kollektivschuld wiederum lässt sich auf Sigmund Freud zurückführen. Freud entwickelte ihn im Versuch, sowohl die Selbstkonstitution der Menschheit als auch die Religionsgeschichte zu verstehen. Der Kollektivschuldbegriff wurzelt in einem Versuch der »Säkularisierung«, der Übersetzung biblischer Narrative in eine quasiwissenschaftliche Sprache. Dabei zeigt sich mit besonderer Deutlichkeit, dass ein politisch relevanter Begriff des 20. Jahrhunderts, der der Kollektivschuld, auf einer Säkularisierung biblischer und christlicher Erzählungen beruht. Das ist insofern nicht verwunderlich, als die Erbbeziehungsweise Ursündenlehre gerade in der (west-)christlichen, also augustinisch-lutherischen Tradition, eine Schuld entwarf, die nicht auf den Einzelnen beschränkt bleibt, sondern Generationen, ja die gesamte postlapsarische Menschheit miteinander verstrickt. Moderne Konzepte der kollektiven Schuld sind eng an den Erbsündenbegriff angelehnt und können als Produkt seiner Säkularisierung verstanden werden. Dabei stellt sich die grundsätzliche Frage, was sich ändert, wenn die theologischen Voraussetzungen dieser kollektiven »Erbsünde« verschwinden.
Diese Frage untersuche ich im ersten Hauptteil des Buches anhand dreier säkularer Schuldpolitiken. Alle drei Ansätze können als unterschiedliche Übersetzungen der Erbsündenlehre und zugleich als postchristliche, atheistische Rechtfertigungslehren verstanden werden, sowie als drei unterschiedliche Weisen, mit Schuld und schuldpolitischen Widersprüchen umzugehen. Äußerst zugespitzt lauten sie: Überwindung der Schuld im Namen ihrer Umwertung; Anerkennung der Unüberwindbarkeit der Schuld; Anerkennung der Ambivalenz der Schuld.
Der erste Ansatz kann als Rechtfertigung durch Umwertung der biblischen Werte und der Schuld beschrieben werden. Er wird nach der Gründung des Deutschen Reichs 1871 entwickelt. Mit der sprunghaft gewachsenen staatlichen Macht Deutschlands wurde hier ein schuldpolitischer Widerspruch zwischen christlich-protestantischem Selbstverständnis und neuer Machtpolitik, zwischen Rückzug in eine »machtgeschützte Innerlichkeit« (Thomas Mann) und der realpolitischen Anpassung an kolonialistische, imperialistische Erfordernisse zu einer schwer erträglichen kognitiven Dissonanz gesteigert.
Vor diesem Hintergrund kann Friedrich Nietzsches Denken, schuldpolitisch betrachtet, als radikaler Versuch verstanden werden, »sich ehrlich zu machen«, indem die Unaufrichtigkeit, die kulturprotestantisch-liberalen Vermittlungen anhaftete, konsequent überwunden werden sollte: durch eine Bejahung des Willens zur Macht, die mit einer Umwertung und Bejahung dessen einherging, was biblischchristlich als Schuld verstanden worden war. Dieses Projekt basiert von Anfang an auf dem Versuch der Abwertung und schließlich Bekämpfung eines »semitisch-priesterlichen« Sündenbegriffs und einer daraus folgenden ressentimentalen »Sklavenmoral« zugunsten einer Rechtfertigung der Sünde, ihrer Umdeutung und Umwertung zu einem tragisch-heroischen Frevel und einer herrenmoralischen und dann über-menschlichen Rechtfertigung des Lebens (Kap. 1).
Mit der Niederlage des Deutschen Reichs im Ersten Weltkrieg taucht ein Entwurf auf, der im Ausgangspunkt entgegengesetzt, in seinen Konsequenzen aber nicht unähnlich ist. Er besteht in der konsequenten Akzeptanz der Schuld. Martin Heidegger ist ihr klarster Exponent. Statt die Widersprüche durch umwertende Rechtfertigung (und das heißt auch: Verneinung des biblischen Verständnisses) der Sünde zu überwinden, geht es hier gerade umgekehrt um eine postprotestantische Anerkennung der Unvermeidbarkeit einer Schuld, die, analog zum theologischen Verständnis der Sünde, der moralischen Schuld noch zugrunde liegt und von Heidegger als existenzielle Schuld verstanden wird. Auch Heidegger verlässt, wie Nietzsche, den biblischchristlichen Horizont, weil der Glaubenshorizont einer Rechtfertigung durch Gnade verschwindet. Auf dieser Grundlage kann eine bereits im westlichen Christentum radikalisierte Lehre der Erbsünde, wonach der Mensch nach dem Sündenfall nicht nicht sündigen kann, noch einmal radikalisiert werden: Weil Heidegger nämlich mit dem biblischen Horizont die Möglichkeit einer anfänglichen Unschuld und einer eschatologischen Überwindung der Sünde verlässt, kann Schuld nicht überwunden werden. Damit aber verwandelt sie sich in eine tragische oder existenzielle Schuld, und wenn diese anerkannt wird, in eine heroische oder »eigentliche« Schuld. Somit rückt Heidegger, gleichsam von der anderen Seite, in die Nähe Nietzsches. Der eigentlichen steht eine uneigentliche, nicht anerkannte existenzielle Schuld gegenüber. Im apokalyptischen Licht der totalen Niederlage Deutschlands 1945 wendet Heidegger, ein einziges Mal, diese Unterscheidung auf das deutsche Volk an und differenziert zwischen einer eigentlichen Kollektivschuld und einer uneigentlichen Kollektivschuld, die er, analog zur uneigentlichen Schuld, als Anpassung an ein »großes Man« deutet.
Heideggers Ansatz überschreitet eine westchristliche Tradition durch ihre Radikalisierung und beerbt damit eine in dieser Tradition erkennbare (Über-)Betonung der Sünde und der Schuld. Gewichtet man demgegenüber die Scham höher, gelangt man (bei Sartre) nicht nur zu einer (Identitäts-)Politik der Opfer, sondern zu Ansätzen einer negativen Identitätspolitik der Täter beziehungsweise Verstrickten, Ansätzen, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland wirksam wurden (Kap. 2).
Generationell und konzeptionell zwischen diesen postchristlichen Rechtfertigungslehren der Schuld steht eine dritte, wirkmächtige Möglichkeit: Sigmund Freuds Psychoanalyse. Freuds Ansatz besteht darin, die Ambivalenz selbst in konsequenter Weise anzuerkennen, das vitalistische Aufbegehren gegen Schuld – und ihre Anerkennung. Diese Ambivalenz lässt sich wissenssoziologisch betrachtet mit der Situation eines (groß-)bürgerlichen, assimilierten westeuropäischen Judentums in den Jahrzehnten um 1900 in Verbindung bringen. Hier bestand eine Ambivalenz zwischen sozioökonomischem Aufstieg und wachsender Gefährdung, zwischen Täterposition (als vermeintliche kapitalistische »Ausbeuterinnen«, als allmählich Einheimische verdrängende Zionisten in Palästina) und Opferposition (Opfer eines erstarkenden Antisemitismus, einer immer bedrohlicheren Verfolgung und schließlich, kurz nach Freuds Tod, Vernichtungspolitik), zwischen »revolutionärer«, entlarvender Aufdeckung einer moralischen Schuld der Väter (bei Freud artikulierte sich das in seiner frühen sogenannten »Verführungstheorie«) und einer »konservativen«, anti-antipatriarchalen Verdeckung dieser Schuld durch ihre Umwandlung in eine tragische Schuld der Söhne (»Ödipuskomplex«). Die gemeinschaftsstiftende Dimension der Schuld wird in der Selbstkonstitution der psychoanalytischen Gemeinschaft selbst erkennbar.
Wie bei Nietzsche und Heidegger, so ist auch beim (späteren) Freud der säkularisierende Bezug zur alttestamentlichen Überlieferung von zentraler Bedeutung. Er unterschied zwei Formen einer Gemeinschaftsbildung durch Schuld, die er eng mit der Menschheits- und Religionsgeschichte verband: Das biblische Judentum verstand er als Gemeinschaftsbildung durch Komplizenschaft (Bund), als Folge eines kollektiv verübten, aber uneingestandenen und verdrängten Verbrechens (an Moses), somit als Konsequenz einer Kollektivschuld der Söhne. Das Christentum dagegen stellte für ihn eine Gemeinschaftsbildung durch Konfession eines noch grundlegenderen, gemeinsamen Urverbrechens (am Urhordenvater) durch ein gemeinsames, öffentliches Schuldbekenntnis dar.
Ich werde die gemeinschaftsstiftende, uneingestandene, geleugnete Schuld als kollusive Schuld (von collusio, geheimes Einverständnis) bezeichnen und die daraus entstehende Gemeinschaft entsprechend kollusive Schuldgemeinschaft nennen. Als uneingestandene Schuld ist sie fühlbar, in Gestalt von Schuldgefühlen, aber nicht (mehr) erkennbar, man kann nicht (mehr) von einem Schuldbewusstsein reden. Hierin unterscheidet sich die kollusive Schuldgemeinschaft von einer Gemeinschaftsbildung durch Schuldbekenntnis, die ich als konfessional bezeichne. Im Schuldbekenntnis wird das Schuldgefühl bekannt, bekannt gemacht, also auch (wieder) bewusst gemacht. Die konfessionale Schuld bekennt und erkennt damit eine Schuld, die in der kollusiven Gemeinschaft geleugnet und nur gefühlt bleibt.4
Bei Freud wirken diese beiden Formen der Schuldvergemeinschaftung nicht nur religionsbildend, sondern bringen jeweils archetypischen Religionsgemeinschaften hervor, Judentum und Christentum. Beide basieren nach ihm auf einer urmenschlichen »Schuld« (Mord des Urvaters, »Ödipuskomplex«), Freuds säkulares Pendant zum Sündenfall. Ich setze diese Schuld in Anführungszeichen, denn von einer solchen kann nur rückwirkend gesprochen werden. Diese stiftende Urschuld kann als »retroaktive Schuld« bezeichnet werden (Kap. 3). Freud kommt das Verdienst zu, diese unterschiedlichen Formen kollektiver und Kollektive stiftender Schuldarten sowie ihre vormoralischen und gewissermaßen vormenschlichen Voraussetzungen erkannt zu haben. Die Psychoanalyse ermöglicht es, die kollusive Schuld als Wiederholung einer retroaktiven und als Voraussetzung einer konfessionalen Schuld zu konzeptualisieren.
Nietzsche, Heidegger und Freud stehen für drei Versuche, auf der Grundlage des Bruchs mit der biblisch-christlichen Tradition, aber gerade deswegen nicht unabhängig von ihr, den Begriff der Schuld neu zu denken und auf Kollektive anzuwenden. Die Ansätze Nietzsches und Heideggers sind philosophisch grundlegender, Freuds Ansatz aber wurde gesellschaftlich und auch politisch wirksamer. An ihm lässt sich besser zeigen, wie die Säkularisierung biblischer Narrative und eine säkulare Deutung der Religionsgeschichte auf die damals gegenwärtigen politischen Verhältnisse übertragen wurde und dann auch im Selbstverständnis Nachkriegsdeutschlands wirksam blieb.
Meine in diesem Buch vorgeschlagene Deutung verdankt Sigmund Freud wichtige Einsichten. Ich unterscheide mich von ihm darin, dass ich die Politik der Schuld postsäkular denke, nicht, wie Freud, säkularistisch. Freud dachte die Politik der Schuld als eine Abfolge von Schuldgemeinschaften: Am Beginn steht eine nur retroaktiv als solche zu bezeichnende Menschheitsschuldgemeinschaft; ihr folgt eine jüdische (»kollusive«) Schuldgemeinschaft; diese bildet die Voraussetzung für eine christliche (»konfessionale«) Schuldgemeinschaft, wobei es erst die säkulare Psychoanalyse ist, die diese religionsgeschichtliche Abfolge von religiösen Schuldgemeinschaften erkennt – und partiell überwindet.
Von Freuds säkularer Linearisierung unterscheidet sich mein Ansatz darin, dass er nicht von einem Urmord oder Urverbrechen ausgeht und das Verhältnis zwischen kollusiver und konfessionaler Schuldgemeinschaft deutlicher als das einer wechselseitigen Abhängigkeit betrachtet: So wie die kollusive Schuld als Voraussetzung einer Schuldanerkennung verstanden werden muss, hat die kollektive Schuldanerkennung die Tendenz, in eine neue kollusive Schuldgemeinschaft zu kippen, und zwar gerade dann, wenn die Überwindung einer kollusiven Schuld vollzogen zu sein scheint. Was bekannt und anerkannt war, kann auch wieder geleugnet und tabuisiert werden.5
Der zweite Hauptteil des Buches konzentriert sich auf den Archetyp einer Nationalisierung kollektiver Schuld und das Umschlagen von einer kollusiven in eine konfessionale Schuldgemeinschaft, die aber gerade in ihrer Vollendung wieder Züge einer kollusiven Schuldgemeinschaft erhält: Deutschland.
Hier zeigt sich der direkte Einfluss Freuds daran, dass das, was eine kollusive Kollektivschuld genannt werden kann, bei frühen intellektuellen Anstrengungen, die nationalsozialistischen Verbrechen zu verstehen, eine zentrale Rolle spielte. Schon kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde diese Form der Gemeinschaftsbildung durch Schuld auf Nazideutschland übertragen, und zwar durch Thomas Mann ebenso wie durch den Freud-Schüler Ernst Kris. Die nationalsozialistische Judenverfolgung und -vernichtung wurde als bewusste Stiftung eines Schuldkollektivs gedeutet, als eine Vergemeinschaftung des deutschen Volkes durch das, was Hannah Arendt eine »organisierte Schuld« nannte.6
Gerade wegen des Freud'schen Ursprungs blieb hier allerdings eine spezifische Unklarheit vorhanden. In seinem letzten Buch hatte Freud die auf einem uneingestandenen Verbrechen beruhende Gemeinschaft mit dem Judentum verbunden. Jetzt konnte genau dies für das Verständnis der nazideutschen Volksgemeinschaft herangezogen werden, deren größte Opfergruppe Juden waren. Damit rückten biblisches Judentum und die antisemitische nazideutsche Volksgemeinschaft beklemmend nahe aneinander. Oder anders gesagt: In entsprechenden Deutungen Nazideutschlands wurden die Interpreten und Interpretinnen in peinlicher Weise mit negativen Ansichten und Stereotypen des Alten Testaments und des biblischen Judentums konfrontiert. Diese frühen Versuche, Nazideutschland mit Freud'schen Mitteln zu deuten, sind entsprechend nicht frei vom Bemühen, den Unterschied zwischen einer kollusiven und einer konfessionalen Schuldgemeinschaft zu verunklaren. Das schwächt diese Deutungen (Kap. 4).
Die Entwicklung Nachkriegsdeutschlands kann als Transformation einer kollusiven in eine konfessionale Schuldgemeinschaft verstanden werden, genauer: als Nationalisierung einer konfessionalen Schuldgemeinschaft, als Bewahrung eines nationalen Wir qua Bekenntnis einer gemeinsamen, einer »deutschen Schuld«. Ich spreche hierbei auch von einer negativen Identitätspolitik. Die deutsche Volksgemeinschaft bewahrte sich in der Dialektik aus Widerstand (»Leugnung«) gegen eine Kollektivschuld und ihrer Anerkennung. Die Grundthese lautet, dass nach 1945 die gemeinsame Schuldübernahme zu einem Mittel wurde, eine vormals ethnisch und rassistisch verstandene Volksgemeinschaft auf konfessionaler Grundlage zu erneuern und zu erhalten. Weil diese Art der Gemeinschaftsstiftung einem christlichen Skript folgte, lässt sich schon Nachkriegsdeutschland rückblickend als ein Projekt verstehen, das sich selbst säkular versteht, das aber in seiner verborgenen Grundlage eine strukturell christliche Dimension aufweist. Die Bundesrepublik hat hierin Ähnlichkeit mit dem fast gleichzeitig gegründeten Staat Israel, bei dem ein säkulares Selbstverständnis auf einer biblisch-alttestamentlichen Grundlage (Landverheißung) beruhte.7
Charakteristisch für die konfessionale Schuldgemeinschaft ist eine Dreiteilung: Wir alle sind schuldig, sind Täterinnen (diese »Solidargemeinschaft der Schuld« meine ich, wenn ich von Tätervolksgemeinschaft rede); die anderen sind unschuldige Opfer und gehören deswegen im Grunde nicht zu uns; aber auch jene von uns, die diese Schuld nicht, wie wir (Geständnisgemeinschaft) bekennen (können) und leugnen, werden ausgeschlossen. Nach den Haupttätern werden allmählich die Leugnerinnen zu den eigentlichen Schuldigen, die wir opfern, aus unseren Reihen ausschließen, mit Kontaktverbot belegen, um damit unsere Reue unter Beweis zu stellen. Und indem wir sie ausschließen, dieses Opfer an uns (Tätervolksgemeinschaft) vollziehen, fühlen wir (Geständnisgemeinschaft) uns gereinigt.
Diese negative Form einer kollektiven Identitätsbewahrung beschränkt sich nicht auf Westdeutschland. Sie konnte auch über die Grenzen Deutschlands hinaus nach 1945 deswegen erfolgreich werden, weil sie auf einem christlichen Denkmuster beruht, das in der säkularen westlichen Welt wirksam bleibt: einer Dreiteilung in »Christen«, die eine gemeinsame Schuld (Israels beziehungsweise der Menschheit) bekennen, »Juden«, die diese gemeinsame Schuld kennen müssten, aber nicht bekennen, und jene, die als Menschen in der gemeinsamen Schuld einbegriffen sind, die aber als »Völker« oder »Heiden« nicht in gleicher Weise unter dem Gesetz und damit »in der Schuld« stehen und in diesem Sinne unwissend schuldig sind. Dieses judenkritische Muster konnte sich ausgerechnet nach der beinahe vollständigen Vernichtung des europäischen Judentums genau deswegen reproduzieren, weil es nun als Anti-Antisemitismus wirksam wurde: Nun waren es nämlich gerade die »Nazis« und Antisemiten, die als »ewiggestrige« Schuldleugner in die Position der (in den Augen der Christen) schuldleugnenden Juden gerieten, (während die Juden als Opfer in die Position der quasi unschuldigen Heiden rückten, zu idealisierten Figuren einer philosemitischen Projektion wurden). Im Schutz des Anti-Antisemitismus konnte sich damit eine klassisch antijüdische Struktur der Vergemeinschaftung reproduzieren.
Drei Etappen dieser konfessional-nationalen Schuldgemeinschaft können rückblickend unterschieden werden. Am Anfang steht der Versuch im Zentrum, durch eine »Solidarität der Schuld« (Stuttgarter Schulderklärung, 1945) die nazideutsche Volksgemeinschaft (ausgenommen die unmittelbar verantwortliche Naziführung) vollständig in eine Tätervolksgemeinschaft zu überführen, qua Internalisierung einer kollektiven Interpellation vonseiten der alliierten Siegermächte (»Eure Schuld!«) und Nationalisierung kollektiver Schuldgefühle. Auch Karl Jaspers betonte, trotz relevanter Nuancen, eine nationale Dimension der Schuld. Das unterschied ihn von Hannah Arendt, die schon früh und sehr deutlich in den 1960er-Jahren eine Denationalisierung der Schuld und die Bedeutung einer kollektiven Verantwortung unterstrich.
Etwas Analoges wiederholte sich auch mit dem Begriff »Auschwitz« und im Eindruck der Auschwitz-Prozesse. Theodor W. Adorno dachte Auschwitz als Ausdruck eines konkreten nationalsozialistischen Menschheitsverbrechens und als allgemeinen Ausdruck für Völkermord und Tortur. Die daraus resultierende Pflicht (»Nie wieder Auschwitz!«) bewahrt eine universalistische Dimension und kann nur deswegen als ein neuer kategorischer Imperativ verstanden werden. Bei Martin Walser dagegen wird, zur gleichen Zeit, Auschwitz nationalisiert (»Unser Auschwitz«).8 Genau hier, vis-à-vis dem sich anbahnenden Bruch der nach 1945 Geborenen (»68er-Generation«) mit ihren schuldigen Vätern, also angesichts der Möglichkeit des Zerbrechens einer nationalen Solidarität der Schuld, wird die Tätervolksgemeinschaft auf den Begriff gebracht9 (Kap. 5).
Nach Versuchen, der deutschen Verfassung patriotische Emotionen zu entlocken (»Verfassungspatriotismus«), gelingt Jürgen Habermas, was seinem Generationsgenossen Walser misslungen war: eine Integration der Nachschuldgenerationen in das deutsche Schuldgeschick. Dies wurde ermöglicht durch den Ausschluss jener, die die Schuld leugneten oder ihre Singularität relativierten. Mitte der 1980er-Jahre bestand eine zentrale, aber nicht immer bedachte Leistung des ersten Historikerstreits darin, die 1968er (und potenziell alle folgenden Nachschuldgenerationen) in eine kurz darauf zur gesamtdeutschen Erinnerungsgemeinschaft transformierten und erweiterten Geständnisgemeinschaft zu integrieren. In ihr Zentrum rückt mit der Singularität des Holocaust ein unbestimmt zwischen säkular und sakral verortetes »säkrales« Ereignis. Als gleichsam absolutes Ereignis kann es nicht überwunden werden und stützt insofern den Übergang von Vergangenheitsbewältigung in Vergangenheitsbewahrung. Mit diesem Schritt war die Nationalisierung einer konfessionalen Schuldgemeinschaft abgeschlossen. Diese gesamtdeutsche Erinnerungsgemeinschaft wird Ende des 20. Jahrhunderts mit der Entscheidung zum Bau des Holocaust-Mahnmals in Berlin symbolisch vollendet (Kap. 6).
Als die vorerst letzten Etappen dieser Entwicklung fallen Vollendung der konfessionalen Schuldgemeinschaft und ihr Kippen in eine neue Form der kollusiven Schuldgemeinschaft zusammen. Hier artikuliert sich in einer spezifischen Weise eine Spaltung, die den gesamten Westen durchzieht und die prinzipiell als Spannung zwischen kollusiver und konfessionaler Schuld verstanden werden kann: als Spannung zwischen einer exzessiv gewordenen Betonung der Schuldanerkennung auf der einen Seite, und der, auch dagegen gerichteten, immer deutlicheren Tendenz der Schuldabwehr im erstarkten Rechtspopulismus auf der anderen Seite. Diese rechtspopulistische Schuldabwehr zeigt sich, wie bereits angedeutet, nicht offen, sondern verbirgt sich hinter einer Form, die mit einer Schuldanerkennung scheinbar kompatibel ist: einem vom Holocaust orientierten Anti-Antisemitismus, und, daraus abgeleitet, einem unbedingten Schutz Israels. Sie verbirgt sich also hinter einer der beiden Seiten einer Spannung, die den gesamten Westen durchzieht und sich als israelbezogener Anti-Antisemitismus und israelbezogener Postkolonialismus artikuliert.
Die Ursprünge dieser Spannung gehen, nicht nur in Deutschland, zurück auf eine Spaltung nach dem Sechstagekrieg 1967. Einer nun zumeist israelkritischen, antiimperialistischen Neuen Linken stand eine prononciert antilinke Israelsolidarität gegenüber. Diese begann in Deutschland Ende der 1970er-Jahre von der Linken selbst internalisiert zu werden, in Gestalt einer linken Selbstkritik. Im Zuge der Wiedervereinigung wurde sie von den sogenannten Antideutschen radikalisiert, in Gestalt einer Verbindung von einer schwer überbietbaren Betonung »deutscher Schuld« und einer ebenso extremistischen, nämlich vorbehaltlosen »Solidarität mit Israel«. Was zunächst als Randposition einer kleinen Gruppe politischer Sektierer erschien, rückte seitdem mehr und mehr in die Mitte der deutschen Gedenkkultur.
So wie Teile der radikalen Linken nach 1967 qua unbedingter Solidarisierung mit den Palästinensern in einen linken Antisemitismus abrutschten, in eine neue Schuld, so ist es jetzt genau umgekehrt: Es ist tragischerweise eine geschichtlich verständliche Solidarisierung mit Israel, die das politische Deutschland qua Waffenlieferung und politischer Unterstützung in eine Komplizenschaft mit einer Politik geführt hat, die in eine Zerstörung Gazas und zum Tod zehntausender Unschuldiger führte. Anerkennung eigener geschichtlicher und Relativierung gegenwärtiger Komplizenschaft mit schwersten Verbrechen verschränken sich hier. Schuldanerkennung und Schuldleugnung stehen sich also nicht einfach gegenüber, wir haben nicht einfach hier die Bekennenden und dort die Leugnenden; vielmehr scheint die Leugnung oder Relativierung der Schuld Israels gerade die letzte Konsequenz der Anerkennung eigener Schuld zu sein.
Unter diesen Umständen geraten Positionen, die die Spannung zwischen israelbezogenem Anti-Antisemitismus und israelbezogenem Antikolonialismus »multidirektional« (Michael Rothberg10) zu entkräften beziehungsweise durch eine auf den gesamten Westen übertragene, konfessionale Identitätspolitik der Schuld auszudehnen versuchten (Dirk Moses11), zwischen die Fronten.
Weil diese Spaltung Einfallstor für eine neue Leugnung der Schuld sein kann, muss diese genauer untersucht werden. Im Gegensatz von kolonialer und antisemitischer Schuld wird ein westliches Selbstverständnis verhandelt. Auf der einen Seite steht eine westliche Perspektive, die im Holocaust einen Zivilisationsbruch innerhalb einer affirmierten Geschichte der Aufklärung und Säkularisierung erkennt. Auf der anderen Seite wird die gesamte westliche, säkulare Neuzeit einer postkolonialen Revision unterzogen. Beide widerstreitenden Narrative, säkulare und postsäkulare, aufklärerische und postkoloniale, können sich darin einig werden, im (westlichen) Christentum die gemeinsame Quelle großer schuldpolitischer Geschichten zu finden, des Antisemitismus ebenso wie des Kolonialismus. Dieser Blickrichtung folgend werde ich mich abschließend dem Christentum zuwenden.
Wiederanknüpfend an einen Gedanken Freuds möchte ich anhand des zentralen schuldpolitischen Ereignisses, der Kreuzigung Jesu, die Dialektik aus Schuldanerkennung einer gemeinsamen Schuld und Beschuldigung jener, die diese Schuldanerkennung nicht vollziehen, untersuchen – wie also konfessionale in kollusive Schuldpolitik kippt. Die Analyse der vielleicht frühestmöglichen christlichen Unterscheidung von Christen und Juden (artikuliert in der Jesus-Barabbas-Wahl) macht es möglich, einerseits die Unvermeidbarkeit dieser Trennung und Auseinandersetzung zwischen schuldbekennenden Christen und – in ihren Augen – schuldleugnenden Juden zu erkennen und anzuerkennen. Andererseits lässt sich hier nachvollziehen, dass die retroaktive Einschreibung dieser Unterscheidung in die Evangelien eine verhängnisvolle Verschärfung des Konflikts zur Folge hatte und nicht unvermeidlich war.
Erkennt man, wie hier die politische Verschärfung erfolgte, dann wird es auch möglich, die uralte und verhängnisvolle Beschuldigung der Juden als Christus- und Gottesmörder in ihrer Wurzel zu überwinden, ohne in eine neue Beschuldigung (der frühen Christen) zu verfallen und um nicht eine Beschuldigung durch eine andere, einen Antijudaismus durch ein potenzielles Antichristentum, zu ersetzen. Das christliche Paradigma einer Politik der Schuld und ihrer Gefahren kann damit auch zu einem Paradigma ihrer Überwindung werden.
TEIL I.VON DER ERBSÜNDE ZURKOLLEKTIVEN SCHULD
Der Begriff der Sünde ist für das Verständnis einer Politik der Schuld von großer Bedeutung. Er ist das unter anderem deswegen, weil sich im Begriff des Sündenfalls wie in jenem der Erbsünde eine »individuell zurechenbare« und eine »kollektive« Schuld, die Schuld eines Einzelnen und die Schuld der Gattung so verbinden, dass der Sündenbegriff von Anfang an zwischen Individuum und Kollektiv angesiedelt ist, zwischen »Moral« und »Sittlichkeit«, und damit auch zwischen Moral und Politik.
Das Problem ist aber komplizierter, da der Sündenbegriff auf Gott ausgerichtet und damit von Anfang an auch zwischen Moral und Trans- oder Amoralität angesiedelt ist. Das gilt schon für die Erzählung des Sündenfalls, in der sich in paradoxer Weise eine protomoralische, das heißt nicht intentionale Handlung (Übertretung eines Verbotes) mit der Konstitution oder Stiftung der Bedingungen von Moral (Erkenntnis von gut und böse) verbinden. Dieser protomoralischen Stiftung von Moral steht eine, christlich betrachtet, transmoralische Überwindung der Sünde durch Gnade gegenüber. Der Sündenbegriff ist, gerade in seiner westchristlichen, also augustinisch-lutherischen Herausarbeitung, von einer transmoralischen Perspektive her entfaltet worden, der Gnade. Wenn wir eine säkulare Politik der Schuld untersuchen, fragen wir entsprechend danach, was »Säkularisierung« eines transmoralischen Sündenverständnisses bedeuten kann.
In seinem Text »Das transmoralische Gewissen«1 hat der Theologe Paul Tillich nach dem Zweiten Weltkrieg (und angesichts dieser politisch-moralischen Katastrophe) versucht, so etwas wie eine Genealogie eines Gewissensbegriffs zu skizzieren, die für unsere Fragestellung erhellend ist. Wie viele interessante Texte wird auch dieser von einer zutiefst unheimlichen Frage angetrieben. Sie entspringt folgendem Syllogismus:
Bei Luther habe eine Entkopplung von Gewissen und Moral stattgefunden. Man könne, schreibt Tillich, mit dem Wort »transmoralisch« ein Gewissen bezeichnen, das nicht aus Gehorsam gegenüber einem moralischen Gesetz urteilt, sondern aufgrund der Partizipation an einer Wirklichkeit, die den Bereich moralischer Gebote transzendiere. »Rechtfertigung durch Gnade« im Sinne Luthers bedeute die Schöpfung eines transmoralischen Gewissens. Während Gott in der Anfechtung der Ankläger sei und unser Herz sich zu entschuldigen trachte, klage uns in der Rechtfertigung unser Herz an, und Gott verteidige uns gegen uns selber. In psychologischen Begriffen bedeute dies: Insoweit wir auf uns selbst sehen, müssten wir ein verzweifeltes Gewissen bekommen, insoweit wir auf die Macht einer neuen Schöpfung jenseits unserer selbst sehen, könnten wir ein fröhliches Gewissen erlangen.2
In einem zweiten Schritt stellt Tillich die Frage, ob nicht auch noch Nietzsche und Heidegger in dieser protestantischen Tradition zu verorten seien. Auch sie hätten nämlich in konsequenter Weise Gewissen und Moral voneinander entkoppelt. Nietzsche habe ein transmoralisches Gewissen nicht auf der Grundlage einer paradoxen Einheit mit Gott (wie Luther), sondern »auf der Grundlage einer enthusiastischen Einheit mit dem Leben in seiner schöpferischen und zerstörerischen Macht«3 entwickelt. Bei Heidegger bestehe das gute, transmoralische Gewissen in der Akzeptanz des bösen, moralischen Gewissens, und dieses wiederum sei unvermeidlich, wo immer Entscheidungen getroffen und Taten vollbracht würden. Beide Namen wiederum seien »[n]icht ganz zu unrecht« mit den »antimoralischen Bewegungen des Faschismus oder Nationalsozialismus verknüpft«4 worden.
Diese beiden Prämissen legen den Schluss nahe, dass die antimoralischen Bewegungen des Faschismus und Nationalsozialismus als Konsequenzen einer Abkopplung von Moral und Gewissen verstanden werden können, die bereits bei Luther zu verorten sind. Damit hätten jene recht, die eine solche Verbindung von Luther und Nationalsozialismus behaupten.
Tillich erkennt eine Gefährlichkeit des protestantischen transmoralischen Gewissens an, versucht sie aber durch die Unterscheidung zwischen einer Wiederherstellung der Moral aus einem Punkt oberhalb der Moral und der Zerstörung der Moral aus einem Punkt unterhalb der Moral zu entschärfen.5 Zudem verweist er darauf, dass auch die Psychoanalyse einen transmoralischen Gewissensbegriff entwickelt habe. Mit der Idee eines transmoralischen Gewissens müssten daher Religion und »analytische Psychotherapie« aufgegeben werden, denn in beiden sei das moralische Gewissen transzendiert: »[…] in der Religion durch die Annahme der göttlichen Gnade, die durch die Sphäre des Gesetzes hindurchbricht und ein fröhliches Gewissen«6 schaffe, in der Tiefenpsychologie durch die Annahme der eigenen Konflikte. Überhaupt sei es unmöglich, das moralische Gewissen nicht zu transzendieren, weil es unmöglich sei, ein »empfindliches und ein gutes Gewissen« miteinander zu vereinen.7
Wenn wir statt Gewissen Schuldbewusstsein einsetzen, kann man auf der Grundlage von Tillich drei moderne Formen einer Amoralisierung und Enttheologisierung der Schuld unterscheiden: Die Psychoanalyse einerseits sowie zwei postprotestantische, eine Nietzsches und eine Heideggers. Aus ihnen lassen sich drei säkulare Schuldpolitiken untersuchen, drei Versuche, die biblische Sündenfallerzählung sowie die christlich-theologische Erbsündenlehre in post-christliche, atheistische Rechtfertigungslehren zu übersetzen. Nietzsche stellt den radikalen Versuch dar, die Schuld umzuwerten und dadurch zu überwinden; Heidegger radikalisiert eine westchristliche Vorstellung der Unüberwindbarkeit der Schuld aus eigener Kraft zu einer Anerkennung der Unüberwindbarkeit der Schuld; und Freud erkennt eine der Schuld zugrunde liegende und für Moral und Religion unzugängliche und damit ebenfalls unüberwindbare Ambivalenz (Triebkonflikt) als Basis von Schuld und Schuldgefühlen.
1. Große Politik der umgewerteten Schuld (Nietzsche)
Friedrich Nietzsche startete den vielleicht radikalsten Angriff auf einen biblisch-christlichen Sündenbegriff. In der Geschichte der Säkularisierung der Erbsünde, die sich seit der Aufklärung vollzog, stellt er insofern einen Höhepunkt dar, als er nicht nur den an Gott gebundenen theologischen Sündenbegriff, sondern auch einen aufgeklärt-säkularen, also von Gott unabhängigen moralischen Begriff der zurechenbaren Schuld verabschiedet.
Schon früh wertet Nietzsche die Sünde um. Der biblisch als Grundübel verstandenen Sünde als Schuld gegenüber Gott stellt er den Frevel als Angriff auf die Götter positiv gegenüber. Frevel ist aktive und bejahte Sünde, Rechtfertigung der menschlichen »Schuld« gegenüber Gott oder den Göttern, die damit aufhört, Schuld zu sein. Aus dieser Gegenüberstellung wird später eine Entgegensetzung. Dabei verschiebt sich Nietzsches »Anti« von einem bejahten Frevel als Angriff auf Gott auf die Sündenfallerzählung, die an die Stelle des Sündenfalls tritt. Sie erscheint als Ausdruck einer verhängnisvollen Verneinung des Lebens.1 Schuld entspringt einer internalisierten, »der rückwärts gewendeten Grausamkeit«2. Aus einem aus Ohnmacht erwachsenden Drang nach Rache (»Ressentiment«) wird ein »schlechtes Gewissen«. Daraus wiederum machen Priester ein Schuldgefühl gegenüber Gott, also Sünde, und dieser Begriff triumphiert im Christentum.
Diese Ausdrucksformen einer Verneinung des Lebens werden von Nietzsche nach seinem Zarathustra ihrerseits verneint. Diese Verneinung einer Verneinung erscheint ihm als eine höhere Form der Selbstbejahung eines Willens zur Macht. Damit soll ein biblischer und insbesondere christlicher Sündenbegriff nicht nur überwunden, sondern für eine höhere Bejahung nutzbar gemacht werden. Das nennt Nietzsche »große Politik«. »Groß« bedeutet bei Nietzsche das, »was von seinem Gegensatz nicht negiert wird, an ihm nicht zugrundegeht, sondern ihn für sich noch fruchtbar machen, an ihm wachsen kann«.3 Konkret versteht er unter »großer Politik« einen »Krieg wie zwischen Aufgang und Niedergang, zwischen Willen zum Leben und Rachsucht gegen das Leben, zwischen Rechtschaffenheit und tückischer Verlogenheit«.4
Nietzsches frühe Gedanken aus Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik sowie seine späteren Arbeiten, insbesondere Zur Genealogie der Moral und das Lenzerheide-Fragment, stehen im Fokus meines Interesses. Anhand dieser Texte lässt sich die Genese von Nietzsches frühen Gedanken bis zur großen Politik nachzeichnen und zeigen, dass sein Versuch einer radikalen Umwertung der Schuld ihn in Konflikt mit sich selbst geraten lässt und am Ende an seiner radikalen Aufrichtigkeit zerbricht.
Diese radikale Aufrichtigkeit ist es auch, die Nietzsche am deutlichsten von jenen trennt, die sich im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert von ihm inspirieren ließen. Denn Nietzsche wird nicht nur zu einem der philosophisch einflussreichsten Denker für das 20. Jahrhundert; mit seiner großen Politik, seiner Verneinung dessen, was ihm als eine Verneinung des Lebens erschien, inspirierte er auch politische Bewegungen. Das gilt für eine Selbstermächtigung durch einen mehr oder weniger offenen Angriff auf ein biblisches Verständnis von Sünde und Schuld im Nationalsozialismus und Faschismus, das gilt auch für gegenwärtige libertär-autoritäre Angriffe auf eine »kulturelle Linke« oder einen »Wokismus«, durch die neue Eliten sich nach ihren ökonomischen und politischen Triumphen auch noch ihres schlechten Gewissens entledigen wollen und die jüdisch-christliche Tradition, zumeist im verlogenen Schein ihrer Verteidigung, abzuräumen versuchen.
1.1 »Aktive Sünde«
Schon in seinen frühen Gedanken aus Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik tritt bei Nietzsche die Abwertung des schlechten Gewissens, des Schuldgefühls und des Sündenbegriffs deutlich zutage. Diese erweist sich als eine der deutlichsten Konstanten eines Denkens, das von Wandlungen, Vielstimmigkeit und Experimentierfreude geprägt ist.
Schon in der Geburt der Tragödie taucht eine später von ihm so genannte »grosse Politik« in der Vorform einer Unterscheidung auf, in der jene Wertungen, die später unversöhnlich gegeneinander gerichtet sind, noch versöhn- oder vermittelbar erscheinen. Das zeigt sich deutlich in einer Abwertung der Sündenfallerzählung, die als negativer Kontrast zu einer positiv verstandenen Prometheussage dient. Deren Vorrangstellung deutet sich schon darin an, dass auf dem Titelblatt des Buches der gefesselte Prometheus abgebildet ist. Hier, in seinem Erstlingswerk, operiert Nietzsche mit der Unterscheidung Frevel-Sünde, die mit zwei weiteren Relationen supplementiert wird: arisch-semitisch und männlich-weiblich. Der im Prometheusmythos artikulierte Frevel sei ursprüngliches Eigentum der »arischen Völkergemeinde«, ihm stellt Nietzsche den »semitischen Sündenfallmythus«5 gegenüber. Zudem beschreibt er dieses Verhältnis als das von Bruder und Schwester. An der Abwertung der einen Seite der Unterscheidung gegenüber der anderen lässt Nietzsche aber keinen Zweifel:
Das Beste und Höchste, dessen die Menschheit theilhaftig werden kann, erringt sie durch einen Frevel und muss nun wieder seine Folgen dahinnehmen, nämlich die ganze Fluth von Leiden und von Kümmernissen, mit denen die beleidigten Himmlischen das edel emporstrebende Menschengeschlecht heimsuchen – müssen: ein herber Gedanke, der durch die Würde, die er dem Frevel ertheilt, seltsam gegen den semitischen Sündenfallmythus absticht; in welchem die Neugierde, die lügnerische Vorspiegelung, die Verführbarkeit, die Lüsternheit, kurz eine Reihe vornehmlich weiblicher Affektionen als der Ursprung des Uebels angesehen werden.6
Im Unterschied zur späteren »großen Politik« mit ihrem »Krieg« zwischen Willen zum Leben und Rachsucht gegenüber dem Leben, ist der Gegensatz von Frevel und Sünde schon durch seine Ergänzung um den hierarchisch verstandenen, aber dennoch komplementären geschlechtlichen Unterschied nicht antagonistisch. Das wird deutlich, wo der Gegensatz auf einen geschlechtlich-komplementären »verborgenen Urwiderspruch« zurückgeführt wird:
Bei dem heroischen Drange des Einzelnen ins Allgemeine, bei dem Versuche über den Bann der Individuation hinauszuschreiten und das eine Weltwesen selbst sein zu wollen, erleidet er an sich den in den Dingen verborgenen Urwiderspruch d. h. er frevelt und leidet. So wird von den Ariern der Frevel als Mann, von den Semiten die Sünde als Weib verstanden, so wie auch der Urfrevel vom Manne, die Ursünde vom Weibe begangen wird.7
Frevel und Sünde sind also komplementäre Ausdrucksformen eines geschlechtlich verstandenen »Urwiderspruchs«, ähnlich wie bei Schopenhauer, für den Männer »die Schuld des Lebens« durch Tun abtragen, die Frauen durch Leiden,8 oder wie bei Peter Sloterdijk, der mit dem verwandten Code Thymos/Stolz und Begehren operierte.9
Beiden Mythen, dem Prometheus- und dem Sündenfallmythos, ist eine jeweilige Übertretung oder Schuld gegenüber höheren Mächten gemeinsam, also eine Asymmetrie nach oben. Im Zentrum der Prometheus-Überlieferung steht die erinnerte Ermächtigung der Menschen (durch Feuer) gegenüber den anderen Naturwesen, die aber um den Preis einer Schuld gegenüber den Göttern erfolgte.
Seine zentrale Bedeutung erhält Prometheus dadurch, dass er das Ideal für den Frevel ist. Frevel bedeutet: aktive Sünde. Und wenn Sünde als Störung der Beziehung zu Gott verstanden wird, dann bedeutet Frevel die aktive, bejahte Störung eben dieses Gottesverhältnisses, Frevel als bejahte Sünde, im Unterschied zur passiven und verneinten Sünde im Sündenfall. Nietzsches Rechtfertigungslehre betrifft hier also nicht die Frage, wie ich trotz der Sünde vor Gott gerechtfertigt werden kann, sondern sie betrifft gewissermaßen die Rechtfertigung der Sünde selbst – in Form ihrer Bejahung.
Das, was die arische Vorstellung auszeichnet, ist die erhabene Ansicht von der aktiven Sünde als der eigentlich prometheischen Tugend: womit zugleich der ethische Untergrund der pessimistischen Tragoedie gefunden ist, als die Rechtfertigung des menschlichen Uebels, und zwar sowohl der menschlichen Schuld als des dadurch verwirkten Leidens.10
Anders als die Annahme der Schuld und der Sünde im Schuldbekenntnis, eine Annahme, die ihre Affirmation nicht einschließt, sondern ausschließt, erscheint diese Bejahung deswegen paradox, weil die Störung des Gottesverhältnisses, die Sünde, im Grunde nur bejaht werden kann, wenn Gott bereits verneint oder als Gott abgewertet wird, das heißt aber: nicht mehr Gott genannt zu werden verdient. Und genauer betrachtet war der Akt des Prometheus für Nietzsche auch gar kein Frevel an sich, sondern erschien nur den »beschaulichen Ur-Menschen […] als ein Raub an der göttlichen Natur«.11 An sich aber war dieser Frevel für Nietzsche ein Schritt zu menschlicher Unabhängigkeit, Akt einer Souveränisierung des Menschen, der Machtsteigerung. Prometheus steht also dafür, dass »der Mensch frei über das Feuer waltet und es nicht nur durch ein Geschenk des Himmels, als zündenden Blitzstrahl oder wärmenden Sonnenbrand empfängt«.12
Ein analoger Gedanke wiederholt sich im letzten Buch der sogenannten mittleren (»freigeistigen«) Periode Nietzsches, in den berühmten Worten aus dem Aphorismus »Der tolle Mensch«: »Gott ist todt! Gott bleibt todt! Und wir haben ihn getödtet!«13 Im Sinne des tragischen Helden übernimmt der tolle Mensch eine lange Geschichte des Todes Gottes als eigene Tat (Mord), als eigene Schuld, als aktive Sünde beziehungsweise als den größten aller denkbaren Frevel. Aber auch dieser Frevel ist naturgemäß paradox, denn mit der Umwertung der größten Schuld zur größten Tat geht zugleich eine »höhere Geschichte« einher, und die ist gerade von einer grundlegend rückwirkenden Entschuldung geprägt. Mit Gott verschwindet nämlich die Quelle frevelhafter Schuld und der Schuld überhaupt, es fehlt jetzt
ein Wesen, das dafür verantwortlich gemacht werden könnte, daß Jemand überhaupt da ist, daß Jemand so und so ist, daß Jemand unter diesen Umständen, in dieser Umgebung geboren ist. – Es ist ein großes Labsal, daß solch ein Wesen fehlt …14
Die frühe Bejahung des Frevels, wie auch noch die Bejahung des Todes Gottes des »mittleren« Nietzsches, haben gemeinsam, dass sie den Selbstwiderspruch in sich tragen, der in ihre Selbstauflösung mündet. Sünde ohne Gott ist absurd. Das ist die Definition des Absurden bei Albert Camus.15 Die Bejahung des Frevels mündet in die Auflösung Gottes und der Schuld, in seine pantheistische Transformation (deus sive natura), also in eine neue Unschuld der großen Bejahung, oder, in den protestantisch getönten Worten Nietzsches, in eine »Rechtfertigung des menschlichen Uebels«, die Rechtfertigung der »menschlichen Schuld« und des »dadurch verwirkten Leidens«.16
Genau hier aber setzt jene Zäsur ein, mit der sich Nietzsche sowohl von seinem früheren Denken als auch von einer pantheistischen Rechtfertigungslehre unterscheidet. An die Stelle der Bejahung »sowohl der menschlichen Schuld als des dadurch verwirkten Leidens« treten Bejahung und Verneinung. Das bedeutet einerseits die Bejahung des Lebens und des Willens zur Macht (also auch Bejahung des Leidens, das durch menschliche Macht, durch Herrschaft in die Welt kommt). Mit dem Frevel, der Schuld »nach oben«, gegenüber Gott/den Göttern, verschwindet auch die »Schuld«, die Schuld »nach unten«, gegenüber den Unterdrückten. Andererseits bedeutet das die Verneinung der Willensverneinung, Verneinung von Ressentiment, schlechtem Gewissen, Schuldgefühl (Sünde). Aufgrund dieser Verneinung hört die Bejahung auf, eine allgemeine und umfassende, eine »pantheistische« zu sein. Es ist eine selektive Bejahung, eine selektive und daher politisch in Richtung Selektion strebende Rechtfertigungslehre, eine Rechtfertigung des Lebens und des Willens zur Macht, die mit einer paradox erscheinenden Beschuldigung der Schuld, des schlechten Gewissens, des Ressentiments einhergeht.
Mit anderen Worten: Nietzsches Vielstimmigkeit, die vielen Masken, die sein Denken trägt, können leicht über einen Code hinwegtäuschen, der seinerseits verschiedene Namen oder »Masken« tragen kann, der unterschiedlichen Differenzierungen und Problematisierungen unterworfen, aber dennoch sehr stabil ist. Auf die kürzeste Formel gebracht, lautet dieser Code Bejahung-Verneinung, und seine Varianten: Herren-Sklaven, aktiv-reaktiv, Unschuld-Schuldgefühl, Griechen-Juden/Christen, Arier-Semiten, Krieger-Priester. Das ist die große Kontinuität in Nietzsches Denken.
Die Diskontinuität, das entscheidende, diesen Gegensatz dynamisierende, politisierende Ereignis bildet der Sprung (im Sinne eines Zerspringens) in eine andere beziehungsweise doppelte Ordnung: Aus Ja-Nein (Lebens- und Willensbejahung, Lebens- und Willensverneinung, Spinoza-Schopenhauer) wird ein Ja zum Ja und ein Nein zum Nein, Bejahung der Bejahung und Verneinung der Verneinung. Der Bejahung einer Bejahung wird die Verneinung der Verneinung entgegengestellt. Diese plötzliche Diskontinuität (»Da, plötzlich, Freundin! Wurde eins zu zwei«17) stellt nicht nur einen Bruch in der genannten Kontinuität dar, einen Wechsel, sondern baut auf ihr auf. In die hierarchisch-komplementäre Wertunterscheidung, die Nietzsches frühes Denken prägte (und die er später18 als »herrenmoralische« gut-schlecht-Unterscheidung bestimmt), bricht die horizontal-antagonistische (»sklavenmoralische«) gut-böse-Unterscheidung ein und dynamisiert sie.
Die Dynamisierung entsteht gerade aus der Unvermitteltheit (Bruch, Diskontinuität) dieser Beziehung und dem daraus folgenden unbestimmbaren Charakter dieses Verhältnisses zwischen beiden Moralen oder Werten: Diese Beziehung zwischen Herren- und Sklavenmoral, zwischen gut-schlecht-Hierarchie und gut-böse-Antagonismus, kann nämlich ihrerseits im Sinne einer hierarchischen, wesentlich apolitischen, überpolitischen gut-schlecht-Beziehung verstanden und gemildert werden, indem sie aus einem gesicherten Jenseits von Gut und Böse beschrieben wird: »Dass die Lämmer den grossen Raubvögeln gram sind, das befremdet nicht«.19 Mit anderen Worten: Wir Raubvögel hier oben mit unserer gut-schlecht-Herrenmoral halten Distanz zur schlechten, giftigen gut-böse-Moral der Lämmer.
Sie kann aber ihrerseits auch jederzeit in einen politischen oder metapolitischen gut-böse-Antagonismus kippen. So etwa, wenn Nietzsche von den »beiden entgegengesetzten Werthe[n] ›gut und schlecht‹, ›gut und böse‹« spricht.20 Dann ist plötzlich Schluss mit der spöttisch-selbstzufriedenen Raubvogelperspektive auf die »Lämmer«. Aus einer funktionalen Feindschaft zu Trainingszwecken – »eine gewisse Nothwendigkeit, Feinde zu haben (gleichsam als Abzugsgräben für die Affekte Neid Streitsucht Übermuth…)«21– sieht man sich unversehens in einen »furchtbaren, Jahrtausende langen Kampf auf Erden« verwickelt, einen Kampf, bei dem nicht etwa die Herrenraubvögel obenauf sind, sondern »der zweite Werth seit langem im Übergewichte ist«.22
1.2 Genealogie welcher Moral? Nietzsches Kratodizee-Problem
Zur Genealogie der Moral, dieses so fragwürdige Buch, im Anschluss an Jenseits der Moral geschrieben, ermöglicht ein gutes Verständnis nicht nur des Schuldbegriffs Nietzsches nach Zarathustra, sondern es vermittelt auch einen Überblick über sein Denken überhaupt, insofern Nietzsches Gedanken hier in einer großen Strenge und systematischen Geschlossenheit auftreten, die allerdings wegen seiner stilistischen und sprachlichen Freiheit und Meisterschaft leicht übersehen werden können.
Schon der Titel ist fragwürdig – oder sollte es zumindest für jene sein, die mit Nietzsches Denken auch nur ein wenig vertraut sind –, denn die Frage, die sich stellt, aber selten gestellt wird, lautet: zur Genealogie welcher Moral? Nietzsche unterschied zuvor, wie gesagt, zwei unterschiedliche und/oder entgegengesetzte Moralen: die Herrenmoral von gut und schlecht und die Sklavenmoral von gut und böse. Hätte sich Nietzsche nur für eine der beiden Moralen interessiert, hätte er das leicht präzisieren können und sein Buch »Genealogie der Herrenmoral« beziehungsweise »Genealogie der Sklavenmoral« nennen können.
Dass er das nicht tat, muss wohl bedeuten, dass es ihm um beide Moralen ging. Und bei genauerem Hinsehen oder Hinhören wird man bemerken, dass der von ihm gewählte Titel diesen Sachverhalt auszudrücken vermag, wenn man nämlich den Genitiv ernst nimmt.23 Dann hätten wir in der Tat zwei Moralen oder, vorsichtiger, zwei Perspektiven: eine Genealogie der Moral im Sinne eines genitivus objectivus, also eine »objektive« oder positivistische, empirische Sozialgeschichte der Moral. Und wir hätten (genitivus subjectivus) eine Genealogie, die sich aus der Moral ergibt, aus ihr entfaltet werden kann, die von ihr her rekonstruiert werden kann. Der doppelte Genitiv ermöglicht damit zwei Perspektiven auf die Frage der Moral, eine empirische, positivistische auf die »äußere« Geschichte der Moral, als ein Pendant zu einer weltgeschichtlichen Perspektive (genitivus objectivus), und eine (im engeren Sinne) genealogische Perspektive als Pendant zu einer transzendentalphilosophischen oder noumenalen Perspektive, bei der der Abgrund der Moral und damit auch der Abgrund dessen, was die Tradition vor Nietzsche mit dem Begriff »Freiheit« umkreiste, zum generativen Pol wird (genitivus subjectivus). Und wenn zur Genealogie gehört, dass sie beides umfasst, dass zur (im engeren Sinne genealogischen) Setzung der Voraussetzungen immer auch gehört, dass diese zu (positiven) Vorgegebenheiten von Setzungen werden, dann könnte beides als Genealogie und »Genealogie im engeren Sinne« als Reentry der Unterscheidung in eine Seite der Unterscheidung verstanden werden.
Dass es sich um eine solche Suchbewegung handelt, deutet das kleine Wort »zur« an: Das Buch bezeichnet nicht einfach eine Geschichte/Genealogie, sondern bewegt sich in einer doppelten Bewegung, über die Genealogie im engeren Sinne und der positiven Geschichte in Richtung einer Genealogie.
Wenn es zwei Perspektiven beschreibt, stellt sich die Frage nach dem Vorrang. Die aristokratische Moral, natürlich, mag man zunächst meinen; sie geht als aktive Moral der reaktiven Moral der Unterworfenen voraus, genießt daher den Vorrang, auch den zeitlichen. Ihre Negativität erhält die Sklavenmoral überhaupt durch ihren reaktiven Charakter: »Während alle vornehme Moral aus einem triumphirenden Ja-sagen zu sich selber herauswächst, sagt die Sklaven-Moral von vornherein Nein zu einem ›Außerhalb‹, zu einem ›Anders‹, zu einem ›Nicht-selbst‹«.24 Dieser Gegensatz – Selbstständigkeit versus Unselbstständigkeit – erscheint als ein Echo jener Unterscheidungen des frühen Nietzsche: Frevel und passive Sünde, männlich und weiblich, arisch und semitisch.25
Daraus scheint zu folgen, dass sich eine Genealogie der Moral rekonstruieren lassen sollte, die mit eben dieser Herrenmoral ansetzt und dann die schlechte Moral der Schwachen, Kranken, Lebens- und Machtverneinenden als ihre Folge hätte. Und insofern die gute Herrenmoral überhaupt von einer großen Bejahung geprägt ist, im Gegensatz zur bloß reaktiven, verneinenden Moral des Ressentiments, müsste sich diese Moral in einer Bejahung der Macht, des Willens zur Macht in all ihren Aspekten und allen seinen Folgen ausdrücken. Das schlösse die Bejahung der Reaktion auf diese Macht, des Ressentiments und seiner Folgen ein, vielleicht sogar der Überwältigung durch das Ressentiment. Ein solches Ja wäre das radikalste, und Nietzsche konnte diese Bejahung wertschätzen, etwa wenn er Jesus von Nazareth den »edelsten Menschen« oder Spinoza »den reinsten Weisen« nannte.26
Spätestens der Nietzsche nach Zarathustra, eine Figur also, deren Name mit einem frühen und ausgeprägten religiösen Dualismus verbunden ist, will aber nicht wie Jesus sein, sondern bestenfalls wie Jesus und Dionysos. Sein Ja ist, wie später Heidegger herausgestrichen hat, ein Ja, das ein Nein beinhaltet, ist, mit Deleuze gesprochen, ein doppeltes Ja, ein Ja zum Ja, das mit einem Nein zum Nein einhergeht. Er will nicht wie Spinoza sein, denn mit seinem eigenen großen Nein hat Nietzsche auch dessen Pantheismus – die scheinbar nächstliegende und konsequenteste Option der Bejahung in Gestalt einer Alles-Bejahung und damit der »zweiten Unschuld« – verworfen: »Die Welt war für Spinoza wieder in jene Unschuld zurück getreten, in der sie vor der Erfindung des schlechten Gewissens dalag«.27 Analog zur Abwertung des prälapsarischen Urstands im Idealismus wird hier, aus dem doppelten Ja heraus, das einfache Ja als das IA der Esel abgewertet.28 Es ist im Interesse der Herrscher, nützlich und sogar wünschenswert, aber für sie selbst gilt es gerade nicht. Diese schroffe Abwertung des einfachen Jas katapultiert Nietzsche auch ins Jenseits jeder Nostalgie oder Verklärung der Herkunft. Er bewegt sich auf postlapsarischem – und man kann auch sagen: postprotestantischem – Terrain, und weil das Auftauchen von Sünde und Schuld auch ihm zu einem Zentralproblem erwachsen war, bewegt er sich auf der gleichen Ebene wie der von ihm gehasste Paulus.
Indem mit dem Ja zum Ja und dem Nein zum Nein Ja und Nein auseinanderbrechen, kann Nietzsche alle Schrecklichkeiten der Macht, des Willens zur Macht, kann er selbst die grausamste Unterdrückung noch bejahen, nicht aber ihre einfachste und notwendigste Folge, nämlich die Reaktion auf diese Unterdrückung. Dieses Nein wird eben verneint. Damit aber handelt sich Nietzsche das ein, was man als Kratodizee-Problem bezeichnen könnte: die Verteidigung oder Bejahung der Macht angesichts der Übel (Ressentiment), die daraus folgen. Daher muss Nietzsche aus Kratodizee-Gründen sogar verneinen, dass sich diese reaktive Moral direkt aus dem Unterdrückungsverhältnis ergibt, weil damit zugegeben wäre, dass Herrschaft ohne Ressentiment nicht zu haben ist und man daher entweder beides bejahen oder beides verneinen muss, nicht aber das eine bejahen, das andere verneinen kann. Dieses Problem führt Nietzsche dazu, so etwas wie das Pendant zur Willensfreiheit voraussetzen zu müssen, das ihm ermöglicht, das Ressentimentnicht aus der Herrschaft abzuleiten. Er muss also, im Interesse einer selektiven Bejahung, der klaren Trennbarkeit von Ja und Nein, einen Freiraum zwischen Unterdrückenden und Unterdrückten bewahren, der, analog zur Freiheit in der Sündenfallgeschichte, die Funktion hat, den guten Ursprung vor den negativen Folgen zu schützen.
Das lässt sich anhand der Genealogie nachzeichnen: Die Herrenmoral reicht dort zurück auf das erste geschichtlich (weil anthropogenetisch) relevante Ereignis überhaupt: die erste Gründung eines »Staates«. Nietzsche ist weit davon entfernt, sie moralisch zu idealisieren, seine Bejahung ist nicht daran gebunden. Im Gegenteil, er bezeichnet die Staatsgründung – vielleicht im Eindruck des Kolonialismus – als »eine furchtbare Tyrannei«, die »als eine zerdrückende und rücksichtslose Maschinerie auftrat und fort arbeitete, bis ein solcher Rohstoff von Volk und Halbthier endlich nicht nur durchgeknetet und gefügig, sondern auch geformt war.«29
Wie dies zustande kam, wie aus der Natur plötzlich eine »Eroberer- und Herren-Rasse« auftauchte, »kriegerisch organisirt und mit der Kraft, zu organisiren«, weiß Nietzsche nicht zu erklären, und er sagt uns auch nicht, woher er Kenntnis von ihrer Haarfarbe hatte. Denn es handelt sich nach seiner Aussage um ein »Rudel blonder Raubthiere«.30 Das sind offenbar Übernahmen zeitgenössischer Rassentheorien, und offenbar wird den (Indo-)Germanen hier eine gottgleiche Rolle zugewiesen, sie werden creatores ex nihilo.
Dass Nietzsche mit Zeichen operiert, die später politisch tonnenschwer werden, kann leicht die Aufmerksamkeit davon ablenken, dass hier deutliche biblische Anleihen an die Erschaffung des Menschen gemacht werden. Nietzsche betont sie sogar noch durch seine Sperrung des Wortes »geformt«: Das »Halbtier« werde hier als »Rohstoff« gleichsam zum Menschen »durchgeknetet«, »geformt«, aber eben nicht durch Gott, der die Erde, ădāmāh, knetet und zu Menschen formt, sondern durch den Staat und die »furchtbaren Tatzen« seiner Gründer. Damit, so wird angedeutet, haben wir mit dem ersten Staat, der ursprünglichen Unterdrückung, auch so etwas wie den Ursprung des eigentlichen Menschen als geschichtliches Wesen, wobei dieser Ursprung mit einer Urteilung einhergeht, mit der Spaltung des Menschengeschlechts in Herren und Sklaven.
Unterstützt wird die Parallele zum Schöpfungsbericht noch durch eine auffällige Betonung der Ereignishaftigkeit dieses Vorgangs. Diese damals eingetretene »Veränderung«, betont Nietzsche, konnte »keine allmähliche, keine freiwillige« sein, kein »organisches Hineinwachsen in neue Bedingungen«, sondern stellte sich »als ein Bruch, ein Sprung, ein Zwang« dar, »ein unabweisbares Verhängniss, gegen das es keinen Kampf und nicht einmal ein Ressentiment gab.«31 Zu diesem »Bruch« gehört auch das Auftauchen dessen, was man als Pendant zum »Lebensatem«, den Gott dem Menschen einblies, nachdem er ihn aus Erde geformt hatte (Gen 2,7), und gleichzeitig zur Willensfreiheit interpretieren mag:
Sie [die »unbewussten Künstler« der ersten »Eroberer- und Herrenrasse«, Anm. LDB] sind es nicht, bei denen das »schlechte Gewissen« gewachsen ist, das versteht sich von vornherein, – aber es würde nicht ohne sie gewachsen sein, dieses hässliche Gewächs, es würde fehlen, wenn nicht unter dem Druck ihrer Hammerschläge, ihrer Künstler-Gewaltsamkeit ein ungeheures Quantum Freiheit aus der Welt, mindestens aus der Sichtbarkeit geschafft und gleichsam latent gemacht worden wäre.32
Was in der biblischen und geschichtsphilosophischen Tradition als Bedingung der Möglichkeit der Schuld, nämlich als Freiheit gedacht ist, taucht hier als in die Seelen hineingehämmerte Restfreiheit einer bei den Herren noch »ausgelebten« ursprünglichen »natürlichen Freiheit« (die aber von einer Naturnotwendigkeit schwer zu unterscheiden ist) auf, die zugleich die Bedingung des »hässlichen Gewächs« des »schlechten Gewissens« und die Wurzel von Schuld und Sünde ist: die (Willens-)Freiheit. Diese unscheinbare verinnerlichte (»latent« gemachte) Freiheit ist zugleich die Lücke, die beide Moralen trennt. Sie bildet die nicht-transzendentale Bedingung der Möglichkeit dafür, dass für die reaktive Moral nicht die aktive Moral der Herrschenden direkt verantwortlich gemacht werden muss. Beide – unbewusstes Künstlertum der Herrenrasse und »schlechtes Gewissen« – stoßen hier dadurch nur fast unmittelbar zusammen, Letzteres lässt sich nur fast aus Ersterem erklären.
Ähnlich sorgfältig, wie der Priester der »Sklavenmoral« die Beschuldigung Gottes abwehrt, indem er dem Menschen eine Freiheit zum Bösen zuspricht, kann Nietzsche als der Priester der Willensbejahung die direkte Verantwortung der Herren für das Aufkommen der Sklavenmoral und des Ressentiments abwehren. Mit der Verneinung »Sie sind es nicht, bei denen das ›schlechte Gewissen‹ gewachsen ist«, betont Nietzsche, dass dieses seinen Ursprung nicht bei der »Herrenrasse« hat; und auch mit dem Ausdruck »nicht ohne sie« ist eine direkte Kausalbeziehung nicht zugegeben, sondern nur eine notwendige Bedingung für die Freiheit der Unterdrückten, die wiederum Bedingung der Sklavenmoral ist. Nietzsche vermeidet somit, die Unterdrückung zur Wurzel der Sklavenmoral zu erklären. Genau diese Lücke aber lässt den Raum für eine quasi-eschatologische Dimension offen, die die Ungleichheit der Menschen bewahrt: die Vorstellung einer Herrschaft, die nicht notwendig mit Ressentiment bei den Beherrschten einhergehen muss.
Die gleiche Vorsicht wird auch in der zitierten Aussage deutlich, wonach das Verhängnis so plötzlich kam, dass »es […] nicht einmal ein Ressentiment gab«. Auch hier artikuliert sich das Bemühen, einen Abstand zwischen einer Art guten »Schöpfung«, einem zu bejahenden Willen zur Macht, und einer schlechten Folge zu wahren. Ich sage »gute Schöpfung« (Selbsterschaffung des geschichtlichen Menschen), trotz aller negativ klingenden Attribute (»Gewaltakt«, »furchtbare Tyrannei«, »zerdrückende und rücksichtslose Maschinerie«, »furchtbaren Tatzen« etc.), denn es besteht kein Zweifel, dass Nietzsche damit keine Kritik oder (moralische) Beschuldigung im Sinne hat. Die Wahl negativer Prädikate kann vielmehr als Gradmesser für Nietzsches Kraft der Bejahung gelesen werden, denn hier drückt sich ereignishaft und »ungeschminkt« jener »Wille zur Macht« aus, dessen Bejahung im Zentrum seines Denkens stand. Menschliche Geschichte, Menschsein beginnt mit einem Akt rücksichtsloser Unterdrückung (Staatsgründung), in dem sich ein Wille zur Macht und der Archetyp einer bejahten Herrenmoral ausdrückt.33
An einer Stelle scheint sich, wenigstens indirekt, sehr wohl eine Kausalität zwischen Unterdrückung und Ressentiment nachweisen zu lassen: dadurch nämlich, dass Nietzsche das schlechte Gewissen, das direkt (als seine »Rückwärtsrichtung«) mit dem Ressentiment zusammenhängt, sehr wohl auf Unterdrückung zurückführt.
Ich nehme das schlechte Gewissen als die tiefe Erkrankung, welcher der Mensch unter dem Druck jener gründlichsten aller Veränderungen verfallen musste, die er überhaupt erlebt hat, – jener Veränderung, als er sich endgültig in den Bann der Gesellschaft und des Friedens eingeschlossen fand.34
Nietzsche spricht hier allerdings nur sehr allgemein und undeutlich vom »Bann der Gesellschaft«, nicht von Unterdrückung. An anderer Stelle, im Lenzerheide-Fragment, war er deutlicher oder, was vielleicht auf dasselbe hinausläuft, unvorsichtiger. Dass das Leiden an Herrschaft und Unterdrückung relevanter ist als das Leiden an Naturwidrigkeiten, hat Nietzsche hier deutlich ausgesprochen: Die »Ohnmacht gegen Menschen, nicht die Ohnmacht gegen die Natur«, erzeuge »die desperateste Verbitterung gegen das Dasein.«35 Warum aber ist die Ohnmacht gegen Menschen schlimmer als die Ohnmacht gegen die Natur? Der Schluss ist schwer zu vermeiden: Sie ist es deswegen, weil sie mit der Möglichkeit der Zuschreibung einer Absicht einhergeht.
In der Tradition dient der Sündenfall dazu, den Herrgott von den Übeln der Welt zu entlasten. Bei Nietzsche dient die Analogie zum Sündenfall dazu, die Herrenrasse zu entlasten. Weil er in der Genealogie alles zu tun scheint, um den naheliegenden Schluss zu vermeiden, dass das Ressentiment das giftigste und gefährlichste Produkt von Unterdrückung sei, findet er stattdessen genau in diesem Schluss selbst die Wurzel des Übels – die Geburt des Ressentiments.
Jeder Leidende nämlich sucht instinktiv zu seinem Leid eine Ursache; genauer noch, einen Thäter, noch bestimmter, einen für Leid empfänglichen schuldigen Thäter, – kurz, irgend etwas Lebendiges, an dem er seine Affekte thätlich oder in effigie auf irgend einen Vorwand hin entladen kann.36
Aus Sicht einer »objektiven«, objektiv-genitivischen Genealogie der Moral scheint das widersprüchlich, eine petitio principii, denn dieser Geschichte zufolge entwickelt sich der Begriff der Schuld zeitlich nach dem Ressentiment, als Folge seiner Verinnerlichung (schlechtes Gewissen) und Zurückwendung (»Schuldgefühl«, »Sünde«). Stellt das Ressentiment dagegen einen »andren Ursprung des ›Guten‹«37 dar, und zwar des Guten, »wie ihn der Mensch des Ressentiments sich ausgedacht hat«38, dann entspringt die Schuld einer leidenden Suchbewegung, die das eigene Leiden damit beruhigt, einen Schuldigen am eigenen Leid gefunden zu haben. Sie folgt damit tatsächlich dem Ressentiment, entspringt aus dem Ressentiment.