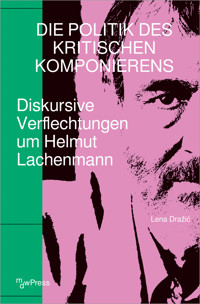
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: mdwPress
- Sprache: Deutsch
Neue Musik konfrontiert uns mit ungewohnten Klängen und zwingt uns so, unser Verhältnis zur Welt zu hinterfragen. Sie rüttelt auf und ist somit immer auch politisch, so die gängige These. Am Beispiel von Helmut Lachenmann, einem der prominentesten Komponisten der Gegenwart, macht Lena Drazic Texte über Neue Musik zur Grundlage einer Diskursanalyse, die deren politischen Versprechungen auf den Grund geht. Daran zeigt sie, dass insbesondere in der Strömung des »Kritischen Komponierens« Werte wie Demokratie, Niederschwelligkeit oder Herrschaftskritik beschworen werden, der Zugang zum Neue-Musik-Betrieb hingegen maßgeblich von Bildungs- und Klassenprivilegien abhängt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Lena Dražić (PhD) promovierte 2021 an der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. 2022 war sie Research Fellow am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien. Ihr Projekt über Bedeutungszuschreibungen an das migrantische Genre Turbo-Folk wurde von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Stadt Wien gefördert. Sie forscht zu Nationalismus und Politik in der Musik der Gegenwart.
Lena Dražić
Die Politik des Kritischen Komponierens
Diskursive Verflechtungen um Helmut Lachenmann
Veröffentlicht mit Unterstützung aus den Mitteln der Open-Access- und Publikationsförderung der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de/ abruf bar.
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 Lizenz (BY-NC). Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung des Urhebers die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium ausschliesslich für nichtkommerzielle Zwecke. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
Um Genehmigungen für die Wiederverwendung zu kommerziellen Zwecken einzuholen, wenden Sie sich bitte an [email protected]. Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellenangabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.
Erschienen 2024 bei mdwPress, Wien und Bielefeld
© Lena Dražić
Umschlaggestaltung: bueronardin/mdwPress
Umschlagabbildung: Helmut Lachenmann. Foto: Keystone / Gaetan Bally (Bildmontage durch mdwPress).
Lektorat und Korrektorat: Sophie Zehetmayer und Michaela Maywald
Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar
https://doi.org/10.14361/9783839467015
Print-ISBN: 978-3-8376-6701-1
PDF-ISBN: 978-3-8394-6701-5
EPUB-ISBN: 978-3-7328-6701-1
Inhalt
1Einleitung
1.1Helmut Lachenmann und das Kritische Komponieren
1.2Theorie und Methode
1.3Vom Text zum Kontext: das analytische Verfahren
Teil I: Innenansicht
2Lachenmann als Autor
2.1Der Komponist als Autor – eine problematische Doppelrolle
2.2Der Status von Komponist*innenkommentaren
2.3Intentio Auctoris
2.4Der Stellenwert der Komponist*innenkommentare im Sprechen über Lachenmann
2.5Der Eigenkommentar als Bestandteil des Werkes?
2.6Brüche und Konstanten in Lachenmanns Schreiben
2.7Verschiebungen in den jüngeren Texten
3Offene und verdeckte Bezüge
3.1György Lukács
3.2Theodor W. Adorno
3.3Luigi Nono
4Zentrale Konzepte in Lachenmanns Texten
4.1Sprachfähigkeit und Transzendenz
4.2Musikalisches Material
4.3Wahrnehmung als Mittel zur gesellschaftlichen Veränderung
Teil II: Ideologie
5Kritisches Komponieren als bürgerliche Kultur
5.1»Abwehrreaktionen eines Hörers« – Ideale der Rezeption
5.2Emphatisches Kunstverständnis
5.3Zwischen Fortschritt und Konservatismus
5.4Zwischen Egalitarismus und Elitismus
5.5Universalismus
5.6»Lieschen Müller beim Geschirrspülen« – die Marginalisierung des Weiblichen und die Unsichtbarkeit des Männlichen
Teil III: Außenansicht
6Über Lachenmann sprechen
6.1Tendenzen in der Lachenmann-Literatur
6.2Stadien im Sprechen über Lachenmann
7Das soziale Feld der ›neuen Musik‹
7.1Szenen und Milieus: Terminologie kultureller Vergemeinschaftung im Zeichen der Lebensstilforschung
7.2Das kulturelle Feld
7.3Feld und Diskurs
8Epilog: Gedanken zu einer Politik des Ästhetischen
Anhang
9Literaturverzeichnis
9.1Korpus der Diskursanalyse
9.2Sekundärliteratur
10Abkürzungsverzeichnis
11Chronologisches Verzeichnis der Texte Helmut Lachenmanns
Über mdwPress
1Einleitung
1.1Helmut Lachenmann und das Kritische Komponieren
Die Frage, inwiefern ein Komponist durch sein Schaffen affirmativ oder kritisch oder gar verändernd auf das Bewußtsein seiner Zeitgenossen wirken kann, ist demnach nicht eine Frage nach den Parolen […], sie ist vielmehr eine Frage seiner Kompositionstechnik.1
[Musik] wird um so besser sein, je tiefer sie in ihrer Gestalt die Macht jener Widersprüche und die Notwendigkeit ihrer gesellschaftlichen Überwindung auszuformen vermag […].2
Es dauerte Jahre, bis diese Phrase von kritischen Journalisten und Wissenschaftlern hinterfragt wurde, inwiefern denn über kulturellen Protest überhaupt materielle, politische Veränderungen möglich wären.3
Es ist noch nicht allzu lange her, dass sich die Kunstmusik neben Erwerbsarbeit, Politik, Privatleben und Religion als autonome Sphäre herauskristallisierte, die ihren einstigen Funktionen im Rahmen von politischer Repräsentation und geistlicher Andacht enthoben und mit dem Anspruch verknüpft wurde, einzig den ihr eigenen Gesetzmäßigkeiten zu gehorchen. Gleichzeitig wird sie gerade seit jenem Moment zu Beginn des bürgerlichen Zeitalters mit besonderen moralischen und politischen Ansprüchen befrachtet, die weit über jene hinausgehen, die sie in ihrer alten Rolle als Handwerk zur Belustigung der Mächtigen je zu erfüllen hatte.4 FriedrichSchiller erhoffte sich eine »Veredlung des Charakters«5 durch eine schöne Kunst, die der Wirklichkeit in der »Richtung zum Guten« vorangehe. Eine »Revolution in seiner ganzen Empfindungsweise«6, die der (als männlich gedachte) Künstler im Menschen auslöse, sollte »sein Jahrhundert […] reinigen«7 und somit einer harmonischen Gesellschaft als Assoziation von Freien und Gleichen den Boden bereiten.
Die infolge des Scheiterns der Französischen Revolution genährte Hoffnung, dass, wenn nicht die Politik, so die Kunst zu einer besseren Gesellschaft führen werde, verstärkte sich an der Schwelle zum 20. Jahrhundert mit dem Aufkommen der ästhetischen Avantgarden, die (wenn auch nicht in ihrer puristischen und formalistischen Spielart)8 die Mauern zwischen Kunst und Leben niederreißen und die Menschen wachrütteln wollten für das Unrecht eines aus der Balance geratenen Europa.9 Parallel dazu entwickelte sich im Zuge der Russischen Revolution eine Kunst, die unmittelbar in den Dienst gesellschaftlicher Veränderung gestellt wurde.10
Von Bedeutung insbesondere für die Kunstmusik des deutschsprachigen Raumes ist der Einfluss der Kritischen Theorie – hier vor allem jener Theodor W. Adornos –, der die ›neue Musik‹ als Instrument der Vernunft galt, das durch die mimetische Darstellung sedimentierter gesellschaftlicher Inhalte die Wahrheit über die Gesellschaft auszusagen und die Rezipient*innen damit zu kritischem Denken anzuregen vermöge.11 Auch wenn Adorno diesen Anspruch primär in der Musik der Wiener Schule verwirklicht sah und den Aufstieg der seriell dominierten Nachkriegs-Avantgarde mit Skepsis verfolgte,12 wurde der Philosoph im Umfeld der Darmstädter Ferienkurse für neue Musik zum wesentlichen Impulsgeber in Bezug auf musikästhetische Fragen.13 Diese Autoritätsposition in ästhetischen Belangen steht im Kontrast zu Adornos angespanntem Verhältnis zur studentischen Neuen Linken, die – stärker an Marcuse orientiert – Adorno im Laufe der 1960er-Jahre zunehmend mit offenem Dissens begegnete.14
Kritisches Komponieren als Kompositionsrichtung
Während im 20. Jahrhundert Komponist*innen wie Hanns Eisler oder Hans Werner Henze auf eine interventionistische Musik setzten, die unmittelbar politische Inhalte zur Darstellung brachte oder gar zu politischer Aktion aufrief, beharrte Adorno auf dem Autonomieanspruch der bürgerlichen Tradition. Durch die »Mimesis ans Verhärtete und Entfremdete«15 könne Musik den Hörenden die Verwerfungen des Spätkapitalismus bewusst machen und eine kognitive Umorientierung provozieren. In der westdeutschen ›neue Musik‹-Landschaft der späten 1960er-Jahre formulierten Komponisten wie Helmut Lachenmann, Mathias Spahlinger oder Nicolaus A. Huber – angeregt durch Adorno – den Anspruch, durch die kritische Auseinandersetzung mit kompositorischen Normen bei den Rezipient*innen ein ebenso kritisches Hören in Gang zu setzen. Nicolaus A. Huber definierte 1972 in seinem gleichnamigen Aufsatz Kritisches Komponieren als Kompositionspraxis, die ihren Status in der Gesellschaft ebenso reflektiere wie die gesellschaftliche Situation in ihrer Gesamtheit: »Kritisches Komponieren behandelt Probleme, die den Menschen betreffen, aber sich in Musik widerspiegeln – unter deren Bedingungen, versteht sich.«16
Mit dem Festhalten am Autonomieanspruch wird ein wesentlicher Unterschied zu einer explizit auf Gesellschaftsveränderung zielenden ›engagierten‹ Musik berührt. In Bezug auf Lachenmann hält Rainer Nonnenmann fest, dass dieser die Vorstellung, »nur eine bewusst hinter den fortgeschrittensten Stand der Reflexion des Materials zurückgehende oder dezidiert engagierte Musik könne die verlorene Kommunikation mit dem Publikum wieder herstellen und gesellschaftlich wirksam werden«17, in seinen Schriften scharf zurückwies. Der Zusammenhang zwischen Gesellschaft und Musik konstituiert sich also über deren mimetische Qualität. Mit der Aufklärungsfunktion und dem zentralen Fokus auf der Wahrnehmung nennt Huber weitere Punkte, die im Umfeld des Kritischen Komponierens konstitutive Bedeutung erlangen. Lachenmann und Spahlinger verwenden den Begriff selbst nicht, Lachenmann distanziert sich 1999 in einem Gespräch mit Jörn Peter Hiekel sogar ausdrücklich davon.18 Dennoch äußert er sich an zahlreichen Stellen im Sinne einer Kompositionspraxis, die durch das Brechen konventioneller Wahrnehmungskategorien – und somit auf dem Umweg über das Bewusstsein der Hörenden – indirekt auch auf die Gesellschaft einwirken will.
Neben Nicolaus A. Huber verwenden auch Autoren wie Claus-Steffen Mahnkopf oder Rainer Nonnenmann den Ausdruck ›Kritisches Komponieren‹ in ähnlicher Bedeutung. Mahnkopf machte das Phänomen 2004 zum Thema eines Symposions, im Zuge dessen er Luigi Nono und Klaus Huber auf der einen sowie Mathias Spahlinger auf der anderen Seite als generationale Grenzpfeiler des Kritischen Komponierens definierte.19 Nonnenmann zufolge ist das Kritische Komponieren im Adorno’schen Sinn »bestimmte Negation«20 und besitzt trotz seines Autonomieanspruchs einen funktionalen Charakter: Es »dient stets als Mittel zum Zweck, bestimmte inner- und außermusikalische Ziele zu erreichen.«21 Dabei sei das Kritische Komponieren »zugleich Kritik des Komponierens und der Rahmenbedingungen der Musik und des Musikhörens.«22 Das ›Kritische‹ des Kritischen Komponierens hat somit ein dreifaches Telos: Es richtet sich auf die Behandlung des musikalischen Materials ebenso wie auf die soziokulturellen Bedingungen der Musikproduktion und jene der Rezeption. Mit der »Brechung gängiger Wahrnehmungsmechanismen«23 formuliert Nonnenmann einen Anspruch, der in Zusammenhang mit dem Kritischen Komponieren eine wesentliche Rolle spielt.
Der Diskurs des Kritischen Komponierens: Merkmale und Grenzen
Von der ästhetisch gestaltenden Praktik des Kritischen Komponierens, die sich in Form musikalischer Werke manifestiert, sind jene sprachlichen Äußerungen zu unterscheiden, mit denen die Urheber ihr Komponieren häufig begleiten und die dieses – so kann argumentiert werden – erst zu einem ›kritischen‹ machen. Spielen erklärende, legitimierende und die Rezeption lenkende Äußerungen für die ›neue Musik‹ insgesamt eine nicht zu überschätzende Rolle,24 so ist diese Bedeutung beim Kritischen Komponieren in besonderer Weise gegeben: Es liegt auf der Hand, dass eine künstlerische Praktik, die trotz des weitgehenden Verzichts auf außermusikalische Mittel mit dem Anspruch einhergeht, eine Aussage über die Gesellschaft zu treffen, auf einen begleitenden Diskurs angewiesen ist, um überhaupt in einem kritischen Bezug zur Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Zu den Sprechakten der Komponist*innen gesellt sich ein Konglomerat aus wissenschaftlichen Abhandlungen, Kritiken, journalistischen Würdigungen, philosophischen Auseinandersetzungen und Werbetexten, die bestimmten kompositorischen Praktiken das Potenzial zuschreiben, aufgrund ihrer immanenten Beschaffenheit aufklärend auf die Rezipient*innen zu wirken, und diese Praktiken somit in einer gesellschaftskritischen Ästhetik verorten.
Diskurse werden hier mit Reiner Keller als »abgrenzbare, situierte, bedeutungskonstituierende Ereignisse bzw. Praktiken des Sprach- und Zeichengebrauchs durch gesellschaftliche Akteure«25 verstanden. Der Diskurs des Kritischen Komponierens ist demnach als die Summe der Aussagen zu verstehen, die sich durch eine Reihe von gemeinsamen Inhalten und Standpunkten konstituieren. Als zentrale Denkfigur erscheint die Vorstellung, dass die strukturelle Beschaffenheit der Musik als Widerspiegelung gesellschaftlicher Strukturen anzusehen und daher unabhängig von einer möglichen Verknüpfung mit außermusikalischen Inhalten inhärent gesellschaftlich sei. Die gesellschaftlichen »Vorwegbestimmungen«26 des musikalischen Materials, mit dem die Komponist*in operiert, erfordern einen negativen Umgang mit diesen Mitteln, um die schlechte Übereinstimmung zwischen traditionellem Ausdrucksrepertoire und gesellschaftlicher Norm zu brechen. Damit geht eine Kritik an den Mechanismen des Kulturbetriebs – einschließlich des bürgerlichen Konzertwesens – einher, der für ein Abstumpfen des Wahrnehmungsapparats und das Einverständnis der Subjekte in ihre eigene Unterdrückung verantwortlich sei. Um diesen falschen Konsens zu stören, zielt das Kritische Komponieren auf eine Disruption von Hörgewohnheiten, die eine Schärfung der Wahrnehmung und in weiterer Folge eine Anregung des kritischen Denkvermögens nach sich ziehen soll. In der Tradition Adornos wird der Musik somit eine Erkenntnis- und Aufklärungsfunktion zugeschrieben, die als Schritt hin zu einer gesellschaftlichen Veränderung verstanden wird. Gemeinsam ist den Proponent*innen des Kritischen Komponierens eine kritische Sicht auf die westliche Gesellschaft der Gegenwart und die politische Vision von Emanzipation und Autonomie.
Auf sprachlicher Ebene kennzeichnet den Diskurs eine Nähe zum Begriffsinventar der Kritischen Theorie, die das linksintellektuelle Feld im Westdeutschland der 1960er- und 1970er-Jahre dominierte – Nonnenmann verweist auf die Leitfunktion des Kritikbegriffs in den ästhetischen Debatten der Zeit.27 In politischer Hinsicht sympathisierten die Diskursteilnehmer*innen mit der antiautoritären Entfremdungskritik der Protestbewegung um 1968. Gleichzeitig distanzierten sich die Verfechter*innen eines Kritischen Komponierens jedoch von einer ausdrücklich politisch engagierten Musik, die das Ziel, breite Massen anzusprechen, mit einer Vereinfachung der musikalischen Sprache und der Integration von außermusikalischen Inhalten verband.28
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist nicht die Musik, auf die sich die Diskursteilnehmer*innen in ihren Aussagen über das Kritische Komponieren beziehen, sondern die Aussagen, die das Kritische Komponieren als ästhetische Strömung konstituieren. Anstatt zu fragen, ob die Kompositionen, die dem Kritischen Komponieren zugeordnet werden, tatsächlich die damit verknüpften Ansprüche erfüllen (ein zweifellos lohnendes Unterfangen, dem an anderer Stelle nachzugehen wäre), steht das diskursive Geschehen im Mittelpunkt der Betrachtung. Dass dessen Teilnehmer*innen häufig demselben Personenkreis angehören, der auch für das kompositorische Phänomen verantwortlich zeichnet, erhöht die Komplexität des Untersuchungsfelds, steht einer analytischen Trennung in Kompositionspraktik und begleitenden Diskurs aber nicht entgegen.
Ungeachtet seiner konstitutiven Gemeinsamkeiten ist der Diskurs des Kritischen Komponierens nicht als monolithischer Block zu betrachten. Anders als Lachenmann verortet sich etwa Nicolaus A. Huber dezidiert in einer durch Eisler geprägten Tradition ›engagierter‹ Musik und divergiert in seinem Beharren auf einer dienenden Funktion von Musik vom Autonomie- und Werkverständnis der bürgerlichen Tradition.29 Spahlinger wiederum wendet sich, obwohl er wie Lachenmann die musikimmanente Ebene als Ort gesellschaftlicher Auseinandersetzung bestimmt,30 wie Huber gegen das traditionelle Werk, das er als Ausdruck von Machtinteressen versteht.31 Dezidierter noch als die erwähnten Autoren verfolgt Mahnkopf den Anspruch, Adornos Kritische Theorie auf die Musik zu übertragen, während er an der Musik Lachenmanns, Spahlingers und Hubers sowie deren theoretischem Überbau eine Überbetonung des negatorischen Impetus kritisiert.32 Trotz dieser Unterschiede ist es im Sinn einer Diskursanalyse legitim, die übergreifenden, das Denkgebäude einer Autor*in transzendierenden Argumentationslinien und Narrative in den Blick zu nehmen.
Auch wenn ähnliche Gedanken an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten artikuliert wurden, handelt es sich bei der hier gemeinten Menge an Aussagen um ein spezifisch westdeutsches Phänomen, das in den späten 1960er-Jahren seinen Ausgang nahm. Im Hinblick auf die Kompositionspraktik des Kritischen Komponierens hat Nonnenmann die Frage aufgeworfen, ob diese eine abgeschlossene Zeitspanne umfasse oder ob es sich vielmehr um eine Kompositionshaltung von überzeitlicher Gültigkeit handle und die damit verbundenen Ansprüche auch im Komponieren der jüngsten Vergangenheit und der unmittelbaren Gegenwart noch lebendig seien. Für die frühen 1990er-Jahre konstatiert Nonnenmann in Zusammenhang mit dem Ende des realen Sozialismus eine Krise des Kritischen Komponierens, die dazu geführt habe, dass im Sprechen darüber der Rekurs auf gesellschaftskritische Begründungen in den Hintergrund getreten sei. Dennoch schlägt Nonnenmann ein überzeitliches Verständnis von Kritischem Komponieren vor, da die ›bestimmte Negation‹ des jeweils herrschenden Materialstands angesichts postmoderner Heterogenität und Ubiquität der Mittel zwar erschwert, aber nicht verunmöglicht werde.
Im Unterschied zu Nonnenmann wird hier nicht beabsichtigt, normative Kriterien zu entwickeln, an denen ein bereits bestehendes Kritisches Komponieren zu messen oder zukünftige Phänomene dieser Art auszurichten wären. Vielmehr sollen jene Sprechhandlungen untersucht werden, die bestimmten musikalischen Phänomenen eine solche kritische Intervention in der Gesellschaft zuschreiben. Der Diskurs nimmt dabei insofern eine historische Gestalt an, als sich von einer Phase ab ca. 1970 bis in die 1980er-Jahre, in welcher der Kunstmusik mit großer Bestimmtheit eine Bedeutung innerhalb gesellschaftlicher Transformationen zugeschrieben wurde, eine darauf folgende Zeitspanne abhebt, die zwischen Mitte der 1980er-Jahre und den frühen 1990er-Jahren einsetzte. Sie substituierte die radikalen politischen Forderungen durch einen stärkeren Fokus auf innerästhetische Belange, ohne den kritischen Anspruch aus den Augen zu verlieren, und hält bis heute an – sind in den Äußerungen der Fürsprecher*innen eines Kritischen Komponierens doch nach wie vor Standpunkte anzutreffen, die im Aufbrechen musikalischer Konventionen ein Potenzial für menschliche Transformation und Aufklärung sehen.
Im Zentrum dieser Arbeit stehen die Texte Helmut Lachenmanns, da dessen Komponieren wie das kaum eines anderen Komponisten von einer ebenso profunden wie extensiven verbalen Reflexion begleitet wurde und wird.33 Ihre Einbettung in den Diskurs des Kritischen Komponierens bleibt dabei von wesentlicher Bedeutung, da sie den von Lachenmann verwendeten Denkfiguren Tiefenschärfe verleiht – lässt doch erst die vielfache Wiederholung ähnlicher sprachlicher Muster die für den Diskurs konstitutiven Aussagen hervortreten. Lachenmanns Texte interessieren hier also weniger als individuelle Äußerungen einer Persönlichkeit mit bestimmten biografischen und psychologischen Merkmalen denn als Fallbeispiel für eine Form des Sprechens über ›neue Musik‹, die im deutschsprachigen Diskurs der Nachkriegszeit eine hegemoniale Stellung einnahm und das Denken über ›neue Musik‹ bis heute nicht unwesentlich prägt.
Trotz dieser Einordnung ist die Individualität von Lachenmanns Texten von unhintergehbarer Bedeutung. Für Reinhold Brinkmann zählen die Selbstkommentare einer Autor*in
zum Begründungszusammenhang des Schaffens von Kunst. […] Ästhetische Grundsatzerklärungen und die Darstellung kompositorischer Prinzipien, oft beides verbunden mit außerästhetischem Räsonnement, gesellschaftskritisch, religiös, dienen den Autoren dabei vorzüglich zur Lenkung ihrer Rezeption und damit ihrer künstlerischen und geschichtlichen Legitimation.34
Zuallererst ist Lachenmann demnach Komponist – eine Identität, die jede seiner Äußerungen unausweichlich prägt, wie auch Ulrich Mosch bemerkt: »Erste Aufgabe des Komponisten bleibt eben das Komponieren, ist nicht die systematische Reflexion.«35
Auch wenn seine Schriften durch den Diskurszusammenhang mit unterschiedlichen Textsorten korrespondieren und sich im Einzelnen kaum von kunstwissenschaftlichen oder philosophischen Betrachtungen unterscheiden mögen, handelt es sich doch weder um kunstwissenschaftliche Abhandlungen noch um philosophische Traktate. Wir haben es vielmehr mit den Texten eines Künstlers zu tun, gewissermaßen mit Nebenerzeugnissen der kompositorischen Praxis, die – was Subjektivität, Parteilichkeit und die Lizenz zur Pointierung betrifft – anderen Gesetzen unterliegen als die Schriften von Theoretiker*innen. Von diesen unterscheiden sich Lachenmanns Texte auch hinsichtlich ihrer Intentionalität: Sie sind nicht als für sich stehende Zeugnisse einer fachlichen Expertise zu verstehen, sondern als Sprachrohr eines Praktikers, der je nach Situation für seine ästhetische Position zu werben oder gegnerischen Stimmen auf der kompositorischen Bühne Kontra zu geben sucht. Als Komponist*innenkommentare36 schreiben sie sich zudem in die Rezeption der Musik Lachenmanns ein, die sie mit Bedeutungen und Assoziationen anreichern und auf nicht zu unterschätzende Weise lenken.
Die Politik des Kritischen Komponierens
Die Verfechter*innen des Kritischen Komponierens grenzen sich somit gegenüber dem Ansinnen ab, Musik dezidiert in den Dienst einer politischen Wirkung zu stellen. Diese Skepsis sowohl gegenüber dem Begriff des Politischen wie auch gegenüber jenem der Wirkung bedeutet indessen nicht, dass dem Kritischen Komponieren nicht dennoch das Streben nach einer politischen Wirkung zugesprochen werden kann. Dieses Buch geht von einem weiten Politikbegriff aus, wie er etwa in der feministischen Theoriebildung, aber auch durch Ansätze im Umfeld von Poststrukturalismus und Marxismus stark gemacht wurde.37 Ein solches Politikverständnis reduziert das Politische nicht auf die Bereiche von Staat und Regierung, sondern versteht es als Ausübung, Verteilung und Ausverhandeln von Macht.38 Diese wird wiederum als die Fähigkeit definiert, durch die eigenen Handlungen die Handlungsmöglichkeiten anderer Menschen zu beeinflussen.39 Im Sinne eines solchen weiten Politikbegriffs lässt sich die von den Fürsprecher*innen des Kritischen Komponierens angestrebte Transformation des Wahrnehmens und Denkens sowie der Wunsch, dass diese die Grundlage auch für ein verändertes Handeln bilden möge, sehr wohl als Streben nach einer politischen Wirkung verstehen.
Meines Erachtens eignet sich der Politikbegriff als analytische Kategorie zur Erhellung nicht nur dieser, sondern auch anderer Ebenen des Diskurses um das Kritische Komponieren. So wäre zum einen die Art und Weise zu untersuchen, wie sich die Diskursteilnehmer*innen in Bezug auf explizit politische Fragen positionieren: Sowohl Lachenmann als auch Spahlinger und Huber tätigen namentlich in den 1970er-Jahren Aussagen, die – bei aller Distanz gegenüber interventionistischen Kunstströmungen – direkt an den Diskurs im Umfeld der Neuen Linken und der Studierendenbewegung anschließen und durchaus als explizite Verweise auf tagespolitische Fragen oder als Vision einer gerechteren Gesellschaft zu verstehen sind. Weiters eignet sich die Kategorie des Politischen zur Untersuchung der an die Praktik des Kritischen Komponierens geknüpften gesellschaftlichen Wirkungsabsicht, die ungeachtet der oben erwähnten Distanzierungsversuche zu konstatieren ist. Schließlich umfasst sie implizite gesellschaftstheoretische Annahmen der Akteur*innen, die insofern als ideologisch zu verstehen sind, als sie unhinterfragt vorausgesetzt und im Diskurs selbst nicht thematisiert werden, diesem aber im Sinne von Tiefenstrukturen zugrunde liegen und möglicherweise zu seinen expliziten Absichten im Widerspruch stehen. Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung aller drei politischen Aspekte des Kritischen Komponierens.
1.2Theorie und Methode
Die Grenzen des Sagbaren: der Diskursbegriff
In Zusammenhang mit dem Diskursbegriff liegt ein Rekurs auf Michel Foucault auf der Hand. Dieser sieht den Gegenstand der Diskursanalyse durch Aussagen konstituiert, die durch ihre Wiederholung und Gleichförmigkeit über Zeit- und Textgrenzen hinweg charakterisiert sind.40 Der Diskurs bestimmt die Grenzen des Sagbaren, er legt fest, welche Aussagen in einem bestimmten Rahmen möglich sind:
Die Beschreibung der diskursiven Ereignisse stellt eine völlig andere Frage [als die der Sprache, Anm. d. Verf.]: wie kommt es, daß eine bestimmte Aussage erschienen ist und keine andere an ihrer Stelle? Man sieht zugleich, daß diese Beschreibung des Diskurses sich in Gegensatz zur Geschichte des Denkens stellt.41
Nach Foucault geht es der Diskursanalyse also nicht um das Aufspüren einer verdeckten Wirklichkeit hinter den Aussagen. Im Gegensatz zur Hermeneutik ist es nicht ihr Ziel, zur Intention der Autor*in vorzudringen – Gegenstand ist lediglich die Menge der Aussagen in Form ihrer textlichen Materialisierungen. Auch im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus nicht auf dem Bewusstsein der Subjekte hinter den Äußerungen, sondern auf Denkfiguren, die sich über die Jahre hinweg in Texten unterschiedlicher Autor*innen behaupten und gemeinsam eine diskursive Wirklichkeit konstituieren. Solche ›Topoi‹ fasst Hubert Knoblauch in Anlehnung an Ernst Robert Curtius als »feststehende Redeweisen, konstante Motive, verfügbare und stereotype Denkmodelle sowie Klischees.«42 Der Toposbegriff kann als Leitbegriff bei der Analyse von Diskursen dienen.43 Im Zentrum der Diskursanalyse steht – so Andreas Domann mit Verweis auf Dietrich Busse und Wolfgang Teubert – ein »Textkorpus, dessen ›Zusammensetzung durch im weitesten Sinne inhaltliche (bzw. semantische) Kriterien bestimmt wird‹.«44 Diese Kriterien umfassen semantische Beziehungen und wechselseitige Verweise zwischen den Texten sowie einen gemeinsamen Gegenstand und Kommunikationszusammenhang.45
Der Diskurs als Teil des Sozialen: Critical Discourse Analysis
Bekanntlich zielt die Foucault’sche Diskursanalyse auf weit mehr als nur sprachliche Äußerungen: So spricht Foucault auch von »Institutionen, Praktiken, Techniken und von ihnen [den Menschen, Anm. d. Verf.] hergestellten Objekten«46alsBestandteilen des Diskurses. In Bezug auf eine Denkweise, die selbst noch die materielle Realität als Resultat von Diskursen ansieht, sprechen Kritiker*innen von einem ›Diskursidealismus‹, der die soziale Wirklichkeit nicht wie der traditionelle Idealismus als gedankliches, dafür aber als diskursives Konstrukt betrachte.47Im Gegensatz dazu definiert die ›Critical Discourse Analysis‹ (CDA) in der Ausformulierung von Lilie Chouliaraki und Norman Fairclough »discourse […] as an element of social practices, which constitutes other elements as well as being shaped by them«48. Fairclough und Chouliaraki sehen den Diskurs – in Anlehnung an Bhaskars ›kritischen Realismus‹49 – also nur als eine unter vielen Dimensionen des menschlichen Lebens, die einander wechselseitig beeinflussen, wobei keine Ebene als absolute Determinante fungiert.50 Die CDA bietet somit die Möglichkeit, einen diskurstheoretischen Ansatz mit einer Theorie der Praxis in einem sozialen Feld zusammenzudenken. Soziale und diskursive Strukturen beeinflussen sich in dieser Sichtweise gegenseitig, ohne dass die einen aus den anderen ableitbar wären.51 Diskurs versteht die CDA als sprachlich artikulierte Form sozialer Praxis, die darüber hinaus noch weitere Elemente wie etwa »social relations, power, material practices, beliefs/values/desires, and institutions/rituals«52 umfasst. Wie Ruth Wodak ausführt, kommt infolgedessen der Analyse des Kontexts – und dabei vor allem der sozialen Verhältnisse, in die ein Diskurs eingebettet ist – innerhalb der CDA besondere Bedeutung zu:
A fully »critical« account of discourse would thus require a theorization and description of both the social processes and structures which give rise to the production of a text, and of the social structures and processes within which individuals or groups as social historical subjects, create meanings in their interaction with texts.53
Ebenso wie die sozialen Strukturen begreift die CDA auch den Diskurs als von Machtverhältnissen durchdrungen.54 Für Fairclough und Wodak sind Diskurse insofern, als sie diese Machtverhältnisse unsichtbar machen und damit zu ihrer Aufrechterhaltung beitragen, als ideologisch zu betrachten.55 Es gehört zum Anspruch der CDA, diese ideologischen Konstruktionen offenzulegen.56 In diesem Sinn lässt sich die Vorgehensweise der CDA als ideologiekritisch verstehen.
Indem die CDA das Ziel verfolgt, die impliziten Annahmen der Diskursteilnehmer*innen transparent zu machen, verhält sie sich nicht unparteiisch, sondern bezieht innerhalb der von ihr beschriebenen Machtbeziehungen Position. Ausgehend von Roy Bhaskar sehen es Chouliaraki und Fairclough als Ziel kritischer Sozialwissenschaft, nicht nur soziale Praktiken, sondern auch die unausgesprochenen ›Proto-Theorien‹ oder unreflektierten Vorannahmen, die ihnen zugrunde liegen, zu analysieren. Im Rahmen dieser Arbeit bedeutet dies, die sprachlichen Äußerungen Lachenmanns und seines diskursiven Umfelds in Rückkoppelung zum soziokulturellen Rahmen zu untersuchen, in dem sie erfolgen. Angelehnt an Fairclough und Chouliaraki verstehe ich den Diskurs über ›neue Musik‹ daher als Spiegel realer Machtverhältnisse und kämpfe.
Verschiedentlich nehmen die Vertreter*innen der CDA auf Pierre Bourdieu Bezug – so etwa in der Adoption des Bourdieu’schen Feldbegriffs.57 Chouliarakis und Faircloughs Konzeption des Lebens als soziale Praxis, die sowohl von Strukturen beeinflusst wird als auch die Transformation dieser Strukturen bedingt, lässt sich zudem mit der vom »konstruktivistischen Strukturalismus«58 geprägten Sozialraumtheorie Bourdieus verbinden.59 Eine Verwandtschaft zu dessen Denkgebäude ist auch in der Auffassung von Theoriearbeit als einer spezifischen Form der Praxis zu bemerken – eine Verbindung, die bereits bei Adorno vorgezeichnet ist und auch in der vorliegenden Arbeit in der Verortung des Diskurses im sozialen Feld der ›neuen Musik‹ fruchtbar gemacht werden soll.60
Auf der CDA beruhende Forschungszugänge kommen bislang vor allem in den Sozialwissenschaften zur Anwendung, während sich innerhalb der Geistes- und Kulturwissenschaften stärker an Foucault ausgerichtete Ansätze etabliert haben.61 Ein Überblick über die Verbreitung diskursanalytischer Zugänge innerhalb der Disziplin steht für den Bereich der Musikwissenschaft noch aus. Insgesamt ist festzustellen, dass diskursanalytische Zugänge hier zwar präsent sind, im Vergleich zu anderen Disziplinen bislang aber eine untergeordnete Rolle spielen.
Musik als soziale Praxis
Den folgenden Überlegungen liegt ein Verständnis von Musik als sozialer Praxis zugrunde.62 Begründet ist dieser Zugang in der pragmatistischen Philosophie, die auf eine Enthierarchisierung und sakralisierung von Kunst zielt und diese in der alltäglichen Lebenserfahrung verortet.63 Aufbauend auf diesen Konzepten soll ›neue Musik‹ in der Folge als Spezialfall westlicher Kunstmusik verstanden werden, der nicht nur Ausdruck einer bestimmten Teilkultur – also einer Interaktions, Kommunikations- und Lebensform – ist und von Werten wie Innovation, Komplexität oder Ernsthaftigkeit getragen wird, sondern auch in sozialen Verhältnissen begründet liegt, die durch Macht und materielle Unterschiede geprägt sind. Dabei ist anzuerkennen, dass sich im 19. Jahrhundert im Kontext der europäischen bürgerlichen Kultur und Gesellschaft eine Sondersphäre der Kunst herausbildete, die als autonom und vom Bereich des Alltags und des Produktionsprozesses geschieden gedacht wird. Obwohl dieser Autonomie aufgrund ihrer diskursiven Konstitution jedenfalls eine Teilwirklichkeit einzuräumen ist, vollzieht sich auch die westliche Kunstmusik – und damit die ›neue Musik‹ – im sozialen Geflecht und in einer hierarchisch strukturierten Gesellschaft.
Musikalische Bedeutung ist diesem Verständnis nach den Werken nicht inhärent, sondern die Folge von Zuschreibungen, die aus einem kulturellen Verständigungsprozess hervorgehen. In Zusammenhang mit dem hier untersuchten Diskursausschnitt sind insbesondere die Zuschreibungen politischer Bedeutung von Interesse, die sich in einer Häufung politischer Rhetorik und Metaphorik manifestieren. Die CDA bietet sich als Mittel an, den diskursanalytischen Ansatz mit einer soziologischen Perspektive zu verbinden.
Aufgrund der Notwendigkeit, der linguistischen Analyse eine Untersuchung der sozialen Situation an die Seite zu stellen, spricht Wodak auch von einer besonderen Affinität der CDA zur Interdisziplinarität.64 In diesem Sinn versteht sich die vorliegende Diskursanalyse als lediglich ein Baustein in einem Gefüge, zu dessen Vervollständigung es auch im engeren Sinn musikanalytischer Studien sowie einer empirisch ausgerichteten soziologischen Analyse bedürfte. Unter dem Blickwinkel von Musik als sozialer Praxis bietet es sich insbesondere an, das Modell der CDA mit praxistheoretischen Zugängen zu verbinden.
Ihr Kritikverständnis rückt die CDA in ein Naheverhältnis zur Kritischen Theorie der Frankfurter Schule, das in dem Streben nach Aufklärung und Emanzipation zum Ausdruck kommt und in den verschiedenen Ansätzen unterschiedlich stark ausgeprägt ist.65 Während den hier verfolgten Forschungsansatz sein kritisches Erkenntnisinteresse ebenfalls mit der Philosophie der Frankfurter Schule verbindet, unterscheidet sich das Musikverständnis grundlegend von einem produktionsästhetischen Ansatz, für den etwa Theodor W. Adorno steht.
1.3Vom Text zum Kontext: das analytische Verfahren
Wie ihre Vertreter*innen betonen, handelt es sich bei der CDA um keine festgelegte Methode.66 Ihr Ansatz wird in diesem Buch daher mit detaillierter ausgearbeiteten diskursanalytischen Verfahren – wie jenen von Reiner Keller und Hubert Knoblauch, insbesondere aber der von Achim Landwehr beschriebenen ›historischen Diskursanalyse‹ – kombiniert.67
Wie von Fairclough vorgeschlagen, vollzieht sich das Analyseverfahren in drei Etappen:
I. Zunächst wird der Diskurs aus sich selbst heraus, noch ohne Betrachtung des Kontexts, zur Darstellung gebracht. Dieser Teil der Untersuchung zielt darauf ab, wesentliche Kategorien und Denkfiguren herauszuarbeiten und die Argumentationsweise der Teilnehmer*innen sowie die interne Strukturierung und Funktionsweise des Diskurses nachvollziehbar zu machen (Kapitel 4).
II. Darauf folgt in Kapitel 5 die Interpretation der im ersten Teil generierten diskursiven Figuren. Dieser Abschnitt, der ideologische Elemente des Diskurses zur Darstellung bringen soll, ist an das Modell der ›historischen Diskursanalyse‹ angelehnt.68 Zur Orientierung dient dabei eine Reihe von Begriffen oder ›Topoi‹, die sich im Zuge der Textanalyse als Knotenpunkte herauskristallisiert haben. Mit Reiner Keller werden sie »in einen weiteren Interpretationshorizont – bspw. Fragen der Macht oder Hegemonie, der Rolle einzelner Akteure und Ereignisse im Diskurs oder diskursiven Feld usw. – gestellt«69. Domann verweist in diesem Zusammenhang auf Charles Taylors Begriff der »Hintergrundbilder«70 (»background ›pictures‹«71) als impliziten Bezugsrahmen kulturell geteilter Vorannahmen und Praktiken, die in den Aussagen nicht explizit gemacht werden, diese aber in einen Horizont stellen, der sie in ihrer Bedeutung erst verständlich macht.Anders als hermeneutischen Verfahren geht es der historischen Diskursanalyse nicht um das Erfassen einer mentalen Wirklichkeit ›hinter‹ den Aussagen oder darum, herauszufinden, was die Autor*innen wirklich gedacht hätten. Gegenstand ist vielmehr die Positivität des Diskurses, der sich durch eine Formation von den Einzeltext transzendierenden Aussagen definiert. Dieser Etappe liegen die folgenden Arbeitsschritte zugrunde:
Korpusbildung: Ein Diskurs wird mit Landwehr als eine Menge von »Aussagen, die sich hinsichtlich eines bestimmten Themas systematisch organisieren und durch eine gleichförmige (nicht identische) Wiederholung auszeichnen«,72 gefasst. Vor dem Hintergrund eines imaginären Korpus – der Menge aller vorliegenden Aussagen über das Kritische Komponieren – wurde für das konkrete Korpuseine Auswahl getroffen, die dem Anspruch der Repräsentativität folgt (zur Begrenzung des Korpus vgl. S. 24).
Die Aussagenanalyse gliederte sich in die detaillierte Untersuchung von Textbausteinen, die von der Ebene des Gesamttextes bis zur Analyse lexikalischer Feinheiten reicht. Auf der Makro-Ebene bestand sie in der Bestimmung der Textsorte und gestalt, des Themas sowie beherrschender Darstellungsprinzipien, narrativer Muster und Querbezüge zu anderen Texten. Die Mikro-Ebene umfasste die Analyse relevanter Argumentationsstränge, Wortfeldanalysen sowie die eingehende Beschäftigung mit Rhetorik und Lexik, einschließlich der Verwendungshäufigkeit einzelner Begriffe.
In der eigentlichen Diskursanalyse wurden aus der Gegenüberstellung von Einzeltextanalysen schließlich jene übergreifenden Tendenzen und ›Topoi‹ (emphatisches Kunstverständnis, Universalismus, Humanität) generiert, die die Kernkategorien der vorliegenden Arbeit bilden und in Kapitel 5 ausführlich dargestellt werden.
III. Die letzte Etappe gibt den von Landwehr unter »Kontextanalyse«73 subsumierten Rahmenbedingungen und sozialen Beziehungen breiten Raum, indem der beschriebene Diskurs in Relation zum sozialen Feld der ›neuen Musik‹ gesetzt wird. Der Fokus wird dabei auf die am Diskurs beteiligten Akteur*innen, die damit einhergehenden Ereignisse sowie die institutionellen Rahmenbedingungen gelegt, unter denen sich der Diskurs vollzieht:74 »During this phase, the researcher draws on social theory in order to reveal the ideological underpinnings of the interpretive procedures. This is how discourse analysis becomes ›critical‹.«75 Unter diesen Analyseschritt fallen in der vorliegenden Arbeit auch Fragen »nach den möglichen Ursachen, Rahmenbedingungen und Wirkungen spezifischer Diskursverläufe.«76
Der Gegenstand der Analyse
Der Diskurs des Kritischen Komponierens soll hier am Beispiel der Texte Helmut Lachenmanns analysiert werden, dessen mündliche und schriftliche Äußerungen das Herzstück des untersuchten Korpus darstellen. Ein Subkorpus bilden die Texte anderer Autor*innen über Lachenmann, die daraufhin befragt werden, inwiefern darin Denkfiguren aus Lachenmanns eigenen Texten reproduziert werden und sie somit ebenfalls als Bestandteil des untersuchten Diskurses anzusehen sind. Auch wenn eine Unterscheidung kompositionstechnischer und gesellschaftspolitischer Fragen in völliger Trennschärfe nicht möglich ist, stehen jene Texte im Mittelpunkt, in welchen explizit gesellschaftliche und politische Aspekte des Kritischen Komponierens behandelt werden. Das Verhältnis zwischen Lachenmanns Schriften und den Schriften über ihn wird in Kapitel 6 einer detaillierten Untersuchung unterzogen.
Der 1996 von Josef Häusler herausgegebene erste Band der Schriften Helmut Lachenmanns, Musik als existentielle Erfahrung, bildet den Grundstock bei der Untersuchung der Texte Lachenmanns, umfasst er doch alle wesentlichen Schriften aus dem Zeitraum 1966–199677 – also jene Texte, die der Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weiterhin als gültig anerkannte. So nicht anders angegeben, wird hier nach der dritten Auflage von 2015 [MaeE3]zitiert. Vor 1996 entstandene Texte, die nicht in den Schriftenband Eingang fanden, wurden ausschließlich ergänzend herangezogen. Bei Musik als existentielle Erfahrung handelt es sich um eine praktische Leseausgabe, die sich an ein breiteres Publikum richtet, nicht um eine Edition mit philologisch-kritischem Anspruch, was den Nachvollzug von Varianten in der Textgestalt mitunter erschwert. Lachenmanns Schriften liegen häufig in unterschiedlichen Textstadien vor: Ihren Ursprung bilden oft Redebeiträge für Kongresse oder den Rundfunk, die in adaptierter Form in einem Tagungsband oder einer Zeitschrift publiziert wurden.78 Diese Erstveröffentlichungen wurden für Musik als existentielle Erfahrung nochmals überarbeitet, ohne dass dies eigens gekennzeichnet wäre. Auch für die beiden Neuauflagen des ersten Schriftenbands wurden die Texte weiteren Überarbeitungen unterzogen.79 Wie bereits Nonnenmann dargelegt hat, handelt es sich bei den Differenzen zwischen den Textgestalten – auch jenen zwischen Vortragstext, Erstveröffentlichung und Fassung letzter Hand – allerdings nur selten um inhaltliche Abweichungen, sondern in der Regel lediglich um Eingriffe redaktioneller Natur.80 Da der 2021 von Ulrich Mosch herausgegebene zweite Band der Schriften Helmut Lachenmanns erst in der Fertigstellungsphase dieses Buches erschien, werden die nach Erscheinen von Musik als existentielle Erfahrung entstandenen Texte in diesem Buch nach den jeweiligen Originalquellen zitiert. Berücksichtigung fanden insbesondere jene, die über bloße Gelegenheitsprodukte hinausgehen (konkret betrifft dies die Texte »Die Musik ist tot … aber die Kreativität lebt«81 (1997), »Philosophy of Composition. Is There Such a Thing?«82 (2004), »Kunst in (Un)Sicherheit bringen«83 (2006), »›East meets West? West eats meat‹ … oder das Crescendo des Bolero«84 (2008), »Kunst und Demokratie«85 (2009), »Tradition der Irritation. Nachdenken über das Komponieren, den Kunstbegriff und das Hören«86 (2012) und »Komponieren am Krater«87 (2016))88. Interviews und Gelegenheitstexte – wie etwa Würdigungen von Persönlichkeiten aus dem Musikbereich, CD-Booklets, Programmheft-Texte, Vor- und Geleitworte sowie kurze Statements und Kommentare zu Jubiläen und aktuellen kulturpolitischen Anlässen – gingen exemplarisch in das Korpus ein. Auch Texte, die ausschließlich in mündlicher Form vorliegen – dabei handelt es sich primär um Interviews und Diskussionen für Hörfunk und Fernsehen –, wurden zwar ausschnitthaft in die Analyse mit einbezogen, spielen aber gegenüber den oben erwähnten ›Haupttexten‹ eine untergeordnete Rolle.
Texte Lachenmanns: Ausführliche Diskursanalyse
•Affekt und Aspekt
•Aufgaben des Fachs Musiktheorie in der Schulmusik-Ausbildung
•Bedingungen des Materials. Stichworte zur Praxis der Theoriebildung
•Die gefährdete Kommunikation
•›Last meets West? West eats meat‹ … oder das Crescendo des Bolero. Materialien, Notizen und Gedankenspiele
•Fragen – Antworten. Gespräch mit Heinz-Klaus Metzger
•Geschichte und Gegenwart in der Musik von heute
•Hören ist wehrlos – ohne Hören. Über Möglichkeiten und Schwierigkeiten
•In Sachen Eisler. Brief an ›Kunst und Gesellschaft‹
•Klangtypen der Neuen Musik
•Komponieren am Krater
•Komponieren im Schatten von Darmstadt
•Kunst in (Un)Sicherheit bringen
•Kunst und Demokratie
•Musik als Abbild vom Menschen. Über die Chancen der Schönheit im heutigen Komponieren
•Musik als existentielle Erfahrung. Gespräch mit Ulrich Mosch
•Paradiese auf Zeit. Gespräch mit Peter Szendy
•Über Tradition
•Vier Grundbestimmungen des Musikhörens
•Vom Greifen und Begreifen - Versuch für Kinder
•Werkstatt-Gespräch mit Ursula Stürzbecher
•Zum Problem des musikalisch Schönen heute
•Zum Problem des Strukturalismus
•Zum Verhältnis Kompositionstechnik – Gesellschaftlicher Standort
•Zur Analyse neuer Musik
Texte Lachenmanns: Ergänzende Betrachtung
•Accanto
•Accanto. Musik für einen Soloklarinettisten mit Orchester (1975/76)
•Air. Musik für großes Orchester mit Schlagzeug-Solo (1968/69)
•Antwort zu ‚Das Schöne & das Häßliche‘
•»Bewundernswerter Geist«. Nachruft auf Heinz-Klaus Metzger
•Die Musik ist tot … aber die Kreativität lebt. Zum Festakt 75 Jahre Donaueschinger Musiktage am 18. Oktober 1996
•Fassade für großes Orchester (1973)
•Carsten Fastner, ›Ich verehre Morricone‹ (Interview)
•Harmonica. Musik für Orchester mit Solo-Tuba (1981/83)
•Herausforderung an das Hören. Gespräch mit Reinhold Urmetzer
•Idée musicale
•In aller Souveränität unscheinbare Menschlichkeit
•Klangschatten – mein Saitenspiel (1972)
•Kunst, Freiheit und die Würde des Orchestermusikers. An Vinko Globokar
•Leserzuschrift zum Fusionsplan der beiden SWR-Sinfonieorchester
•Luigi Nono oder Rückblick auf die serielle Musik
•Mahler – eine Herausforderung
•Nono, Webern, Mozart, Boulez. Text zur Sendereihe ›Komponisten machen Programm‹
•NUN. [Werkeinführung]
•Offener Brief an Hans Werner Henze
•Philosophy of composition. Is there such a thing?
•Präzision und Utopie. Die Musik des Komponisten Mark Andre lässt das Zuhören zum Hören werden
•Selbstporträt 1975. Woher – Wo – Wohin
•Siciliano – Abbildungen und Kommentarfragmente
•temA
•›… total verformt natürlich‹. Helmut Lachenmann moderiert E- und U-Musik
•Tradition der Irritation. Nachdenken über das Komponieren, den Kunstbegriff und das Hören
•Trio fluido für Klarinette, Viola und Schlagzeug (1966) I
•Über das Komponieren
•Über mein zweites Streichquartett. (»Reigen seliger Geister«)
•Über Nicolaus A. Huber
•Über Schönberg
•Von Nono berührt. Für Carla Henius
•Von verlorener Unschuld
•Zur Frage einer gesellschaftskritischen (-ändernden) Funktion der Musik
•1968. Ein Fragebogen
Interviews, Diskussionen und Rundfunk-Sendungen
•Birkenkötter, Das Postmoderne in der Musik Helmut Lachenmanns am Beispiel der ›Musik mit Bildern‹ »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern
•De Benedictis und Mosch, Alla ricerca di luce e chiarezza. L’epistolario Helmut Lachenmann-Luigi Nono (1957–1990)
•Demmler, »Wo bleibt das Negative?« Podiumsdiskussion mit Heinz-Klaus Metzger, Helmut Lachenmann, Matthias Pinscher und Max Nyffeler
•Gadenstätter und Utz, »Klang, Magie, Struktur«. Podiumsdiskussion mit Helmut Lachenmann
•Hiekel, »Kritisches Komponieren, Glückserfahrungen und die Macht der Musik. Jörn Peter Hiekel im Gespräch mit Helmut Lachenmann, Hans-Peter Jahn, Martin Kaltenecker, Ulrich Mosch und Isabel Mundry«
•Metzger, »Gespräch zwischen John Cage, Helmut Lachenmann und Heinz-Klaus Metzger«
•Gielen, Orchesterfarben: Helmut Lachenmann
•Hilberg, »›Nicht hörig, sondern hellhörig‹. Helmut Lachenmann im Gespräch«
•Konold, »Distanz wegen Nähe. Gespräch mit dem Komponisten Helmut Lachenmann«
•Ryan, »Musik als ›Gefahr‹ für das Hören. Gespräch mit Helmut Lachenmann«
•Steenhuisen, »Interview with Helmut Lachenmann«
•Still, Helmut Lachenmann ›Pression‹ with Lucas Fels
•Struck-Schloen, »›Ernst machen: das kann ja heiter werden!‹ Helmut Lachenmann im Radiogespräch«
Texte des diskursiven Umfelds
•Heister, »Neue Musik im 20. Jahrhundert und ihre Feinde«
•Huber, »Intention und Wirkung. Zur Situation der Neuen Musik«
•Ders., »Kritisches Komponieren«
•Mahnkopf, »Adornos musikalische Moderne«
•Ders., Kritik der neuen Musik
•Ders., »Foreword«, in: Critical Composition Today
•Ders., »Was heißt kritisches Komponieren?«
•Ders., Kritische Theorie der Musik
•Metzger, »Adornos ›Philosophie der neuen Musik‹ ein halbes Jahrhundert später«
•Metzger und Riehn, »Editorial«, in: Geschichte der Musik als Gegenwart. Hans Heinrich Eggebrecht und Mathias Spahlinger im Gespräch
•Oehlschlägel, Mit Haut und Haaren. Gespräche mit Mathias Spahlinger
•Redaktion der Zeitschrift Kunst und Gesellschaft, »Musik im Klassenkampf«
•Spahlinger, »politische implikationen des materials der neuen musik«
Texte über Lachenmann
•Abbinanti, »Sections of Exergue/Evocations/Dialogue with Timbre«
•Böttinger, »erstarrt/befreit – erstarrt?«
•Brinkmann, »Der Autor als sein Exeget«
•Cavallotti, »Präformation des Materials und kreative Freiheit«
•Cox, »Helmut Lachenmann als romantischer Hochmodernist‹«
•Ders., »Critical Modernism«
•Domann, »›Wo bleibt das Negative?«
•Etscheit und dpa, »Komponist Lachenmann setzt auf Hörner. Uraufführung in München«
•Febel, »Zu Ein Kinderspiel und Les Consolations von Helmut Lachenmann«
•Gottwald, »Vom Schönen im Wahren«
•Grüny, »›Zustände, die sich verändern‹«
•Handschick, »Visionen und Realitäten – Schüler-Kompositionsprojekte zwischen Kunstanspruch und Klischeeproduktion«
•Häusler, »Vorwort des Herausgebers«
•Hiekel, »Interkulturalität als existentielle Erfahrung«
•Ders., »Erfolg als Ermutigung«
•Ders., »Lachenmann verstehen«
•Ders., »Die Freiheit zum Staunen«
•Ders., »Ist Versöhnen das Ziel?«
•Hinz, »Lachenmann lesen. Ein Kinderspiel«
•Hockings, »Helmut Lachenmann’s Concept of Rejection«
•Hockings, Jewanski und Hüppe, »Helmut Lachenmann«
•Hüppe, »Über das Höhlengleichnis«
•Ders., »Topographie der ästhetischen Neugierde«
•Ders., »Rezeption, Bilder und Strukturen«
•Ders., »Helmut Lachenmann«
•Jahn, »Pression«
•Ders., »›Schöne Stellen‹«
•Jeschke, »Hören ohne zu und auf?«
•Kabisch, »Dialektisches Komponieren – dialektisches Hören«
•Kaltenecker, »Manches geht in der Nacht verloren«
•Ders., Avec Helmut Lachenmann
•Ders., »Helmut Lachenmann und das ‚kritische Orchester’«
•Ders., »Hören mit Bildern«
•Ders., »Was ist eine reiche Musik«
•Kohler, »Zur politischen Dimension einer musikalischen Kategorie«
•Lesser, »Dialectic and Form in the Music of Helmut Lachenmann«
•Linke, Konstellationen
•Mäckelmann, »Helmut Lachenmann, oder: ›Das neu zu rechtfertigende Schöne‹«
•Mahnkopf, »Helmut Lachenmann: Concertini«
•Ders., »Zwei Versuche zu Helmut Lachenmann«
•Mohammad, »What has Lachenmann done with my Mozart?!«
•Mosch, »Vorwort«
•Nonnenmann, Angebot durch Verweigerung
•Ders., »›Musik mit Bildern‹«
•Ders., »Die Sackgasse als Ausweg«
•Ders., »Was ist Musik?«
•Nyffeler, »Himmel und Höhle«
•Ders., »Sich neu erfinden, indem man sich treu bleibt«
•o. V., »Eine kalte Dusche im Konzertsaal«
•Rocha, »Where Does Music Start?«
•Schmidt, E., »Mahler contra Lachenmann«
•Schmidt, M., »Mozart gedenken. Erinnerung und Bild bei Helmut Lachenmann«
•Shaked, »›Wie ein Käfer, auf dem Rücken zappelnd‹«
•Sielecki, Das Politische in den Kompositionen von Helmut Lachenmann und Nicolaus A. Huber
•Utz, »Klangkadenz und Himmelsmechanik«
•Utz und Gadenstätter, »Vorwort«
•van Eecke, »NUN?!«
•Ders., »The Adornian Reception of (the) Child(hood) in Helmut Lachenmann’s ›Ein Kinderspiel‹«
•Wellmer, »Über Negativität, Autonomie und Welthaltigkeit der Musik«
•Ders., Versuch über Musik und Sprache
•Zehentreiter, »Sensory Cognition as an Autonomous Form of Critique«
•Zender, »Über Helmut Lachenmann«
Innerhalb der Texte über Lachenmann steht insbesondere die deutschsprachige Literatur im Fokus dieser Arbeit. Die englischsprachige Literatur dient dabei vor allem als Kontrastfolie, da sie die Spezifik des deutschsprachigen Diskurses nochmals klarer hervortreten lässt. Im Mittelpunkt stehen Lachenmann gewidmete Monografien und Sammelbände; auch einige Zeitschriften-Sonderhefte (MusikTexte 1997, NZfM 2006) sowie die beiden Lachenmann gewidmeten Ausgaben der Musik-Konzepte (1988 und 2000)sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung.
Unter den Lachenmann-Monografien sind insbesondere die beiden Bände von Rainer Nonnenmann – einem Musikwissenschaftler, der sich besonders intensiv mit Lachenmann beschäftigt hat – sowie Albrecht Wellmers Versuch über Musik und Sprache hervorzuheben, das als philosophische Auseinandersetzung mit der Musikästhetik Lachenmanns eine Sonderstellung einnimmt. Daneben haben sich Autoren wie Hans-Werner Heister, Jörn Peter Hiekel, Eberhard Hüppe, Hans-Klaus Jungheinrich, Martin Kaltenecker, Ulrich Mosch oder Jürg Stenzl wiederholt mit Lachenmann beschäftigt. Auch wenn diese Auseinandersetzung im Regelfall auf die Musik zielt, nehmen Lachenmanns Texte darin durchwegs einen hohen Stellenwert ein, wobei eine Frühphase der weitgehenden Identifikation mit der Position des Komponisten von einer Phase abgelöst wird, in der die Autor*innen vermehrt eigenständige Kategorien und alternative Deutungsmuster an den Gegenstand herantragen.89 Unvermeidlich ist in diesem Zusammenhang, dass zahlreiche Texte in diesem Buch eine Doppelrolle einnehmen: Sie stellen einerseits eine unverzichtbare Quelle für das Verständnis von Lachenmanns Schaffen dar und werden andererseits als Bestandteile eines Diskurses ausgewertet, in dem sich bestimmte übergreifende Tendenzen beobachten lassen. Eine scharfe Trennung in Korpus und Sekundärliteratur wäre im Sinne methodischer Klarheit zwar wünschenswert, ist aber praktisch undurchführbar, weshalb die Lesenden ersucht werden, ein gewisses Maß an Ambivalenz zu tolerieren. Folgerichtig überschneiden sich die in Abbildung 1 angeführten Texte über Lachenmann mit jenen, die im Literaturverzeichnis unter »Sekundärliteratur« firmieren (siehe S. 258). Beispielhaft hinzugezogen wurden auch journalistische Beiträge wie Aufführungskritiken, Zeitungsinterviews sowie Radio- und Fernsehbeiträge.
Da die vorliegende Arbeit Lachenmanns Schriften als Fallbeispiel heranzieht, machen diese auch das Schwergewicht innerhalb des untersuchten Textkorpus aus. Um jedoch Verflechtungen innerhalb des Diskurses sichtbar zu machen, die diesen als solchen erst plastisch werden lassen, wurden ausgewählte Texte des diskursiven Umfelds mit einbezogen. Diese umfassen zunächst Publikationen der Komponisten, die Nonnenmann neben Lachenmann zum Kernbestand des Kritischen Komponierens zählt: Nicolaus A. Huber und Mathias Spahlinger, die sich – wenn auch in geringerem Umfang als Lachenmann – aktiv an dem begleitenden Diskurs beteiligt haben. Als wesentlicher Vermittler zwischen der ersten Generation der Kritischen Theorie und deren Adaption im Umfeld der ›neuen Musik‹ durch eine jüngere Komponistengeneration wurde Heinz-Klaus Metzger herangezogen. Ebenso berücksichtigt wurde mit Claus-Steffen Mahnkopf ein die Tradition der Kritischen Theorie fortschreibender Komponist und Philosoph, der den Diskurs des Kritischen Komponierens in einer Vielzahl von Publikationen mitgeprägt hat. Unter den zahlreichen weiteren Diskursteilnehmer*innen ist Nonnenmann als ein Autor hervorzuheben, der – mit zeitlicher Verzögerung und somit aus bereits historischem Blickwinkel – über mehrere der betroffenen Komponisten geschrieben hat und maßgeblich an der Ausdifferenzierung des Begriffs ›Kritisches Komponieren‹ beteiligt war. Somit ist Nonnenmann in einer Doppelrolle präsent, in der sich auch andere in der vorliegenden Arbeit zitierte Autor*innen wiederfinden: Sie sind Teil des Diskurses, den sie zugleich zum Objekt ihrer Forschung machen, treten also als Akteur*innen und als Expert*innen in Erscheinung – ein Umstand, der keine unbeträchtliche methodische Herausforderung darstellt.
Die Analyseschritte
Die Arbeit setzt sich aus drei Hauptteilen zusammen, die den oben erläuterten Schritten der Diskursanalyse entsprechen: Nach einer einleitenden Befragung der problematischen Doppelrolle von Komponist und (Text)Autor nimmt Teil I zentrale Denkfiguren in den Texten Lachenmanns unter die Lupe, wobei das Hauptaugenmerk auf der diskursiven Herstellung von Bezügen zwischen Musik und Gesellschaft liegt. Ein Blick auf Parallelen von Lachenmanns Texten zu den Schriften von György Lukács und Theodor W. Adorno (Kapitel 3) führt zu grundlegenden Konzepten des Lachenmann’schen Denkens (Kapitel 4) – etwa der an Begriffen wie Welthaltigkeit, Sprachcharakter oder Transzendenz festgemachten Vorstellung von Musik als klanglichem Phänomen, dessen Gehalt die akustische Sphäre überschreitet (4.1). Die spezifischen Verknüpfungen von Musik und Gesellschaft nimmt auch Kapitel 4.2 ins Visier, in welchem Lachenmanns von Adorno entlehnter Materialbegriff als Konzept vorgestellt wird, das bereits die musikalischen Mittel selbst – unabhängig von außermusikalischen Inhalten – als inhärent gesellschaftlich begreift. Schließlich zeigt Kapitel 4.3, wie Lachenmann den Hauptakzent von der Materialebene auf die Ebene der Wahrnehmung verschiebt, die sich als eigentlicher Ort des gesellschaftsverändernden Anspruchs des Kritischen Komponierens erweist.
Fairclough und Wodak zufolge zielt die CDA darauf ab, die häufig unbewussten ideologischen Aspekte und Machtverhältnisse innerhalb von Diskursen sichtbar zu machen.90 Im Gegensatz zu akteursbasierten, mikrosoziologischen Ansätzen wie dem symbolischen Interaktionismus – aber auch anders als an Foucault angelehnte Zugänge, die sich auf die »Positivität des Diskurses«91 beschränken – sieht die CDA den Blickwinkel der Akteur*innen nicht als unhintergehbare Letztinstanz, sondern zielt auf Wissensebenen »hinter dem Rücken der Subjekte«92, die diesen möglicherweise verborgen bleiben. In Übereinstimmung mit diesem kritischen Anspruch werden in Teil II wesentliche Topoi des Diskurses auf implizite und unhinterfragt vorausgesetzte soziokulturelle Grundannahmen hin untersucht, die sich in einer Traditionslinie der bürgerlichen Kultur des 19. Jahrhunderts verorten lassen (Kapitel 5). In Zusammenhang mit Themen wie Elitismus, Universalismus oder Eurozentrismus werden Spannungen zwischen demokratischen, partizipativen und egalitären Idealen auf der einen und konservativen, hierarchischen und elitären Tendenzen auf der anderen Seite sichtbar gemacht. Auch die implizite Gewichtung von Männlichkeit und Weiblichkeit verweist auf diskursive Ausschlüsse.
Nach diesen Nahaufnahmen tritt Teil III gewissermaßen einen Schritt zurück, um einen Blick von außen auf Lachenmanns Denken und das Kritische Komponieren zu werfen. Während bisher die Texte von Lachenmann das Zentrum der Betrachtung bildeten, nimmt Kapitel 6 verstärkt die Texte über Lachenmann und deren Verhältnis zu Lachenmanns eigenen Schriften ins Visier. Die Verortung des Diskurses im sozialen Feld der ›neuen Musik‹ schafft in Kapitel 7 schließlich jenen Kontext, dem im Rahmen der CDA besondere Bedeutung zukommt, bestimmt die Position der Subjekte innerhalb des sozialen Gefüges doch auch deren Positionierung im Diskurs: »To determine whether a particular (type of) discursive event does ideological work, it is not enough to analyse texts; one also needs to consider how texts are interpreted and received and what social effects they have.«93 Da das Aufzeigen von Verbindungen zwischen dem Diskurs und anderen Elementen der sozialen Wirklichkeit ein zentrales Element der CDA darstellt, erschöpft sich diese nicht in reiner Textanalyse, sondern ist notwendig auf sozialwissenschaftliche Methoden angewiesen.94 Nachdem die Durchführung empirischer Feldforschung den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde, greife ich zu diesem Zweck auf bestehende sozialwissenschaftliche Untersuchungen zum Feld der ›neuen Musik‹ zurück. Dabei wird der Blick auch auf mögliche Diskrepanzen zwischen Diskurs und Praxis gelenkt.95 Die CDA schärft den Blick dafür, dass Diskurse stets ein Austragungsort von Machtkämpfen sind und die Vorherrschaft im sozialen Feld auf der Ebene des Diskurses erkämpft und verteidigt werden muss.
Die Arbeit schließt mit einigen grundsätzlichen Gedanken, die den Diskurs des Kritischen Komponierens im historisch gewachsenen Feld politischer Ästhetik verorten. Der Epilog richtet den Blick auf die komplexen Verstrickungen von ästhetischem und politischem Denken, die tief in der modernen Ästhetik verankert sind. Diese Reflexionen verstehen sich weniger als Zusammenfassung denn als tentativer Ausblick auf mögliche Denkrichtungen, welche über die in diesem Buch angestellten Überlegungen hinausführen.
Bei diesem Buch handelt es sich um eine überarbeitete Fassung einer Arbeit, die im November 2020 unter dem Titel Die Politik des Kritischen Komponierens bei Helmut Lachenmann. Ein Diskurs im Spannungsfeld von Musikästhetik und Musiksoziologie am Institut für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien als Dissertation angenommen wurde. Ihr Zustandekommen verdankt sich in wesentlichem Ausmaß der kritischen Unterstützung und dem stets interessierten Nachfragen meiner Betreuer, Nikolaus Urbanek und Tasos Zembylas. Das Erscheinen dieses Buches wäre nicht möglich ohne die akribische Lektüre sowie die umsichtigen Anregungen meiner Lektorin Sophie Zehetmayer. Die Arbeit ist gewachsen an zahllosen kollegialen Diskussionen – insbesondere gilt mein Dank für herausfordernde Denkanstöße und konstruktive Kritik Cornelia Szábo-Knotik, Annegret Huber, Andreas Holzer, Julia Heimerdinger, Juri Giannini, Wolfgang Fuhrmann, Tia DeNora, Marie-Agnes Dittrich und Evelyn Annuß. Bedanken möchte ich mich auch bei Angela Ida De Benedictis von der Paul Sacher Stiftung Basel für die kompetente Erschließung und die freundliche Bereitstellung von Materialien aus der Sammlung Helmut Lachenmann. Karl-Jürgen Kemmelmeyer danke ich für wertvolle Einsichten in die Diskussion über eine neue Studienordnung für das Fach Schulmusik an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, an der Helmut Lachenmann beteiligt war. Nicht zuletzt gilt mein Dank Vitali Bodnar und Therese Kaufmann für die Unterstützung bei der Veröffentlichung dieser Arbeit und deren Aufnahme in das Verlagsprogramm von mdwPress.
1Helmut Lachenmann, »Zum Verhältnis Kompositionstechnik – Gesellschaftlicher Standort« [1972], in: MaeE3,S. 93–97, hier S. 93.
2Theodor W. Adorno, »Zur gesellschaftlichen Lage der Musik«, in: Musikalische Schriften V (= GS, Bd. 18), Frankfurt a.M. 1984, S. 729–777, hier S. 731.
3Rainer Dollase, »Rezeptionseinstellungen zur Rock- und Jazzmusik nach 1968«, in: Rebellische Musik. Gesellschaftlicher Protest und kultureller Wandel um 1968, hg. von Arnold Jacobshagen u.a., Köln 2007, S. 147–156, hier S. 150.
4Cornelia Klinger, »Modern/Moderne/Modernismus«, in: Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden 4, hg. von Karlheinz Barck, Stuttgart, Weimar 2002, S. S. 121–167, hier S. 133.
5Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. Mit den Augustenburger Briefen herausgegeben von Klaus L. Berghahn, Stuttgart 2013, S. 33.
6Ebd., S. 114.
7Ebd., S. 34.
8Klinger, »Modern/Moderne/Modernismus«, S. 141.
9Peter Bürger, Theorie der Avantgarde, Frankfurt a.M. 1974, S. 44, 67.
10 Steven G. Marks, »Abstract Art and the Regeneration of Mankind«, in: New England Review 24 (2003), Heft 1, S. 53–79, hier S. 58–59.
11 Tia DeNora, After Adorno. Rethinking Music Sociology, Cambridge 2003, S. 19–20.
12Vgl. Theodor W. Adorno, »Das Altern der Neuen Musik«, in: Dissonanzen; Einleitung in die Musiksoziologie (= GS, Bd. 14), Frankfurt a.M. 32017, S. 143–167, passim.
13Jörn Peter Hiekel, »Neue Musik und Philosophie. Überlegungen anlässlich des 70. Jubiläums der Darmstädter Ferienkurse«, in: NZfM 177 (2016), Heft 4, S. 14–17, hier S. 15.
14Lorenz Jäger, Adorno. Eine politische Biographie, München 2003, S. 272–291; Rolf Wiggershaus, Die Frankfurter Schule. Geschichte, theoretische Entwicklung, politische Bedeutung, München 21987, S. 686–704.
15Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie (= GS, Bd. 7), Frankfurt a.M. 131995, S. 39.
16Nicolaus A. Huber, »Kritisches Komponieren«, in: Durchleuchtungen. Texte zur Musik 1964–1999. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Josef Häusler, Wiesbaden 2000, S. 40–42, hier S. 41.
17Rainer Nonnenmann, Angebot durch Verweigerung. Die Ästhetik instrumentalkonkreten Klangkomponierens in Helmut Lachenmanns Orchesterwerken (= Kölner Schriften zur Neuen Musik, Bd. 8), Mainz 2000, S. 156–157.
18Helmut Lachenmann, »Schönheit als Verweigerung von Gewohntem. Gespräch mit Jörn Peter Hiekel«, in: Kunst als vom Geist beherrschte Magie. Texte zur Musik 1996 bis 2020, hg. von Ulrich Mosch, Wiesbaden 2021, S. 150–163.
19Claus-Steffen Mahnkopf, »Foreword«, in: Critical Composition Today, hg. von Claus-Steffen Mahnkopf (= New Music and Aesthetics in the 21st Century, Bd. 5), Hofheim 2006, S. 7. Nono und Klaus Huber verstehe ich aufgrund anderer theoretisch-politischer Bezugspunkte eher als wesentliche Vorläufer denn als Vertreter des Kritischen Komponierens.
20Rainer Nonnenmann, »Die Sackgasse als Ausweg. Kritisches Komponieren: ein historisches Phänomen?«, in: Musik & Ästhetik 9 (2005), Heft 36, S. 37–60, hier S. 37.
21Ebd., S. 37.
22Ebd., S. 37–38.
23Ebd., S. 37.
24Reinhold Brinkmann zufolge ist Selbstreflexion »eine definitorische Kategorie der neueren Kunst überhaupt. Im Zentrum der Moderne steht Musik, die sich selbst reflektiert.« Reinhold Brinkmann, »Der Autor als sein Exeget. Fragen an Werk und Ästhetik Helmut Lachenmanns«, in: Nachgedachte Musik. Studien zum Werk von Helmut Lachenmann, hg. von Jörn Peter Hiekel u.a., Saarbrücken 2005, S. 118.
25Reiner Keller, Diskursforschung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen (= Qualitative Sozialforschung, Bd. 14), Wiesbaden 42011, S. 66.
26Helmut Lachenmann, »Selbstporträt 1975. Woher – Wo – Wohin« [1975], in: MaeE3, S. 153–154, hier S. 154.
27Nonnenmann, »Die Sackgasse als Ausweg«, S. 38.
28So kritisiert Lachenmann »die Fragwürdigkeit des politischen Anspruchs von Musik, solange sich diese um das Problem herumdrückt, ästhetische Vorprogrammierungen unserer Gesellschaft zu durchbrechen, ohne sie durch die Hintertür wieder zu bestätigen«; Heinz-Klaus Metzger sieht »das politische Engagement der Kunst […] nicht darin, dass eine Komposition den medizinisch unterversorgten Kindern der südlichen Flugverbotszone gewidmet ist, sondern das Engagement steckt in den technischen Strukturen des Kunstwerks, die auch, wenn sie nichts sagen, reden, nämlich ein Urteil sprechen und die Wirklichkeit verurteilen.« Mahnkopf wiederum lobt die Musik Brian Ferneyhoughs als »realistisch insofern, als sie den gesellschaftlichen Ausdifferenzierungen in der ›Außenwelt des Subjekts‹ Rechnung trägt, dem sie die Treue hält – durch Analogien in der Struktur, nicht durch ›billige‹ politische Bezüge.« Lachenmann, »Selbstporträt 1975«, S. 153; Martin Demmler, »Wo bleibt das Negative? Die neue Musik zwischen Verweigerung und Wohlgefallen«. Podiumsdiskussion mit Heinz-Klaus Metzger, Helmut Lachenmann, Matthias Pinscher und Max Nyffeler im Rahmen des Festivals UltraSchall Berlin 2003, in: NZfM 164 (2003), Heft 6, S. 20–24, hier S. 22; Claus-Steffen Mahnkopf, Kritik der neuen Musik. Entwurf einer Musik des 21. Jahrhunderts, Kassel 1998, S. 110.
29Josef Häusler, »Vorwort des Herausgebers«, in: Durchleuchtungen. Texte zur Musik 1964–1999. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Josef Häusler, Wiesbaden 2000, S. IX–XII, hier S. IX; Huber, »Kritisches Komponieren«, S. 40–42.
30Wiewohl näher an Lachenmann in der Beschränkung auf den immanent gesellschaftlichen Charakter der Musik.
31Mathias Spahlinger, »politische implikationen des materials der neuen musik«, in: MusikTexte (2016), Heft 150, S. 57–72, hier S. 57, 65.
32Claus-Steffen Mahnkopf, Kritische Theorie der Musik, Weilerswist 22008, S. 14–15, 34.
33Eberhart Hüppe verzeichnet im Anhang zu seinem Eintrag im Lexikon Komponisten der Gegenwart (Stand: 2006) 147 Schriften, wobei Werkeinführungen sowie ein Großteil der Radio- und Fernsehbeiträge hier noch nicht mitgerechnet sind.
34Brinkmann, »Der Autor als sein Exeget«, S. 118.
35Ulrich Mosch, »Vorwort«, in: Helmut Lachenmann, KGM, S. IX–XX, hierS. IX.
36Mit dem Komponist*innenkommentar als Textgattung hat sich Wolfgang Gratzer in einer Monografie näher auseinandergesetzt: Wolfgang Gratzer, Komponistenkommentare. Beiträge zu einer Geschichte der Eigeninterpretation, Wien 2003.
37Anton Pelinka und Johannes Varwick, Grundzüge der Politikwissenschaft, Wien u.a. 22010, S. 20–21; Colin Hay, Political Analysis, Basingstoke 2002, S. 59–71.
38Hay, Political Analysis, S. 73.
39Ebd., S. 74.
40Michel Foucault, Archäologie des Wissens, Frankfurt a.M. 1981, S. 40.
41Ebd., S. 42.
42Hubert Knoblauch, »Diskurs, Kommunikation und Wissenssoziologie«, in: Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse. Bd. I: Theorien und Methoden, hg. von Reiner Keller u.a., Wiesbaden 2001, S. 207–223, hier S. 218.
43Ebd., S. 221–222.
44Dietrich Busse und Wolfgang Teubert, »Ist Diskurs ein sprachwissenschaftliches Objekt? Zur Methodenfrage der historischen Semantik«, in: dies., Fritz Hermanns (Hg.), Begriffsgeschichte und Diskursgeschichte. Methodenfragen und Forschungsergebnisse der historischen Semantik, Obladen 1994, S. 14; zit.n. Andreas Domann, Postmoderne und Musik. Eine Diskursanalyse (= Musikphilosophie, Bd. 4), Freiburg i.Br. 2012, S. 21.
45Ebd., S. 21–22.
46Foucault, Archäologie des Wissens, S. 172.
47Lilie Chouliaraki und Norman Fairclough, Discourse in Late Modernity. Rethinking Critical Discourse Analysis, Edinburgh 2007, S. 28: »[D]iscourse theory has its dangers. Many of those who have worked with the concept of discourse have ended up seeing the social as nothing but discourse«.
48Ebd., S. vii. Unter dem Namen ›Kritische Diskursanalyse‹ hat Siegfried Jäger am Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung einen eigenständigen Zugang zur Diskursforschung entwickelt, der sich von den englischsprachigen Ansätzen der CDA unterscheidet, weswegen hier auch der englische Begriff zur Anwendung kommt. Siehe Siegfried Jäger, Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung (= Edition DISS, Bd. 3), Münster 72015.
49Vgl. Andrew Collier, Critical Realism. An Introduction to Roy Bhaskar’s Philosophy, London u.a. 1994, passim.
50 Chouliaraki, Fairclough, Discourse in Late Modernity, S. 18: »The various dimensions and levels of life – including physical, chemical, biological, economic, social, psychological, semiological (and linguistic) – have their own distinctive structures […]. Because the operation of any mechanism is always mediated by the operation of others, no mechanism has determinate effects on events«.
51Ebd., S. 1.
52Ebd., S. 28.
53Ruth Wodak, »What CDA Is About. A Summary of Its History, Important Concepts and Its Developments«, in: Methods of Critical Discourse Analysis, hg. von Ruth Wodak u.a., London 2001, S. 1–31, hier S. 3.
54 Chouliaraki, Fairclough, Discourse in Late Modernity, S. 32.
55 Norman Fairclough und Ruth Wodak, »Critical Discourse Analysis«, in: Discourse as Social Interaction, hg. von Teun Adrianus van Dijk (= Discourse Studies. A Multidisciplinary Introduction, Bd. 2), London u.a. 1997, S. 258–284, hier S. 258; Keller, Diskursforschung, S. 31: »Als ideologisch gelten Diskurse dann und insofern, wie sie (aus Sicht der kritischen Maßstäbe der DiskursanalytikerInnen) etablierte soziale Macht- und Herrschaftsbeziehungen verstärken.«
56Wodak, »What CDA is about«, S. 3.
57Chouliaraki, Fairclough, Discourse in Late Modernity, S. 22.
58Ebd., S. 1, 31.
59Vgl. Pierre Bourdieu, Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns, Frankfurt a.M. 1998, S. 18; Pierre Bourdieu, Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes, Frankfurt a.M. 62014, S. 84.
60Theodor W. Adorno, »Marginalien zu Theorie und Praxis«, in: Kulturkritik und Gesellschaft 2 (= GS, Bd. 10), Frankfurt a.M., S. 759–782; vgl. Kapitel 7.1–7.2, vgl. auch Chouliaraki, Fairclough, Discourse in Late Modernity, S. 27–29.
61Marian Füssel und Tim Neu, »Diskursforschung in der Geschichtswissenschaft«, in: Theorien, Methodologien und Kontroversen, hg. von Johannes Angermüller u.a. (= Diskursforschung, Bd. 1), Bielefeld 2014, S. 145–161, hier S. 151–152.
62Vgl. Tia DeNora, »Musical Practice and Social Structure. A Toolkit«, in: Empirical Musicology. Aims, Methods, Prospects, hg. von Eric Clarke u.a., Oxford 2004, S. 35–56, hier S. 36–37; Ann Swidler, »Culture in Action. Symbols and Strategies«, in: American Sociological Review 51 (April 1986), Heft 2, S. 273–286.
63John Dewey, Kunst als Erfahrung, Frankfurt a.M. 31998, passim.
64Wodak, »What CDA is about«, S. 11.
65Ebd., S. 2, 9–10; Fairclough, Wodak, »Critical Discourse Analysis«, S. 261; Chouliaraki, Fairclough, Discourse in Late Modernity, S. 259.
66Ebd., S. 17.
67Achim Landwehr, Historische Diskursanalyse, Frankfurt a.M., New York 22009.
68Ebd.
69Keller, Diskursforschung, S. 115.
70Domann, Postmoderne und Musik, S. 25.
71Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge, Mass.u.a. 2018, S. 575. Das Konzept ist Collingwoods Begriff der ›absolute presuppositions‹ verwandt – Vorannahmen, die im Diskurs selbst nicht verhandelt werden, sondern den Rahmen dafür vorgeben, welche Fragestellungen überhaupt möglich sind. Giuseppina D’Oro und James Connelly, »Robin George Collingwood«, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy (2006), https://plato.stanford.edu/entries/collingwood/ (Zugriff am 26. Oktober 2020).
72Ebd., S. 92f.
73Ebd., S. 105–110.
74Keller, Diskursforschung, S. 115.
75Brent C. Tabot, »Critical Discourse Analysis for Transformative Music Teaching and Learning. Method, Critique, and Globalization«, in: Bulletin of the Council for Research in Music Education (2010), Heft 186, S. 81–93, hier S. 85.
76Diese Fragen werden Keller zufolge erst im Anschluss an den dritten Analyseschritt adressiert. ebd., S. 115.
77Der Band enthält auch die beiden Vorträge »Geschichte und Gegenwart in der Musik von heute« und »Text – Musik – Gesang«, die Luigi Nono 1959 bzw. 1960 in Darmstadt hielt. Entgegen der lange vorherrschenden Annahme, dass die Texte im Wesentlichen von Lachenmann stammen, veranlasste die Aufarbeitung von Vortragsskizzen im Archivio Luigi Nono in Venedig Angela Ida De Benedictis und Ulrich Mosch jedoch zu dem Schluss, dass Lachenmann lediglich für die deutsche Formulierung verantwortlich zeichnete. Angela Ida De Benedictis und Ulrich Mosch, »Introduzione«, in: Alla ricerca di luce e chiarezza. L’epistolario Helmut Lachenmann-Luigi Nono (1957–1990), Firenze 2012, S. VII–XXIV, hier S. XIV–XV.
78Von den Texten »Zum Problem des musikalisch Schönen heute« und »Zum Problem des Strukturalismus« existieren beispielsweise jeweils fünf solcher Veröffentlichungsschritte (Skizzen und Vortragstext nicht eingeschlossen) – einschließlich je zwei Übersetzungen. Die Originalquellen sind in der Sammlung Helmut Lachenmann der Paul Sacher Stiftung Basel einzusehen.
79Gemäß dem Vorwort des Herausgebers nahm Lachenmann für die 2004 erschienene zweite Auflage zahlreiche kleinere Modifikationen vor, ohne jedoch grundlegend in den Inhalt der Texte einzugreifen. (Eine Ausnahme bildet Lachenmanns Analyse seines zweiten Streichquartetts.) Josef Häusler, »Vorwort zur 2. Auflage«, in: Helmut Lachenmann, MaeE3, S. XXVI. Für die 2015 erschienene dritte Auflage, die der vorliegenden Arbeit als Grundlage dient, wurden lediglich Werkregister, Diskografie und Anmerkungen vom Verlag aktualisiert.
80Um dies zu überprüfen, wurden am Beispiel der Aufsätze »Zur Analyse Neuer Musik« und »Zum Problem des musikalisch Schönen heute« die Textgestalten vom Typoskript, das dem mündlichen Vortrag als Grundlage gedient hatte, über die Erstveröffentlichung bis zu den Varianten in MaeE untersucht. In beiden Fällen befinden sich Unterlagen in Form von annotierten Typoskripten und Fotokopien sowie vereinzelten handschriftlichen Notizen in der Paul Sacher Stiftung Basel. Der erste Text basiert auf einem 1971 gehaltenen Vortrag, der erstmals 1973 und dann wieder in MaeE abgedruckt wurde. In diesem Fall gibt es kaum Abweichungen zwischen den Textfassungen. Der Aufsatz »Zum Problem des musikalisch Schönen heute« beruht auf einem Vortrag von 1976, der 1977 in gekürzter Form in der NMZ und der NZZ erschien und ins Englische sowie ins Spanische übersetzt wurde, bevor er in MaeE Eingang fand. In der Paul Sacher Stiftung findet sich dazu ein Vortragstyposkript, das mit der unter dem Titel »Die Schönheit und die Schöntöner« 1977 erfolgten Erstausgabe sowie mit den Fassungen in MaeE (1996/2015) verglichen wurde. Während es sich bei der Erstveröffentlichung im Wesentlichen um eine gekürzte Version jener Fassung handelt, die schließlich in den Schriftenband Eingang fand, unterscheidet sich das Vortragstyposkript in zahlreichen sprachlichen Details von den Druckfassungen. Da jene die inhaltliche Aussage meines Erachtens jedoch nicht substanziell berühren, wurde im weiteren Verlauf der Arbeit von einer Beschäftigung mit dem Archivmaterial abgesehen und die Diskursanalyse aus praktischen Gründen auf die Letztfassungen beschränkt. Helmut Lachenmann, »Zur Analyse Neuer Musik« [1973], in: MaeE3, S. 21–34; Helmut Lachenmann, Zur Analyse neuer Musik (1971). Typoskript mit handschriftlichen Korrekturen und anderen Eintragungen. Sammlung HL, PSS Basel, mit freundlicher Genehmigung; EV in: Die Wertproblematik in der Musikdidaktik, hg. von Werner Krützfeld, Ratingen 1973, S. 35–53. Helmut Lachenmann, »Zum Problem des musikalisch Schönen heute« [1977], in: MaeE3, S. 104–115; Helmut Lachenmann, Zum Problem des musikalisch Schönen heute (1976). Konvolut, Sammlung HL, PSS Basel, mit freundlicher Genehmigung; EV: Helmut Lachenmann, »Die Schönheit und die Schöntöner«, in: NMZ 26 (Februar/März 1977), Heft 1, S. 1–7; zu den weiteren Druckfassungen vgl. Elke Hockings, Jörg Jewanski und Eberhard Hüppe, »Helmut Lachenmann«, in: Komponisten der Gegenwart, hg. von Hanns-Werner Heister u.a., https://www.nachschlage.net/search/document?index=mol-17&id=17000000327&type=text/html&query.key=SBsQAdMo&template=/publikationen/kdg/document.jsp&preview= (Zugriff am 14. Juli 2020). Vgl. dazu Nonnenmann,





























