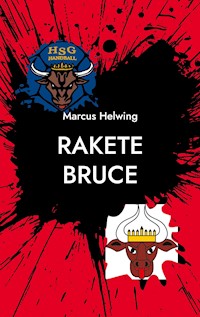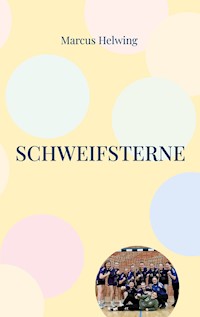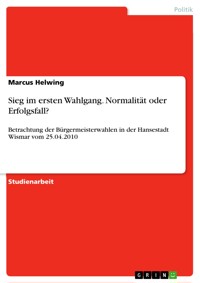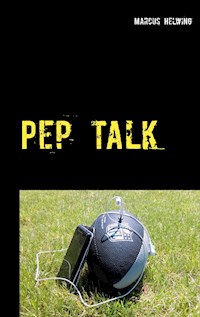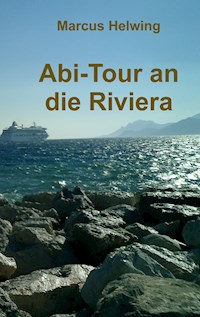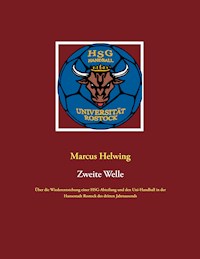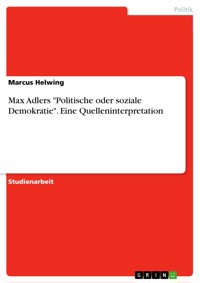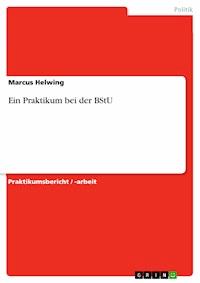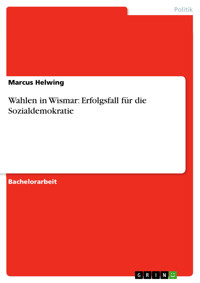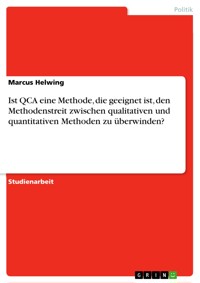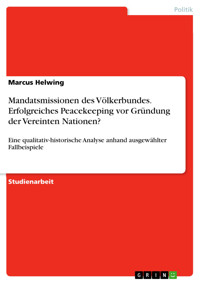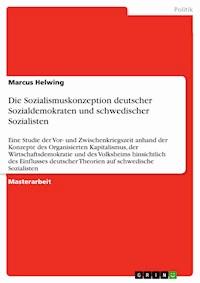15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Politik - Politische Theorie und Ideengeschichte, Note: 2,0, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Institut für Politik- und Kommunikationswissenschaft), Veranstaltung: Demokratie und Außenpolitik, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit werden die kosmopolitanistischen Positionen von John Rawls, Charles R. Beitz und Martha C. Nussbaum miteinander verglichen. Die Vorstellungen von globaler Gerechtigkeit sind hierbei unterschiedlich ausgeprägt. Während John Rawls mit seinen kontraktualistisch-liberalen Theorien die Grundlage für die Diskussion bereitet, setzen die beiden anderen Autoren an verschiedenen Punkten zur Kritik an, wobei sie die Pionierarbeit von Rawls auf diesem Gebiet nicht ungewürdigt wissen wollen. Ausgangspunkt ihres Ansatzes ist der Staat, der aus ihrer Sicht nicht mehr die Rolle des von Rawls beschriebenen Verhandlungspartners einnehmen kann. Darüber hinaus wird eine empirische Bestandsaufnahme der aktuellen globalen Situation durchgeführt. Die Stärke ökonomischer Großkonzerne und des Kapitals in einer globalisierten Weltwirtschaft führt zu einer Machtverschiebung. Diese muss bei der zukünftigen Debatte über globale Gerechtigkeit beachtet werden. Außerdem weist Nussbaum darauf hin, dass den einzelnen Individuen auch größere Bedeutung zukommen wird. Allerdings müssten diese durch, noch zu schaffende, internationale Institutionen unterstützt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Literaturübersicht
3. John Rawls – Das Völkerrecht
4. Charles R. Beitz – Gerechtigkeit und internationale Beziehungen
5. Martha C. Nussbaum – Jenseits des Gesellschaftsvertrages. Fähigkeiten und globale Gerechtigkeit
6. Vergleich
7. Schlussbetrachtung
8. Literatur
9. Eigenständigkeitserklärung
1. Einleitung
Die Kosmopolitanismusdebatte hat in den letzten Jahren, unter anderem wegen der zunehmend spürbaren Globalisierung, neuen Schub erfahren. Der Informationsfluss hat sich selbst im Vergleich zum Ende des letzten Jahrhunderts noch einmal drastisch verstärkt. Die Welt ist enger zusammengerückt, auch weil die immer größer werdenden Unterschiede der Lebensbedingungen der Menschen beständig leichter ersichtlich werden. Außerdem verlieren einzelne Nationalstaaten immer weiter an Bedeutung und supranationale Organisationen und Institutionen könnten schon in der näheren Zukunft immer größere Bedeutung erlangen. Hinzu kommt noch die stetig steigende und zunehmend undurchsichtige Rolle großer ökonomischer Komplexe, die überhaupt erst in globale Gerechtigkeitsstrukturen eingebunden werden müssen. Sofern diese schon heute vorhanden sind, bedarf es auch eines Ausbaus und einer Umgestaltung.
Aus diesen verschiedenen Gründen war es unumgänglich, auch die Theorien der globalen Gerechtigkeit weiterzuentwickeln. Trotzdem steht John Rawls am Anfang dieses Prozesses, weil er mit seiner liberalistisch-kontraktualistischen Theorie die Basis für eine Vielzahl westlicher Gerechtigkeitstheorien geschaffen hat. Dennoch erschien sein Standardwerk hierzu bereits vor fast vierzig Jahren. Die Welt hat sich in dieser Zeit verändert und jede noch so gute Theorie bedarf nach gewisser Zeit einer Anpassung. Aus diesem Grund kommen sowohl die Positionen von Charles R. Beitz und Martha C. Nussbaum mit in die Betrachtung. Die vertragstheoretische Position von Rawls steht hier verstärkt im Fokus. Vor allem seine Einschätzungen über den Verlauf von Verhandlungen und darüber, wer als Teilnehmer daran partizipieren soll. Des Weiteren wird zu erörtern sein, wie globale Gerechtigkeit in der heutigen Welt implementiert werden kann. Die Frage danach, ob der Staat hierbei auch weiterhin eine entscheidende Rolle spielt, muss differenziert betrachtet werden.
Des Weiteren ist zu erörtern, ob sich die vertragstheoretisch geprägte westliche Sicht auf Gerechtigkeitsvorstellungen adäquat mit der gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Situation auf dem Erdball auseinandersetzt. Sind allein liberal-westliche Vorstellungen prägend oder müssen auch andere Gesellschaftsentwürfe mit eingebunden werden? Können liberale Gesellschaften auch in Zukunft ihre demokratischen und liberalen Vorstellungen auf das Völkerrecht ausweiten, um die Sicherung der Grund- und Menschenrechte zu gewährleisten?
Außerdem ist zu diskutieren, in welcher Form zur globalen Gerechtigkeit weiter beigetragen werden kann. Geschieht dies in Form von Kooperationsverbänden, von Staaten, von nationalen oder internationalen Institutionen, von wirtschaftlichen Konzernen oder von einzelnen Individuen? In welchem Maße sich jeder einzelne beteiligen kann ist unter dem Aspekt der Fairness auch umstritten.
2. Literaturübersicht
Im Rahmen der Seminardiskussion über den Richtungsstreit um die Deutungshoheit in der Debatte zwischen Partikularisten und Kosmopolitisten, ging es in erster Linie darum, die ausdifferenzierten Positionen der herausragenden Theoretiker auf diesem Gebiet kennenzulernen, deutlich herauszukristallisieren und einander gegenüberzustellen. Zu diesem Zweck wurde als Grundlage der Diskussion das Buch „Globale Gerechtigkeit“, herausgegeben von Christoph Broszies und Henning Hahn, ausgewählt, weil in ihm Schlüsseltexte von verschiedenen Autoren, unter anderem Thomas Nagel, David Miller, Otfried Höffe, Thomas W. Pogge, Jürgen Habermas und Seyla Benhabib, mit divergierenden Standpunkten zur Partikularismus-Kosmopolitismus-Debatte vorgestellt werden.[1]