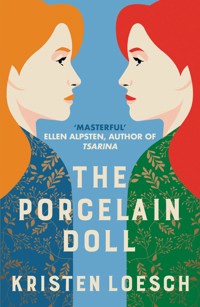3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine große Liebesgeschichte vor den Wirren der russischen Revolution Nur einen Augenblick sehen sich Tonja und Walentin in die Augen, doch an diesem Herbsttag 1915 beginnt ihre unendliche Liebe. Der Bolschewik ist genauso gefangen in seinem Leben wie die wohlhabende Ehefrau eines Fabrikanten, die von ihrem Mann immer wieder eingesperrt wird. Sie kann sich heimlich zu Walentin flüchten, aber am Vorabend der Oktoberrevolution ist die schwangere Tonja in höchster Gefahr. Walentin, schon auf den Weg zu ihr, wird in den Unruhen aufgehalten. Jahrzehnte später reist eine junge Frau aus London nach Moskau, im Gepäck das alte russische Märchenbuch ihrer Mutter und viele Fragen zu ihrer Familiengeschichte. Sie ist auf der Suche nach einer Frau, die schön sein soll wie eine Puppe. ***Folgen Sie Tonja in die Weiten der russischen Seele***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die Porzellanpuppe
Die Autorin
KRISTEN LOESCH ist in San Francisco aufgewachsen. Nach dem Studium der Geschichte und Slawistik in Cambridge hat sie sich mit Kurzgeschichten einen Namen gemacht. Nach zehn Jahren in Europa lebt sie heute mit ihrem Ehemann und den Kindern in Kalifornien.
Das Buch
Rosie ist als Kind mit ihrer Mutter aus Russland geflüchtet und hat in England ein neues Leben begonnen. Jahrzehnte später, kurz vor ihrer Hochzeit, reist sie nach Moskau, um end- lich zu verstehen, was damals geschehen ist. In ihrem Gepäck ein handgeschriebenes Buch mit russischen Märchen, das ihre Mutter ihr vermacht hat.In Moskau stößt Rosie immer wieder auf die Spuren von Tonja und Walentin, deren Liebe 1915 begann und unter schwierigsten Bedingungen jahrzehntelang bestand. Rosie ist fasziniert von Tonja, eine Frau so schön wie eine Porzellanpuppe, und den Erzählungen, die sie über sie hört. Doch Geheimnisse ranken sich um Tonja und Walentin, hat jemand ihre Liebe immer wieder sabotiert – oder geschützt? Vieles ist in den Wirren der russischen Geschichte verloren gegangen. Das Märchenbuch von Rosies Mutter scheint der Schlüssel zu sein, wie alle Geschichten zusammengehören.
Kristen Loesch
Die Porzellanpuppe
Roman
Aus dem Englischen von Silke Jellinghaus
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2022unter dem Titel »The Porcelain Doll«bei Allison & Busby, London
Das Motto ist aus: Sergej Jessenin: Gedichte. Übertragen von Karl Dedecius. C.H.Beck, 2010. S. 53Das Puschkin-Zitate aus Eugen Onegin sind aus: Deutsch von Torsten Schwanke https://de.scribd.com/document/369506191/PUSCHKIN-EUGEN-ONEGIN-odtBis auf das Zitat in Kapitel 9: Aus dem Russischen von Rolf-Dietrich Keil. https://www.russlandjournal.de/russische-literatur/jewgeni-onegin-roman-versen-von-alexander-puschkin/Die Puschkin-Gedichte (Kapitel 7) sind aus: Gedichte von Alexander Puschkin; Im Versmaß der Urschrift von Friedrich Fiedler. Philipp Reclam jun. Verlag Leipzig, 1907
© 2022 by Kristen Loesch© der deutschsprachigen Ausgabe2023 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Sabine Kwauka Umschlagmotive: © Shelley Richmond / Trevillion Images (Paar); shutterstock / Alfmaler (Blätter),Vonts (Blattadern), Leonid Ikan (Landschaft), Kichigin (Kathedrale), Serghei Starus (Schnee)Autorinnenfoto: © Samna Chheng-Mikula
ISBN: 978-3-8437-2799-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Der Brautschleier
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Das große und schreckliche Ungeheuer
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Teil 2
Der neue König
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Teil 3
Der Junge und die Wellen
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Ein Haus an einem breiten Fluss
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Teil 4
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Der Schnee war Porzellan und der Regen war Glas
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Epilog
Anhang
Anmerkungen der Autorin
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Für meine Familie»So wenig Wege sind gemacht,so viele Fehler sind begangen!«Sergej JesseninProlog
In einem fernen Königreich, in einem längst vergangenen Land lebte einst ein junges Mädchen, das sah genauso aus wie ihre Porzellanpuppe. Das gleiche rotgoldene Haar. Die gleichen Augen von rötlich dunklem Braun. Selbst des Mädchens eigene Mutter konnte sie kaum voneinander unterscheiden. Doch sie waren nie getrennt, denn das Mädchen behielt die Puppe stets bei sich, um sie vor den Händen ihrer vielen, vielen Geschwister zu schützen.
Die Familie lebte in einem blassrosa Haus am Fluss, und abends versammelten sich die Kinder gern um den alten Ofen und lauschten den Erzählungen ihrer Mutter. Erzählungen von entfernten Königreichen und längst vergangenen Ländern, in denen Könige und Königinnen in Schlössern lebten, Geschichten darüber, wie diese Schlösser ins nachtschwarze Meer gespült worden waren. Die vielen, vielen Geschwister schlummerten bei diesen Geschichten ein, und dann nahm die Mutter das Mädchen und die Puppe auf den Schoß und erzählte vom Vater des Mädchens. Er hatte dasselbe rotgoldene Haar und dieselben Augen von rötlich dunklem Braun gehabt, in einem anderen, fernen Königreich, in einem anderen, längst vergangenen Land.
Eines Abends nach dem Essen, der Ofen bullerte und der Samowar surrte und die Mutter erzählte und die Kinder lauschten, erklangen Schritte vor dem Haus. Stampf, stampf, stampf.
Es klopfte an der blassrosa Tür. Tok, tok tok.
Es ertönte die Stimme eines Mannes, die überhaupt keine Farbe hatte. Aufmachen, aufmachen, aufmachen!
Die Mutter öffnete die Tür. Zwei Männer standen da, jeder trug ein Gewehr.
»Du kommst mit uns«, sagten die Männer zur Mutter.
Die Mutter senkte den Kopf, damit ihre Kinder sie nicht weinen sahen. Aber der Samowar hörte auf zu surren und der Ofen hörte auf zu bullern und die Geschichte blieb unerzählt, und in der Stille konnten die vielen, vielen Geschwister hören, wie die Tränen ihrer Mutter zu Boden fielen. Sie rannten los, um die Männer aufzuhalten.
Halt, halt, halt!
Peng-peng-peng.
Die Geschwister fielen wie die Tränen der Mutter. Ihre Körper lagen so reglos und still da wie die Puppe im Arm des Mädchens.
»Ist das da noch eins?«, fragte der eine Mann den anderen und deutete auf das Mädchen, das am Ofen geblieben war.
»Das sind nur Puppen«, sagte der zweite Mann zum ersten.
Die Männer nahmen die Mutter mit. Ihre Schritte wurden leiser. Stampf-stampf-sta… Die Schreie der Mutter schienen weit entfernt und lange vergangen. Nein, nein, nein … Das Mädchen begann wieder zu atmen. Ein, aus, ein. Sie stand auf, die Puppe unter dem Arm, und ging über den blutroten Boden, über ihre blutroten Geschwister hinweg durch die blutrote Tür, aus dem blutroten Haus bis zum blutroten Fluss. Sie vergaß, ihre blutroten Hände zu waschen.
Aus Furcht vor diesen Männern blieb das Mädchen nicht an dem Fluss und auch nicht im Land. Aus Angst vor diesen Männern trug sie die Puppe durch all ihre Jahre, auf all ihren Reisen bei sich. Aber sie trug sie zu lange bei sich, so lange, dass sie sich und sie nicht mehr unterscheiden konnte. So lange, dass sie nicht mehr sicher sein konnte, ob sie überhaupt das Mädchen war, ob sie diejenige war, die echt war.
Teil 1
Kapitel 1
RosieLondon, Juni 1991
Der Mann, den ich hier treffen will, ist fast ein Jahrhundert alt. Es ist nur noch ein kleiner Rest von dem filmstarhaft guten Aussehen seiner Jugend übrig; mit weißem Haar, hager, sitzt er allein auf der Bühne und trommelt mit den Fingern auf seine Knie. Er legt den Kopf in den Nacken und wirft einen gestrengen Blick in die Menge, auf die Nachzügler, die unbeholfen in den Gängen stehen und verlegen lächeln. Auf das junge Paar, das seine Kinder mitgebracht hat, ein Mädchen im Kindergartenalter, das mit den Beinen baumelt, und den älteren, reglosen Jungen mit dem ernsten Gesicht. Auf mich.
Wenn sich zwei Fremde in einem überfüllten Raum in die Augen sehen, wendet normalerweise einer den Blick ab, aber keiner von uns tut das.
Alexej Iwanow wird heute Abend aus seinen Memoiren lesen, dem schmalen Buch mit dem roten Umschlag, das auf dem Tisch neben seinem Sessel liegt. Ich habe es inzwischen so oft gelesen, dass ich zu seinen Worten lautlos die Lippen bewegen könnte: Ein Hügel verschwindet aus dem Blickfeld, und auch die Stimmen verklingen … wir sind wie Schiffbrüchige, die auf einem einzelnen Wrackteil in Richtung Meer treiben und alles zurücklassen, was uns mit der Menschheit verbunden hat …
Alexej erhebt sich. »Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind«, sagt er mit messerscharfem Akzent. »Und nun will ich beginnen.«
Der letzte Bolschewik ist ein Bericht über seine Zeit auf Stalins Weißmeerkanal, erzählt in Form von Kurzgeschichten, damit man beim Lesen nicht vergisst zu atmen. Heute hat Alexej die Geschichte des zum Scheitern verurteilten Einsatzes eines Arbeitstrupps ausgewählt, der in eine düstere winterliche Wildnis aufbricht, um eine Straße zu bauen, die nie jemand befahren wird. Die Gruben, die die Gefangenen ausheben, sind für sie selbst bestimmt. Sie sollen zu ihrem eigenen Grab werden.
Meine Hände fühlen sich feucht und schwer an, und meine Zehen beginnen in den Stiefeln zu kribbeln. Der Mann mittleren Alters, der neben mir sitzt, zieht seinen Mantel fester um sich, und das kleine Mädchen weiter vorne baumelt nicht mehr mit den Beinen, sondern sitzt mit ebenso durchgedrücktem Rücken da wie ihr älterer Bruder. In einem Vorlesungssaal voller Menschen hat Alexej Iwanow jedes Geräusch zum Verstummen gebracht. Er ist am Ende der Geschichte angelangt und klappt das Buch zu. »Ich stehe für Fragen zur Verfügung«, sagt er.
Leises Füßescharren ist zu hören. Irgendwo im Hintergrund hustet jemand und ein Baby beginnt zu wimmern, gefolgt von dem beruhigenden Schsch der Mutter. Alexej macht gerade Anstalten, sich in seinen Sessel zurückzulehnen, da hebt der Mann neben mir plötzlich die Hand.
Alexej lächelt breit und deutet auf ihn. »Fangen Sie an.«
»Meine Frage ist ziemlich persönlich«, sagt mein Nachbar mit breitem schottischem Zungenschlag. »Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus …«
»Bitte sehr.«
»Sie haben diese Memoiren jemandem gewidmet, den Sie bloß Kukolka nennen. Bestünde die Möglichkeit, dass Sie uns verraten, um wen es sich dabei handelt?«
Das Lächeln verschwindet aus Alexej Iwanows Gesicht. Ohne dieses Lächeln sieht er nicht mehr aus wie der berühmte Dissident und Schriftsteller, der gefeierte Historiker. Er ist nur noch ein alter Mann, gebeugt unter der Last von über neun Jahrzehnten Leben. Er blickt sich erneut im Saal um, und da stößt das Baby irgendwo in unserer Mitte einen weiteren erschrockenen Schrei aus. Alexejs Blick bleibt eine halbe Sekunde lang an mir hängen, bevor er weitergleitet.
»Ihren Namen spreche ich niemals laut aus«, sagt er. »Und wenn ich es täte, würde ich ihn schreien.«
Ich verlasse meine Sitzreihe und gehe auf die Bühne zu. Das Publikum zerstreut sich, aber Alexej schüttelt noch immer Hände und plaudert mit den Organisatoren. Ich habe alle seine Schriften gelesen, meist zusammengekauert in einem Lesesaal der Bodleian Library, und das Ergebnis dieser muffigen Stunden in vollkommener Stille ist: Egal, wie menschlich der Mann auch aussieht, Alexej Iwanow ist für mich zu einer beinahe mythischen Figur geworden. Zu einer Legende.
»Hallo Sie«, sagt er und wendet sich mir zu. Sein Lächeln ist wie das Licht einer Fackel.
»Ich habe Ihre Lesung sehr genossen, Mr Iwanow«, sage ich, als ich meine Stimme wiedergefunden habe. Vielleicht ist genießen nicht das richtige Wort, aber er nickt. »Ihre Geschichte ist inspirierend.«
Ich hatte mir vorgenommen, das zu sagen, aber erst, nachdem ich es ausgesprochen habe, merke ich, wie ernst ich es meine.
»Ich danke Ihnen«, sagt er.
»Ich heiße Rosemary White. Rosie. Ich habe in Oxford Ihre Ausschreibung gesehen. Dort bin ich Doktorandin.« Ich huste. »Sie suchen für den Sommer eine wissenschaftliche Mitarbeiterin?«
»So ist es«, sagt er freundlich. »Jemanden, der mit mir nach Moskau kommen kann.«
Ich lockere den Griff um meine Handtasche. »Ich würde mich gerne bewerben, falls die Stelle noch frei ist.«
»Das ist sie.«
»Ich habe nicht viel Erfahrung auf Ihrem Gebiet, aber ich spreche fließend Russisch und Englisch.«
»Am Donnerstag bin ich in Oxford«, sagt er. »Wollen wir uns dort verabreden? Ich würde Ihnen gerne mehr darüber erzählen.«
»Unbedingt, danke. Nur fahre ich morgen nach Yorkshire, um die Großmutter meines Verlobten zu besuchen. Sie lebt allein. Wir besuchen sie einmal im Monat.« Ich bin mir nicht sicher, warum ich das alles hinausplappere. »Am Wochenende bin ich zurück.«
»Gut, dann dieses Wochenende«, sagt er. Seine Stimme klingt sanft. Um uns herum sind als angenehmes Summen Menschen zu hören, die sich unterhalten und scherzen, aber etwas in Alexejs Augen löst in mir plötzlich das Verlangen aus, mich gegen einen schneidenden Wind zu stemmen. Vielleicht ist der Textauszug, den er gerade vorgelesen hat, vielleicht sind die Einzelheiten über das Weiße Meer, die verlassenen Straßen, jene langen Winter in meinem Gedächtnis noch zu frisch. Vielleicht sehen die Leute, wenn sie ihn anschauen, immer nur diese Dinge.
Die Zeit, zu der meine Mutter schlafen geht, ist schon vorbei, als ich in ihre Wohnung zurückkehre, aber aus ihrem Zimmer dringt ein leises Stöhnen.
Ich klopfe an ihre Tür. »Mum? Bist du wach?«
Das Schlafzimmer meiner Mutter ist schmuddelig und düster, und sie passt perfekt hinein. Ungewaschen und reglos sitzt sie im Bett, gegen die Kissen zusammengesackt, und verströmt in Wellen den Moschusgeruch von Wodka. Ich besuche sie mindestens einmal im Monat und bleibe ein oder zwei Nächte bei ihr in London. In letzter Zeit habe ich sie häufiger besucht, aber wenn überhaupt scheint sie mich seltener zu erkennen. Mum hat immer weiter getrunken, selbst als die Ärzte sagten, dass ihre Leber dabei war zu versagen. Jetzt gerade ist sie wieder betrunken.
»Ich war bei einer Lesung«, sage ich. »Hast du auf mich gewartet?«
Ihre gelblichen Augen huschen durch den Raum, bevor sie mich direkt vor ihrer Nase entdeckt.
»Na dann, gute Nacht.« Ich stelle die Tablettenspender auf ihrem Nachttisch wieder auf und wische mir die Hände an der Hose ab. »Soll ich dich morgen früh wecken?« Ich halte inne. »Ich fahre gleich morgens nach York, schon vergessen?«
Sie zieht die knochigen Wangen ein und beginnt Halt suchend nach ihrer Decke zu greifen. Sie will, dass ich näher komme. Ich setze mich vorsichtig an das Fußende des Bettes.
»Raisa«, murmelt sie.
Raisa. Mein Geburtsname. Inzwischen fühlt er sich eher an wie etwas, das ich in Russland zurückgelassen habe, zusammen mit meinen Kleidern, meinen Büchern und allem anderen, was mich ausgemacht hat. Meine Mutter ist die Einzige, die ihn benutzt.
Wenn sie stirbt, wird sie ihn mit sich nehmen.
»Ich weiß, was du vorhast.« Ihr Atem geht stockend.
»Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.«
»Doch, hast du.« Ihr Blick sucht den meinen, aber sie kann ihn nicht halten. »Du versuchst, nach Moskau zu fahren.«
»Woher weißt du …«
»Ich habe dein Telefonat mit der Botschaft mitgehört. Warum verweigern sie dir die Einreise? Liegt es an deinem Studienfach?« Sie versucht zu lachen. »Ich hoffe, sie lassen dich nie rein.«
»Es liegt an dem Chaos mit den Papieren, das du angerichtet hast, als wir hierhergezogen sind«, sage ich widerborstig. »Ich wollte schon immer einmal zurückkehren, um es zu sehen. Ich dachte, es ist eine gute Idee, wenn ich das mache, bevor Richard und ich heiraten. Um es hinter mich zu bringen.«
»Du lügst, Raisotschka. Du wirst diesen Mann suchen.«
Sie muss betrunkener sein als jemals zuvor, da sie diesen Mann erwähnt. Vor vierzehn Jahren, als unser klappriger Aeroflot-Flieger in den tiefroten Himmel in Richtung London abhob, brachte ich den Mut auf, sie nach ihm zu fragen. Meine Mutter starrte nur geradeaus. Das war ihre Antwort: Dieser Mann existierte nicht. Ich hatte es nur geträumt. Vielleicht habe ich sogar alles geträumt.
»Falls du jetzt fährst, bin ich nicht mehr da, wenn du zurückkommst«, sagte sie.
»Mum, bitte sag so etwas nicht. Und wenn du uns einfach lassen …«
»Du meinst, ihn lassen. Ihn mit seinem ganzen Geld. Er hält sich für etwas Besseres, für besser als mich.«
»Was? Sprichst du von Richard? Richard hält sich nicht …«
»Die Puppen.« Ihre Pupillen weiten sich. »Was hast du mit meinen Puppen vor, wenn ich tot bin?«
Jetzt spricht definitiv der Wodka aus ihr. Puppen? Ich habe noch nie darüber nachgedacht, was ich mit ihrer Sammlung alter Puppen aus Biskuitporzellan machen werde. Sie sind wie eine Armee von Untoten mit ihren starren Gesichtern, den blicklosen Augen. Zum Glück lagern sie auf einem Regal im Wohnzimmer, sonst wären sie Zeugen dieser Unterhaltung. Meines Zauderns. Wenn sie ein paar gekippt hat, setzt sich Mum oft dazu und unterhält sich mit ihnen.
»Ich weiß es nicht«, sage ich, aber sie ist schon eingenickt.
Um halb neun Uhr morgens schläft Mum noch immer. Ihr Gesicht ist nass von Schweiß, aber sie wirkt so entspannt, so ausgeruht, sie könnte über Nacht auch einfach gestorben sein. Ich taste an ihrem Handgelenk nach dem Puls, der ganz schwach ist, und will dann auf ihrem Nachttisch die Tablettenbehälter aufrichten – sie stößt sie immer um, auf der Suche nach etwas, an dem sie sich festhalten kann – , aber das Tischchen ist abgeräumt worden. Keine Döschen. Auch keine zerknitterten Pfundnoten und keine Flaschen. Alles, was da liegt, ist ein ledergebundenes Notizbuch.
Es ist auf einer Seite aufgeschlagen, die so verwittert ist wie meine Mutter.
Ich spüre einen Anflug von Nervosität, als ich mich darüber beuge. Die kyrillische Handschrift ist ein unentzifferbares Gekrakel. Eine Handschrift ist nicht mit der Blockschrift in gedruckten russischen Büchern oder auf Straßenschildern zu vergleichen. Ich kann die ersten paar Zeilen entziffern:
Hinweis für den LeserDiese Geschichten sollten nicht der Reihe nach gelesen werden.
»Raisa?«
»Mum«, sage ich und richte mich ruckartig auf. »Ich habe mir gerade – was ist das? Du hast deine Geschichten aufgeschrieben?«
Sie greift nach mir, und ich nehme ihre Hand.
»Ich …« Irgendetwas, vielleicht Galle aus ihrer Leber, steigt meiner Mutter in den Hals und schneidet ihr die Stimme ab. »Ich … für dich, Raisotschka. Nimm es mit. Lies es, bitte. Versprich es mir.«
»Ich verspreche es. Lass mich dir Wasser holen, Mum.« Ich versuche mich loszumachen, aber jetzt ist sie diejenige, die meine Hand festhält. Meine Handfläche fühlt sich an ihrer klebrig an.
»Ich … entschuldige …«
Ich möchte mich auch entschuldigen. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich diejenige bin, die hier mit ihr gestrandet ist. Es tut mir leid, dass sie mich nicht zurücklassen konnte, denn wenn sie das getan hätte, wäre es ihr vielleicht möglich gewesen, auch diesen Mann zurückzulassen. Aber ich habe zu viel Übung darin, Dinge nicht laut auszusprechen. Das habe ich von Mum selbst gelernt. Jetzt kann ich es nicht mehr verlernen. Alles, was jemals ungesagt geblieben ist, hängt zwischen uns in der Luft, so penetrant wie der Geruch von Verfall, der von dem seltsamen kleinen Notizbuch ausgeht. Oder vielleicht auch von dem, was von meiner Mutter übrig ist.
»Versprich es«, sagt sie wieder.
»Ich verspreche es.«
»Ich liebe dich, kleine Sonne.« Ihre Augen schließen sich, bis sie nur noch einen Schlitz geöffnet sind. »Müde …«
»Mum?«
Sie lässt meine Hand los, immer noch vor sich hin murmelnd.
Als der Zug aus King’s Cross hinausrollt, lehne ich die Stirn an die Scheibe. Richard ist bereits in York. Es wird eine ordentlich lange Fahrt bis zu dem Cottage, in dem seine Großmutter lebt. Es steht, fast schwebt es, mitten im Nichts der Moorlandschaften des Nordens. Dort werden Richard und ich im Herbst heiraten. Mum ist nie dort gewesen, aber ihr würde sehr gefallen, wie das Haus an einem Tag schroff und zornig, am nächsten anheimelnd und windumtost aussieht. Wie eine Landschaft aus ihren Geschichten.
Ich habe ihr Notizbuch in meiner Handtasche. Ich werde mein Versprechen halten. Aber ich habe ihre Geschichten immer gehasst.
Sie sind das Einzige an ihr, was nach einem kräftigen Schluck lebendiger und nicht weniger lebendig wird. Eigenartige kleine Vignetten, Miniaturmärchen, oft mit einer albtraumhaften Wendung. Sie beginnen alle mit einer Version ihrer Lieblingsphrase: Weit entfernt und vor langer Zeit. Diese Phrase ist kein Zufall. Das meiste an meiner Mutter ist weit entfernt und lange her.
Als Charlotte uns zeigt, wo die Musiker aufbauen werden, und uns mit leichtem Schnauben anweist, uns nicht auch nur in die Nähe ihres Rosengartens zu wagen, weht ein kühler Luftzug vorbei. Ich erschauere, und Richards Großmutter blickt mich mit einem ebenso kühlen Lächeln an.
»Entspricht das nicht deinen Vorstellungen?«, fragt sie.
»Doch, es ist – es ist wunderschön.«
Richard schlüpft aus seinem Mantel und legt ihn mir um die Schultern. Wir nähern uns dem Haus von der Rückseite her. Charlottes Hund, eine knöchelhohe Art von Terrier, springt neben der Tür kläffend auf und ab wie ein mechanisches Spielzeug. Charlottes Lippen sind zusammengepresst. Ihr Hund ist normalerweise auf den Kissen im Wohnzimmer anzutreffen, wo er an einem Trog voller Leckerlis schnüffelt. Er gehört nicht zu der Sorte Hund, die aus freiem Willen nach draußen entschlüpft. Die meisten Menschen würden ihn nicht einmal einen Hund nennen.
»Hast du ihm heimlich Kaffee verabreicht?«, frage ich Richard scherzhaft. »Oder etwas …«
Knoblauch.
Knoblauchgeruch hängt in der Luft und wird von dem frischen Wind weiter verbreitet, als es sonst vielleicht der Fall gewesen wäre. Einen Moment lang befürchte ich, dass ich es bin, da ich gerade eine Woche bei meiner Mutter verbracht habe, denn meine Mutter fügt allem, was sie isst, Knoblauch hinzu. Vielleicht sogar ihren Getränken. Als Teenager habe ich deswegen immer abfällige Bemerkungen gemacht: Gab es, als du ein Kind warst, eine Knoblauchknappheit oder so? Und sie lachte darüber, als machte ich Scherze, nicht, als wäre sie sauer.
Ich habe keine Scherze gemacht.
»Ro? Alles in Ordnung?«, fragt Richard.
»Sind es die Rosen?«, erkundigt sich Charlotte. »Sie duften sehr stark.«
»Mir ist nur kalt, glaube ich.«
Der Hund heult immer noch und klingt jetzt richtiggehend geistesgestört.
»Ich weiß nicht, was mit ihm los ist.« Charlotte legt eine Hand auf die Brosche an ihrem Revers. »Würdest du ums Haus gehen, Richie? Es könnte jemand gekommen sein.«
Ich kuschel mich in Richards Mantel. Es ist schon jemand da, direkt dort am Hintereingang. Ein Gast, der den Hund aus seinem Morgenschlaf geweckt hat, der uns wahrscheinlich dabei beobachtet hat, wie wir durch Charlottes Garten geschlendert sind. Ein Gast, der auch in Oxford oft da ist.
Zoja.
Richard entfernt sich. Der Hund beruhigt sich und scheint befriedigt, dass sein Aufstand eine Reaktion hervorgerufen hat.
»Ich habe das Gefühl, dass mit dir heute etwas nicht stimmt, Rosie«, sagt Charlotte. »Du bist nicht du selbst.« Sie gibt ein Ts-ts von sich.
Dieser Laut ist das, was sie von mir denkt, in einem Geräusch zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob sie sich je hat träumen lassen, dass ihr Lieblingsenkel mit jemandem wie mir enden könnte, aber wahrscheinlich findet sie auch, dass es hätte schlimmer kommen können. Ts-ts.
Ein weiteres Ts-ts in meine Richtung, weil ich nicht sofort geantwortet habe. Ich versuche sie anzulächeln, aber sie unternimmt ihrerseits keinen Versuch, mein Lächeln zu erwidern. Was will sie von mir hören, eine Entschuldigung dafür, dass ich heute nicht ich selbst bin? Welche Rosie ist schon sie selbst? Rosie, die nicht immer Rosie geheißen hat? Manchmal blitzt bei Charlotte etwas auf, das mich argwöhnen lässt, sie könnte vermuten, dass mit meiner Geschichte etwas nicht stimmt. Aber sie ist diejenige, die sich in ein abgeschiedenes, rosengärtnerndes Witwenleben zurückgezogen hat, weit abseits von allen, die sie kennt, von ihrem alten Leben als Ehefrau. Vielleicht stimmt auch an ihrer Geschichte etwas nicht.
»Es ist wegen meiner Mutter. Es geht ihr nicht gut«, sage ich.
Charlotte strafft sich. »Ja, natürlich. Richard hat es erwähnt. Was für eine fürchterlich schwierige Situation für deine Familie. Ist deine Mutter religiös?«
»Sie hat ihre Überzeugungen«, sage ich. »Sie glaubt an die Seele.«
Einst war Mum fest entschlossen, auch mich und Zoja an die Seele glauben zu lassen. Sie versuchte uns zu zermürben, Abend für Abend saß sie an unserem Bett und strich ihr Lieblingsnachthemd glatt, das einzige, das sie heute noch trägt. Einige ihrer die menschliche Seele betreffenden Behauptungen waren mit fest gefügten moralischen Lektionen verbunden. Bei anderen handelte es sich um morbiden Aberglauben, wie ihn Schulkinder auf dem Schulhof von sich geben.
Ich habe damals nichts davon geglaubt.
Der Hund schweigt jetzt eisig.
»Niemand«, vermeldet Richard und schlendert auf uns zu. »Wollen wir reingehen?«
Charlotte bückt sich mit beeindruckender Beweglichkeit und nimmt ihr Haustier hoch. Sein Schwanz klopft wie ein Metronom gegen ihren Arm. Bevor ich ihr folgen kann, weht mich wieder der Knoblauchgeruch an, jetzt vermischt mit dem Geruch von Wodka. Eine mächtige Kombination.
Diese besondere Kombination, die Mum ausströmt wie Radioaktivität.
Mein Frühstück dreht sich mir im Magen um und droht mir hochzukommen. Mums Volksglauben zufolge gibt es nur eine feste Regel: Nach dem Tod muss die Seele all die verschiedenen Orte besuchen, an denen der lebende Mensch jemals gesündigt hat.
Hat Zoja nicht überall gesündigt außer direkt hinter meinem Rücken?
Spät am Abend ruft Mums Nachbar aus London an. Mum ist gestorben. Er hat ihr wie immer die Einkäufe gebracht und es einfach gespürt, sagt er. Ich würde ihn gern bitten, noch einmal nachzusehen, weil man Mum schon seit ein paar Jahren für tot halten könnte, aber ich tue es nicht. Ich krieche ins Bett und denke über dieses winzige, efeubewachsene Haus nach und die Moorlandschaft ringsum, die sich in alle Richtungen ausdehnt, wild und öde, die von nirgendwoher kommt und niemandem gehört.
In London gibt es keine Beerdigung, keine Zeremonie außer der Einäscherung. Mum hatte keine Freunde. Sie kannte niemanden, der nicht dafür bezahlt wurde, sie ebenfalls zu kennen. Ich nehme ihre Asche in einer unscheinbaren Urne mit und lehne Richards Angebot ab, noch zu bleiben und mir zu helfen.
Ich werde nur noch einen Tag hier sein, sage ich, weil ich am Wochenende wieder in Oxford sein muss.
Ich versuche ihre Wohnung aufzuräumen. In der Küche fange ich mit ihren grässlichen Gläsern voll selbst eingelegtem Gemüse an, das ich sie nie habe anrühren sehen. Als Nächstes nehme ich mir das Wohnzimmer vor, aber die Glasaugen ihrer Puppen folgen mir, als warteten sie nur darauf, dass ich ihnen den Rücken zukehre. Also beschließe ich, mich um sie das nächste Mal zu kümmern, und öffne stattdessen alle Fenster, um etwas von der abgestandenen, wodkagetränkten Luft hinauszulassen. Um Mums Seele hinauszulassen.
Ich habe einfach keine Ahnung, was ich mit ihren Sachen anfangen soll. Und soll ich die Urne einlagern? Oder aufstellen?
Wenn ich ihre Asche verstreuen wollte, dann auf der Bühne des Bolschoitheaters, über die Köpfe der Musiker hinweg, zu Bravorufen aus jeder Loge. Meine Mutter war im Ballettensemble, bevor sie heiratete – bevor meine Schwester und ich auf die Welt kamen und ihr jede Chance auf eine Beförderung zur Primaballerina verdarben – , und sie hat wahrscheinlich immer gehofft, auf der Bühne zu sterben, mitten im Plié. Zoja und ich haben sie morgens beim Üben immer veralbert. Wir stolperten über unsere eigenen Füße, wenn wir versuchten, neben ihr her en pointe zu gehen.
Katerina Ballerina.
Später treffe ich mich mit ihrem Anwalt. Er hat ein schickes Büro und ein sympathisches Lächeln. Er eröffnet mir, dass sie mir die Wohnung hinterlassen hat. Sie gehört jetzt mir. Das kann nicht sein, sage ich und versuche mit ihm darüber zu diskutieren. Richard und ich haben dafür Miete bezahlt. Wir schicken ihr alle drei Monate einen Scheck.
Vor meinem inneren Auge erscheint das Bild von gehorteten Schecks, eingemacht in Einmachgläser.
Ihr Anwalt hat Mitleid mit mir. Ich höre es seiner Stimme an. Er hat einen vornehmen Akzent, wie Richard, einen, mit dem man Glas schleifen könnte. Er könne mir die notarielle Besitzurkunde zeigen, sagt er. Katherine White, eine Immobilienbesitzerin. Einen Augenblick denke ich, ach so, das ist es. Er hat die falsche Person erwischt. Meine Mutter hieß nicht Katherine White. Sie hieß Jekaterina Simonowa. Katerina Ballerina.
Richard steht ohne Schirm im Regen, den Collegeschal um den Hals, die Hände in den Hosentaschen. Ich steige aus dem Bus und blicke missbilligend zu dem dunklen Himmel auf, der steif und flach über ganz Oxford liegt. Ein Regentropfen landet auf meinen Wimpern. Ich habe mich immer gefragt, ob sich Mum England ausgesucht hat, weil es so farblos ist. Weil sie nicht wollte, dass es mit ihrem alten Leben konkurrieren kann.
Er küsst mich sanft auf den Mund. »Du bist ja schon so schnell zurück.«
»Ich habe es da keine Sekunde länger ausgehalten«, sage ich. »Alles andere regele ich ein andermal.«
»Wollen wir etwas essen gehen?«
In dem kleinen Lokal an der Ecke schäle ich mich aus meinen nassen Schichten und fröstele. Richard leiht mir seinen Schal, der nach ihm riecht, nach Holz und Asche und Sherry.
»Wie fühlst du dich?«, fragt er, als das Essen kommt.
»Mir geht’s gut. Ehrlich.« Ich steche mit der Gabel in einen breiigen Berg von Erbsen. Richards Mutter ist vor fünf Jahren beim Tee bei Fortnum & Mason anmutig an einem Hirnaneurysma gestorben. Es ist fast schwer, nicht neidisch zu werden, wenn ich mir vor Augen halte, dass sich Mums Zustand beinahe ein ganzes Jahrzehnt über immer weiter verschlechtert hat. Manchmal hat es sich so angefühlt, als würde sie in diesem Zustand ewig leben.
»Und wie ist es bei dir?«, frage ich mit halb vollem Mund.
»Das Übliche. Dad hat gestern angerufen und wollte wissen, ob ich schon fertig bin.« Richards Vater scheint es amüsant zu finden, dass sein Sohn einen Doktor in Klassischer Philologie macht, so als müsste Richard das erst aus seinem System bekommen, bevor er in der City an der Börse anfangen kann oder was auch immer Männer in seiner Familie sonst so tun. »Er ist immer noch sauer, weil sich Henry und Olivia getrennt haben«, fügt Richard hinzu und meint damit seinen älteren Bruder und dessen langjährige Freundin. »Ich habe ihm nicht gesagt, dass Henry vorhat, seinen Job zu kündigen, um diesen Sommer durch Europa zu reisen.«
»Ach, was den Sommer angeht.« Ich schlucke mühsam. »Ich überlege, mich für ein Projekt in Moskau zu bewerben.«
Seine Augenbrauen heben sich. »Ich weiß, du wolltest einige Zeit dort verbringen, aber bist du dir sicher? Hast du mit Windle gesprochen?«
»Du weißt doch, wie er ist. Ich mache es wieder gut, wenn ich zurück bin. Es wird ihm nichts ausmachen.«
»Ich wünschte, meinem Doktorvater würde es auch nichts ausmachen.« Richard gluckst. »Aber wärst du rechtzeitig zu unserer Hochzeit wieder zurück?«, fragt er halb im Scherz. Er klingt nicht verärgert, aber Richard ist selten verärgert. Seine Robustheit, seine Zuverlässigkeit und die Tatsache, dass er immer derselbe ist, haben ihn mir von Anfang an ans Herz wachsen lassen. In Richards Welt sterben die Menschen reinlich an Hirnaneurysmen. Sie zerstören sich nicht selbst. In Richards Welt ist es ein Schock, wenn die Jugendliebe dann doch nicht die Liebe für das ganze Leben ist.
»Rede keinen Quatsch.« Die Erbsen in meinem Mund schmecken wie kleine Gummistücke. Irgendwie habe ich gewusst, dass Mum an unserer Hochzeit nicht dabei sein würde, als wir den Termin festgesetzt haben. Vielleicht habe ich den Termin absichtlich in für sie unerreichbare Ferne gelegt, weil ich befürchtet habe, dass sie mit knallrotem Gesicht erst zu spät kommen und dann während der Zeremonie anfangen würde zu schnarchen, die Arme und Beine über die Stühle anderer Gäste geworfen, wie ein Geschirrtuch über ihrem eigenen Stuhl hängend. Dass sie immer noch im Nachthemd sein würde.
»Ich brauche in Moskau sowieso etwas mehr Zeit«, füge ich hinzu. »Du weißt schon. Um Mums Freunden und Familie Bescheid zu sagen?« Ich habe keine Vorstellung davon, was Menschen normalerweise tun, wenn jemand stirbt. Aber normalerweise haben Menschen andere Menschen.
Ich schaufle mir noch mehr Erbsen in den Mund.
»Was ist das für eine Aufgabe in Moskau?«, fragt Richard. »Es gibt doch eine ziemlich berühmte Universität dort, stimmt’s, wie heißt sie noch …«
»Lomonossow. Es ist im Grunde bloß eine Idee.«
Richard senkt den Blick auf sein Gericht, das in einem früheren Leben vielleicht ein Shepherd’s Pie gewesen ist. Ich kann sehen, wie er versucht, es von den Rändern her zu zerlegen. Er schiebt einen Klumpen Pie herum und räuspert sich. »Warum komme ich nicht mit?«
»Du hast doch gerade erst mit deiner Doktorarbeit angefangen.« Die Erbsen liegen mir wie Blei im Magen. »Du hast so viel zu tun. Und vielleicht muss ich … ich weiß nicht. Ich muss eine Weile von hier weg.«
»Ist es wirklich nur das?«
»Es ist nur das.« Wenn Richard bloß noch ein paar Monate durchhält, dann müssen wir nie wieder über Mum oder Russland sprechen. Es wird ein stiller Zusatz zu meinem Ehegelübde werden: Zu lieben. Zu ehren. Rosie zu sein und nicht mehr Raisa, nie wieder.
»Also, ich werde dich vermissen.« Möglicherweise hat er Schuldgefühle, denn er fügt hinzu: »Ich verstehe dich. So lange gab es nur dich und Katherine, nur euch beide.«
Nur uns beide. Er hat ja recht. Warum hat es sich dann immer so angefühlt, als hätte ich in einer einzigen Nacht in Moskau meine ganze Familie verloren? Als wäre auch Mums Blut dort auf unserem Wohnzimmerboden vergossen worden? Oder zumindest ihr Herzblut, denn sie hat nie wieder Ballett getanzt, nachdem wir Sowjetrussland verlassen hatten. Übergelaufen sind, hätten die Leute damals gesagt, aber wir sind nicht übergelaufen. Wir sind entkommen. Wir sind geflohen.
Das Läuten der Glocken vom Turm einer nahe gelegenen Kapelle klingt gespenstisch. Die Glocken läuten in Oxford schon seit Jahrhunderten. Genauso lange kommen mir meine Nächte oft vor.
Neben mir bewegt sich Richard, aber ich rühre mich nicht. Ich leide seit Jahren an Schlaflosigkeit, und oft fühle ich mich nachts so wach wie sonst nie. Mein Vater hätte das verstanden. Er hat oft bis spät in die Nacht hinein gearbeitet, Arbeiten korrigiert, Turnübungen gemacht. Meine Mutter hat es darauf geschoben, dass er Mathematiker war. Es ist nicht gut, wenn einem ständig Zahlen durch den Kopf gehen, hat sie gesagt, denn sie nehmen kein Ende.
Aber wenn es Zahlen sind, die mich wach halten, dann sind es keine besonders hohen.
Eins, zwei.
Heute Nacht denke ich an Alexej Iwanow, den ich morgen treffen werde, und daran, wie viel er und ich gemeinsam haben. Der letzte Bolschewik ist in den späten Siebzigerjahren in Europa erschienen und in Russland prompt verboten worden, was ihn dazu zwang, zu seiner eigenen Sicherheit ins Ausland zu gehen. Doch seit 1985 hat sich unter Michail Gorbatschow in der UdSSR so vieles verändert. Die Ära der politischen Verfolgung scheint vorüber. Alexejs Memoiren sind letztes Jahr in seinem Heimatland offiziell veröffentlicht worden. Er wird von der sowjetischen Regierung umworben, und man hat ihm sogar die Staatsbürgerschaft wieder angeboten.
Ich könnte zu ihm sagen: Sehen Sie, auch für mich musste etwas aufhören, damit ich zurückkehren kann.
In meinem Fall handelte es sich um Mum.
Richard hebt den Kopf vom Kissen und blinzelt schläfrig. Er ist daran gewöhnt, dass ich hellwach und eulenhaft in der Dunkelheit liege. Bevor ich etwas sagen kann, küsst er mich daunenweich auf die Wange. Richards Berührung ist immer sanft, immer freigiebig. Hier bist du sicher, sagt er mir auf seine Art, und bald weichen alle Gedanken an Mum und Russland in die Schatten zurück.
Später läuten zur vollen Stunde wieder die Glocken. Ich versuche, mit ins Kissen vergrabenem Gesicht zu schlafen. In Moskau wird Richard nicht da sein. Nur die Schatten.
Das Café, das Alexej ausgesucht hat, ist gemütlich und nur spärlich erleuchtet, die Gäste sind vornehmlich Universitätsangestellte und Studenten. Die entspannte Atmosphäre passt zu ihm. Das meiste von dem, was er tut, wirkt entspannt, wie er sich auf seinem Stuhl zurücklehnt, gegen das Etikett seines Teebeutels schnippt, gelegentlich einen Blick aus dem Fenster wirft. Das Gespräch zum Erliegen kommen lässt.
Je ruhiger und entspannter er erscheint, desto getriebener fühle ich mich, als wollte ich damit einen Ausgleich schaffen.
»Ich würde gern etwas über Ihr neues Projekt erfahren, Mr Iwanow.« Ich schließe meine Hände um den Becher. »Ich studiere eigentlich etwas anderes, aber ich lerne schnell, und ich habe große Lust auf etwas Neues. Den letzten Monat über habe ich zur Vorbereitung einiges gelesen.«
»Warum?«, fragt er.
»Entschuldigung?«
»Ich habe ein paar Nachforschungen über Sie angestellt. Sie sind in Ihrem ersten Jahr als Doktorandin am Mathematischen Institut«, sagt er. »Sie schreiben über Kryptografie, soweit ich das verstehe. Codes knacken. Da denke ich an Bletchley Park. Sehr spannend. Wieso schwenken Sie jetzt auf russische Geschichte um?«
Zuerst will ich ihm eine glatte Lüge erzählen, aber ich glaube, er hat mich durchschaut. Ich muss ausweichen.
»Ich bin in Moskau geboren«, sage ich. »Meine Mutter ist vor Kurzem gestorben. Ehrlich, das hat mich dazu gebracht, über ein paar Sachen neu nachzudenken. Ich will meine eigene Kultur und Geschichte kennenlernen. Mein Erbe.«
Er lässt mir ein paar Sekunden Zeit, um das auszuführen, und als ich es nicht tue, nickt er bloß. Ich vermute, er ist schon sein ganzes Leben von Menschen umgeben, die die langen Geschichten ihrer Vergangenheit für sich behalten. Beinahe möchte ich ihn fragen: Wie ist das, wenn man über seine Vergangenheit nicht nur spricht, sondern sie öffentlich macht? Sich außerdem den Fragen eines ganzen Raums voller Menschen stellt?
»Na gut. Nun, um ehrlich zu sein, könnte ich eine etwas andere Perspektive gebrauchen«, sagt Alexej. »Weil die Aufgabenstellung eine ganz andere ist als bei meinen sonstigen Arbeiten. Ich versuche eine Frau zu finden, die ich früher einmal gekannt habe. Das ist alles. Das ist das Projekt, das Vorhaben. Wir müssen nur sehen, ob mir genügend Zeit bleibt. Und damit meine ich nicht freie Zeit«, fügt er mit einem selbstironischen Lachen hinzu. »Einfach nur Zeit.«
Ich senke den Blick in meinen Tee und lasse den Dampf brennend heiß auf meine Augenlider treffen. Mum ist gerade im Alter von dreiundfünfzig Jahren gestorben. Mein Vater ist mit vierundvierzig gestorben.
Zoja ist mit fünfzehn gestorben.
Alexej greift nach dem welken Etikett seines Teebeutels, hebt den Beutel aus der Tasse und lässt ihn wieder hineinsinken.
»Sie ist seit Jahren verschollen«, fährt er fort. »Ich stelle mir gern vor, dass sie irgendwo auf dem Land lebt. Sie liebte die Natur. Sie hat immer gesagt, sie könnte darin schwelgen, baden, ertrinken …« Er lehnt sich zurück, als wollte er den Satz wirken lassen. »Aber lassen Sie uns über die Logistik sprechen. Vielleicht werden Sie nicht mehr ganz so begeistert sein, wenn Sie erfahren, wie die Bezahlung ist, auch wenn ich bereit bin, mich um die Reiseformalitäten und die Unterkunft zu kümmern. In dieser Hinsicht müssten Sie keinen Finger krumm machen.«
Darauf hat seine Ausschreibung hingedeutet, und es ist genau das, was ich zu hören gehofft habe.
»Ich werde recht viel herumreisen müssen, wenn wir dort sind, also sollten Sie in der Lage sein, selbstständig zu arbeiten. Außerdem sollten Sie weiterhin so viel lesen wie möglich. Sie brauchen eine …«, er macht eine vage Geste. »Eine solide Wissensgrundlage. Aber es ist gut für junge Leute, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Sie müssen nur aufpassen.«
»Aufpassen?«, wiederhole ich.
Seine blauen Augen fixieren mich. »In der Vergangenheit wartet keine Erleuchtung. Keine Heilung. Kein Trost. Wonach auch immer wir suchen, es wird nicht da sein.«
So, wie er sie ausspricht, klingen seine Worte wie die Glockenschläge einer Kirche. Wonach auch immer wir suchen, es wird nicht da sein.
Kann ein Historiker das wirklich glauben?
Ich muss an Zoja denken, daran, wie sie den Geruch von Rost und billigen Kerzen heraufbeschwor und mich damit zwang, mich an meinen ersten Winter in England in dieser schäbigen Übergangswohnung zurückzuerinnern. Mich daran zu erinnern, wie Mum am Fenster stand und durch die Vorhänge schaute, einen Fuß angewinkelt, als wollte sie gleich wegtanzen, wie auf jeder Oberfläche Kerzen brannten, als wollte sie die ganze Wohnung niederbrennen lassen. Ich saß umgeben von Schulbüchern am Tisch und arbeitete fieberhaft, ich dachte: Wenn ich nur bis zum Ende dieses Problems komme, wenn ich diese eine Lösung finde, wird alles einen Sinn ergeben.
Aber will Zoja nur, dass ich mich erinnere? Oder durchforstet sie meine alten, geheim gehaltenen Erinnerungen, weil sie nach etwas sucht?
»Es handelt sich um diejenige, die neulich Abend erwähnt wurde«, sagt Alexej und verschränkt über seinem Tweedjackett die Arme.
Er spricht von der Frau, die er finden möchte. Ich reibe mir die Schläfen. Zoja ist im Moment nicht hier, und ich will nicht zu sehr an sie denken, sonst könnte sie auftauchen.
»Sie hieß Kukolka«, sagt er.
Püppchen.
Ich nehme einen Schluck von meinem Tee. Er ist kalt geworden.
Kukolka. Das ist eine unwillkommene Erinnerung an Mums Strafgefangene aus Porzellan in London. Ich wäre froh, wenn ich sie nie wieder zu Gesicht bekommen müsste, und nicht nur, weil sie unheimlich sind. Sondern weil Mum ihre Puppen menschlicher Gesellschaft vorgezogen hat. Das hat sie immer getan. Von all den Dingen, die wir aus Russland hätten mitnehmen können – und wir konnten nicht viel mitnehmen – , hat sie ausgerechnet sie ausgesucht.
Ich bleibe noch im Café sitzen, nachdem Alexej gegangen ist, trinke meinen letzten Schluck Tee aus und beobachte den Strom der Gäste. Durch die Glasscheibe sehe ich den Regen auf den Bürgersteig prasseln und langsam an Heftigkeit zulegen, während die Markise im Wind flattert und wie besessen wirkt. Menschen stürmen mit durchnässten Zeitungen in der Hand herein und schütteln sich wie Hunde.
In Oxford regnet es ständig. Nichts scheint jemals zu trocknen, weder drinnen noch draußen. Aber es stürmt nicht oft so stark, dass die Straßen so menschenleer sind wie jetzt. Hätte ich mir doch nur etwas Arbeit mitgebracht oder irgendeine Beschäftigung …
Mums Notizbuch mit den Geschichten. Ich wühle es aus meiner Tasche. Je dunkler draußen der Himmel wird, desto heller kommt es mir hier drinnen vor. Aber das macht die Lektüre dieser geschwungenen Schrift nicht weniger anstrengend. Ich verstehe kaum etwas.
Hinweis für den Leser …
Hinweis für den Leser
Diese Geschichten sollten nicht der Reihe nach gelesen werden.
Wenn Du, in welcher Reihenfolge auch immer, alle anderen Geschichten gelesen hast, kannst Du zur ersten zurückkehren. Schließlich ist dieses Buch voller Geschichten für diejenigen bestimmt, die wissen, dass der Anfang erst vom Ende her verstanden wird.
Du musst nun die Augen schließen, damit Du sehen kannst, was ich Dir zeigen werde.
Wenn Du glaubst, dass Deine Augen fest genug geschlossen sind, dann lass uns beginnen: In einem fernen Königreich, in einem längst vergangenen Land …
Kapitel 2
AntoninaPetrograd, Herbst 1915
Im Blauen Salon wird um vier Uhr nachmittags der Tee serviert, jeden Tag. An den meisten Tagen gibt es auf Platten angerichtet auch Sahnetorten, Puddingtörtchen und Blätterteiggebäck oder gebuttertes Brot, frisch aufgeschnitten und noch dampfend. Trotzdem verspürt Tonja niemals Hunger. Sie redet sich ein, es läge daran, dass das Mittagessen zu kurz zurückliegt oder zu reichhaltig war. Oder an der hässlichen silbernen und blauen Tapete, nach der das Zimmer benannt ist und die alles, was sich darin befindet, kränklich aussehen lässt. Oder weil Dmitri das Teeservice oder die Platten mit den Leckereien selbst so gut wie nie anrührt. Heute zählt er am Sekretär leise murmelnd Geldscheine: Zwanzig, vierzig, sechzig. Eins. Zwei. Drei. In diesem Haus bekommt alles eine Zahl.
Alles hat seinen Preis.
Der Karawanentee ist schwarz und rauchig. Tonja trinkt so lautlos wie möglich.
Dmitri legt seine Brieftasche zur Seite. Er fischt eine Zigarre aus der wohlriechenden Zedernholzkiste, in der er sie aufbewahrt. Man könnte sich leicht fragen, warum sie sich für den Tee überhaupt die Mühe machen, wenn man nicht wüsste, dass sie sich sonst möglicherweise den ganzen Tag nicht sehen würden.
»Deine Albträume werden immer schlimmer«, sagt er.
Ihre Zunge fühlt sich an ihren Zähnen geschwollen an, verdreht. »Nicht schlimmer als sonst.«
Dmitri nimmt einen langen Zug. »Ich konnte gestern sogar von meinen Zimmern aus hören, wie du dich hin und her geworfen hast.«
»Ich träume von zu Hause«, sagt sie verschlossen. »Von Otrada. Vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass ich dort einen Besuch machen sollte.«
»Es kommt nicht infrage, dass du allein reist.«
»Aber ich könnte dich begleiten, wenn du das nächste Mal in den Süden fährst …«
»Ich habe in absehbarer Zeit keine dahin gehenden Pläne. Es gibt hier Schwierigkeiten mit der Gewerkschaft.« Ein Seufzer, der durch einen weiteren Zug an der Zigarre besänftigt wird. »Unter meinen Angestellten gibt es mehrere Aufwiegler.«
Tonja würgt ihre Antwort hinunter. Dmitri verreist häufig, um das Land nach Stücken für seine geliebte Sammlung von Raritäten, Kuriositäten und anderen Schätzen abzusuchen. Manchmal ist er wochenlang fort.
Sie muss zum Tee zu Hause sein.
»Langweilst du dich, Tonja?«, fragt er. »Ist das das Problem?«
»Ich – ich kann mich beschäftigen«, stammelt sie.
»Vielleicht solltest du dich für die Philanthropie erwärmen«, sagt er. »Erst neulich dachte ich, dass eine Besichtigung der Fabrik, sogar der Baracken, längst überfällig ist. Und es wird mir sicher zugutegehalten werden, wenn sie sehen, dass ich ein verheirateter Mann bin.« Dmitri pafft die Zigarre und scheint sich an dem Gedanken zu erfreuen. Vor den wässrigen Farbtönen der Tapete hebt sich sein Profil ab, scharf, fürstlich. Verwegen vielleicht. Tonja lebt lange genug in diesem Haus, um das Kichern der jungen Hausmädchen gehört zu haben, ihre Schwärmereien. Wie sich ihr Herr doch von den anderen seines Standes unterscheidet! Er behandelt seine Untergebenen mit so viel Achtung, solcher Güte! Er ist kein hartherziger Despot, kein hinterhältiger Tyrann, kein grausamer Prinzipal! Sie haben recht. Er ist nichts von alledem. Wenigstens nicht hier unten.
Tonja ist in die Lektüre von Alexander Puschkins Eugen Onegin vertieft, als Dmitri verkündet, dass es Zeit für eine Spazierfahrt ist. Hat sie gestern versehentlich Interesse an der Idee einer Fabrikbesichtigung geheuchelt? Sie ist sich nicht einmal sicher, was seine Fabrik herstellt. Magnetzünder, hat sie die Leute im Vorbeigehen sagen hören. Irgendetwas, das mit dem Krieg gegen das Deutsche Kaiserreich zu tun hat. Im Wagen schließt Tonja die Augen und versucht, sich in die atemberaubende, romantische Welt Puschkins zurückzuversetzen, aber die Stimme ihres Mannes unterbricht sie.
»Du trägst dein Haar offen«, bemerkt er, als hätte er Olenka nie angewiesen, es so zu frisieren. »Ich verabscheue diese matronenhaften Hochsteckfrisuren. Du bist zwar bald siebzehn, aber du bist noch ein Mädchen.« Dmitri beugt sich vor und berührt ihr Ohr, zieht an einem Perlenohrring. »Du gefällst mir so. Du siehst so aus wie an dem Tag, als wir uns begegnet sind.«
»Sollte eine verheiratete Frau so aussehen wie ich?«, fragt sie und bemüht sich, nicht missmutig zu klingen.
»Niemand sonst sieht aus wie du«, sagt er.
Sein Tonfall deutet darauf hin, dass er sie heute Abend in ihrem Bett besuchen wird. Es wäre das erste Mal seit seiner Rückkehr von der letzten Reise. Aus den geflüsterten Unterhaltungen des Chauffeurs mit der Köchin weiß sie, dass Dmitri regelmäßig die Hafenanlagen aufsucht, wenn er hier in der Hauptstadt ist. Dass er die Mädchen gut zugeritten mag, wie Pferde.
Nicht alle Angestellten haben Scheuklappen auf wie die Hausmädchen.
Tonja dreht sich zum Fenster. Die Fabrik steht auf der Wyborger Seite, auf der anderen Seite der Newa, aber der Fahrer scheint einen großen Umweg zu machen. Sie blinzelt, weigert sich, das Stadtbild zu bewundern. Es ist beinahe anderthalb Jahre her, dass sie Dmitri geheiratet hat, und über ein Jahr, dass er sie nach Petrograd mitgenommen hat. Noch immer ist das Einzige, was ihr an der Hauptstadt gefällt, die unnahbare Turmspitze der Admiralität und wie sie einsam das Sonnenlicht einfängt. Mit der Newa kann sie sich anfreunden, obwohl sie nach Dorsch und Möwen stinkt. Und manchmal freut sie sich, die Wäsche auf den Leinen in den gelben Höfen hängen zu sehen und zu hören, wie sie im Wind flattert, flap-flap-flap. Sie möchte, dass sie weggeweht wird. Sie will, dass alles weggeweht wird.
Eugen Onegin, sagt sie sich. Denk an Eugen Onegin.
Die Führung ist todlangweilig, sie wird von dem Vorarbeiter angeführt, einem stoppeligen Mann namens Gotschkin. Tonja fährt mit der Hand über die Tische, das Werkzeug und die Maschinen, für die sie keinen Namen hat. Die Arbeiter werfen ihr finstere Blicke zu, aber das tun auch Dmitris Freunde aus der besseren Gesellschaft. Tonja mag dem Provinzadel entstammen, ihr Vater mag ein Fürst sein, aber für die alte St. Petersburger Elite ist sie einfach ein unbedeutendes Landei. Ihr Heimatdorf liegt so tief auf dem Land, dass man es hier kaum als zu Russland gehörend betrachtet.
Ob jung oder alt, die Gesichter der Arbeiter sind schmutzig und ernst. Dmitri scheint das nicht zu bemerken. Er ist zu allen freundlich, schüttelt Hände, klopft auf Schultern. Erkundigt sich nach Babys. Tonja weiß, dass ihr Mann sich für einen Liberalen hält. Es bereitet ihm ein schlechtes Gewissen, dass seine Vorfahren jemals Leibeigene besessen haben.
Er hat jedoch kein schlechtes Gewissen, Tonja zu besitzen.
Nach der Besichtigung gesellt sich Tonja zu Dmitri und Gotschkin auf die erhöhte Plattform, von der aus man die Fabrikhalle überblickt. Die Männer ziehen sich ins Büro des Vorarbeiters zurück, und Tonja schlendert zum Geländer. Sie spielt mit ihren Haarspitzen, sucht ihren Ärmel nach den kleinsten Fäden ab. Das Kleid mit dem steifen Kragen ist furchtbar einengend. Ihr Schmuck fühlt sich schwer an. Ihr ist unbehaglich zumute und sie ist unruhig. Da wird ihre Aufmerksamkeit von einer Gruppe von Arbeitern angezogen, die sich unten versammelt haben. Junge Männer, die lachen und miteinander reden.
Das Geländer ist plötzlich das Einzige, was sie noch aufrecht hält.
Tonja weiß nicht, wer er ist. Er war bei der Besichtigung nicht dabei. Wäre er es gewesen, wüsste sie es. Er ist dunkelhaarig und schlank, aber das sind sie alle, zweifellos ernähren sie sich von Kohlsuppe und Buchweizengrütze. Und er sieht gut aus. So gut, dass es auf ihrem Körper anfängt zu krabbeln, als hätten sich Läuse in ihren Strümpfen eingenistet.
»Du hast Publikum, Andrejew«, sagt jemand.
»Das hat er doch immer«, kommentiert ein anderer.
Er ist es, den sie Andrejew nennen. Er blickt kaum merklich auf und begegnet ihrem Blick. Er lächelt wissend – nein, spöttisch – , und ihr Herz rast. Vielleicht sind hier in letzter Zeit einige wohlhabende Weltverbesserer hereingestolpert auf der Suche nach einem Sinn für ihre verwöhnte Existenz und in der Hoffnung, die traurigen Lebensumstände der Arbeiterklasse zu verbessern, und er hält sie für eine von denen. Erst gestern war ein solches Paar zu Besuch. Sie waren entsetzt über das, was sie in einer Arbeiterbaracke gesehen hatten, und berichteten mit bleichen Gesichtern von Kakerlaken, die an den Pritschen gehangen hatten, von ganzen Familien, die in Räume gepfercht waren, die selbst für Vieh ungeeignet wären, und von dem Gestank, oh, dem Gestank!
Tonja kann sich nur vorstellen, wie jemand wie er riecht. Nach den widerlichen handgedrehten Zigaretten, die die Einwohner von Petrograd so gerne rauchen. Nach den Abgasen und dem Ruß der Fabrikschornsteine. Nach den Straßen der Stadt. Nach Schweiß.
Sie haben einander zu lange angeschaut. Sie errötet. Er wischt sich etwas aus dem Auge, Schmutz oder auch nur ihren Anblick, und wendet sich ab.
Seit Beginn des Sommers unternimmt Tonja früh am Morgen ausgedehnte Spaziergänge, vom Haus an der Fontanka bis zur Newa, von einem Fluss zum anderen. Dmitri schläft gewöhnlich lange, und es ist eine Gelegenheit, allein zu sein, unbewacht, ungehemmt, denn zwischen fünf und sechs Uhr morgens ist niemand sonst unterwegs, abgesehen von den Droschkenkutschern und Soldaten. Und ein paar Unruhestiftern.
Leuten wie – ihm.
Sie geht gerade an den Zeitungsredaktionen am Newski-Prospekt vorbei, da sieht sie ihn. Nur durch Zufall, denn um Andrejew hat sich eine beachtliche Menschenmenge gebildet: ein paar Studenten mit blauen Mützen, Arbeiter mit teerschwarzen Hüten und ungewaschenen Köpfen, Kutscher mit ihren typischen Nerzstolen. Tonja kann sich am Rand in die Menge einfädeln. Er ist der Einzige, der spricht: Das alte Russland wird einem neuen weichen! Und an dieser neuen Welt werden alle teilhaben, alle werden mitmachen, auch ihr Burschen, auch ihr Damen, auch du, Genosse, auch –
Du.