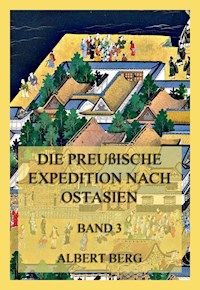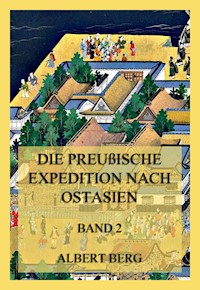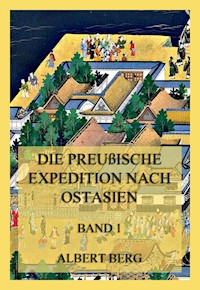
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die preußische Ostasien-Expedition, auch als "Eulenburg-Expedition" bekannt, war eine diplomatische Mission, die Friedrich Albrecht zu Eulenburg im Auftrag Preußens und des Deutschen Zollvereins in den Jahren 1859-1862 durchführte. Ihr Ziel war es, diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu China, Japan und dem damaligen Siam aufzubauen. Die wichtigsten Teilnehmer der Expedition waren Friedrich Albrecht zu Eulenburg, Lucius von Ballhausen (Arzt), Max von Brandt (Attaché), Wilhelm Heine (Maler), Albert Berg (Künstler), Karl Eduard Heusner, Fritz von Hollmann, Werner von Reinhold, Ferdinand von Richthofen und Gustav Spiess. Der Expedition standen drei Kriegsschiffe des preußischen Ostasiengeschwaders zur Verfügung, die SMS Arcona, die SMS Thetis und die SMS Frauenlob. Dies ist Band eins von vier der Aufzeichnungen zu dieser Expedition. Der Text folgt den Originalausgaben, die zwischen 1864 und 1873 erschienen, wurde aber in wichtigen Wörtern und Begriffen der heute aktuellen Rechtschreibung angepasst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die preußische Expedition nach Ostasien
Band 1
ALBERT BERG
Die preußische Expedition nach Ostasien, Band 1, A. Berg
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849662165
Quelle: [Berg, Albert]: Die preussische Expedition nach Ost-Asien. Bd. 1. Berlin, 1864. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/berg_ostasien01_1864>, abgerufen am 03.05.2022. Der Text wurde lizenziert unter der Creative Commons-Lizenz CC-BY-SA-4.0. Näheres zur Lizenz und zur Weiterverwendung der darunter lizenzierten Werke unter https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de. Der Originaltext aus o.a. Quelle wurde so weit angepasst, dass wichtige Begriffe und Wörter der Rechtschreibung des Jahres 2022 entsprechen.
Cover Design: Cropped, By Koa-public - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78051662
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
EINLEITUNG.1
RECHTSCHREIBUNG UND AUSSPRACHE DER AUßEREUROPÄISCHEN WORTE UND NAMEN.8
EINLEITENDES ZUM VERSTÄNDNIS DER JAPANISCHEN ZUSTÄNDE.9
I. GEOGRAPHISCHE LAGE UND BESCHAFFENHEIT; MYTHOLOGIE, GESCHICHTE.11
II. POLITISCHE EINRICHTUNGEN UND ZUSTÄNDE WÄHREND DER ABSPERRUNG.79
III. DER FREMDENVERKEHR WÄHREND DER ABSPERRUNG UND DIE AUFSCHLIEßUNG DES REICHES.100
REISEBERICHT.173
I. SINGAPUR.173
II. REISE DER THETIS VON SINGAPUR NACH TOKIO.196
III. REISE DER ARKONA VON SINGAPUR NACH TOKIO.217
IV. TOKIO.228
V. TOKIO.260
EINLEITUNG.
Das Bedürfnis einer eigenen diplomatischen Vertretung in den ost-asiatischen Reichen besteht für Preußen und die Zollvereins-Staaten seit langer Zeit. Schon im Jahre 1843 wurde die Aufmerksamkeit der königlichen Regierung auf die für den deutschen Handel in Ost-Asien zu erwartenden Vorteile geleitet und der Vorschlag zur Gründung einer großen Handelssozietät gemacht, die ihre Niederlage in Singapur hätte, mit der Aussicht die direkten Operationen auch auf China auszudehnen, sobald auf diplomatischem Wege der preußischen Flagge in den geöffneten Häfen dieses Reiches dieselben Rechte zugesichert wären wie der britischen. Der Antrag, eine imposante Ambassade nach Ost-Asien zu senden, war damals nicht zeitgemäß. Im Jahre 1844 liefen nach den englischen Schifffahrtsregistern nur ein preußisches, ein Hamburger und ein Bremer Schiff in Wampoa, dem Hafen von Kanton, ein, und selbst 1846 kamen nur ein Bremer und ein Hamburger Schiff mit Ladungen aus Liverpool und Hongkong nach dem damals aufblühenden Hafen Schanghai. Die deutsche Schifffahrt begann erst einigen Aufschwung in den indischen und chinesischen Meeren zu nehmen, als im Jahre 1848 durch einen Act der königlich großbritannischen Regierung alle fremden Schiffe den englischen für die Ein- und Ausfuhr von und nach den ostindischen Häfen — außer bei Befrachtung mit Salz und Opium — gleichgestellt wurden. Das Bedürfnis nach eigenen diplomatischen Vertretern mit richterlicher Befugnis machte sich seit der Zeit bei den in China verkehrenden Deutschen mehr und mehr fühlbar. Die Geschäftsverbindungen nahmen nach den Berichten ausgesendeter Handels-Agenten in großem Maßstab zu, aber der Mangel eigener Jurisdiktion versetzte die Untertanen traktatloser Mächte in China in eine sehr unvorteilhafte Lage; ihre Stellung drohte bei dem schnell wachsenden Verkehr unhaltbar zu werden.
Das Jahr der großen Weltausstellung in London 1851 und die folgenden bezeichnen einen Umschwung in den Verhältnissen des Welthandels. Überall tauchten liberalere Grundsätze auf, die internationalen Beziehungen wurden lebhafter und der Unternehmungsgeist brach sich Bahn nach allen Seiten. Der zunehmende Verbrauch chinesischer Erzeugnisse, die rasche Entwickelung der Niederlassungen in Australien und an der Westküste Nordamerikas, die Unternehmungen der Wallfischfänger und Pelzjäger, die von der niederländischen Regierung angenommene liberale Kolonialpolitik, die Eröffnung einer anscheinend unerschöpflichen Quelle von Reiszufuhren aus Hinter-Indien, der durch Übervölkerung und politische Umwälzungen gesteigerte Auswanderungsdrang der Chinesen gaben damals den Küstenländern des Stillen Ozeans eine kommerzielle Bedeutung, an die noch wenige Jahrzehnte vorher nicht gedacht werden durfte. In der westlichen Welt erweckten die Fortschritte der Humanität und Bildung, die starke Zunahme der Bevölkerung und der aufblühende Wohlstand immer lebhafter das Bedürfnis nach Kraftäußerung und Ausbreitung im Raume; der allgemeine Verkehr der Nationen und der freie Austausch ihrer Erzeugnisse wurden zur Notwendigkeit. — Im Süden von China hatten die Engländer festen Fuß gefasst; sie zwangen die Mandschu-Herrscher, ihrer alten Politik zu entsagen, und errangen sich, trotz dem heftigsten Widerstreben der Mandarinen-Regierung, teils auf friedlichem, teils auf kriegerischem Wege allmählich die Stellung, zu der die zivilisierten Völker des Westens durch ihre Macht und überlegene Bildung berechtigt sind. Von Norden her schob Russland seine Kolonien und Militärposten immer weiter vor und erlangte die Abtretung ausgedehnter und für die Beherrschung des nördlichen Stillen Meeres sehr günstig gelegener Landstriche. In Japan, das sich seit zweihundert Jahren allem Verkehr mit fremden Nationen verschlossen hatte, brachen 1854 Amerika und Russland die Bahn; gleich darauf schlossen auch England, Frankreich und Holland dort Freundschafts- und Schifffahrtsverträge. In kurzen Jahren fiel eine Schranke nach der anderen, und schon 1858 erlangten alle in Ost-Asien vertretenen Mächte unter dem Einfluss der englisch-französischen Siege in China Handelstraktate, die mehrere Häfen des entlegenen Inselreiches dem freien Geschäftsverkehr dieser Nationen öffneten, ihnen das Recht der diplomatischen Vertretung und des ausgedehntesten Schutzes ihrer Untertanen in allen rechtmäßigen Ansprüchen gesitteter Völker verliehen.
Der Handel und die Reederei der norddeutschen Staaten machten in diesen Jahren ohne den Rückhalt eigener internationaler Verträge und ohne die Vorführung einer eigenen schutzbereiten Marine bedeutende Fortschritte. Es lag damals noch nicht in der Handelspolitik der ostasiatischen Staaten, nachdem sie ihre Häfen fremden Schiffen und Waren einmal geöffnet hatten, zwischen der Nationalität der Schiffe und der Herkunft der Waren zu unterscheiden, und solchen europäischen Staaten gegenüber, mit welchen sie keine Verträge abgeschlossen, andere Grundsätze geltend zu machen, als wozu sie dem einen oder dem anderen gegenüber sich hatten bereitfinden lassen. Aber selbst in Fällen, wo es auf Anrufung gesandtschaftlichen oder konsularischen Schutzes ankam, der nicht füglich anders als auf Grund völkerrechtlicher Verträge in Anspruch genommen werden kann, brachte es in den ersten Jahren des Verkehrs die Solidarität der europäischen Interessen mit sich, dass die Repräsentanten der Vertragsmächte sich gern und aus eigenem Antriebe der Untertanen anderer Staaten annahmen. Bei dem gesteigerten Verkehr hingegen stellten sich Übelstände heraus, die für beide Teile immer fühlbarer wurden. Die Fortschritte des deutschen Handels und namentlich der deutschen Reederei mussten mit der Zeit die Eifersucht der anderen Nationen erwecken, die Solidarität der Interessen mit der gesteigerten Konkurrenz aufhören. Die Deutschen nahmen nur eine geduldete Stellung ein und waren niemals sicher, ihre Rechte geltend machen zu können. Auf der anderen Seite klagten die Vertreter der Vertragsmächte laut und wiederholt darüber, dass die in den geöffneten Häfen verkehrenden Deutschen keinerlei Jurisdiktion unterworfen und für ihre Handlungen keiner vorgesetzten Behörde verantwortlich wären.
Es lag vor Allem in der Natur der Sache, dass diejenigen Vorteile, welche unser Handel, unsere Schifffahrt und Industrie sich mittelbar aus den Berechtigungen anderer Nationen herleitete, zu unsicher erschienen, um der Gegenstand einer ausgedehnten soliden Spekulation werden zu können, und dass die neuerschlossenen Märkte erst dann als uns zuständig gelten könnten, wenn ihre Benutzung unter dem anerkannten Schutze der eigenen Regierung stände. Unsere Reederei bewegte sich schon seit längerer Zeit nicht mehr ausschließlich in dem früher herkömmlichen engen Kreise von Unternehmungen, machte vielmehr seit Jahren erfolgreiche Anstrengungen, auch jene entlegenen Weltteile in den Bereich ihrer Operationen zu ziehen. Sie konnte das allerdings nur in der Voraussetzung tun, dass die Regierung nicht säumen würde, ihr schützend zur Seite zu treten, da ja auch die Handelsschiffe anderer maritimen Nationen des Beistandes ihrer Regierungen nicht entbehren können. Das Bewusstsein, dass es der Stellung Preußens nicht angemessen sei, seine Unternehmungen unter dem Schutze fremder Nationalitäten, ihrer Gesandten und Kriegsflotten auszuführen, war auch bei unseren in Ost-Asien ansässigen Landsleuten wach geworden, und die vielfachen Anregungen von da zum Abschluss von Handels- und Schifffahrtsverträgen ließen deutlich erkennen, dass der Handelsstand in jenen Gegenden nationales Selbstgefühl genug besaß, um das Auftreten der vaterländischen Regierung neben den Unternehmungen anderer Staaten als ein Bedürfnis zu empfinden.
Auf diese Wahrnehmungen und Tatsachen fußend glaubte die preußische Regierung mit der Anbahnung vertragsmäßiger Beziehungen zu den ost-asiatischen Reichen nicht länger zögern zu dürfen, und beschloss eine handelspolitische Mission dahin zu entsenden, deren Zweck wäre, von den Regierungen jener Länder ähnliche Zugeständnisse zu erlangen, wie solche den übrigen westlichen Nationen gemacht worden waren. Geleitet von königlichen Kriegsschiffen, welche dabei erwünschte Gelegenheit fänden, die preußische Kriegsflagge in fernen Gegenden zu zeigen und ihre Führer und Mannschaften mit Erfahrungen zu bereichern, sollte die Mission sich nach Japan, China und Siam begeben, das Terrain in wissenschaftlicher und kommerzieller Beziehung erforschen, und den Abschluss von Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsverträgen herbeizuführen suchen.
Am 9. August 1859 wurde der Plan über die abzuschließenden Verträge, das Personal der Gesandtschaft und ihr beizugebender Fachmänner, über die Stärke und Ausrüstung des Geschwaders, die mitzugebenden Warenproben und Geschenke, die Kosten, und die von den Hansestädten beantragte Beteiligung an den Verträgen entworfen. Dieser Plan wurde Allerhöchsten Orts zur Bestätigung vorgelegt und mittelst Kabinettsorder vom 15. August 1859 genehmigt. Der Legationsrat Graf Friedrich zu Eulenburg wurde unter Ernennung zum Außerordentlichen Gesandten und Bevollmächtigten Minister bei den Höfen von China, Japan und Siam an die Spitze der Expedition gestellt. Seine Vollmachten wurden zugleich für die inzwischen davon in Kenntnis gesetzten und zur Einsendung von Warenmustern aufgeforderten Zollvereins-Staaten, für die Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz und für die drei Hansestädte Bremen, Hamburg und Lübeck ausgefertigt, welche in die mit den ost-asiatischen Reichen abzuschließenden Verträge aufgenommen zu werden wünschten. Der Graf zu Eulenburg wurde zugleich mit Ausarbeitung der für diese Mission notwendigen Instruktionen, der Beschaffung von Geschenken und den übrigen für die schleunige Entsendung des Geschwaders zu treffenden Vorbereitungen und Maßnahmen beauftragt, welche die Allerhöchste Genehmigung erhielten. Dem preußischen Landtage wurde der Plan und Kostenanschlag des Unternehmens im März 1860 vorgelegt; beide Häuser bewilligten die für die Expedition erforderlichen außerordentlichen Mittel.
Das Expeditionsgeschwader sollte ursprünglich aus drei Schiffen, der Dampfkorvette Arkona, der Segelfregatte Thetis und dem Kriegsschoner Frauenlob bestehen; diesen wurde noch das ausdrücklich für diesen Zweck in Hamburg angekaufte Clipper-Fregattschiff Elbe hinzugefügt, welches einen großen Teil der Geschenke und Warenproben, ferner Proviant und Kohlenvorräte an Bord nahm. Auf der Elbe wurde auch die in Hamburg erstandene Dampfbarkasse Vesta eingeschifft, welche zum Schleppen der Boote in heißen Gegenden und zur Vermittlung des Verkehrs der Kriegsschiffe untereinander und mit der Gesandtschaft dienen sollte.
Das Personal der Expedition bestand, soweit dasselbe nicht der königlichen Marine angehörte, aus dem Gesandten Grafen Friedrich zu Eulenburg;
dem Legations-Sekretär Pieschel;
den Gesandtschafts-Attachés von Brandt,
von Bunsen,
Grafen August zu Eulenburg, Leutnant im 1. Garderegiment zu Fuß;
den Naturforschern Regierungsrat Wichura für Botanik,
Dr. von Martens für Zoologie,
Dr. Freiherr von Richthofen für Geologie;
dem landwirtschaftlichen Sachverständigen Dr. Maron;
dem Maler A. Berg;
dem Zeichner W. Heine;
dem Photographen Bismark;
dem botanischen Gärtner Schottmüller;
den preußischen Kaufleuten Grube, Jakob und Kommerzienrat Wolff;
dem Bevollmächtigten der sächsischen Handelskammer, Kaufmann Spiess .
Von dem genannten Zivilpersonal schifften sich der Legations-Sekretär Pieschel, der Regierungsrat Wichura, Dr. von Martens, die Kaufleute Jakob und Grube und der Gärtner Schottmüller auf der Thetis, Dr. Maron und der Photograph Bismark auf der Elbe ein, während der Gesandte und die übrigen Expeditionsmitglieder sich auf dem Überlandwege über Suez und Ceylon nach Singapur begaben.
Die Dampfkorvette Arkona — von 2320 Tonnen — ist auf der königlichen Werft zu Danzig in den Jahren 1856 bis 1858 gebaut. Ihre Armierung bestand während der ost-asiatischen Expedition aus 1 Sechsunddreißigpfünder I. Klasse, 6 Achtundsechzigpfündern und 20 Sechsunddreißigpfündern II. Klasse, die Bemannung mit Einschluss des Stabes aus 319 Köpfen.
Die Segelfregatte Thetis — von 1533 Tonnen — ist 1846 in Plymouth gebaut und durch Kauf in den Besitz der preußischen Regierung übergegangen. Ihre Armierung bestand aus 32 Dreißigpfündern und 6 Achtundsechzigpfündern, Stab und Bemannung aus 333 Köpfen.
Der Schoner Frauenlob — von 95 Tonnen — war in den Jahren 1853 und 1854 aus den Mitteln der Stiftung »Frauengabe« gebaut, seine Armierung 1 Dreißigpfünder, die Equipage mit dem Stabe 41 Mann stark.
Das in Hamburg gebaute Transportschiff Elbe wurde mit 6 Sechspfündern armiert; Stab und Mannschaft betrugen 47 Köpfe.
Der zum Chef des ost-asiatischen Geschwaders ernannte Kapitän zur See Sundewall, welchem für die Dauer der Expedition der Rang eines Commodores verliehen wurde, hisste seine Standarte auf der Arkona. Das Kommando der Thetis erhielt der Kapitän zur See Jachmann, das des Frauenlob der Leutnant zur See I. Klasse Rehtzke, das der Elbe der Leutnant zur See I. Klasse Werner.
Thetis und Frauenlob verließen schon am 25. Oktober 1859 die Reede von Danzig. Die Ausrüstung der Arkona, welche gleich nach den Probefahrten auf Erlass des königlichen Oberkommandos vom 17. Oktober am dreiundzwanzigsten desselben Monats zu Danzig in Dienst gestellt wurde, machte große Schwierigkeiten und konnte nur langsam von Statten gehen, da die zu dieser Jahreszeit auf der Danziger Reede wehenden Winde die Kommunication mit dem Lande sehr erschwerten. Häufig konnten die Boote nicht an Bord zurückkehren; die Bordinge lagen oft Tage lang unweit des Schiffes vor Anker, ehe das Wetter erlaubte sie längsseits zu holen. Ebenso hindernd waren die eintretenden Fröste, in Folge deren die Kommunication auf der Weichsel aufhörte, die Ausrüstungsgegenstände per Achse von Danzig nach Neufahrwasser gebracht und hier in Boote umgeladen werden mussten. Die Zimmermannsarbeiten erlitten gleichfalls viele Unterbrechungen, da die an Bord geschickten Arbeiter einmal seekrank waren und ein anderes Mal vor Kälte nicht arbeiten konnten. Die Ausrüstung wurde unter Leitung des Kapitän Sundewall, welcher das Kommando gleich nach der Indienststellung übernommen hatte, nach Möglichkeit gefördert; Anfangs Dezember war die Arkona seeklar und trat am elften desselben Monats die Reise nach England an.
Thetis und Frauenlob trafen am 12. November 1859 auf der Reede von Spithead ein. Sie lagen dort, auf Befehle wartend, bis zum 15. März 1860. Arkona hatte in der Nordsee einen Sturm von der äußersten Heftigkeit zu bestehen und erlitt bedeutende Havarien. Sie kam den 26. Dezember 1859 auf der Reede von Margate und am 10. Januar 1860 vor Southampton an, wo erhebliche Reparaturen vorgenommen und die Einrichtungen des Schiffes vervollständigt wurden. — Thetis und Frauenlob verließen die englischen Küsten am 15. März und ankerten am dreißigsten auf der Reede von Funchal (Madera), gingen von da am 12. April wieder in See und trafen am 18. Mai in Rio de Janeiro ein. — Arkona verließ am 8. April Southampton und am zwölften Spithead, lief am neunzehnten Madera und am 23. April Santa-Cruz auf Teneriffa an, und erreichte Rio de Janeiro am 24. Mai. Von da stachen die drei Schiffe am 5. Juni in See. Im südatlantischen Ozean erhielt Frauenlob vom Flaggschiffe den Befehl, die Reise nach Singapur allein fortzusetzen, während Arkona und Thetis bis zur Sundastraße zusammen segelten. Dort setzte Arkona bei eintretender Windstille unter Dampf die Reise fort, berührte am 23. Juli Anyer auf Java und ging am sechsundzwanzigsten desselben Monats vor Singapur zu Anker. Thetis erreichte Anyer am Abend des 24. Juli und ankerte am dreißigsten vor Singapur, wo am 5. August auch Frauenlob eintraf.
Singapur war der letzte von Frauenlob berührte Hafen; er ging am 13. August von da mit Arkona zugleich in See und sollte mit derselben bis Tokio segeln. In der Nacht zum 2. September riss beim plötzlichen Ausbruche eines Sturmes die Trosse, an welcher das Flaggschiff, unter Dampf, den Schoner in der Windstille schleppte; bei Tagesanbruch war er schon außer Sicht. Arkona selbst geriet bei dem furchtbaren Orkan in große Gefahr; von Frauenlob und seiner braven Bemannung ist trotz allen Nachforschungen nie wieder eine Spur entdeckt worden. —
Die Elbe wurde am 8. Januar 1860 zu Hamburg in Dienst gestellt und ging am 7. März in See. Sie traf am zehnten desselben Monats vor Spithead und am neunzehnten in Southampton ein, lichtete am 5. April wieder die Anker und segelte, Madeira und Lanzarote berührend, nach Santa Cruz auf Teneriffa, verließ diesen Hafen am 8. Mai und erreichte am 1. August Anyer, am 7. August die Reede von Singapur.
Sämtliche Schiffe hatten in verschiedenen Breiten der Meere südlich vom Cap der Guten Hoffnung schwere und anhaltende Stürme zu bestehen, in welchen sich die junge Mannschaft vortrefflich bewährte und einen erheblichen Grad von Übung und Gewandtheit erlangte.
Seine volle Gestaltung gewann das Unternehmen erst in Singapur, wo der Gesandte und die anderen über Land gereisten Mitglieder am 2. August 1860 eintrafen.
Nach Beendigung der Expedition beschloss die königliche Regierung, deren Erlebnisse, Bestrebungen und Leistungen, sowie die gewonnenen Erfolge und Erfahrungen durch Herausgabe eines umfassenden Werkes zur öffentlichen Kenntnis und Anschauung zu bringen. Dieses Werk zerfällt in drei Abteilungen, welche, einander ergänzend, jede für sich ein abgeschlossenes Ganzes bilden, nämlich:
Einen allgemeinen beschreibenden Teil unter dem Titel: »Die preußische Expedition nach Ost-Asien. Aus amtlichen Quellen«.
Einen rein wissenschaftlichen Teil, die Berichte der der Gesandtschaft beigegebenen Fachgelehrten enthaltend.
Eine Reihe landschaftlicher Darstellungen aus den ostasiatischen Reichen, unter dem Titel: »Ansichten aus Japan, China und Siam«.
Diese drei Werke sollen gleichmäßig gefördert werden und in einzelnen Bänden und Heften so schnell erscheinen, als die Ausdehnung des Unternehmens und die vorhandenen Kräfte gestatten.
Berlin, im Juni 1864.
RECHTSCHREIBUNG UND AUSSPRACHE DER AUßEREUROPÄISCHEN WORTE UND NAMEN.
Alle in dieser Arbeit vorkommenden außereuropäischen Worte und Namen sind, sofern dieselben nicht schon in europäische Sprachen übergegangen sind und durch den Gebrauch eine bestimmte Orthographie angenommen haben, ihrem Klange nach vermittelst der von Professor Lepsius in seinem »Standard Alphabet« (2. Ausgabe, Berlin London 1863) aufgestellten Buchstaben und diakritischen Zeichen ausgedrückt. Um diese von den gewöhnlichen Lettern des Textes zu unterscheiden und als Schriftzeichen des Standardalphabet kenntlich zu machen, werden sie als Kapitälchen gedruckt. Das folgende Verzeichnis nennt die Aussprache und Bedeutung der in dem ersten Bande vorkommenden Buchstaben und Zeichen.
Die Vokale haben, sofern sie nicht mit diakritischen Zeichen versehen sind, den im Deutschen gewöhnlichen Klang. Länge und Kürze werden durch die gebräuchlichen Zeichen ‒ und ~ ausgedrückt, die getrennte Aussprache zweier Vokale eines Diphthongen durch das Trema ¨. Unter den Konsonanten haben die Buchstaben B, D, F, G, H, K, L, M, N, P, T dieselbe Aussprache wie im Deutschen.
R lautet wie das Zungen-R des Englischen und Italienischen (very, rabbia); S wie das scharfe französische S (savoir, sûr); V wie das V des Englischen und der romanischen Sprachen (Vision, Verdad. Voce); W wie das englische W (water, William); Z wie das englische und französische Z (zeal, zèle); Ṅ lautet wie ng in Enge, Strang; Ṙ wie das Gaumen-R deutscher und französischer Dialekte; Š wie das deutsche Sch (Schuld); Ž wie das französische J (jardin).
EINLEITENDES ZUM VERSTÄNDNIS DER JAPANISCHEN ZUSTÄNDE.
Es ist unmöglich das Wesen einer Nation zu erfassen, ohne ihre Religion, Geschichte und Sprache, und die leitenden Ideen ihrer Existenz zu kennen; daher erscheinen Völker, deren Kultur auf verschiedenen Grundlagen beruht, einander bei der ersten Berührung meist sonderbar und unbegreiflich. Die Gegensätze der äußeren Lebensgewohnheiten treten scharf hervor; was dem einen ganz natürlich, weil seit Jahrhunderten eingelebt und anerzogen ist, erscheint dem andern widerstrebend und abgeschmackt. So geht es uns mit den meisten ostasiatischen Völkern und vor allen mit den Japanern.
Ihre ganze Gesittung ist von der unseren so grundverschieden, dass der Europäer sich dort auf ein anderes Gestirn versetzt glaubt. Japan hinterlässt dem flüchtig Reisenden den Eindruck eines bunten Bilderbuches voll wunderlicher Szenen ohne Text: daher denn alle die abenteuerlichen Berichte, die nur deshalb so märchenhaft und unbegreiflich klingen, weil uns der Zusammenhang der Erscheinungen und der Schlüssel zu ihrem Verständnis fehlt. Aber selbst begabte Männer, die jahrelang in Japan gelebt und in genauen Beziehungen zu den Eingeborenen gestanden haben, bekennen in der Beurteilung der Zustände wenig vorgeschritten zu sein. Bei tieferem Eindringen knüpfen sich Rätsel auf Rätsel, und wenige lösen sich; überall stößt man auf unerklärliche Widersprüche. Der Grund dieser Unklarheit liegt in unserer unvollkommenen Kenntnis der japanischen Sprache und Schriften und der sittlichen und religiösen Fundamente ihrer Kultur, die Schwierigkeit sie zu bemeistern in der Verschlossenheit der Japaner.
Das japanische Volk hatte sich von Anfang an, wenn auch mit Zuziehung fremder Elemente, selbstständig entwickelt und zu einer bedeutenden Stufe der Gesittung aufgeschwungen: da erschienen im sechszehnten Jahrhundert die Europäer und brachten Ideen und Anschauungen in das Land, die mit den einheimischen Zuständen unvereinbar waren. Gewann damals das christliche Element die Oberhand, so war es um die Eigentümlichkeit und politische Selbstständigkeit Japans geschehen. Eines musste weichen. Aber grade zu dieser Zeit kam nach langen Umwälzungen und inneren Kriegen das Regiment des Landes wieder in eine kräftige Hand. Der Machthaber hemmte den Fortschritt der Fremden, und seine Nachfolger verbannten sie gänzlich aus dem Reiche. Nur durch ein System der vollständigen Abschließung nach außen und der durchgreifenden Beaufsichtigung aller Verhältnisse und Personen im Inneren konnte sich die Dynastie des Jyeyas halten; sie gab aber dem Reiche Einheit und Frieden und sicherte sein Fortbestehen in der angestammten Eigentümlichkeit. Ein wesentlicher Bestandteil dieses merkwürdigen auf der ungemessenen Scheu und Ehrfurcht des Volkes vor den herrschenden Ständen gegründeten Systems besteht in der prinzipiellen Verhüllung aller Angelegenheiten, Zustände und Ereignisse, welche den Herrscher und seine Regierung betreffen. Diese Gewohnheit der Verheimlichung ist den Japanern völlig zur Natur geworden und erstreckt sich nicht bloß auf wichtige Staatsangelegenheiten, sondern auch auf die unverfänglichsten geringfügigsten Dinge. Auch jetzt, da Japan sich der Fremden nicht mehr erwehren kann, lassen sie nicht davon, so dass es noch heute fast unmöglich ist, sei es von bestehenden Einrichtungen und den Ereignissen des Tages, sei es von der Vergangenheit des Reiches, zuverlässige Kunde zu erlangen. Das Volk wird in Unwissenheit erhalten und fürchtet sich auch das mitzuteilen was ihm bekannt ist, und selbst die niederen Beamten scheinen mit dem Organismus der Staatsverwaltung nicht vertraut zu sein.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass die folgenden Blätter nicht den Anspruch machen, ein Bild der japanischen Zustände zu zeichnen. Es soll nur versucht werden eine Übersicht der geschichtlichen Entwickelung des Volkes nach den vorhandenen Quellen zu geben, den Leser mit dem Terrain bekannt zu machen, auf dem sich die nachfolgenden Berichte bewegen. Die Literatur ist ausgedehnt, zum Teil schwer zugänglich, und für denjenigen, der nicht durch eigene Anschauung des Landes befähigt ist, eine gewisse Kritik zu üben, kaum nutzbar.
I. GEOGRAPHISCHE LAGE UND BESCHAFFENHEIT; MYTHOLOGIE, GESCHICHTE.
Auf der Karte erscheint Japan wie der stehen gebliebene Ostrand eines mächtigen in das Meer gesunkenen Kraters; Korea und die mandschurische Küste bilden die gegenüberliegende Seite; nördlich schließen Yeso und Krafto den Umkreis. Von der vulkanischen Beschaffenheit des Landes zeugen tätige und erloschene Krater, Solfateren, heiße Quellen und häufige Erdbeben.
Die drei großen Inseln Nippon, Kyushu und Shikoku bilden das eigentliche Japan. Nippon ist die größte: die Eingeborenen bezeichnen mit diesem Namen auch das ganze Reich 1). Der Ausdruck Japan ist im Lande selbst unbekannt, die Portugiesen haben ihn aus der chinesischen Benennung Tsipang 2) korrumpiert.
Die drei großen Inseln umschließen, durch schmale Meeresarme getrennt, eine Binnensee; darin und rings um die buchtenreichen Küsten liegen viele kleinere Eilande. Die meisten sind bewohnt und angebaut, sie stehen in regem Verkehr untereinander und mit dem Hauptlande, denn ein häufiger Austausch der Erzeugnisse ist Lebensbedingung für ein volkreiches Land, das alle seine Bedürfnisse selbst hervorbringt. Die Küsten sind bergig und steil; unzählige Klippen, Felsen und Riffe, reißende Strömungen und Fluten, ungestüme wechselnde Winde machen die Schifffahrt gefährlich. Das Binnenmeer 3), welches die beiden großen Heerstraßen von Kyushu und Shikoku nach der Hauptstadt queer durchschneiden, befahren tausende von Dschunken; bei Tage wimmeln diese Gewässer von Segeln, bei Nacht suchen alle Schutz in den gastlichen Häfen und Buchten, denn von den hohen Küsten und aus engen Talschlünden stürzen oft heftige Böen verderbenbringend herab. Die Reisenden schildern die Schönheit dieser Meere in glühenden Farben: hier ein stiller Landsee, dort schmale Sunde, durch welche sich die Gewässer in tosender Brandung drängen; die Ufer bald schroffe Felsen, von denen rauschende Gießbäche herabstürzen, bald angebaute sanfte Bergeshänge. Aus immergrünen Hainen ragen fürstliche Schlösser, und hohe Tempel krönen die Vorgebirge; landeinwärts aber gewahrt man mächtige Gebirgsmassen mit zackig zerrissenen Gipfeln und schneegefüllten Schluchten.
Die größte Insel des Binnenmeeres heißt Awadsi. Nordwestlich von Nippon liegen Sando und Oki, westlich und südlich von Kyushu die Gruppe der Gotto-Inseln, Firando, Amaksa, Tanegasima 4); viele kleinere sind rings um die Küsten zerstreut.
Dem asiatischen Festlande am nächsten bildet die Insel Tsus-sima gleichsam eine Brücke zur Halbinsel Korea.
Über die genannten Landesteile ist durchweg die japanische Kultur verbreitet. Die nördlich von Nippon gelegene Insel Yeso und die südlichen Kurilen gehören auch zum japanischen Reiche, sind aber zum größten Teil von einem halbwilden Volksstamm, den Aïnus (behaarten Kurilen) bewohnt. Das Klima ist rau und der Entwickelung japanischer Kultur ungünstig. Die Japaner bewohnen nur die Städte und Hafenplätze und treiben Handel mit den Erzeugnissen nach dem Mutterlande. Das ganze Innere von Yeso soll ein unbewohntes Waldgebirge sein. Die nördlichen Kurilen gehören zum russischen Reiche, nur Kunašir und Yeturup sind japanisch; die Grenzlinie geht nach den neuesten Verträgen zwischen der letztgenannten Insel und Urup hindurch.
Die Liukiu-Inseln erkennen, im Anfange des siebzehnten Jahrhunderts durch den Fürsten von Satsuma unterworfen, die japanische Oberhoheit an und zahlen Tribut, scheinen aber zugleich an China zinspflichtig zu sein. Ähnlich ist es mit Korea, wo seit uralten Zeiten bald der japanische bald der chinesische Einfluss vorgewaltet hat.
Der Flächeninhalt des eigentlichen Japan wird auf 5300 Quadratmeilen, die Bevölkerung auf mehr als 25 Millionen geschätzt 5).
Die japanischen Inseln sind durchaus gebirgig, an weiten Ebenen fehlt es ganz. Von welcher Seite man sich dem Lande nähern mag, gewahrt man hohe Küsten. Bewaldete Höhen wechseln mit fruchtbaren Tälern, angebautes Hügelland mit unwirtbarem Felsgebirge. Fast überall ist das Land wasserreich, leidet aber Mangel an schiffbaren Flüssen.
Das Klima ist eines der glücklichsten der Erde und weit gemäßigter als unter gleichen Breiten in andern Weltteilen, die Sommerhitze niemals unerträglich, der Winter kurz und milde. Im Frühjahr und Herbst regnet es viel, besonders im Mai und Juni, und im November. Im Dezember tritt klares Wetter ein, im Januar und Februar wechseln schöne Tage mit Regen und Schnee. Am kältesten ist es im Januar, dann sinkt die Temperatur im mittleren Teile des Reiches zuweilen unter den Gefrierpunkt. Niemals aber dauert die Kälte lange, und auch anhaltende Dürre ist unbekannt. Die Luft ist weich und milde und in Folge beständiger Strömungen immer rein und frisch, die Witterungswechsel treten zum großen Vorteil des Ackerbaues in allen Jahreszeiten sehr regelmäßig ein. Besonders günstig sind die Luft- und Bodenverhältnisse der Entwickelung des Pflanzenreiches. Wenige Länder können sich mit Japan im Reichtum der Formen messen, wenn auch an Reichtum der Arten tropische Gegenden voranstehen. Während die Vegetation der meisten Inselländer mit der der benachbarten Kontinente übereinzustimmen, aber ärmer an Gattungen zu sein pflegt, daher gewöhnlich als von der kontinentalen abstammend betrachtet wird, scheint die japanische Flora eine ursprüngliche und reicher als die des benachbarten 5) Festlandes zu sein. Kamelien, Kryptomerien und viele andere Geschlechter werden als Japan eigentümlich und eingeboren angesehen. Neben den einheimischen Gewächsen haben sich auch viele fremdländische eingebürgert, so unter anderen der Theestrauch, die Orange 6), der Tabak 7), der Maulbeerbaum. Die Japaner sind Meister in der Baumzucht und vielen anderen Zweigen des Feld- und Gartenbaues, und haben sich zu allen Zeiten bemüht, fremde Nutzpflanzen in ihrem Lande zu akklimatisieren. Der Charakter der Flora ist schwer zu beschreiben, sie enthält Elemente aus allen Zonen: aus der kalten die Nadelhölzer — Japan ist reicher an Koniferen-Arten als irgend ein Land der Welt — aus der gemäßigten viele unseren Laubbäumen verwandte Gattungen, aus der subtropischen die immergrünen Laubhölzer, aus der tropischen vor allen Bambus, Palmen, Zikadeen. Analog ist die Vegetation der Sträucher und Staudengewächse und die überaus reiche Cryptogamen-Flora.
Weniger mannigfaltig ist die japanische Tierwelt; der überall verbreitete Anbau mag ihrer Verbreitung hinderlich sein. Eigentümlichen Zügen begegnen wir auch hier: der Riesenmolch, der Kupferfasan und einige andere Arten kommen nur in Japan vor. Im allgemeinen ist die Fauna die der gemäßigten Zone; Affen gibt es nur im Süden des Reiches, die Raubtiere aus dem Katzengeschlechte fehlen wie bei uns fast ganz. An Fischen und Seetieren haben die japanischen Gewässer einen Reichtum und eine Mannigfaltigkeit wie wenige andere: kalte und warme Meeresströme führen den Küsten die Bewohner fast aller Zonen zu, an einigen Stellen wird auch die Perlenmuschel gefischt. — Als Haustiere findet man Hunde, Katzen, Pferde, Rindvieh, viele Enten- und Hühnerarten. Esel gibt es nicht, und die Schafzucht einzuführen hat man vergebens versucht.
Überaus reich ist Japan an wertvollen Mineralen, seine Bergwerke liefern Gold, Silber, Zinn, Blei- und Eisenerze, vor allen aber goldreiches Kupfer in großer Menge — es soll das feinste und geschmeidigste der Welt sein. Edelsteine scheinen nicht gewonnen zu werden — der Japaner achtet sie nicht — wohl aber herrliche Bergkrystalle. Steinkohlen finden sich an vielen Orten, und Schwefel liefern die zahlreichen Vulkane und Solfataren.
So reich und glücklich von der Natur ausgestattet liegen die japanischen Inseln fern und einsam in einem der unwirtbarsten Meere der Welt. Wirbelorkane, die gewaltigsten die man kennt, durchwühlen die japanischen Meere fast zu allen Jahreszeiten, Nebel und Regengüsse verhüllen die klippenreichen Küsten, wechselnde Winde und heftige Strömungen machen alle Berechnungen des vorsichtigen Schiffers zunichte. Die Natur selbst scheint das schöne Land zur Isolierung bestimmt zu haben. Die Japaner haben sich durch eigne Kraft zu einer bedeutenden Stufe der Gesittung emporgeschwungen und sind niemals einem anderen Volke untertan gewesen. Sie haben sich die koreanischen Reiche unterworfen und von da die Elemente der chinesischen Bildung in ihr eigenes Land verpflanzt, aber in freier und eigentümlicher Weise verarbeitet. Nur in diesen Feldzügen und außer Landes haben Massenberührungen der Japaner mit anderen Völkern stattgefunden, im Übrigen wurde der Verkehr immer nur durch Einzelne vermittelt, durch Gesandtschaften von und nach China, durch buddhistische Reformatoren, durch japanische Priester und Edelleute, die sich des Studiums wegen nach dem Festlande begaben. Niemals erlitt die Entwickelung der Kultur und des staatlichen Lebens eine gewaltsame Unterbrechung von außen. Kublai Khan war der einzige, der jemals ernstliche Anstrengungen zur Eroberung des Reiches gemacht hat: seine Flotten versanken im Meere und die ausgeschifften Truppen fielen unter dem Schwerte der Japaner. Die Europäer wurden im sechszehnten Jahrhundert mit offenen Armen aufgenommen, die lernbegierigen Japaner griffen mit Lust nach den neuen Ideen und Elementen der Bildung, das Christentum fand Eingang bei allen Ständen. Sobald aber die staatliche Selbstständigkeit des Reiches dadurch gefährdet schien, verbannten die Herrscher die schädlichen Gäste, rotteten die keimende Saat ihrer Lehre mit eiserner Strenge bis auf den letzten Halm aus und umgaben sich mit einer Mauer, die ein erneutes Eindringen unmöglich machte. Während das chinesische Reich durch die tartarische Invasion in den tiefsten Verfall geriet, haben sich die Japaner nicht nur volle politische Selbstständigkeit, sondern auch ihre innere Lebenskraft bewahrt. Ihre Nationalität erlangte Festigkeit und Kraft in mehrtausendjähriger ungestörter Fortbildung, wie sie kaum ein anderes Volk gehabt hat; das japanische ist zur Rasse geworden. Dass sie starr am Alten festhalten und sich in den Verkehr mit den Westvölkern nicht schicken können, ist natürlich. Der Japaner ist konservativ und patriotisch, nicht nur die herrschenden Stände, die Nachkommen derer, welche die japanische Geschichte gemacht haben, sondern auch das Volk, das in der eisernen Zeit der Bürgerkriege in das tiefste Elend versunken war und auch jetzt noch, bei äußerem Wohlstande und sonst glücklichen Verhältnissen, in engen Schranken gehalten wird. Japan ist ein durchgebildeter, wenn auch ein sehr künstlicher Organismus.
Wie sich die erneute Berührung des wenig veränderten Reiches mit dem im Laufe zweier Jahrhunderte durchaus umgewandelten Europa gestalten wird, ist das merkwürdige Problem der nächsten Jahrzehnte.
Das japanische Volk ist wahrscheinlich ein ureingeborenes, oder in vorhistorischen Zeiten, vor Bildung der Sprachen eingewandertes. Der Punkt ist kontrovers gewesen: sowohl unter den europäischen Gelehrten als in Japan hat die Ansicht Anhänger gefunden, dass die Bevölkerung in historischen Zeiten von China eingewandert sei; aber die geschichtliche Überlieferung, die Sprache und die Götterlehre liefern den stärksten Beweis für das Gegenteil.
Der Ausgangspunkt der japanischen Geschichte ist die Vereinigung des Reiches unter Dsin-Mu im Jahre 660 v. Chr. Dieses Datum halten die Japaner für historisch sicher. Von Dsin-Mu leitet sich die lange Reihe der Erbkaiser her, deren Geschlecht in ununterbrochener Folge bis auf den heutigen Tag den Thron der Mikados inne gehabt hat. Nun ist selbst aus chinesischen Quellen bewiesen worden, dass alle Einwanderer, die als Stammväter des japanischen Kaiserhauses genannt werden, nach der Zeit des Dsin-Mu in das Land gekommen sind 8). Mehrerer dieser Einwanderungen erwähnen die japanischen Kaiserannalen, die älteste fällt in das Jahr 219 v. Chr. 9). Aufgeklärte japanische Schriftsteller nehmen an, dass ihr Vaterland ursprünglich von denselben Aïnus (japanisch Yebis) bewohnt gewesen sei, welche jetzt noch im halbwilden Zustande die Bevölkerung von Yeso und den Kurilen bilden, dass die heutigen Japaner ein durch lange Kultur veredelter Zweig dieses Stammes sind, dass Dsin-Mu, ein begabter Häuptling im Süden des Reiches, zuerst eine politische Ordnung bei seinem Stamme eingeführt und sich die wild und gesetzlos lebenden Nachbarstämme unterworfen habe. Er wählte die Landschaft Yamatto im mittleren Teile von Nippon zum Sitze seiner Herrschaft; von da verbreiteten sich staatliche Einheit, Bildung und milde Sitten allmählich über das ganze Land. Wie langsam die neue Ordnung Platz griff, beweisen die fortwährenden Kriege gegen wilde und aufrührerische Stämme im Norden und Westen des Reiches, von denen die japanischen Annalen noch bis in das achte Jahrhundert n. Chr. berichten.
Das wichtigste Zeugnis für die Ursprünglichkeit der Bevölkerung ist ihre Sprache, welche sowohl von dem chinesischen als allen anderen bekannten Idiomen grundverschieden ist und bis jetzt ganz isoliert dasteht 10). Der Schädelbildung nach stehen die Japaner der mongolischen Rasse am nächsten.
Die alteinheimische Götterlehre der Japaner ist durchaus eigentümlich und hat, außer dem Gedanken von der Entstehung der Welt aus dem Chaos und wenigen anderen sich natürlich ergebenden Zügen nichts mit den Mythologien anderer Völker gemein. Fast alle ihre Sagen knüpfen sich an japanische Örtlichkeiten und an die besondere Natur des Landes. — Aus einem wellenschlagenden Chaos entwickeln sich Himmel und Erde, indem die leichten Teile in die Höhe steigen, die schweren sich senken; in der Mitte bildet sich ein göttliches Wesen, ein Kami. Er lebt hundert Millionen Jahre, und zeugt aus sich selbst einen Nachfolger, der ebenso lange lebt, und welchem, gleichfalls geschlechtlos, ein dritter entquillt. Dann folgen nacheinander vier Götterpaare, Mann und Weib, deren jedes zweihundert Millionen Jahre regiert. Diese sieben sind die Geschlechter der himmlischen Götter. Von den vier Götterpaaren zeugen die drei ersten ihre Nachfolger, indem sie einander in geistiger Anschauung durchdringen, das letzte Paar, der Gott Izanagi und die Göttin Izanami, gelangt nach leidenschaftlichen Bewegungen der Trennung und Wiedervereinigung zur Begattung. Sie erzeugen zunächst die japanischen Inseln, die Flüsse, die Berge, den Vater der Bäume und die Mutter der Pflanzen — endlich ein glänzendes Wesen Ten-zio-daï-sin. Er wird wegen seiner Schönheit an den Himmel versetzt, ein Sonnengott, die höchste aller in Japan verehrten Gottheiten, denn die älteren himmlischen Geschlechter stehen den Menschen zu fern. Ten-zio-daï-sin wird der Stammvater der fünf irdischen Göttergeschlechter. Seine nachgeborenen Brüder sind der Mond, dann ein Genius des Meeres, und Sosan, ein Geist der Unruhe und Bewegung, des Ungewitters, der Stürme. Dieser gibt zuerst Anlass zu Unfrieden und Streit, muss sich aber schließlich vor der Sonnengottheit beugen und steigt zur Erde, d. h. nach Japan hinab. Er tritt dort in Verkehr mit den Menschen — sie scheinen mit den Pflanzen und Tieren für selbstverständliche Erzeugnisse des Bodens zu gelten — befreit eine Jungfrau von einem Drachen und zeugt mit ihr einen Sohn. Seine Nachkommen, die irdischen Kamis, Halbgötter und Heroen wollen den von Ten-zio-daï-sin entsprossenen Gottheiten wiederholt die Herrschaft über die Erde streitig machen, werden aber besiegt. Jene treten in den folgenden Generationen noch wiederholt mit den Heroengeschlechtern in Verbindung und freien deren Töchter. Die sehr phantastische Sagengeschichte dieser Phase spielt im Himmel, im Meere, auf den japanischen Inseln; zum Teil sind Naturphänomene darin symbolisiert 11), zum Teil die Entstehung bestimmter Örtlichkeiten mit Ereignissen der Götterwelt in Verbindung gebracht, die allmähliche Urbarmachung des Landes unter dem Bilde der Ausrottung von Ungeheuern und bösen Dämonen versinnlicht. Alle diese Mythen stehen in der speziellsten Beziehung zu den physischen Eigentümlichkeiten der japanischen Inseln und Meere; sie gründen sich gewiss zum Teil auf wirkliche Ereignisse und verherrlichen im Gewande der Sage die großen Taten und Eigenschaften der frühesten Gründer japanischer Kultur. Die Gewohnheit jeden bedeutenden Mann, der sich um das Land Verdienste erwarb, unter die Götter zu versetzen, ist dem Volke eigentümlich und hat sich bis in späte Zeiten erhalten. Die Mikados treten von selbst durch Geburtsrecht in die Reihe der Kamis, aber auch andere Sterbliche, die sich durch Großtaten irgend einer Art berühmt gemacht, werden nach ihrem Tode feierlich kanonisiert und erhalten besondere Ehrentitel und Tempel, wo man sie verehrt.
Unmittelbar an das Heroenalter schließt sich nach der Auffassung der Japaner ihre Geschichte. Dsin-Mu, der Stammvater des Mikado-Geschlechtes, wird ein Sohn des vierten Nachkommen von Ten-zio-daï-sin genannt, stammt also in grader Linie von dem Sonnengenius und dessen Ahnen, den himmlischen Göttern her. Deshalb ist sein Geschlecht unverletzlich und über alle Menschen erhaben 12).
Die folgenden Nachrichten gründen sich zumeist auf die von Professor Hoffmann in Leiden übersetzten Geschichtstabellen Wa Nen Keï, teils auch auf die von Klaproth durchgesehene und herausgegebene Übertragung der im Jahre 1652 erschienenen Kaiserannalen Nippon O Daï Itsi Ran 13). Letzteres Werk ist ein Auszug aus den größeren Geschichtswerken in Form einer Chronik. Unter einem Wust bedeutungsloser Hofnachrichten werden auch die politisch wichtigen Begebenheiten ohne Verknüpfung und Zusammenhang in trockenen Worten kurz berichtet. Nur selten findet sich ein allgemeiner Satz. Wer es aber unternimmt die Fäden zu verfolgen, die Tatsachen aneinander zu reihen, den geschichtlichen Stoff zu sichten und zu ordnen, der erhält nicht nur einen Überblick über den Gang der äußeren Ereignisse, sondern auch ein Bild von den inneren Eigentümlichkeiten der verschiedenen Entwickelungsperioden. Diese Eigenschaft der Kaiserannalen, dass sich aus der einfachen Aufzählung der Tatsachen allgemeine Begriffe von selbst ergeben, ist das beste Zeichen für ihre Glaubwürdigkeit. Selbst die Berichte aus den frühesten Zeiten tragen ein bestimmtes Gepräge und enthalten nicht so viel des Wunderbaren und Sagenhaften als die Geschichte gleichnamiger Zeitalter bei den westlichen Völkern.
Die Schrift, und zwar zunächst die chinesische ideographische, wurde zu Ende des dritten Jahrhunderts n. Chr. in Japan eingeführt. Vor dieser Zeit sollen alle Gesetze und Verordnungen durch öffentliches Ausrufen publiziert und durch mündliche Überlieferung fortgepflanzt worden sein, ebenso das Andenken an wichtige Staatsbegebenheiten. Die Zeitbestimmungen aber wurden durch Einkerbungen in Balken und durch Knoten, die man in Seile machte, der Nachwelt übergeben. Die Tatsache, dass von Japan aus eine Gesandtschaft nach Korea ging, um die chinesische Schrift und Gelehrte von dort zu holen, lässt auf den Bildungsgrad schließen, den das Volk im dritten Jahrhundert n. Chr. erreicht hatte.
Von dem ersten Geschichtswerke — Reichsarchive werden schon viel früher erwähnt — berichten die Annalen unter dem vierunddreißigsten Mikado um 600 n. Chr. Diese Arbeit geht in die frühesten Zeiten zurück und wird als Berichtigung und neue Redaktion älterer Werke bezeichnet. Von der Zeit scheinen die Aufzeichnungen regelmäßig fortgeführt worden zu sein 14). Die japanische Literatur ist reich an historischen Monographien über einzelne Landesteile, Familien und merkwürdige Entwickelungsphasen, aber den Europäern ist noch wenig davon bekannt geworden. — Mit den chinesischen Geschichtswerken stimmen die japanischen, wo es sich um Berührung der beiden Völker handelt, in Bezug auf Data und Tatsachen meist im Wesentlichen überein, aber ihre Auffassung der Begebenheiten ist häufig sehr verschieden.
Die Nachrichten der Kaiserannalen über das Ende des sechszehnten und den Anfang des siebzehnten Jahrhunderts sind sehr lückenhaft und unvollständig, sie hätten sonst manchen zarten und für die neue Shogun-Dynastie empfindlichen Punkt berühren müssen. Über diesen Zeitraum, einen der wichtigsten und merkwürdigsten der japanischen Geschichte, da sich in ihm das neue politische System aus anarchischen Zuständen und fast gänzlicher Auflösung der alten Staatsordnung entwickelte, besitzen wir eine ausgedehnte Literatur in den Briefen und Berichten, welche die katholischen Missionare von Jahr zu Jahr an ihre Ordenshäuser in Europa sandten 15). Diese Nachrichten sind umso wichtiger, weil zu jener Zeit die Fremden ohne Einschränkung mit allen Klassen der Bevölkerung verkehrten; die Missionare besonders kamen vielfach in intime Berührung mit den Großen des Reiches und konnten eine Anschauung von den Zuständen gewinnen, die unter den jetzigen Verhältnissen unmöglich zu erlangen ist; ihre Angaben stimmen meistens mit den Nachrichten der Kaiserannalen überein 16). Nach dem Jahre 1652 durfte kein Geschichtswerk mehr veröffentlicht werden, so dass wir für die letzt verflossenen zweihundert Jahre auf die Nachrichten beschränkt sind, welche die Holländer bei ihren Hofreisen und auf Desima sammelten. Im Geheimen kursieren bei den Japanern Manuskripte, welche die Geschichte der Neuzeit behandeln; davon sind einige den holländischen Faktoreibeamten in Nagasaki zugänglich geworden. Aber sie erzählen fast nur Hofgeschichten und Anekdoten, und geben wenig Aufschluss über die innere Entwickelung des Staates, das einzige Wissenswerte aus einer Zeit, in der sich das Reich nach außen hermetisch verschlossen hatte. Es ist zwar anzunehmen, dass sich, seitdem in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts das System der Abschließung nach außen und der allgemeinen Beaufsichtigung seine volle Ausbildung erreichte, bis zum Eindringen der Amerikaner im Jahre 1854 in den politischen Zuständen wenig geändert hat; aber leider besitzen wir auch aus der Zeit der Entwickelung des neuen Systems über die inneren Einrichtungen keine ausführlichen Angaben, denn die Missionare, welche die äußeren Begebnisse und die Umwälzungen, von denen sie Zeugen waren, sehr eingehend beschreiben, geben über diesen Punkt fast gar keine Rechenschaft.
Dsin-Mu der Göttersohn eroberte, von Süden kommend, das ganze Reich, und schlug in der Landschaft Yamatto 17) den Sitz seiner Herrschaft auf. Seine Proklamierung als Kaiser des ganzen Landes (660 v. Chr.) ist der Ausgangspunkt der japanischen Zeitrechnung. Er wird als der erste genannt, der ein Haus baute 18), während bis dahin die Eingeborenen in Erdhöhlen gewohnt hätten. Von seiner Leibwache rühmt sich der japanische Adel abzustammen.
Die Nachrichten über die folgenden Mikados sind dürftig und beschränken sich auf die Erzählungen von Kriegen gegen die Yebis, von wunderbaren Naturphänomenen und Erbstreitigkeiten um die Thronfolge. Von dem zehnten Mikado wird berichtet, dass er vier Shoguns, Feldherren zur Bekriegung der wilden Eingeborenen in den abgelegenen Provinzen ernannt habe. Unter seiner Regierung (33 v. Chr.) kamen zum ersten Male Koreaner nach Japan: die Annalen erwähnen ihrer als einer tributbringenden Gesandtschaft, doch scheinen es nur Einwanderer gewesen zu sein, welche, den politischen Stürmen in ihrem Vaterlande weichend, eine neue Heimat suchten. In Korea waren seit dem Jahre 57 v. Chr. große Umwälzungen vorgegangen: das alte Reich Tšaosien, welches die ganze Halbinsel umfasste, teilte sich damals in die drei Königreiche Kaoli, Petsi und Sinra. — Im Jahre 27 n. Chr. kam abermals eine Einwanderung nach Japan, an deren Spitze ein Fürst aus dem Königshause von Sinra stand. Von Japan soll um 57 n. Chr. zum ersten Male eine Gesandtschaft nach dem Auslande, und zwar an den chinesischen Kaiser Ko-bu-ko-tei (chinesisch Kuang-wukuang-ti) aus der Dynastie Go-kan gegangen sein. — Unter dem zwölften Mikado wurde der Krieg gegen die Yebis nach Yeso ausgedehnt, die beiden folgenden hatten viel mit Bekämpfung der wilden Stämme in den östlichen Landschaften von Kyushu und Nippon zu tun.
Das sind die wenigen Nachrichten aus diesem Zeitalter, denen man einigen historischen Wert beimessen kann. Alles übrige gehört, wenn auch gewiss mit Tatsachen vermischt, doch vorwiegend in das Gebiet der Sage. Schon die geringe Zahl von vierzehn Mikados, welche den Zeitraum von 660 v. Chr. bis 200 n. Chr. ausfüllen, also durchschnittlich je über sechzig Jahre regiert haben müssten, ist sehr verdächtig. Um 201 n. Chr. bestieg zum ersten Male eine Frau den Thron, Sin-ko-wo-gu, die Witwe des vierzehnten Mikado, eine gewaltige Kaiserin, welche noch heute als Schutzgöttin des Landes verehrt wird. Der Vorschub, den die Bewohner von Sinra den aufrührerischen Stämmen von Kyushu leisteten, veranlasste sie an der Spitze eines Heeres nach Korea überzusetzen: Sinra wurde in kurzer Zeit erobert, die beiden anderen koreanischen Reiche huldigten aus freien Stücken und verpflichteten sich zu regelmäßigen Tributzahlungen. In Mimana, einem Distrikt von Petsi, wurden damals japanische Statthalter eingesetzt, welche neben den einheimischen Königen die Verwaltung führten. Eine Gesandtschaft, welche 239 von Japan nach dem chinesischen Reiche Weï 19) ging, scheint durch die koreanischen Angelegenheiten veranlasst worden zu sein — doch dauerte es noch mehrere Jahrzehnte bis die dortigen Verhältnisse eine feste Gestaltung gewannen. Im Jahre 249 führten die Japaner abermals einen siegreichen Krieg gegen das feindliche Sinra, und 264 musste das Königreich Petsi, wo ein Usurpator sich des Thrones bemächtigt hatte, zugleich mit seinem rechtmäßigen Herrn eine Verfassung aus den Händen des Mikado annehmen. — Wo-zin, der Sohn der obengenannten Kaiserin, ließ koreanische Arbeiter zur Erbauung von Landstraßen, Teichen und Kanälen kommen, und schickte 280 eine Gesandtschaft nach Petsi 20), um den gelehrten Chinesen Wo-nin (chinesisch Wang-tsin), der sich seit kurzem dort niedergelassen hatte, nach Japan zu führen. Er wurde Erzieher des Thronfolgers, lehrte am japanischen Hofe die Schreibekunst, und scheint die Werke des Confucius und Mencius dort eingeführt zu haben 21).
Der Verkehr mit den koreanischen Reichen war auch während der beiden folgenden Jahrhunderte sehr lebhaft; zuweilen mussten sie durch kriegerische Expeditionen zur pflichtmäßigen Tributzahlung angehalten werden. Die fortwährenden Grenzstreitigkeiten und die Kämpfe der drei Reiche um das Supremat gaben der japanischen Herrschaft in Korea ein bleibendes Übergewicht durch das dritte, vierte, fünfte und die erste Hälfte des sechsten Jahrhunderts. Um diese Zeit (562) aber gewann das den Japanern von jeher feindliche Sinra die Oberhand und vertrieb ihre Besatzung aus Mimana. Die vom Mikado hinübergesandten Heere wurden geschlagen und mussten das Land räumen. Die Fehden in Korea und die Unterhandlungen und Kämpfe um Herausgabe von Mimana währten von da an noch fast ein volles Jahrhundert.
Während des beschriebenen Zeitraumes wurden vielfach Handwerkerkolonien aus Korea und China nach Japan herübergeführt und erhielten dort zunftmäßige Rechte. Man warb Baumeister, Maler, Töpfer, Metallgießer, Ziegelbrenner, Sattler, und erlernte die Kunstfertigkeiten des Nähens, Stickens, Spinnens und Webens. Auch Ärzte und Meister der klassischen Literatur kamen aus China herbei, und die Werke chinesischer Poesie erweckten gleiche Bestrebungen in Japan — schon werden einheimische Dichter und Dichterinnen genannt. — Den Maulbeerbaum und die Seidenzucht führte schon der zweiundzwanzigste Mikado — um 470 — ein.
Den meisten Raum erfüllen in den Annalen des vierten und fünften Jahrhunderts die Familienzwiste der Großen und die Erbstreitigkeiten im Hause des Mikado; um die Thronfolge wurden oft blutige Kriege geführt.
Es ist ein merkwürdiger und für die Entwickelung aller dortigen Verhältnisse höchst wichtiger Zug, dass in Japan, wo fast alles Recht sich auf Erblichkeit gründet, die Erstgeburt fast gar keine Bedeutung hat: der Erbe wird durch das Familienhaupt aus der Zahl seiner legitimen Kinder und Agnaten erwählt. So ist es auch im Kaiserhause. Da nun die Mikados zu allen Zeiten mehrere rechtmäßige Frauen hatten, so war hier der Intrige Türe und Tor geöffnet. Jeder Günstling suchte dem Herrscher Gemahlinnen aus seiner Familie zu geben und dann deren Söhne auf den Thron zu bringen. Oft kam es durch die Eifersucht der Großen gar nicht zur Ernennung eines Thronfolgers, dann entspannen sich nach dem Tode des Kaisers heftige Fehden. In dieser Einrichtung der Vielweiberei bei den Mikados und der Thronfolge durch Erwählung ohne Berechtigung der Primogenitur liegt der natürliche Keim des Verfalles ihrer Macht. Verweichlichung, Entkräftung, Beeinflussung von vielen Seiten mussten die Folgen dieser Verhältnisse sein. Die Parteiungen und eifersüchtigen Kämpfe der dem Kaiserhause verschwägerten Geschlechter haben in hohem Maße den Gang der japanischen Geschichte bestimmt.
Schon gegen Ende des fünften Jahrhunderts entzogen sich mehrere Mikados ganz den Regierungsgeschäften, und bestellten Regenten, die an ihrer statt die Verwaltung leiten mussten.
Die Ereignisse, welche die Einführung des Buddhismus in Japan begleiteten, verdienen erzählt zu werden, da sie einiges Licht auf die Zustände jenes Zeitalters werfen.
Im Jahre 552 sandte der König von Petsi dem Mikado eine Bildsäule des Buddha Siaka und die kanonischen Bücher seines Kultus zum Geschenk. An der Spitze der japanischen Regierung standen damals zwei mächtige Minister, welche über die Zulassung des fremden Kultus in Streit gerieten. Der Mikado schenkte das Buddhabild dem Iname, welcher für Einführung der neuen Lehre stimmte und nun dem Götzen einen Tempel baute. Schon damals gab es unter den koreanischen Einwanderern viele Buddhisten, welche ihrer Religion auch bei den Japanern Eingang zu verschaffen suchten. — Bald nach Aufstellung jenes Buddhabildes brach die Pest aus; der Gegner des Iname überredete den Mikado, dies sei eine Strafe der alten Landesgötter, und bewirkte, dass die Bildsäule gestürzt, der Tempel zerstört wurde. Unter dem folgenden Mikado erneut sich der Streit zwischen den Söhnen jener Günstlinge. Aus Petsi kommen viele buddhistische Priester und Gelehrte herüber, ein Teil des Mikado-Hauses ist dem Kultus günstig, aber noch einmal kommt die Pest dem buddhafeindlichen Regenten Moriya zu Hilfe, er setzt abermals die Ausrottung der Lehre durch. Die Priester werden ihres Ornates beraubt, die Tempel zerstört. Unter dem folgenden, dem zweiunddreißigsten Mikado, gewinnt Mumako, der Sohn des Ministers Iname, wieder Macht; er lässt nochmals Priester aus Petsi kommen, stellt den Kultus wieder her, und stürzt mit Hilfe des Prinzen Siotok-Daïsi den Moriya. Der Mikado stirbt; sein jüngerer Bruder wird von dem allmächtigen Mumako auf den Thron gesetzt, aber bald nachher, da er dem fremden Kultus abhold ist, auf sein Geheiß ermordet. Seine Schwester muss ihm sukzedieren 22), Mumako wird Regent. Unter seinem Schutze verbreitete sich die Buddhalehre schnell im ganzen Lande; sie fand besonders an den vielen neuen Einwanderern aus Korea und auch an den älteren Kolonisten eifrige Jünger. Man gründet Tempel und Klöster; gegen das Jahr 620 gab es nach den Annalen schon 816 Priester, 569 Priesterinnen und 46 Tempel des Buddha Siaka in Japan.
Der Einfluss des mächtigen Mumako erstreckt sich über ein halbes Jahrhundert. Sein Sohn Soga-no-Yemisi folgt ihm in der Regentenwürde unter dem fünfunddreißigsten Mikado Dsio-meï (629—641). Mit der Thronbesteigung von dessen Witwe wächst die Macht und der Übermut des Yemisi, er baut seinem Vater ein Grabmal gleich dem der Mikados, und überträgt erkrankend aus eigener Machtvollkommenheit die Regentenwürde seinem Sohne Iruka, dessen maßlose Willkür die Großen zur Verschwörung treibt. Iruka wird in feierlicher Hofversammlung in Gegenwart der Kaiserin, deren Sohn Naka-no-Osi unter den Verschworenen ist, niedergestoßen. Darauf entspinnt sich ein heftiger Kampf, die Hälfte des Hofes schlägt sich zu Yemisi, seine Partei ist so mächtig, dass sie die kaiserliche überwunden haben würde, wenn nicht die seinen Anhängern gemachten Vorstellungen, es sei unerhört, dass das Göttergeschlecht des Mikado einem Rebellen weichen solle, gewirkt, die Partei zerstreut hätten. Yemisi wurde in seinem Hause mit seinen Schätzen verbrannt.
So die Annalen. — Diese Ereignisse geben ein Bild der späteren Umwälzungen, die Elemente sind immer dieselben. Das Geschlecht des Mikado degeneriert, der fähigste Minister bemächtigt sich der Leitung des Staates; seine Würden vererben nach altjapanischer Sitte auf seine Nachkommen, nicht aber seine Kraft und Fähigkeiten. Nach einigen Generationen ist sein Geschlecht unter der Wirkung der Schmeichelei und des üppigen Hoflebens ebenso entartet, wie das des Mikado und erfährt ein gleiches Schicksal: eine andere Familie tritt an dessen Stelle. Zuweilen auch erhebt sich, während das herrschende Regentengeschlecht in Entkräftung versinkt, das Kaiserhaus wieder aus dem Elende; niemals aber ist seine Herrschaft von langer Dauer. Der Luxus und die Üppigkeit des Hoflebens, die göttliche Verehrung der Person des Mikado, die Schmeichelei, die sich nur in der Zeit der Erniedrigung von ihm abwendet, machen ein Andauern der Kraft durch mehrere Generationen unmöglich. — Die Soga wollten den Mikado stürzen und dessen Würde an sich reißen. Wie fest und untrennbar diese nach dreizehnhundertjähriger Herrschaft (wenn man es glauben darf) mit dem Geschlechte des Dsin-Mu verwachsen, wie stark der Glauben an dessen Beruf und Recht auf den Thron war, beweisen die erzählten Begebenheiten. Spätere Usurpatoren versuchten niemals, sich die Würde, den Rang des Mikado anzumaßen, sie begnügten sich, ihm die Macht zu nehmen und übten auch diese nur in seinem Namen. Die Würde ist nach japanischen Begriffen etwas erbliches, von der Abstammung untrennbares — dieses Erbrecht war zu allen Zeiten heilig und unantastbar — keine äußeren Umstände können ein Geschlecht jemals seines angestammten Ranges berauben, selbst das größte Elend nicht, wie die japanische Geschichte vielfach beweist; — nur ehrlose Handlungen des Familienhauptes, wenn sie nicht durch Selbstopferung gesühnt werden, rauben dem Geschlechte seinen Rang. So oft in der späteren Geschichte die Herrschaft auf ein anderes Haus übergegangen ist, hat dieses niemals den Titel seiner gestürzten Vorgänger angenommen, sondern einen anderen neuen. Aber die Erfahrung hat die Japaner gelehrt, dass die Kraft nicht immer mit der Würde vereint ist, deshalb gewöhnten sie sich, die Macht als etwas rein tatsächliches anzusehen. Dem großen Usurpator Taïko-sama gelang es im sechszehnten Jahrhundert das von Bürgerkriegen zerrissene Reich unter seinem Szepter zu vereinigen, und trotz seiner niedrigen Abstammung seine Herrschermacht zur vollsten Anerkennung nicht nur beim Volke, sondern auch bei den Großen zu bringen; er konnte aber trotz allen Bemühungen den Shogun-Titel, welcher von uralters her der Familie Minamoto eigen war, nicht erlangen, und musste sich, um durch eine andere alte Würde seinem Throne Glanz zu verleihen, von einem Mitgliede der Familie Fudsiwara, welche den Kuanbak-Titel seit Jahrhunderten erblich besaß, förmlich adoptieren lassen. Der Mikado gab auch dann nur widerstrebend seine Zustimmung: es war eine Anomalie wegen Taïko-sama’s niedriger Geburt und wurde als etwas unerhörtes angesehen, weil nach japanischen Begriffen nur die Adoption Ebenbürtiger statthaft ist; seine Macht aber wurde als rechtmäßig anerkannt, sobald sie tatsächlich begründet war.
Nach der Ermordung des Iruka (645) dankte die Kaiserin Kuogok 23) zu Gunsten ihres Bruders Kotok ab, bestieg aber nach dessen Tode nochmals den Thron. Erst im Jahre 662 erhielt Prinz Naka-no-Osi unter dem Namen Tentsi die Krone. Sein Freund und Mitverschworener Kamatari stand seit Irukas Tode an der Spitze der Staatsverwaltung. In der Familie des Kamatari, welche vom Kaiser den Namen Fudsiwara erhielt, wurde später die Kuanbak-Würde 24) erblich; ihr Einfluss war schon im achten Jahrhundert am Hofe vorwiegend. — Dieses Geschlecht hat sich auch später, nachdem es die Macht verloren, durch alle Zeiten im Besitz der höchsten Hofämter erhalten.
Kamatari scheint sich um die inneren Einrichtungen des Staates verdient gemacht zu haben; er teilte das Reich in acht Provinzen, regelte die Verwaltung und gab den Beamten feste Besoldung: durch das ganze Land wurden Postrelais eingerichtet, Kataster aufgenommen, das Steuerwesen geordnet. Das Heerwesen erhielt eine festere Gestaltung; eine stehende Kriegsmacht hatte man seit lange im Westen des Reiches — gegen Korea — unterhalten, einzelne Abteilungen davon bildeten, sich ablösend, die Garnison der Residenz. Kamatari baute Arsenale und Magazine, brachte auch die Hofhaltung in eine feste Ordnung, regelte die Etikette und führte die öffentlichen Audienztage ein. Der größte Teil des noch jetzt am Hofe des Mikado üblichen Zeremoniells, sagen die Annalen, datiert aus jener Zeit 25).
Auch nach außen machte sich die steigende Blüte des Reiches geltend. Die Jahrbücher berichten von einem Kriegs- und Jagdzuge nach der Tartarei, und von einer Expedition gegen die wilden Stämme auf Yeso. Gefangene Aïnus von abenteuerlichem Aussehen mussten den Glanz der Gesandtschaften an den chinesischen Hof erhöhen. — In Korea gewannen die Japaner im Jahre 600 einen Teil ihres alten Besitzes zurück; um 623 wurden sie wieder vertrieben, waren aber bald darauf nochmals siegreich 26). Von dieser Zeit bis 650 scheinen alle drei Reiche regelmäßig Tribut entrichtet zu haben; aber das Übergewicht des mit den Chinesen verbündeten Sinra machte sich mehr und mehr geltend. Als im Jahre 651 seine Gesandten in chinesischer Tracht erschienen, wiesen die Japaner sie an der Grenze zurück. Zehn Jahre darauf eroberte Sinra mit chinesischer Hilfe Petsi und bedrängte auch Kaoli. Die in den Jahren 662 und 663 von Japan gesandten Hilfsvölker mussten der Übermacht der Chinesen weichen und das Land räumen; mit ihnen kamen einige tausend koreanische Einwanderer nach Japan, darunter Mitglieder der Königsfamilie von Petsi, welche in der Landschaft Muts Lehnsgüter erhielten. Später folgten noch wiederholt große Züge von Einwanderern. — Seitdem übte Japan keinen Einfluss mehr auf die koreanischen Angelegenheiten. Man errichtete Grenzwachen auf den Inseln Iki und Tsus-sima und an der Nordostküste von Kyushu und legte starke Besatzungen dahin. Die guten Beziehungen zum chinesischen Hofe wurden bald wieder hergestellt, und auch mit Korea, das jetzt unter dem Supremate Sinras stand, trat man wieder in freundliche Verkehrsverhältnisse, welche bis 922 dauerten.
Tentsi, sagen die Annalen, war ein Freund der Wissenschaften; unter ihm wurde die Landesverwaltung und die Gerechtigkeitspflege zuerst auf festen und haltbaren Grundlagen geordnet. Noch heute ehrt man ihn als einen der größten Fürsten von Japan.
Mehr und mehr blühte das Reich unter den folgenden Kaisern auf. Gegen Ende des siebenten Jahrhunderts scheint die japanische Kultur über die drei großen Inseln verbreitet gewesen zu sein, mit Ausnahme der nördlichsten Teile von Nippon, wo noch immer wilde Stämme hausten. In diese Zeit fällt die erste Entdeckung der einheimischen Gold-, Silber- und Kupferminen.
Mit dem Reichtum wuchs auch das Bedürfnis verfeinerter Bildung. Die Mikados schickten glänzende Gesandtschaften nach China; mit ihnen gingen Priester und gelehrte Edelleute hinüber, die zur Erweiterung ihrer Kenntnisse oft viele Jahre dort zubrachten. Dass aber schon damals die einheimische Bildung, wenn auch auf die chinesische gepfropft, einen hohen Grad der eigentümlichen Entwickelung erreicht hatte, beweist der Umstand, dass die chinesische Schrift dem japanischen Bedürfnisse nicht mehr genügte. Man stellte Silbenalphabete auf, um den Klang der japanischen Sprache ausdrücken zu können, und zwar zunächst, wahrscheinlich noch im achten Jahrhundert, die Firakana-, etwas später die Katakana-Schrift 27).
Unter dem Jahre 794 unserer Zeitrechnung erwähnen die Annalen der Gründung des Palastes von Miako; bis dahin hatten die Erbkaiser in verschiedenen Gegenden von Yamatto und den angrenzenden Landschaften Hof gehalten. Der fünfzigste Mikado Kuan-mu baute in der Landschaft Yamasiro, nördlich von Yamatto, ein prächtiges Schloss, zu dessen Ausschmückung alle Teile des Landes beisteuern mussten: dort haben seitdem die Erbkaiser residiert. Miako 28) liegt in der Ebene, umgeben von waldigen Höhen, nicht weit von dem See Oomi, der im Jahre 286 v. Chr. durch plötzliches Versinken einer großen Strecke Landes entstanden sein soll. — Die Stadt wuchs rasch zu ansehenlicher Größe heran, der Hof und die Großen verbreiteten dort Reichtum und Bildung. Auf den benachbarten Bergrücken ließen sich die Priester und Mönche verschiedener Sekten nieder, prächtige Tempelanlagen bedeckten die waldigen Hänge. Die buddhistischen Sekten hatten sich im achten Jahrhundert immer mehr in Japan ausgebreitet; dem gebildeteren Volke musste ihre zum Denken und zur Betrachtung anregende Lehre mehr zusagen als die alte Naturreligion. Durch die häufigen Berührungen mit China kamen vielerlei Observanzen herüber und auch in Japan entstanden neue Sekten. Die einheimischen Theologen scheinen das Material in eigentümlicher Weise verarbeitet und mit der alten volkstümlichen Lehre verschmolzen zu haben: bald ließen sie die alten Kamis unter der Hülle indischer Gottheiten erscheinen, bald diese in den Personen japanischer Herrscher und Helden wiedergeboren werden. So wurde die alte Landesreligion nicht verdrängt, aber vielfach modifiziert, und übte auch ihrerseits starken Einfluss auf den buddhistischen Kultus. Wenige Sekten scheinen die eine oder die andere Lehre in ihrer vollen Reinheit bewahrt zu haben, aber der Buddhismus gewann ein großes Übergewicht. Selbst die Erbkaiser, wiewohl doch eigentlich eine Inkarnation der alten Nationalgottheit, bekannten sich zu dem indischen Kultus; von Kuan-mu, dem fünfzigsten Mikado, wird ausdrücklich erzählt, dass er sich buddhistisch taufen ließ 29).
Das Ansehen der Erbkaiser scheint in dieser Periode und noch bis in den Anfang des neunten Jahrhunderts im Steigen gewesen zu sein. Zwar bekleideten schon damals die Fudsiwara fortwährend die höchsten Hofund Staatsämter, doch war ihr Einfluss nicht unbedingt; sie hatten lange Zeit die Eifersucht anderer Günstlinge zu bekämpfen, mussten oft weichen, und überwanden ihre Nebenbuhler erst zu Ende des achten Jahrhunderts, das besonders reich war an weiblichen Mikados. Die Politik dieser Familie bestand darin, ihre Töchter den Kaisern zu vermählen und ihnen oder ihren unfähigsten Söhnen die Sukzession zu verschaffen. Im Anfange des neunten Jahrhunderts befestigte sich die Macht der Fudsiwara immer mehr: unter ihrer Einwirkung abdizieren der einundfünfzigste, zweiundfünfzigste, dreiundfünfzigste Mikado in der Kraft ihrer Jahre und ziehen sich in das Privatleben zurück. Fudsiwara-no-Yosi-fusa wird Regent bei der Thronbesteigung des sechsundfünfzigsten Mikado, der sein Tochtersohn und nur neunjährig war. Auch dieser dankt in seinem sechsundzwanzigsten Jahre zu Gunsten seines achtjährigen Sohnes ab, welcher heranwachsend Begabung und Tatkraft zeigt, aber von Moto-tsune, dem Sohne und Nachfolger des Yosi-fusa, entthront wird. Moto-tsune nahm zuerst den Titel Kuanbak an und setzte einen Greis auf den Thron; in ähnlicher Weise schalten seine Nachfolger durch mehrere Generationen. Die Kuanbak-Würde vererbt vom Vater auf den Sohn, das Haupt der Fudsiwara steht in Wirklichkeit an der Spitze des Staates. Nur Greise und Unmündige werden auf dem Throne geduldet; die höchste Würde bleibt den Mikados, aber alle unter ihnen, die Fähigkeit und Tatkraft zeigen, müssen abdanken und sich in das Privatleben zurückziehen. Die Ex-Mikados bewohnen prächtige Paläste in und um Miako, wetteifern mit den Großen in glänzenden Festlichkeiten und vergeuden ihre Kraft in Mummereien und anderen rauschenden Vergnügungen. Miako wird ein Sitz des Reichtums und verfeinerter Sitten: die vornehme Jugend übt die Jagd und ritterliche Spiele, Musik und Poesie, sie wirbt um zarte Frauenminne und Waffenruhm, und sucht Abenteuer gleich den Kämpen des Westens. So erscheint in Japan das neunte und zehnte Jahrhundert als ein Zeitalter ritterlicher Romantik 30).
Die Berührungen mit dem Auslande wurden seit dem Anfange des neunten Jahrhunderts seltener: nur in langen Zwischenräumen gingen einzelne Priester und Gelehrte nach China, von Gesandtschaften dahin berichten die Annalen in diesem Zeitraume gar nicht. Die japanische Gesittung stand jetzt auf eigenen Füßen und entwickelte sich selbstständig zu immer höherer Blüte. Die Beziehungen zu Korea blieben die alten bis um das Jahr 935, in welchem ein Fürst von Kaoli das alternde Königshaus von Sinra stürzte. Von da bis zum Jahre 1392 hatte Japan gar keinen Verkehr mit Korea. Gegen das Ende des neunten und zu Anfang des zehnten Jahrhunderts verwüsteten Korsaren von Sinra vielfach die japanischen Küsten und bemächtigten sich auf kurze Zeit der silberreichen Insel Tsus-sima.
Die Ruhe im Inneren des Reiches wurde in dieser Blüteperiode nur durch die hochmütigen ränkesüchtigen Priester und Mönche der Umgegend von Miako zuweilen gestört. In hunderten reich dotierter Klöster angesiedelt befehdeten sie einander mit Feuer und Schwert, und zogen oft, mit den zur Schlichtung ihrer Kämpfe getroffenen Entscheidungen unzufrieden, in hellen Haufen nach der Hauptstadt, legten Feuer an die Paläste der Kuanbaks und selbst an die Wohnung der geheiligten Erbkaiser, und mussten mit Waffengewalt vertrieben werden. Die Annalen erzählen viel von der Unbeugsamkeit und Zügellosigkeit dieser Priester; ihr Reichtum und Einfluss wuchs noch bedeutend in den folgenden Jahrhunderten. Sie wohnten in zahlreichen Korporationen zusammen, die sich später, zur Zeit der inneren Kriege, vielfach an den Kämpfen beteiligten und eine politische Macht wurden, welche die Parteien nicht verachten durften.
Um die Mitte des zehnten Jahrhunderts begegnen wir einer Rebellion, angestiftet von einem Abkömmling des Kaisers Kuan-mu, der sich im Osten von Nippon zum Mikado ausrufen ließ und eine zahlreiche Partei zu gewinnen wusste. Erst nach mehreren Feldzügen bewältigten ihn die Heere der Kuanbaks. Dies war die Blütezeit ihrer Herrschaft, welche in den Annalen bis zu Ende des zehnten Jahrhunderts als gerecht und weise gepriesen wird. Den Erbkaisern gegenüber behaupteten sie ihr Ansehen auch noch durch die beiden ersten Dritteile des elften Jahrhunderts: von dem neunundsechzigsten Mikado wird ausdrücklich gesagt, dass er, obgleich sehr fähig und unterrichtet, sich doch in allen Regierungsangelegenheiten in den Willen der Kuanbaks habe fügen müssen; aber ihre Autorität im Lande sank immer mehr. Das Geschlecht war entkräftet und den inneren Zuständen, die sich im Laufe der Zeit herangebildet hatten, nicht mehr gewachsen. Die einzelnen Landschaften wurden ursprünglich von Statthaltern des Mikado regiert, welche allmählich das Amt in ihren Familien erblich gemacht zu haben scheinen. Die Souveränitätsrechte, die sie ursprünglich im Namen der Erbkaiser übten, gingen durch den Brauch und die Gewohnheit langer Zeiträume allmählich auf sie selbst über. So entstanden die Erblehen. Einige dieser Fürsten wuchsen den schwachen Kuanbaks über den Kopf und schüttelten deren Herrschaft ab: schon im Anfange des elften Jahrhunderts bekriegten mehrere selbstständig gewordene Daïmios einander ungestraft, und um 1050 brach in den nördlichen Landschaften von Nippon eine Rebellion gegen die Zentralregierung aus, welche erst nach langen heftigen Kämpfen unterdrückt wurde. Der siegende Held dieses Krieges war Minamoto-no-Yori-yosi 31), der nach seinem Tode als Kriegsgott Fatsman-yu verehrt wurde, der Stammvater der späteren Shogun-Dynastien.
Dem einundsiebzigsten Mikado Go-Sansio 32) gelang es um das Jahr 1070, dem schwachen Kuanbak das Ruder der Herrschaft zu entwinden; er wurde auch für kurze Zeit Herr der rebellischen Großen. Seine Nachfolger fuhren zwar fort den Häuptern der Fudsiwara den hergebrachten Kuanbak-Titel zu verleihen, doch scheint dieses Amt seitdem eine Art Hausministerium geworden zu sein; die frühere Macht erlangten sie trotz mancherlei Versuchen niemals wieder.
Die nächsten achtzig Jahre bieten nun die merkwürdige Erscheinung, dass die Erbkaiser, sobald sie einen lebensfähigen Erben haben, dem Throne freiwillig entsagen, aber die Leitung des Staates in der Hand behalten. Das Zeremoniell, mit welchem die Kuanbaks die geheiligte Person des Mikado umgeben hatten, und dessen man sich jetzt nicht mehr entledigen konnte, scheint jede freie Bewegung gehemmt und ein kräftiges Eingreifen in die Geschäfte unmöglich gemacht zu haben. Go-Sansio abdiziert schon nach dreijähriger Regierung zu Gunsten seines Sohnes Dsiro-kawa, der, von seinem Vater in die Geschäfte eingeweiht, im Jahre 1086 ebenfalls abdankt, um die Leitung des Staates nach dessen Tode zu übernehmen. Er regiert das Land unter den beiden folgenden Kaisern, seinem Sohne und Enkel. Der Letztere, Toba, resigniert schon im zweiundzwanzigsten Jahre zu Gunsten seines Sohnes Siutok und ergreift bei Dsiro-kawas Tode die Zügel der Herrschaft. Auf sein Geheiß muss später Siutok die Krone einem jüngeren Halbbruder abtreten, nach dessen Tode Toba abermals einen seiner unmündigen Söhne auf den Thron setzt. Dsiro-kawa stirbt, und Siutok sucht sich (1156), zu schwach für die Herrschaft, wenigstens des Thrones wieder zu bemächtigen, um seinen eigenen Söhnen die Nachfolge zu sichern. Der Hof ist in zwei Parteien gespalten: Siutok unterliegt nach blutigem Kampfe, wird zum Priester geschoren und in die Verbannung geschickt.
Alle diese Herrscher waren ihrer Stellung nicht gewachsen. Unter der kraftlosen Verwaltung der letzten Kuanbaks hatten die Lehnsfürsten ihre Häupter erhoben und boten der kaiserlichen Regierung Trotz, und wenn auch Go-Sansio auf kurze Zeit der aufrührerischen Großen wieder Meister wurde, so konnten doch weder er noch seine Nachfolger ihr Ansehen auf die Länge behaupten. Der Zwist in der Familie der Mikados gab ihrer Macht den Todesstoß. Seitdem Siutok seinen Bruder zu entthronen suchte, war das Kaiserhaus immer in verschiedene Fraktionen zerspalten und wandte vergebens alle Mittel der Gewalt und Intrige auf, um die Herrschaft wieder an sich zu reißen; sie wurden seitdem ein Spielball der Großen, welche sich ihres Ansehens nur zu Erreichung der eigenen selbstsüchtigen Zwecke bedienten.
Schon unter der Herrschaft des Dsiro-kawa waren wieder Unruhen in den nördlichen Landschaften von Nippon ausgebrochen, zu deren Unterdrückung zwei blutige Kriege geführt werden mussten. Der kaiserliche Feldherr Minamoto-no-Yosi-ye, ein Sohn des Yori-yosi, benutzte sein in diesem Kriege gewonnenes Ansehen, um sich von den Bewohnern des Kuanto 33) huldigen zu lassen. Dsiro-kawa sandte den Fürsten Taïra-no-Masa-mori gegen die Minamoto: dies war die erste feindliche Begegnung der Familien Minamoto und Taïra (Gensi und Feïke) deren erbitterte Kriege bald darauf eine Umgestaltung aller Verhältnisse herbeiführen sollten. Zwei Heerführer aus diesen Geschlechtern, Minamoto-no-Yosi-tomo Fürst von Simotske und Taïra-no-Kiyo-mori gewannen dem Mikado Go-Dsiro-kawa den Sieg über seinen Halbbruder Siutok und wurden die einflussreichsten Männer im Staat. Ihre und ihrer Nachkommen Kämpfe um die Herrschaft bilden die Geschichte der nächsten fünfundzwanzig Jahre.