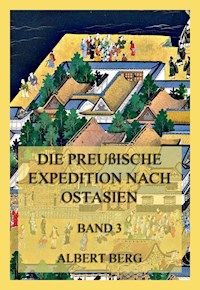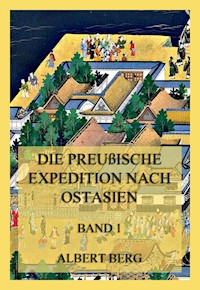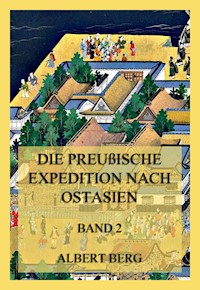
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die preußische Ostasien-Expedition, auch als "Eulenburg-Expedition" bekannt, war eine diplomatische Mission, die Friedrich Albrecht zu Eulenburg im Auftrag Preußens und des Deutschen Zollvereins in den Jahren 1859-1862 durchführte. Ihr Ziel war es, diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu China, Japan und dem damaligen Siam aufzubauen. Die wichtigsten Teilnehmer der Expedition waren Friedrich Albrecht zu Eulenburg, Lucius von Ballhausen (Arzt), Max von Brandt (Attaché), Wilhelm Heine (Maler), Albert Berg (Künstler), Karl Eduard Heusner, Fritz von Hollmann, Werner von Reinhold, Ferdinand von Richthofen und Gustav Spiess. Der Expedition standen drei Kriegsschiffe des preußischen Ostasiengeschwaders zur Verfügung, die SMS Arcona, die SMS Thetis und die SMS Frauenlob. Dies ist Band zwei von vier der Aufzeichnungen zu dieser Expedition. Der Text folgt den Originalausgaben, die zwischen 1864 und 1873 erschienen, wurde aber in wichtigen Wörtern und Begriffen der heute aktuellen Rechtschreibung angepasst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die preußische Expedition nach Ostasien
Band 2
ALBERT BERG
Die preußische Expedition nach Ostasien, Band 2, A. Berg
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849662172
Quelle: [Berg, Albert]: Die preussische Expedition nach Ost-Asien. Bd. 2. Berlin, 1866. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/berg_ostasien02_1866>, abgerufen am 03.05.2022. Der Originaltext aus o.a. Quelle wurde so weit angepasst, dass wichtige Begriffe und Wörter der Rechtschreibung des Jahres 2022 entsprechen.
Cover Design: Cropped, By Koa-public - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78051662
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
VORWORT.1
REISEBERICHT.3
VI. TOKIO.3
VII. TOKIO.52
VIII. DIE FAHRT DER ELBE VON SINGAPUR NACH TOKIO ÜBER HONGKONG, FORMOSA UND NAGASAKI.96
IX. TOKIO.100
X. TOKIO.118
XI. FAHRT DER ARKONA UND THETIS VON YOKOHAMA NACH NAGASAKI. AUFENTHALT IN NAGASAKI.153
XII. REISE DER ARKONA UND DER THETIS VON NAGASAKI NACH DEM JANGTSEKIANG.183
ANHANG I. DER VERTRAG MIT JAPAN.187
ANHANG II. DIE EREIGNISSE DER LETZTEN JAHRE.200
VORWORT.
Im Personal-Verzeichnis der ost-asiatischen Expedition (Bd. I. S. xiii) ist aus Versehen der Namen des Dr. med. Robert Lucius ausgelassen worden, welcher derselben sehr wesentliche Dienste geleistet hat. Er traf, aus Marokko kommend, wo er den spanischen Feldzug mitmachte, auf der Reise nach China begriffen, wo er sich der englischen Armee anschließen wollte, in Ceylon zufällig mit dem Gesandten zusammen, und begleitete denselben, dazu aufgefordert, während der ganzen Dauer des Unternehmens. Ein Gesandtschafts-Arzt war von vornherein nicht ernannt worden; im Laufe der Reise machte sich der Mangel eines solchen sehr fühlbar; es war für das Gesandtschafts-Personal bei dem langwierigen Aufenthalt in Tokio, Tientsin und Bangkok nicht nur vom größten Werte, sondern wurde in mehreren eingetretenen Fällen dringend notwendig, ärztliche Hilfe sogleich bereit zu haben. Diesem Amt hat sich Dr. Lucius freiwillig unterzogen, hat ohne jede Verpflichtung auch unter den beschwerlichsten Umständen mit Selbstverleugnung darin ausgeharrt, Zeit und Kräfte, die er genussreicher verwenden konnte, ganz seinen Reisegefährten gewidmet, und sich deren wärmsten Dank und persönliche Zuneigung erworben. Seine uneigennützigen Dienste wurden durch nachträgliche Ernennung zum königlichen Gesandtschafts-Arzt auch amtlich ehrenvoll anerkannt.
Der japanische Teil des Expeditionswerkes ist in diesem Band zum Abschluss gebracht. Es konnte nicht die Absicht sein, neben dem persönlich Erlebten eine erschöpfende Beschreibung des Landes zu geben, doch lag es nah, manches Ergänzende einzuflechten, wo es die Gelegenheit gab und glaubhafte Nachrichten vorhanden waren. Sicher fehlt es in diesen Abschweifungen nicht an Lücken und Irrtümern; aber unsere Kenntnis von Japan ist überhaupt nur eine werdende, und selbst Abwege führen leichter zur Wahrheit, als Stillstand und Verwirrung.
Aus demselben Gesichtspunkte ist der II. Anhang dieses Bandes unternommen worden, ein Versuch, aus den im Laufe der letzten Jahre eingelaufenen Nachrichten die gegenwärtige unfertige Entwicklung darzustellen. Was darin über Berührung der Fremden mit Japanern gesagt ist, beruht auf zuverlässigen Quellen; für die Vorgänge der inneren Politik dagegen mussten auch Gerüchte in die Darstellung gezogen und mindestens eine Meinung über den Gang und Sinn der Ereignisse ausgesprochen werden. Der Abschnitt wird bei aller Unvollständigkeit einem künftigen Bearbeiter der japanischen Zeitgeschichte vielleicht von Nutzen sein.
Der Reisebericht ist vor dem glorreichen Krieg geschrieben, welcher uns der Erfüllung mancher darin ausgesprochenen Wünsche so viel näher gerückt hat.
Berlin, im August 1866.
A. Berg.
REISEBERICHT.
VI. TOKIO.
VOM 2. OKTOBER BIS 1. NOVEMBER 1860.
Der Oktober, sonst in Japan der schönste Monat, brachte in seiner ersten Woche heftigen Regen. Als der Himmel am Morgen des 7. sich aufklärte, beschloss der Gesandte den längst beabsichtigten Ausflug nach Kanagava auszuführen; wir stiegen gegen zehn zu Pferde und ritten, geleitet von Heusken und gefolgt von mehreren Yakuninen, dem Tokaïdo zu. Der Weg führt durch die endlosen Häuserreihen von Sinagava und Omagava, dann zwischen Hecken und ländlichen Wohnungen hin, und endlich in das Freie. Streckenweise ist die Landstraße mit Reihen von Kryptomerien gesäumt; zu beiden Seiten liegen Reisfelder, links vom Meere, rechts von grünen Hügelreihen begrenzt; grade aus, über die zackigen Fakone-Berge ragend, der Fujiyama. Bei trefflicher Anlage auf breitem Damm ist die ganze Strecke bis Kanagava auffallend vernachlässigt, während in anderen Landesteilen die Verkehrsstraßen den Vergleich mit guten europäischen aushalten sollen. — Halbwegs Kanagava überschreitet man auf Fähren das Flüsschen Logan, die vertragsmäßige Nordgrenze des freien Verkehrs für die fremden Ansiedler in Kanagava und Yokohama; drüben empfangen den Reisenden wieder die geschlossenen Häuserreihen des Dorfes Kawasaki, das sich ohne Unterbrechung in mehrere andere fortsetzt; man glaubt durch eine große Stadt zu reiten. Wo der Blick endlich wieder Raum gewinnt, beherrscht er links das Meer; rechts tritt ein grüner Höhenzug immer näher an die Straße. Bald künden zerstreute Gehöfte und Bauernhäuser die Nähe von Kanagava an; ihre Strohdächer tragen auf der First eine auffallende Bekrönung hellgrüner Irispflanzen, die, einmal gesät, sich immer wieder erzeugen, und durch ihr Wurzelgewebe der Dachfirst große Festigkeit gegen Wind und Wetter verleihen. — Dann werden die Häuser städtischer. Der Raum zwischen dem Meer und der steil abfallenden Höhe verengt sich zu einem schmalen Streifen, den ein Labyrinth gewundener Gassen und Gässchen erfüllt. Auf der Höhe rechts und an ihrem Abhange liegen Tempel und andere ansehnliche Gebäude, die Wohnungen der Konsuln; schwindelnde Treppenfluchten führen bis zum Gipfel hinan. — Der Gesandte stieg bei Herrn von Bellecourt ab, der grade in Geschäften anwesend war; seine Begleiter fanden im englischen und im portugiesischen Konsulat gastliche Aufnahme. Die Yakunine wurden entlassen, denn hier durfte man sich ohne Eskorte bewegen.
Kanagava bietet außer seiner schönen Lage und dem Blick von den Höhen auf die freundliche belebte Bucht kaum etwas Bemerkenswertes; Einige von uns fuhren noch denselben Nachmittag nach Yokohama hinüber zu ihren dort wohnenden Reisegefährten. Die Bootsfahrt dauert bei gutem Wetter kaum eine halbe Stunde; der Fujiyama, der uns an diesem Tage zuerst im weißen Winterkleide erschien, spiegelte majestätisch sein glänzendes Haupt in dem weiten Becken.
Wir fanden unsere Freunde in dem damals in Entstehung begriffenen Yokohama-Hotel, — das ein gewesener holländischer Schiffskapitän baute, — zwar nicht sehr bequem eingerichtet, aber zufrieden mit ihrem Aufenthalt. Das Vordergebäude des Gasthofes wurde eben in Angriff genommen und noch im Laufe des Winters vollendet; der geräumige Hof, an drei Seiten von langen einstöckigen Baracken umschlossen, lag voll Baumaterial; auf der einen Seite der Speisesaal mit Billard und Schankzimmer, gegenüber eine Reihe kleiner Wohn- und Schlafstuben, im Grunde, dem Hauptgebäude gegenüber, die Pferdeställe, Alles in Eile budenartig zusammengezimmert und halb japanisch, halb europäisch eingerichtet. Das Ganze glich damals einer improvisierten Jahrmarktsschenke; aber Küche und Keller waren gut, der Wirt zuverlässig und gefällig, und für Bedienung sorgte man selbst. Yokohama, zwei Jahre vorher noch ein elendes Fischerdorf, blühte mächtig auf, und, war auch die goldene Zeit der Kobang-Ausfuhr vorüber, so wurden doch täglich noch bedeutende Summen gewonnen. Alle großen westländischen Handelshäuser Chinas hatten dort ihre Kommanditen und setzten große Massen baren Silbers in Umlauf; die Waren-Ausfuhr blieb immer hinter der Nachfrage zurück. Japanische, europäische und amerikanische Kaufleute, Handwerker und Abenteurer strömten in Menge zu, um voneinander Vorteil zu ziehen und den Markt auszubeuten, ein reges schwindliges Treiben.
Den Mittelpunkt des kleinen Verkehrs bildete eine lange gerade Straße, mit Krambuden und Kaufläden Haus für Haus, wo man die größte Auswahl von Lack- und Bronze-Waren und alle die tausenderlei Kleinigkeiten findet, deren schon bei der Beschreibung von Tokio gedacht wurde. Die meisten Sachen aber sind von geringer Qualität, außen glatt und glänzend, doch wenig dauerhaft, dabei wohlfeiler als in Tokio und großenteils auf das Bedürfnis und den Geldbeutel der Schiffsmannschaften berechnet. Das fremde Publicum ist hier ja auch viel zahlreicher und weniger wählerisch als in der Hauptstadt; die meisten kaufen aus Spekulation, nicht aus Liebhaberei, daher denn auch der europäische Markt mit mittelmäßigen japanischen Fabrikaten überschwemmt ist, die im Lande selbst keinen Absatz finden würden, während die besseren, namentlich alte Lac- kund Bronzewaren, welche in Japan hohe Preise haben, verhältnismäßig selten zu uns gelangen. Einzelne wertvolle Stücke kommen auch in Yokohama vor und finden an den wenigen Liebhabern unter den Konsuln und gebildeteren Kaufleuten bereitwillige Käufer. Die japanischen Krämer wissen ihr Publicum sehr wohl zu beurteilen, und hüten sich kostbare Sachen in den offenen Läden der Kritik und Betastung des Schiffsvolkes preiszugeben; in den Hinterzimmern aber kramen sie bereitwillig ihre Schätze aus, oder bringen guten Kunden auch wohl die wertvollsten Sachen in die Häuser.
Am Ende der langen Straße lag eine kleine Menagerie, richtiger Tierhandlung, in der für die Eingeborenen ein europäisches Schaaf und ein Kakadu das Merkwürdigste waren, für uns dagegen die weißen Kraniche und japanischen Affen, welche nur in den südlichen Teilen des Reiches vorkommen. Der Zoologe der Expedition Dr. von Martens tat dort und auf dem Fischmarkt, wie der Botaniker Regierungsrat Wichura bei den Kunstgärtnern und Samenhändlern manchen erwünschten Fund. Beide Naturforscher und auch der Geologe Freiherr von Richthofen waren mit ihrem Aufenthalte in Yokohama sehr zufrieden; sie konnten sich hier frei bewegen und machten weite Ausflüge in die Umgegend. Überall nahmen die Landleute sie freundlich auf, bewirteten sie gern mit Tee, Eiern und Apfelsinen, und waren oft erstaunt einige Tempo — Groschen — dafür zu erhalten. Sie zeigten sich niemals misstrauisch oder zudringlich, gingen oft, dienstfertig und bescheiden, weite Strecken mit um den Weg zu zeigen, oder beauftragten damit ihre Kinder. Kleine Knaben und Mädchen liefen, wo ein Fremder sie zufällig in Busch oder Feld allein überraschte, wohl schreiend davon, wurden aber bei näherer Bekanntschaft leicht freundlich und vertraulich; sie waren in Schwärmen höchstens durch unaufhörliches Zurufen des Grußes »Anata oheio«, durch neugieriges Andrängen und starres Begaffen, niemals aber durch absichtliche Unarten und Possen lästig, wie in anderen Ländern nur zu häufig. Die Naturforscher fanden in dem Verkehr mit dem einfachen unbefangenen Landvolk geradezu eine Lebensannehmlichkeit, und besuchten manches stille Tal, wohin niemals Fremde gedrungen waren. Dann war ihre Tuchkleidung immer Gegenstand der größten Bewunderung und wurde unter vielen Fragen von allen Seiten betastet. Dass man sie weder verstand noch antworten konnte begriffen die Meisten gar nicht; man schien das Japanische für die natürliche Sprache des Menschengeschlechtes zu halten, und nicht zu ahnen, dass es noch andere gäbe. — Sowohl der Botaniker als der Zoologe ließen sich auf diesen Wanderungen häufig durch ihre japanischen Diener begleiten, deren Treue und Anhänglichkeit sie nicht genug zu rühmen wussten; beide lernten ihren Herren bald ab worauf es ankam, und bewiesen, durchdrungen von der Wichtigkeit ihres Amtes, den größten Eifer in Herbeischaffung und Präparierung der Naturalien.
Die sumpfige Niederung von Yokohama ist von Hügelland umgeben, das sich an der Südseite des Städtchens in steilen Tonmergelwänden in das Meer hinausschiebt; — die Fremden nennen das Vorgebirge »Mandarin-Bluff«. Hier liegt in einer nach Norden sich öffnenden Schlucht das Denkmal der ermordeten Russen. Viele Täler und Tälchen, deren flacher Boden, wie bei Tokio, mit Reis bebaut und künstlich bewässert ist, durchfurchen die niedrigen, meist mit Pinus Massoniana bestandenen Höhen. Am oberen Ende der Senkung liegt gewöhnlich im Waldesdickicht ein Teich, zahlreich bewohnt von Fischen, Wassersalamandern und Libellen, wo die von den Hängen abfließenden Gewässer sich sammeln, um nach Bedürfnis auf die Felder abgelassen zu werden. Hier und da sind kleine Hochebenen mit Rüben und Gerste, Weizen, Bohnen, Buchweizen, Bataten, Hibiskus, mit Moorhirse und Baumwolle bestellt. Bauernhütten trifft man überall, und mitten im Walde stattliche Tempel, deren Priester dem Wanderer oft nicht ganz uneigennützig eine Schale abscheulichen Saki anbieten. Einen ähnlichen Charakter hat die Landschaft um Kanagava sowohl als die Küste nordöstlich von Yokohama.
Die Südosthälfte des Städtchens hatten damals die Ausländer, den nordwestlichen Teil die Japaner inne. Das den Fremden zugestandene Terrain reichte bald nicht mehr aus; die Repräsentanten der Vertragsmächte bemühten sich deshalb beständig um die weitere Abtretung von Grundstücken, und die Japaner wurden immer mehr aus Yokohama verdrängt. Man arbeitete fleißig an dem breiten Kanale, welcher die Niederlassung nach Art von Desima zur Insel machen sollte; jetzt umschließt er das Städtchen vollständig, so dass aller Verkehr von den japanischen Behörden kontrolliert werden kann. Der Weg nach Kanagava führt zunächst auf einem künstlich aufgeschütteten Damm zwischen Sumpf und See hin, und auf zwei gut gebauten Brücken über Einschnitte des Meeres. Hier und an anderen Stellen der Straße hat die japanische Regierung Wachthäuser und Tore angelegt, die bei eintretender Dunkelheit geschlossen und den Europäern oft erst nach langem Parlamentieren geöffnet werden. Es ist fast wie auf Desima, denn natürlich steht auch der Verkehr der Japaner mit Yokohama unter Aufsicht der Polizei, welche oft Menschen und Waren, ja Lebensmittel ganz nach ihrem Belieben ausschließt. Die in den Verträgen stipulierte Freiheit des Handelsverkehres besteht also in Wahrheit nicht und wird sich auch schwer durchsetzen lassen, denn die Autorität der Regierung über ihre Untertanen ist unbegrenzt, und die Behörden üben die strengste Aufsicht über den Großhandel. Die Anfuhr der Waren in Yokohama richtet sich ganz nach den Fluktuationen der politischen Lage. Jetzt, nachdem einige Jahre vergangen, lässt sich die Situation viel deutlicher übersehen als zur Zeit unserer Anwesenheit. Die im einleitenden Abschnitt ausgesprochene Ansicht, dass in den letzten Jahrzehnten die Regierung der Taïkūn die Zügel schießen lassen und an Macht und Ansehen verloren habe, dass einzelne Daïmios selbständiger geworden seien und sich leicht einmal wieder um den alten Thron des Mikado scharen könnten um das Haus Minamoto zu stürzen, hat sich bestätigt. Die höchste Würde des Mikado scheint heute ebenso anerkannt zu sein als vor tausend Jahren. Eine mächtige Adelspartei hat, die mit den westlichen Nationen vom Taïkūn eigenmächtig geschlossenen Verträge zum Vorwand nehmend, die Autorität des Erbkaisers angerufen und, ganz wie vor dreihundert, vierhundert, sechshundert Jahren, sich wiederholt seiner Person zu bemächtigen gesucht. Die Dynastie der Minamoto kämpft einen ernsten Kampf um ihre Existenz und hat sich zu Demütigungen vor dem Mikado verstehen müssen, wie sie seit Jahrhunderten unerhört waren. Sie braucht dessen Autorität vor dem Volke, um das Staatsruder in Händen zu behalten, die Verträge mit den Fremden sind ihr nur eine sekundäre Frage; die Regierung des Taïkūn ist offenbar sich selbst nicht klar, ob sie ihre Herrschaft besser durch Vertreibung der Ausländer oder durch Aufrechthaltung der Verträge sichern könne. Von beiden Seiten ist die Gefahr groß, daher die beständigen Schwankungen. Die Vertreter der westlichen Mächte haben in den letzten Jahren dem Gorodžio wiederholt ihre tätige Hilfe zur Unterdrückung der rebellischen Fürsten angeboten; aber ein solches Bündnis schien den Ministern wegen des nationalen Stolzes der Japaner immer zu gefährlich, und würde in der Tat wahrscheinlich das Volk auf die Seite des Feindes bringen. Man hat daher gegen jeden selbständigen Angriff der Fremden auf die rebellischen Fürsten immer laut protestiert, solchen aber stets gern gesehen und im Stillen unterstützt. Es ist ein beständiges Lavieren. Zu Zeiten ging die Regierung so weit, den fremden Vertretern öffentlich die Verträge zu kündigen und die Räumung von Yokohama zu verlangen, bezeichnete aber zugleich im Vertrauen diese Maßregel als eine bloße Form, die nur zur Erhaltung des guten Einverständnisses mit dem Mikado notwendig sei. Dann wieder, wenn es unmöglich schien sich auf diese Weise zu halten, wurde die Räumung von Yokohama allen Ernstes verlangt, die Lebensmittel abgeschnitten und eines schönen Tages alle Japaner aus der Niederlassung entfernt. In solchen Fällen brachte das kategorische Auftreten der fremden Vertreter und Geschwader-Kommandanten die japanischen Behörden meist bald zur Besinnung und Herstellung des alten Verhältnisses. In Wahrheit scheint die Regierung von Tokio den Ausländern im Prinzip weder feindlich noch besonders geneigt zu sein. Die Verträge sind ihr abgedrungen worden; sie wird dieselben gern erfüllen, wenn sie dadurch ihre Macht im Innern erhöht und befestigt, und wird sie brechen, wenn sie durch die Erfüllung ihre Existenz stärker gefährdet sieht als durch die Eventualität eines äußeren Krieges. Wäre eine sichere Gewährleistung ihrer Herrschaft durch die Fremden möglich, so würden die Minamoto und ihre Partei wahrscheinlich sofort deren aufrichtige Freunde. Einstweilen benutzen sie dieselben eifrig um durch Verbesserung ihres Kriegsmaterials den Rebellen überlegen zu werden.
Der Verfasser hat mit diesen allgemeinen Andeutungen vorgegriffen, um die Schwankungen des Handels in Yokohama zu erklären; eine genauere Darstellung der neuesten Ereignisse soll am Ende des Bandes folgen. Zur Zeit unserer Anwesenheit schwebte tiefes Dunkel über den Vorgängen der inneren Politik; die Gärung, aus der sich die Parteien nachher deutlicher ausklärten, scheint damals in vollem Gange gewesen zu sein. Der Großhandel in Yokohama war immer das beste Barometer der politischen Stimmung: zu Zeiten starke Anfuhr, dann wieder vollständige Stockung. Man wusste oft, dass große Massen Seide, für Yokohama bestimmt, in Tokio lagerten und nur auf Befehl der Regierung zurückgehalten wurden. Dann ein Umschwung in der Politik, und der Markt war überschwemmt. Diese Unsicherheit wird fortdauern, bis die politischen Verhältnisse sich vollständig konsolidiert haben, und, wenn es auch heute den Anschein hat, so ist doch keineswegs gewiss, dass es dabei ohne vollständigen Umsturz im Innern, temporäre Vertreibung der Fremden und einen ernsten Krieg mit dem Auslande abgeht.
In Yokohama wohnten bis zum Frühjahr 1861 nur Kaufleute; später sahen sich auch die Konsuln der Vertragsmächte, welche zur Zeit unserer Anwesenheit noch sämtlich in Kanagava lebten, durch die Umstände genötigt ihr Domicil dort zu nehmen. — Der Landweg nach Kanagava führt, nachdem er die Niederung durchschnitten, über bewaldete Höhen, an deren Fuß das Haus des japanischen Gouverneurs liegt, und mündet dann in den Tokaïdo.
Wir kehrten noch denselben Abend nach Kanagava zurück und besuchten am folgenden Morgen die Konsulate. Am schönsten liegt das amerikanische, auf der Höhe des Hügelkammes, eine weite Aussicht über den Golf beherrschend. Die Konsuln wohnten hier nicht wie die Gesandten in Tokio in den Nebengebäuden der Tempel, sondern im Heiligtum selbst, und es galt für keine Entweihung, dass einige den Altar als Buffet benutzten. — Am Abend des 8. versammelte sich ein Teil der Gesellschaft zum Diner auf dem englischen Konsulat, wo auch Herr Alcock, der großbritannische Gesandte in Japan, eingetroffen war. Wenige Tage zuvor von einem Ausflug nach dem Fujiyama zurückgekehrt, hatte er schon in Tokio mit dem Grafen zu Eulenburg Besuche gewechselt. Seine Reisebegleiter erzählten viel von der Schönheit des Landes und der guten Aufnahme die sie unterwegs gefunden hatten: die Ebenen seien fruchtbar und angebaut, im Gebirge herrliche, wohlgepflegte Waldungen, wo die Kryptomeria zu erstaunlicher Höhe wachse; die Bevölkerung gesund, wohlhabend, tätig, heiter und gutmütig. Die breiten Landstraßen sind meist gut gehalten und mit dichten Reihen hoher Bäume gesäumt; von Meile zu Meile zeigen runde Hügel mit einer Tanne auf dem Gipfel die Entfernungen an. Auf allen Stationen gibt es Posthäuser zum Einstellen der Pferde und zum Wechseln der Lastträger; man bezahlt für die Meile eine bestimmte Taxe, deren Höhe, sowie das Gewicht der Lasten, die Trägerzahl für die Sänften u. s. w. von der Obrigkeit für jede Strecke nach den Schwierigkeiten des Weges normiert ist. Ein sonderbarer Umstand ist schon von anderen Reisenden erwähnt worden: die von der unreinen Zunft der Yeta bewohnten Strecken zählen nicht mit in den Entfernungen, noch werden Träger und Pferde dafür berechnet, so dass man hier gewissermaßen kostenfrei reist und, dem Meilenzeiger nach, oft stundenlang keinen Schritt vorwärts kommt. — Für jeden Distrikt gibt es ausführliche Karten und Handbücher, so wohlfeil, dass sie in Jedermanns Hand sind, mit Angaben über den Reisebedarf, die Gasthäuser, Pferde- und Träger-Taxen, Beschreibung der Gebirgspässe, berühmter Berge, Wallfahrtsorte und aller Industrien, historischen und Natur-Merkwürdigkeiten, mit Regeln der Wetterkunde, chronologischen Übersichtstafeln, Tabellen über Ebbe und Flut, Aufrissen der gebräuchlichsten Maße und einer aus aufstellbaren Papierstreifen gefertigten Sonnenuhr. In den Stationsorten findet jede Klasse von Reisenden angemessene Aufnahme, sogar die Lastträger sollen nach ermüdendem Tagesmarsche der Wohltat des warmen Bades genießen. Zahllose Garküchen und Teeschenken am Wege bieten Labung auch armen Wanderern, von denen die Landstraßen wimmeln. Der Japaner reist gern und häufig, in Berufs- und Handelsgeschäften, pilgernd, zum Vergnügen, zur Belehrung. Die Lehnsfürsten nehmen, nach Tokio oder auf das Land ziehend, mit ihrem Gefolge die Landstraßen oft auf eine Strecke von mehreren Tagereisen in Anspruch; wo sie einkehren, wird die Herberge außen mit Zeltvorhängen bekleidet, auf denen ihr Wappen prangt. Kämpfer und Thunberg erzählen, wie sie auf ihren Hofreisen oft tagelang warten und in Tempeln wohnen mussten, weil alle Träger, Pferde und Gasthäuser von reisenden Großen in Beschlag genommen waren.
Die Reisenden der englischen Gesandtschaft wurden überall mit Respekt und Höflichkeit behandelt; die Daïmios ließen sie an den Grenzen ihrer Gebiete durch Ehrenwachen empfangen, die Menge zeigte sich freundlich und ehrerbietig. Kleine Schwierigkeiten entstanden nur, wo sie die Hauptstraße verließen, denn den Fujiyama besteigen nur Pilger der ärmeren Klassen, und die dahin führenden Gebirgswege sind für den Empfang vornehmer Reisenden nicht eingerichtet; es mangelt an jeder Bequemlichkeit. — Die Besteigung des höchsten Kegels war beschwerlich; der Gipfel wurde auf 14,177 englische Fuß Meereshöhe gemessen, der umfangreiche Crater soll 350 Fuß tief sein. Nach der japanischen Tradition wäre der Berg im Jahre 286 v. Chr. in einer Nacht aus der Erde gewachsen, während zugleich im mittleren Nippon ein umfangreiches Gebiet versank und den großen Landsee von Oomi bildete. Furchtbare Ausbrüche, welche die ganze Umgegend verheerten, erwähnen die Annalen unter den Jahren 800 und 864 n. Chr. Die letzte Eruption erfolgte 1707; seitdem gilt der Vulkan für erloschen.
In der Reisegesellschaft des Herrn Alcock befand sich auch der Major de Fonblanque von der englischen Armee in China, welcher nach Japan geschickt worden war um Pferde zu kaufen. Das Erstaunen der Minister war anfangs groß, als sie hörten, dass die Engländer dreitausend Pferde wünschten; sie machten allerlei Schwierigkeiten, vergaßen aber sonderbarer Weise den einzigen triftigen Weigerungsgrund: die Wahrung ihrer Neutralität. So fremd sind selbst den japanischen Staatsmännern die Elemente des Völkerrechtes. Sie versprachen nach kurzem Widerstande die Pferde herbeizuschaffen, und machten damit wahrscheinlich ein sehr gutes Geschäft. Etwa zwölfhundert Stück waren in Kanagava angekommen, und die Hälfte davon nach dem Peïho verschifft, als die Nachricht von der Einnahme von Tientsin und der Befehl eintraf den Kauf zu sistieren. Die übrigen Pferde wurden nun öffentlich versteigert und brachten sehr niedrige Preise, manche nur einen Itsibu, während beim Einkauf der Durchschnittspreis gegen dreißig Dollar betrug.
Das Diner bei Kapitän Vyse, welchem auch Kommodore Sundewall, Herr von Bellecourt und der niederländische Konsul Herr de Graeff van Polsbroek beiwohnten, währte bis tief in die Nacht. Auf den Wunsch unseres liebenswürdigen Wirtes hatte der Kommodore das Musikcorps der Arkona mitgebracht, dessen Vortrag der National-Hymnen und anderer heimatlichen Weisen wie immer elektrisierend auf die Gäste wirkte. Nach dem Essen lockte die herrliche Nacht in das Freie; dort warteten in malerischen Gruppen die japanischen Diener der Konsulate mit großen Papierlaternen, weiß und bunt, die teils auf langen Bambusstangen, teils in der Hand getragen werden. Wir zogen mit klingendem Spiel durch die finsteren Straßen, dann die steile, von hohen Wipfeln überwölbte Treppe zum amerikanischen Konsulat hinan; die bunten Laternen warfen magische Lichter auf die überhangenden Laubmassen und der Zug gewährte, von vielen Japanern begleitet und langsam die Treppe hinan steigend, ein phantastisches Bild, das gewiss Manchem unvergesslich geblieben ist. — Nachher kehrte die Musik an Bord zurück; das Meer lag spiegelglatt unter dem sternfunkelnden Firmament, und wir standen noch lange am Ufer, bis die letzten Klänge »Muss i’ denn, muss i’ denn zum Städtle hinaus« zum Takt der Ruderschläge in der Zaubernacht verhallten.
Der folgende Tag war zur Rückkehr nach Tokio bestimmt; wir besuchten unterwegs noch Herrn de Graeff van Polsbroek, dessen Tempel an der Landstraße liegt. Er und alle übrigen Konsuln führten bittere Klagen über ihre in Yokohama angesiedelten Landsleute, deren Anmaßung und Rücksichtslosigkeit fortwährend betrübende Kollisionen hervorrief. Wir hatten leider schon damals vielfach Gelegenheit uns von der Richtigkeit dieser Angaben zu überzeugen; nicht lange nachher kam es zum offenen Eklat. Die Japaner sind von Natur durchaus jovial und zu freundschaftlichem Verkehr mit den Fremden geneigt; sie fördern gern auf jede Weise deren Vergnügen und Bequemlichkeit, sofern nur nicht gegen persönliche Rechte oder die Sitten und Gesetze des Landes verstoßen wird. So hatte unser nächtlicher Umzug bei den Bewohnern von Kanagava nur Aufsehen und heitere Teilnahme, aber nicht den geringsten Anstoß erregt; die Behörden erkundigten sich am folgenden Tage nur, welchem »O-Bunyo« denn das Fest gegolten habe.
Wir machten auf dem Heimweg im Teehaus von Kawasaki, wo Herr von Bellecourt uns einholte, einen kurzen Halt; die lustigen Aufwärterinnen schälten eigenhändig die gesottenen Eier und steckten sie den Gästen scherzend in den Mund, bewirteten uns nachher auch mit köstlichen Weintrauben. Vor Omagava bog Heusken von dem Tokaïdo ab und führte uns über Ikegami durch Feld und Busch auf sehr anmutigem Wege nach der Stadt.
Den 11. abends ertönte in unserer Nähe die Feuerglocke, der Himmel war bis zum Zenit gerötet. Da dem Anschein nach die Brandstätte nicht entfernt sein konnte, so machte sich der Gesandte mit seinen Begleitern und Herrn Heusken trotz den verzweifelten Gegenvorstellungen unserer Hausbeamten zu Fuß dahin auf den Weg. Es stürmte und regnete, aber die Straßen waren gedrängt voll Menschen. Wir konnten nur auf Umwegen auf eine hochgelegene Stelle gelangen, von wo das Feuer sichtbar wurde, ein wogendes Flammenmeer in der Richtung des Stadtviertels Asaksa, aber wohl eine Stunde entfernt, so dass wir unser Vorhaben aufgeben mussten. Auch am folgenden Tage machten unsere Yakunine so ängstliche Vorstellungen gegen den beabsichtigten Besuch der Brandstätte, dass wir endlich davon abstanden. Das Feuer zerstörte eine Strecke von zehn Straßen Länge und drei Straßen Breite in dem berüchtigten Stadtviertel Yosiwara und legte die drei größten Theater in Asche. — Die Bunyos der auswärtigen Angelegenheiten baten den Gesandten nachher wiederholt und dringend, sich bei Feuersbrünsten niemals auf der Straße zu zeigen, das Volk sei dann wie toll; wer zuerst beim Brande erscheine oder sich beim Löschen auszeichne werde feierlich belohnt, sein Namen auf Tafeln geschrieben und durch alle Straßen getragen; nach dieser Auszeichnung strebe jeder Japaner, daher das wilde Gedränge. — Die Löschmannschaften tragen aus Rohr geflochtene Brustharnische und metallbelegte Sturmhauben, deren Helmdecke auf die Schultern herabfällt und unter dem Kinn zugeknöpft wird; höhere Staatsbeamten und Daïmios, unter deren Aufsicht die Löschanstalten stehen, erscheinen zu Pferde in voller Rüstung. Ein Teil der Mannschaften wird auf die nächstbedrohten Dächer postiert und muss dort im Kampfe gegen das Flugfeuer so lange als möglich aushalten, dann aber — in Eile alle Schindeln und Ziegel herabwerfen. Wer eine Leiter verlangt oder zureicht ehe die Gefahr auf das höchste steigt, gilt für ehrlos; wer aber beim Löschen umkommt, erntet großen Ruhm und öffentliche Ehren. Das Niederreißen bedrohter Häuser soll wohl in anderen japanischen Städten, nicht aber in Tokio üblich sein, wo die Eigentümer sich ihm widersetzen. An Wasser ist bei den zahlreichen Kanälen selten Mangel; auf vielen Dächern stehen auch große Kübel mit Vorrat zum schleunigen Gebrauch. Die Feuerspritzen sind klein und tragbar, nach altem holländischem Muster sehr fest und sauber gearbeitet.
Die Häufigkeit der Brände, namentlich im Winter, erhält die Mannschaft in beständiger Übung; Feuerlöschen ist eine Leidenschaft des tatenlustigen Volkes geworden, das in den beiden Jahrhunderten des Friedens kaum andere Gelegenheit fand Mut und Geistesgegenwart zu brauchen. Im Winter hörten wir die Feuerglocke fast jede Nacht, oft drei- bis viermal 1). Die Zimmer werden in den kalten Monaten durch offene Kohlenbecken erwärmt, mit denen man sehr unvorsichtig umgeht; die Holzkohlen springen und spritzen, und die feinen Binsenmatten brennen im Umsehen; die Papierfenster und Tapetenwände pflanzen den Brand mit reißender Schnelligkeit fort und erzeugen rasch auflodernd unglaubliche Hitze; und wenn auch die massiven Ziegeldächer der besseren Häuser dem Flugfeuer widerstehen, so geraten doch auch diese leicht von unten in Brand, da sich ihre Papierfenster wie Zunder schon an dem glühenden Hauch aus der Ferne entzünden. Selten brennt ein einzelnes Haus ab; ehe Hilfe erscheint, steht eine ganze Straße in Flammen. Am größten ist die Noth bei heftigen Erdbeben im Winter: die umgestürzten Häuser entzünden sich dann unfehlbar von innen; Hilfe ist unmöglich, die Flammen brechen plötzlich aller Orten hervor. Bei dem letzten großen Erdbeben, im Dezember 1854, sollen in Tokio gegen 200,000 Menschen verunglückt sein, und zwar großen Teils in den Flammen.
Am 12. besuchten Einige von uns den Lackfabrikanten Sebi und ließen ihre Pferde vor der Tür. Wie gewöhnlich versammelte sich eine große Menschenmenge vor dem Hause; die Hintersten drängten nach vorn, eines der Pferde wurde unruhig, warf rückwärts schreitend einen Knaben zu Boden und trat ihm so unglücklich auf das Bein, dass der Knochen brach. Dr. Lucius, der bei der Gesellschaft war, legte sogleich einen provisorischen Verband um; — bald darauf kam ein japanischer Arzt herbei, der sich überzeugte, ob der Knochen richtig zusammengefügt wäre und dann die Bandagen kunstgerecht wieder ordnete. Die Menge benahm sich bei dem ganzen Vorgange verständig und teilnehmend, alle Umstehenden waren sichtlich erfreut über die hilfreiche Sorgfalt unseres Freundes, welcher nachher den Patienten bis zu seiner Genesung täglich besuchte. Er traf dort häufig mit japanischen Ärzten zusammen und fand sie zu seinem Erstaunen mit den neuesten europäischen Heilmethoden vertraut.
Am 15. Oktober feierten wir still den letzten Geburtstag Seiner hochseligen Majestät König Friedrich Wilhelm IV. Zum Diner waren die in Akabane wohnenden Preußen bei dem Gesandten versammelt, welcher in ernsten Worten die Bedeutung des Tages besprach und mit seinen Gästen ein stilles Glas auf das Wohl des erhabenen Kranken leerte. An Bord der Arkona, welche vor Yokohama lag, wurde Gottesdienst gehalten und die Mannschaft festlich bewirtet.
Die Korvette hatte geflaggt und alle im Hafen liegenden Schiffe folgten ihrem Beispiel, sobald ihre Befehlshaber die Veranlassung erfuhren. In ähnlicher Weise begingen die Offiziere und Mannschaften der Thetis die Feier auf der Reede von Tokio; die Matrosen hatten sich aus eigener Tasche eine große Zahl der schönsten geblümten Papierlaternen angeschafft, mit welchen sie das ganze Zwischendeck am Abend festlich erleuchteten. Zur Nachfeier begab sich am folgenden Tage Graf Eulenburg mit Herrn Heusken, dem Legationssekretär Pieschel und den drei Gesandtschafts-Attachés auf Einladung des Kapitän Jachmann zum Diner an Bord der Fregatte.
Der 18. Oktober sollte durch eine Landpartie verherrlicht werden, zu welcher die Herren der englischen und der amerikanischen Legation eingeladen waren, doch musste der Ausflug wegen schlechten Wetters unterbleiben. Die Gäste stellten sich zum solennen Festmahl in Akabane ein, wo die Gesundheit des kronprinzlichen Paares mit lautem Jubel, aus vollen Herzen und Gläsern getrunken wurde. Vier Unteroffiziere der Thetis, welche auf der ganzen Reise täglich Quartettgesang geübt und darin große Vollkommenheit erlangt hatten, waren auf Graf Eulenburgs Wunsch zu dem Feste herübergekommen und erfreuten die Tischgesellschaft durch ihre Vorträge. Hatte man bei früheren Gelegenheiten das Musikcorps der Arkona bewundert, so übten doch die schönen Männerstimmen und unsere köstlichen deutschen Lieder noch einen weit stärkeren Zauber; sie machten auf die mit solcher Musik wenig vertrauten Gäste den angenehmsten Eindruck und erhöhten wesentlich die festliche Stimmung.
Den 20. unternahmen wir einen Spazierritt nach den nördlichen Stadtteilen; der Weg ging zunächst durch das Siro, an den Palästen des Fürsten Oki und des ermordeten Regenten vorbei. Die Straße, wo die Tat geschah, war noch immer gesperrt 2). Vom Schlosshügel in die nächste Gasse hinabreitend wurde unsere Kavalkade einmal wieder mit dem Rufe »Todžin-bakka«, Toller Fremder, begrüßt, unter hellem Kinderjubel, ohne jede Feindseligkeit. Man passierte lange einförmige Straßen, dann einen freien Platz 3), auf den die Fortsetzung des Tokaïdo über Nippon-basi hinaus mündet; links zieht sich ein breiter Mauerwall, das Soto-Siro und die zentralen Stadtviertel gegen Norden begrenzend, nach dem Fluss zu; ein mächtiges Festungstor flankiert den Eingang in die jenseitigen Stadtviertel. Unser Weg führte an dem Konfuzius-Tempel vorbei, dann wieder durch endlose schmale Gassen; aber plötzlich öffnet sich die Aussicht: man steht vor einem schilfbewachsenen See mit halb städtischen halb ländlichen Ufern. Gegenüber liegt mitten im Wasser ein Tempel mit seinen Nebengebäuden, und am Rande des dahin führenden Steindammes eine Reihe zierlicher Teehäuschen 4). Ein grünes Vorgebirge, aus dessen dichten Wipfeln die Spitze eines Mausoleums vorragt, begrenzt nach rechts die Aussicht; links schweift der Blick nach dem fernen nördlichen Ufer, das ländlich angebaut ist, eine weite Landschaft umfassend, die nichtsdestoweniger noch im Umkreise der Stadt liegt; denn jenseits schließen zusammenhängende Straßen sie ein, nach denen östlich und westlich bevölkerte Stadtviertel vorspringen.
Wir ritten das östliche Ufer entlang. Am Ausgangspunkte des nach der Insel führenden Dammes steht ein hohes steinernes Toori in der Flucht des einladenden Tempelportals; die Torflügel wurden uns aber vor der Nase zugeschlagen und die Yakunine drängten ängstlich vorwärts. — Der große Buddha Amida wird nämlich neben hundert anderen Eigenschaften auch als Gottheit der Zeugungskraft verehrt, und diesem Dienste ist der Tempel von Benteng geweiht. Er soll unter dem Patronate mehrerer Daïmios stehen, die in den angrenzenden Teehäusern ausgesuchte Schönheiten unterhalten. — Als später der Verfasser dieser Blätter von der Galerie einer gegenüberliegenden Schenke aus den Tempel skizzierte, kam eine ganze Schaar jener Damen, die wahrscheinlich niemals einen Fremden gesehen hatten, auf den Balkon des anstoßenden Hauses. Sie waren sehr hübsch, in prächtige Stoffe gekleidet und leicht geschminkt. — Die Herren Patrone aber scheinen das missbilligt und Klage geführt zu haben: glücklicherweise war die Zeichnung fertig, als die Regierung den Künstler bitten ließ seine Studien anderswo zu machen.
Auch die grünen Anlagen jenseits, welche den nördlichen Begräbnisplatz der Taïkūn-Familie einschließen, ein beliebter Spaziergang der höheren Stände von Tokio, wurden den Fremden trotz allen Vorstellungen der Gesandten nicht zugänglich. Von außen ist der Anblick sehr einladend: mächtige Wipfel mannigfachen Immergrüns beschatten die moosbewachsenen Hänge, und verschlingen ihre rankenbedeckten Zweige mit dem Unterholz zum wuchernden Dickicht. Hohe düstere Alleen stoßen, den kaiserlichen Friedhof von den nebenliegenden Tempelgründen scheidend, auf die Ufer des Sees, der, von Reiherscharen und zahllosen wilden Enten bevölkert, im Lichte der sinkenden Sonne ein Landschaftsbild von seltener Lieblichkeit gewährte.
Auf dem Heimwege begegnete uns ein Trupp gefangener Verbrecher, die mit Stricken in langer Reihe aneinander gefesselt gingen, elende unheimliche Gestalten. Sie schienen vom Lande her eingebracht zu werden und hatten wohl auf dem Wege viel gelitten, denn die Behandlung beim Transport ist etwas unsanft. Weder zum Essen noch nachts werden die Hände entfesselt; die Delinquenten müssen sich füttern lassen und in sehr unbequemer Stellung schlafen. Solchen, die einzeln transportiert werden, bindet man die Hände in schmerzhafter Weise auf den Rücken: kann Einer nicht mehr vorwärts, so hängt man ihn mit zusammengeschnürten Armen und Beinen an eine Stange, die zwei Büttel auf den Schultern tragen. Die Fesselung ist sehr künstlich, für jede Klasse von Missetätern und jeden Stand eine besondere und durch ausführliche Verordnungen vorgeschrieben. Gemeine Verbrecher werden zuweilen im Kango transportiert, die Füße in einen schweren Block geschlossen; vornehme haben das Standesvorrecht des Norimon, der aber für diesen Fall mit festgefugten Brettern statt des leichten Bambusgeflechtes bekleidet ist; innen sitzt der Delinquent bis an den Hals im Sack steckend; außen wird noch ein Netz aus dicken Stricken über die Sänfte geworfen. Die Ängstlichkeit der Vorsichtsmaßregeln grenzt an das Lächerliche, doch muss man bedenken, dass die japanischen Büttel nicht nur die Flucht, sondern vor Allem den Selbstmord zu verhüten haben; wer irgend kann entzieht sich der zeitlichen Gerechtigkeit durch das Harakiri; die Diener der Justiz hätten wenig zu tun, wenn sie nicht den Selbstmord verhinderten. Was die Grausamkeit der Behandlung angeht, so muss man immer das weniger ausgebildete Nervensystem der Ost-Asiaten in Betracht ziehen, die ungleich härter gegen körperliche Leiden sind als Europäer. Danach sind auch die Strafen zu beurteilen 5). Die Gefängnisse sollen meist reinlich sein, besonders die zur Untersuchungshaft bestimmten. Statt der Zellen hat man Gitterverschläge, deren gewöhnlich mehrere in einem Raume aufgestellt und gemeinschaftlich bewacht werden. Die zur Untersuchungshaft dienenden sind bequem und geräumig, die Nahrung gut, nur Tabak und Saki verboten. Verurteilte dagegen sperrt man in enge Käfige, in denen sie zuweilen mit gekrümmtem Rücken auf den Knieen liegen müssen 6). Die Hinrichtungen geschehen entweder in den Gefängnissen oder öffentlich, und die Köpfe der Gerichteten bleiben eine Zeitlang ausgestellt. Oft lässt man die Verurteilten mehreren Exekutionen beiwohnen, ehe sie selbst an die Reihe kommen.
Am 22. Oktober, dem neunten Tage des neunten japanischen Monats feierte man in Tokio das Goldblumenfest. Schon den Abend zuvor waren alle Häuser mit bunten Laternen, die Tempel-Portale und Treppen mit frischem Laube geschmückt, und in den Straßen viele hohe Masten mit grünen Bambusbüscheln an der Spitze aufgepflanzt, welche lange wehende Banner mit Inschriften trugen. Zahlreiche Kinderscharen zogen mit grünen Zweigen und Laternen jubilierend durch die Gassen, wo Bänkelsänger, drollige Masken und Possenreißer den mutwilligsten Spaß trieben. Wir begegneten abends vom Spazierritt zurückkehrend hier und da Betrunkenen, deren aufgeregter Zustand sich in besonders strammer Haltung und einiger Abneigung unseren Pferden auszuweichen offenbarte. Berittene Samurai jagten barhaupt, mit gerötetem Antlitz, verhängten Zügels durch die Straßen. Man fühlt sich ohne Waffen bei solcher Begegnung etwas unbehaglich, da die meisten Angriffe gegen Fremde von trunkenen Soldaten ausgehen sollen. Der Rausch dieser Tage schien aber durchaus harmloser Art zu sein; nur zuweilen hielten einige der wilden Rossetummler neben uns still und machten spöttische Bemerkungen, oder legten wohl trotzig die Hand an den Säbelgriff. Kämpfer sagt, dass das Goldblumenfest vor allen übrigen »einen kordialen Trunk fordere«, dass »Alles im Überfluss vorhanden und ess- und trinkbare Dinge Allen gemein sein müssen«, dass »sich die Nachbarn der Reihe nach herumtraktieren«, und dass es »die größte Ähnlichkeit mit den Bacchanalien der Römer habe«. Es war also alles ganz in der Ordnung.
Nach Siebold ist das Goldblumenfest chinesischen Ursprungs; es gehört zu den fünf großen Volksfesten, von denen das Neujahrsfest am ersten Tage des ersten Monats, das Pfirsichblüten- oder Puppenfest am dritten des dritten Monats, das Flaggenfest am fünften des fünften Monats, das Abendfest am siebenten des siebenten Monats gefeiert wird. Diese Tage gelten, wie der neunte des neunten Monats, wegen des Zusammentreffens der gleichen ungraden Zahl, den Japanern für besonders unheilbringend und sollen vorzüglich zur Abwendung des Götterzornes so heiter und festlich begangen werden. Das Neujahrsfest ist ein allgemeiner Gratulationstag, die ganze Bevölkerung erscheint im Feierkleide, man beschenkt und bewirtet sich gegenseitig drei Tage lang. Wo Bekannte einander auf der Straße begegnen, sagen sie sich unter feierlicher Verbeugung einen kurzen Glückwunsch. Gastmähler und gesellige Festlichkeiten sind den ganzen Monat im Schwange wie bei uns im Carneval, mit dem es auch in der Jahreszeit zusammenfällt. Das japanische Neujahr fiel 1861 auf den 10. Februar; nur der Regierungsrat Wichura feierte es in Nagasaki, während alle übrigen Mitglieder der Expedition auf stürmischem Meere umhertrieben. Einige seiner Bemerkungen darüber mögen hier Platz finden. Alle Läden wurden geschlossen, Geschäfte und Arbeit ruhten gänzlich. An jedem Hause war ein Seil aus Reisstroh die ganze Fassade entlang gezogen; daran hingen in fußlangen Zwischenräumen regelmäßig mit einander abwechselnd ein kleines Strohbündel und der gabelförmig geteilte Wedel eines Farrenkrautes (Gleichenia), über der Tür aber ein dickgedrehter, wohl auch in einen Knoten verschlungener Zopf aus Resstroh, an dem eine Orange, ein Stück Holzkohle, einige getrocknete Kaki, ein Stück essbaren Seetangs, einige Tütchen voll Reis und einige voll Salz mit einem in der Mitte angebrachten rot gesottenen Seekrebs zu einer Gruppe vereinigt waren. Das zusammengekrümmte Schwanzende des Krebses wird mit der gebückten Stellung des Alters verglichen und bedeutet langes Leben; Kohle versinnlicht die behagliche Wärme des häuslichen Heerdes, Seetang Fröhlichkeit, und so hat jedes der Embleme seine glückbringende Bedeutung.
Die Geschenke, die man einander sendet, sind in ähnlicher Weise verziert, und bestehen in schönen Seefischen, Körbchen mit Orangen, Kuchen aus Reismehl und anderen Kleinigkeiten, deren Wert und Anordnung die Etikette für jeden Stand genau vorschreibt. In wohlhabenden Häusern nimmt ein besonderer Offiziant die Gratulationsgeschenke mit der sauber geschriebenen Liste in Empfang und registriert sie in seine Bücher; an der Haustür sitzen an diesen Festtagen zwei Diener, die alle Eintretenden mit tiefer Neigung begrüßen.
Das Puppenfest gilt vorzüglich der weiblichen Jugend und heißt, als Frühlingsfeier, auch Fest der Pfirsichblüten. Das kriegerische Flaggenfest begeistert die Knaben und Jünglinge, so auch das Abendfest, an welchem die Schuljugend Bambusrohre aufstellt und mit selbstgeschriebenen Versen oder anderen Proben ihres Fleißes behängt. — Außer diesen fünf gibt es viele ähnliche Feste lokaler Bedeutung und andere die nur den Höfen von Miako und Tokio oder gewissen Daïmio-Familien angehören. Alle Volksfeste sind mit gottesdienstlichen Feierlichkeiten verbunden, ohne deshalb eine religiöse Bedeutung zu haben. Diese fehlt auch den Reïbi, — so heißen die monatlichen Feiertage, der erste, fünfzehnte und achtundzwanzigste jeden Monats, Vollmond und Neumond. Kämpfer nennt sie »bürgerliche Gratulations- und Galatage«, an denen Audienzen erteilt, Gastmahle, Hochzeiten und andere festliche Handlungen ausgerichtet werden. Auch an diesen Tagen ist es Sitte, sich gegenseitig zu beglückwünschen; jeder Japaner legt sein Festgewand und die Abzeichen seines Amtes und Standes an, verrichtet eine kurze Andacht im Tempel, und besucht seine Freunde und Vorgesetzten; Frauen, Mädchen und Kinder lustwandeln festlich geputzt nach den Tempeln und Kami-Höfen, während der Handwerker, nachdem er seine Pflicht- und Geschäftsbesuche abgelegt, an seine Hantierung, der Landmann nach freundlichem Empfang bei dem Ortsvorsteher zu seinen Feldern zurückkehrt; denn Arbeit und Gewerbe stehen an diesen Tagen nicht still. Sie sind bestimmt an die Pflichten gegen die Kami, gegen Mitbürger und Vorgesetzte zu erinnern, öffentliche Angelegenheiten sowie Gewissens- und Familiensachen in geziemender Stimmung zu ordnen, und haben in mancher Beziehung Ähnlichkeit mit unseren Sonntagen 7).
Eine dritte Art Feste, die Jahrestage der Götter und Kami, heißen Matsuri. Manche werden durch ganz Japan gefeiert, so vor allen das des nationalen Sonnengottes Ten-zio-daï-zin, andere sind, nach Art unserer Kirchweihen, örtlicher Bedeutung, Feste des lokalen Schutzpatrons. Keine Volksklasse, mit Ausnahme der lebenslang unreinen Yeta, ist von diesen Festen ausgeschlossen, die mit treuer Beibehaltung der alten volkstümlichen Gebräuche begangen werden; sie bilden einen Einigungspunkt der Jugend, welche unter Musik und mimischen Tänzen die Taten und merkwürdigen Schicksale ihrer göttlichen Ahnen, Heroen und Wohltäter theatralisch dar zustellen pflegt. Die Matsuri sollen einen bedeutenden Einfluss auf die sittliche, geistige und körperliche Entwicklung der japanischen Jugend üben, und viel zur Erhaltung der alten Gebräuche und patriotischen Eigentümlichkeiten beitragen.
Siebold gibt folgende allgemeine Beschreibung der Kami-Feste: »Das Gebot der Körper- und Seelenreinigung eröffnet die Feier. Nach einer sieben- und mehrtägigen Reinigung versammeln sich die zu einer Kami-Halle gehörigen Priester und Laien um den Oberpriester und begeben sich, meistens Nachts unter Fackellicht, nach der Halle des Kami, dessen Jahrestag bevorsteht, wo sie zur Reinigung des Mikosi schreiten. Dies ist eine kostbare Sänfte, worin man Geräte, Waffen, Harnische und andere Überreste des Kami bewahrt. Wenn Ortsumstände es gestatten, wird dies Gotteshäuschen an ein klares fließendes Wasser gebracht und unter mancherlei Feierlichkeiten von den Priestern gewaschen. Die Shinto-Hallen und der Weg den der Zug nimmt, werden beleuchtet. Unterdessen suchen Priester und Volk den Geist des Kami, der mit dem Mikosi seinen Thron auf Erden einstweilen verlieren muss, durch Gebet und Musik zufrieden zu stellen, während mehrere Feuer zur Abwehr böser Geister unterhalten werden. — Dieser Dienst währt bis spät in die Nacht und die Musik des heiligen Chors ertönt häufig noch den ganzen folgenden Tag hindurch, um dem Geiste im Himmel seine Verherrlichung auf Erden zu verkünden. Das gereinigte Mikosi wird mit den übrigen Geräten nach einer eigens dazu errichteten Halle gebracht, wo gottesdienstliche Feierlichkeiten, Volksfeste und Belustigungen mancherlei Art mehrere Tage über statt haben. Diese Hallen — sie führen den Namen Oho-tabi-tokoro, hoher Ruheplatz der Reise — sind zum Gedächtnis der Vorzeit äußerst einfach in ihrer Bauart und bestehen gewöhnlich aus Bambusstangen und Matten mit einem Strohdach, auf dessen Giebel ein Wedel des Sonnenbaumes (Thuja-hinoki) oder der japanischen Zypresse steckt. Vor dem Eingange sind zwei grüne Tannen gepflanzt. In der Nähe desselben wird auf hell loderndem Feuer kochendes Wasser unterhalten und mit eingetauchten Bambuswedeln von Zeit zu Zeit das Mikosi besprengt. Die Unreines abhaltenden Strohseile begrenzen diese zeitliche Kami-Wohnung, und Priester rennen zu Pferde hin und her, und spielen, Pfeile schießend, dem Volk ihren Kampf gegen die bösen Geister vor. Erst mit der Zurückbringung des Mikosi in seine erste Halle, die inzwischen gereinigt wurde, endigt die ganze Feier, an der das Volk und die Regierung gleichen Anteil nimmt. Die Kami-Priester spielen während dieser Tage eine große Rolle und tragen den ganzen Reichtum ihrer Hallen zur Schau. Die Feierlichkeiten und Belustigungen, welche dabei statthaben, sind sehr verschieden, stehen übrigens mit den früheren Verhältnissen des gefeierten Kami in Beziehung und spielen mehr oder weniger auf die Tugenden und Taten desselben an. Festliche Umgänge, Musikchöre, pantomimische Tänze, Maskeraden, theatralische Vorstellungen, Beleuchtungen, Wettrennen, Bogenschießen, Ringkämpfe und andere Leibesübungen wechseln mit Heldengesängen, Ablesung abenteuerlicher Geschichten, öffentlichen Lotterien, Mahlzeiten und Trinkgelagen.«
Das große Matsuri von Nagasaki, der Jahrestag des Suva, fällt mit dem Goldblumenfest zusammen und ist von Holländern mehrfach beschrieben worden, — denn auch die auf Desima Eingesperrten wurden an diesen Freudentagen nach dem Tempel geführt um die theatralischen Aufzüge und Darstellungen der Jugend anzusehen und an dem allgemeinen Jubel teilzunehmen. Nagasaki eigentümlich scheint ferner das Laternenfest zu sein, das wahrscheinlich aus China dahin verpflanzt wurde. Jeder, der seine Eltern noch hat, verbringt diese Tage — vom 13. bis zum 15. des siebenten Monats — in Fröhlichkeit; man beglückwünscht einander und ladet seine Freunde zum Fischessen ein. Verheiratete Söhne und Töchter und angenommene Kinder senden ihren Eltern lackierte Kästchen mit frischen, gesalzenen und getrockneten Fischen. — Das Fest ist seiner Bedeutung nach eine Totenfeier und beginnt mit Einholung der abgeschiedenen Seelen: die ganze Bevölkerung wallfahrtet am ersten Tage nach den Friedhöfen, und glaubt dann von den Seelen der verstorbenen Blutsverwandten nach Hause begleitet zu werden. Man nimmt deren Gedächtnistafeln, die Ifaï, aus den Kasten, stellt sie in der Nische, dem Ehrenplatze des Hauptgemaches auf und setzt ihnen auf grünen Binsenmatten eine zierliche Mahlzeit von Reis, Gemüsen und Früchten vor. In der Mitte steht ein Gefäß mit Rauchkerzen, ein Wasserkrug, aus dem der Reis mit Hanfbüscheln besprengt wird, eine Schüssel, in welcher ungekochte Reiskörner auf Blumenblättern im Wasser schwimmen, und Becher mit Blumen und grünen Sträußen. Lichter und Laternen brennen dabei die ganze Nacht; die Hausbewohner verrichten dort ihre Andacht und rufen den helfenden Buddha-Amida um ein seliges Leben für die Verstorbenen an. Am Morgen des zweiten Tages wird der Wasserkrug durch Teetassen ersetzt; zum Frühstück und Mittag trägt man Schüsseln mit Reis und Leckerbissen auf; abends werden vor allen Gräbern Laternen angezündet, und Becher mit grünen Zweigen, Schüsseln mit Leckerbissen und Rauchkerzen daneben gestellt. Die Laternen brennen die ganze Nacht; früh um drei den folgenden Morgen packt man die Lebensmittel mit bunten Leuchten, Rauchkerzen und Geldmünzen — der Reisezehrung — auf strohgeflochtene Schiffchen mit Papiersegeln und lässt diese in das Wasser. In den Häusern wird zugleich großer Lärm durch alle Gemächer und Winkel bis unter das Dach gemacht, damit ja kein Seelchen zurückbleibe und Spuk treibe; — sie müssen ohne Gnade hinaus. — Die Beleuchtung der Friedhöfe von Nagasaki, welche in steilen Terrassen ansteigend die Uferhöhen rings um die Bai bedecken, soll zauberisch wirken. Die Straßen der Stadt sind die ganze Nacht hell erleuchtet und von Menschen belebt; alle Glocken läuten, die Priester singen Litaneien, Jeder lärmt auf seine Weise so laut er kann; — wenn dann ein Windstoß die Strohschiffchen in die Bucht hinaustreibt, so tanzen auch auf dem Wasser unzählige Lichtchen, und ein kleines Fahrzeug nach dem andern geht in hellen Flammen auf. Arme Leute stürzen sich trotz den ausgestellten Wachen scharenweise in das laue Meer, um die Geldmünzen und Lebensmittel zu erbeuten, und zuweilen sollen sich förmliche Seeschlachten entspinnen.
Mit der Geburt, Hochzeit und Bestattung sind in Japan feierliche Gebräuche verbunden wie bei uns. — Das Kind wird dreißig Tage nach der Geburt gereinigt, geschoren und festlich aufgeputzt in den Tempel des Kami gebracht, zu dem die Familie sich hält; das Los bestimmt seinen Namen, wobei eine Art Taufe durch Besprengung mit Wasser vollzogen wird, während der heilige Chor die Litaneien singt. Man besucht nach der Einsegnung noch andere Kami-Hallen und bringt endlich den Säugling zu den nächsten Verwandten. Ist es ein Knabe, so erhält er dort zwei Fächer und ein Hanfbündel; ein Mädchen wird mit einer Schale Schminke, einem Hanfbündel, Talismanen und anderen Kostbarkeiten beschenkt. Die Fächer bedeuten Schwerter, männliche Tapferkeit, die Schminke weibliche Reize; das Hanfbündel soll sich zum langen Lebensfaden ausspinnen. Beim Übergang in das Jünglingsalter wird dem Knaben das Haupt feierlich in der Art geschoren wie es die Männer tragen, — von der Stirn bis zur Scheitel kahl; das Haar bleibt in Hufeisenform um den Hinterkopf und bis zu den Schläfen stehen, wird oben zusammengebunden und in einem kurzen steifen Schopf nach vorn gebogen. Der Jüngling erhält jetzt einen anderen Namen, der sich nachher bei wichtigen Lebensereignissen gewöhnlich noch mehrfach ändert.
Das Ehebündnis wird im Hause des Bräutigams in Gegenwart der Eltern und einiger Zeugen geschlossen, indem man dem Brautpaar unter gewissen Formalitäten eine Schale Saki reicht. Man bringt zugleich dem Jahresgott Opfer, damit er langes Leben verleihe, stellt beim Hochzeitsgelage das Simadaï, ein Sinnbild des glücklichen Alters auf, und genießt zum Gedächtnis der Voreltern deren einfache Nahrung, Seetang und Muscheln. Die Braut ist in weiß, die Farbe der Unschuld gekleidet; — ihr Gewand soll zugleich ihre Tugend und ihre Betrübnis beim Scheiden aus dem elterlichen Hause andeuten, — denn Weiß ist, wie in China, zugleich die Farbe der Trauer. — Im Einzelnen sind die Verlobungs- und Hochzeitsgebräuche sehr kompliziert und mannigfaltig, für jeden Stand besonders geregelt. Titsingh hat ein japanisches Buch übersetzt, in welchem alle Formalitäten, die Festgeschenke und ihre Überreichung, die Kleidung und das Betragen der Brautleute, Verwandten, Hochzeitsgäste, Dienstboten und Vermittler bis ins Kleinste geregelt, jeder Schritt und jede Stellung genau beschrieben sind.
Die Leichen werden meist nach buddhistischem Ritus bestattet; — den Shinto-Priester würde die Berührung der Toten, ja selbst die Begräbnisfeier unrein machen. Der Sarg besteht aus einem leichten, mit weißem Papier beklebten Holzgestell, in welchem der Tote aufrecht sitzt; man soll ein Mittel haben, den steifgewordenen Körper wieder biegsam zu machen und in die sitzende Stellung zu bringen. So wird er auf den Schultern der weißgekleideten Angehörigen hinausgetragen und unter dem Gesange von Litaneien in die Gruft gesenkt. — In früheren Zeiten soll es üblich gewesen sein die Toten zu verbrennen. Nach älterem Shinto-Brauch wurde die Leiche im Sarge auf dem Begräbnisplatz unter einfachem Strohdach von den trauernden Verwandten so lange bewacht, bis das Grabmal nach Stand und Würde fertig war und die feierliche Beisetzung erfolgen konnte. Man gab dem Verstorbenen seine Rüstung, Waffen und Kostbarkeiten mit in die Gruft.
Bitt- und Bußfeste werden gefeiert an den Jahrestagen der Sterbefälle und anderer Familienereignisse, oder auf Anordnung der Obrigkeit bei wichtigen Staatsbegebenheiten.
Fast sämtliche japanische Feste und Festgebräuche stammen aus dem Shinto-Kultus; nur wenige sind rein buddhistischen Ursprungs. Die Lehren des Konfuzius und Siaka sollen auf die Gestaltung der Volksfeste einen wesentlichen Einfluss geübt haben, doch tragen auch diese zu bezeichnende Merkmale des alten Kami-Dienstes, um diesem Kultus nicht zugeeignet zu bleiben. — Die Reisenden der preußischen Expedition waren selbstverständlich bei ihrem kurzen Aufenthalt und ihrer Unkenntnis der Landessprache nicht in der Lage, viel neue und zuverlässige Aufschlüsse über das Verhältnis des Kami-Dienstes zum Buddhismus zu gewinnen, doch möge dem Verfasser gestattet sein, hier die durch eigene Beobachtung erläuterten Früchte seiner Bücherstudien über diesen Gegenstand in kurzem mitzuteilen.
Der Buddhismus ist seit Verbannung des Christentums erklärte Staatsreligion, zu der sich, wenigstens äußerlich, alle Japaner bekennen müssen. Als Graf Eulenburg die mit ihm verkehrenden Bunyos nach ihrem Bekenntnis fragte, antworteten sie ausweichend, dass sie »als Buddhisten begraben würden«. Sie gehörten unzweifelhaft, wie die gebildeten Stände fast durchweg, der philosophischen Sekte Syuto an, deren Lehren sich auf die schon im Anfange unserer Zeitrechnung in Japan eingeführten Schriften des Konfuzius gründen und nicht eigentlich eine Religion zu nennen sind. Ihnen gilt die Ausbildung des sittlichen Prinzipes im Menschen als das Höchste; die Frage nach dem geistigen Wesen der Gottheit, welche Konfuzius selbst hartnäckig von sich abgewiesen zu haben scheint, bleibt unerledigt. Das Körperliche, Unvollkommene, Vergängliche, steht im Gegensatz zu dem Geistigen, Vollkommenen, Ewigen, dessen Keim in jeden Menschen gelegt ist, mit der Pflicht, ihn aus eigener Kraft zu nähren und auszubilden. Staat und Familie sind unmittelbare Ausflüsse und Repräsentanten des ewigen Prinzips, eingesetzt und berufen die Ausbildung des Geistig-Sittlichen im Ganzen und Einzelnen zu leiten, zu fördern. Symbol des Scheinbaren, Endlichen ist die Erde, Symbol der Ewigkeit und Wahrheit der Himmel. Die Wahrheit wird im Bewusstsein jedes Menschen geboren; er ist bestimmt, ihr durch eigene Wahl anzugehören, mit dem Ewigen eins zu werden. Das sind die Grundlagen der Konfuzius-Lehre, über deren weitere Aus- und Umbildung in der Syuto-Sekte der Verfasser keine Auskunft zu geben vermag. Ihre Auffassung erheischt offenbar einen höheren Bildungsgrad, als bei der Menge des japanischen Volkes zu finden ist.
Fragt man den Japaner über die Verbreitung des Buddhismus und des Kami-Dienstes, so heißt es, »auf hundert Buddhisten sei kaum ein einziger Bekenner der Shinto-Lehre zu rechnen«. Das ist aber nur von den Anhängern des reinen Shinto-Kultus zu verstehen, dessen Vorschriften allen Bilderdienst und den Besuch der Buddha-Tempel streng verbieten. Ihnen scheint die Sekte Ikosyo schroff gegenüberzustehen, welche die reine Lehre des Buddha-Amida ausgebildet hat und jeden anderen Kultus verdammt. Dagegen sollen die Anschauungen und Gebräuche aller übrigen Buddha-Sekten sich mehr oder weniger denen des alt-nationalen Kami-Dienstes angepasst und verschmolzen haben, und so kann man noch heut mit vollem Rechte sagen, dass die Shinto-Religion durch das ganze Volk verbreitet ist. Die Sekte der Riobu-Shinto, in welcher Gebräuche und Lehren des Buddhismus und des Kami-Dienstes auf das innigste verschmolzen zu sein scheinen, gilt für eine der zahlreichsten. Die ersten Verkünder des Buddhismus in Japan haben ihre Lehre geradezu auf den Kami-Dienst gepfropft; Wunder, Götter- und Geistererscheinungen waren in jenem Zeitalter an der Tagesordnung; die im Shinto-Kultus hochverehrten göttlichen Ahnen kamen bald hier bald dort unter der Hülle indischer Gottheiten in buddhistischen Tempeln zum Vorschein, während indische Götter und Propheten, in Japan wiedergeboren, in den Personen lebender Regenten, großer Männer und Helden auftraten. Buddhistische Mönche gaben vor, den japanischen Sonnengott in China in der Gestalt eines indischen Heiligen angetroffen zu haben, wo er erschienen sei um feindliche Anschläge gegen sein Schutzland abzuwenden; sie brachten das Götzenbild sogar herüber und erhielten einen Tempel dafür. Diese Beispiele zeigen deutlich, dass der Buddhismus wenigstens mancher Sekten nur ein verändertes Gewand des Kami-Dienstes ist.
Der gebildete Japaner verachtet geradezu den Buddhismus und dessen Priester, nicht so sehr wegen der Glaubenslehren, sondern weil es ihn herabwürdigt, dem gemeinen Haufen gleich ein Gegenstand plumpen Mönchsbetruges zu werden, in den der öffentliche Gottesdienst dieser Sekten vielfach ausgeartet ist. »Der Butto«, heißt es in dem Briefe eines Gelehrten an Siebold, »ist unser herrschender Gottesdienst und aus keinem anderen Grunde als solcher aufgestellt, als um das Volk in seiner Dummheit zu erhalten. Die Sekte Sensyu ausgenommen geht das Streben aller Bonzen dahin, das Volk, und vor Allen den Landmann in plumper Unwissenheit zu lassen: Einfältigkeit, sagen sie, führt auf dem Wege des blinden Glaubens und Vertrauens in die Vorschriften und Auslegungen der heiligen Bücher von selbst zur Tugend.« Ähnliche Äußerungen berichtet Golownin; die Verachtung des Buddhismus scheint bei den höheren Ständen allgemein, ebenso aber die Überzeugung von seiner Unentbehrlichkeit für das Fortbestehen der alten Ordnung. Der gemeine Mann hat blinde Ehrfurcht vor den Bonzen, blickt aber mit scheuer Achtung zu der philosophischen Sekte als einer höheren auf, deren erhabene Lehren nur den bevorzugten Ständen zugänglich sind. Der Kami-Dienst dagegen steht bei Vornehm und Gering in großem Ansehen; selbst die Anhänger der Syuto-Lehre beweisen ihm Ehrerbietung und beobachten gern die altherkömmlichen Festgebräuche der nationalen Gottesverehrung. Sie scheint allerdings wenig ausschließliche Bekenner zu haben, aber fast alle Japaner, die buddhistischen Priester kaum ausgenommen, besuchen neben den Tempeln ihrer Sekten auch die Kami-Hallen. Die Gebräuche des Shinto-Kultus sind mit dem Volks- und Familienleben innig verwachsen und nicht davon zu trennen. Die Feier der darin vorgeschriebenen heiligen Tage und Feste ist jedem Japaner eine Pflicht der Pietät, sie bilden einen Einigungspunkt aller Stände und Glaubenssekten, und werden mit allgemeiner Begeisterung begangen. Es verhält sich damit ähnlich wie bei uns mit mancher alten Volks- und Hausgewohnheit, deren Ursprung oft in die heidnische Zeit hinaufgeht, deren wahre Bedeutung längst vergessen ist; sie ist uns lieb als alter Gebrauch, den wir seit frühester Kindheit begangen haben und auch in reiferem Alter ungern missen. Je schärfer ausgeprägt die Eigentümlichkeit eines Stammes, desto mehr solcher uralten Sitten, Gebräuche und Feste werden sich erhalten, die, aus der Heidenzeit stammend, oft in gradem Widerspruch mit dem Christentume stehen, oder ihm notdürftig angepasst sind. So begleiten auch den buddhistischen Japaner Gebräuche und Feste des Kami-Dienstes von der Wiege bis zum Grabe durch das Familien- und Bürgerleben. Sie führen ihn erheiternd und erbauend im Kreise des Jahres herum und mahnen zu bestimmten Tagen und Stunden an die Vorzeit, an die Pflichten gegen sich selbst und die Seinen, gegen seine Mitbürger und Vorgesetzten. Japanischer Anstand und Lebensart stehen in enger Beziehung zu dem Kami-Dienste, die Festgebräuche sind eine Schule der jugendlichen Bildung, sie verfeinern die Sitten und lenken die Vergnügungen.
In jeder Wohnung ist an erhöhtem Platze eine kleine aus weißem Holz geschnitzte Hauskapelle, Miya, aufgestellt, in welcher das Goheï 8), ein aus Papierstreifen bestehendes Sinnbild des Kami aufbewahrt wird. Davor stehen Blumentöpfe und Opfergeräte, und zur Seite Laternen von eigentümlicher Form. Becher mit frischen Zweigen des immergrünen Sakaki, der Myrthe und Zypresse schmücken das häusliche Heiligtum, und in den Gefäßen wird zu bestimmten Zeiten Tee, Saki und gereinigter Reis geopfert. An den Reïbi, den Jahrestagen des Kami, bei Volks- und Familienfesten hängt man sinnbildliche Verzierungen, Gemälde und künstliche Blumensträuße dort auf, und die festlich gekleideten Familienglieder begehen die Feier je nach ihrer Bedeutung mit gemessenem Ernst oder heiteren Spielen. — Auch in dem Gärtchen, das fast keinem japanischen Hause fehlt, ist dem Hausgötzen ein zierlicher Ehrensitz bereitet. —
Seinem Wesen nach ist der Shinto-Dienst ein Natur- und Heroenkultus; alle Andachtsübung scheint auf Erhebung der Seele an wunderbaren Naturkräften und menschlicher Größe hinauszulaufen 9).
Eigentliche Glaubenssätze hat der Verfasser nicht entdecken können, aber an sittlichen Vorschriften und Regeln für das Leben und die Andachtsübung ist der Kultus reich. Man soll vor Allem reinen Herzens sein, soll Wahrheit und Glauben im Gemüte tragen, reine Opfergaben bringen und den Kami bitten, dass er Wohlsein und Segen verleihe, die Fehler verzeihe und die Seele des Schuldigen von allem Übel erlöse. Die Reinheit der Seele soll sich durch körperliche Reinheit betätigen; Feuer und Wasser sind Symbole der Reinigung, daher stehen deren Genien am Eingange vieler Shinto-Tempel. »Unrein« wird man durch Sterbefälle der Blutsverwandten und Berührung von Leichen, durch Blutvergießen, Befleckung mit Blut und den Genuss der Haustiere. Der Mensch ist den Göttern nur im Zustande reiner Seelenfreude angenehm, und wird durch Trauer und wilde Leidenschaft, wie durch die ekelerregende Berührung des Verwesenden von ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen. Im Zustande der Unreinheit lässt man Bart und Haare wachsen und bedeckt das Haupt, die Männer mit einem Strohhut, die Frauen mit weißem Schleier; Türen und Fenster der Wohnung bleiben geschlossen, außen zeigt eine Tafel den Zustand der Unreinheit an. Um in die Gottesgemeinschaft zurückzukehren zieht der fromme Japaner sich in ein frisch gereinigtes Haus zurück, legt ein weißes Trauergewand an, enthält sich, unter Beobachtung der größten Reinlichkeit, aller nahrhaften Speisen, und bringt seine Zeit mit Gebeten und dem Lesen erbaulicher Bücher zu. Diese Fasten dauern je nach dem Grade der Unreinheit länger oder kürzer, und werden von Landleuten und Handwerkern auch vor dem Antritt der Pilgerfahrten, ja sogar vor dem Besuch bei hochgestellten Personen beobachtet. — Der Entsündigte kehrt endlich im Festgewande, den Bart und das Haupthaar nach Landessitte geschoren, in die Gemeinschaft seiner Verwandten und Freunde zurück, und nimmt wieder Anteil an den Festen der Landesgötter.
Die reine Shinto-Lehre verbietet allen Bilderdienst 10); selbst Tempel scheint es außer dem uralten Heiligtum von Isye vor Einführung des Buddhismus kaum gegeben zu haben. Um 906 teilte der Mikado jeder Landschaft die Verehrung bestimmter Gottheiten zu; seitdem ist die Zahl der Kami bedeutend gestiegen. Alle Shinto-Tempel zeichnen sich durch die einfachste Bauart aus; sie sind mit Rohr oder Schindeln gedeckt, das Innere so schmucklos wie das Äußere; das berühmte Heiligtum von Isye ist ein bescheidenes Haus von Rohr und Stroh. Als Sinnbild der Gottheit dient überall das aus Papierstreifen gefertigte Goheï, das entweder in vergittertem Schrein oder in einem abgesonderten Allerheiligsten hinter dem Tempel bewahrt wird. Auf dem Altar steht ein Metallspiegel als Symbol der Sonne, der Reinheit; wenige Opfergeräte, eine Trommel, eine Schelle und ein muschelförmiges Gong über dem Eingang bilden das Tempel-Inventar. Vor der Tür wachen grimmige Tiergestalten, »die koraïschen Hunde«, deren Vorbilder die Japaner von ihren frühesten Eroberungszügen nach dem Festlande mitgebracht haben sollen. Niemals fehlt das Toori, ein Portal von typischer Form aus Holz oder Stein, gebildet von zwei gegeneinander geneigten Säulen und zwei sie verbindenden Querbalken. Die Neigung der Säulen, die Schweifung der oberen Schwelle, und die auch bei dem steinernen Toori selten fehlenden Keile beweisen deutlich den Ursprung der Form aus dem Holzbau 11). — Die größeren Tempel haben Nebengebäude für das Mikosi, einen Wasserplatz mit großen Bronzekübeln, Stallungen für die Priesterpferde, Hallen für Votivbilder, für Schrifttafeln mit den autographen Sprüchen berühmter Männer, mit Gedichten, Legenden und historischen Notizen. Auch Rüstungen, Waffen und andere Votivsachen werden dort aufbewahrt. — Oft stehen kleinere Miyas oder Bethäuser zur vorbereitenden Andacht neben dem Tempel.
Die meisten Kami-Höfe liegen in dichten Hainen, an Bergeshängen, Seen oder strömenden Wassern. Gewöhnlich ist ein bewegter Baugrund zu Herstellung von Terrassen und Vorhöfen benutzt; künstliche Anlagen wetteifern mit der Natur, jede Zufälligkeit des Bodens gestaltet sich unter der Hand des japanischen Architekten zur landschaftlichen Zierde. Sie sind Meister in der malerischen Verwertung abschüssiger Bauplätze; wo symmetrische Anordnung unmöglich ist, spricht doch die Anlage immer einen klaren Gedanken aus. Mannigfache Ziersträucher schmücken die wipfelbeschatteten Vorhöfe; die Strebewände hochgetürmter Terrassen sind malerisch in Moos, Efeu und Immergrün verhüllt. Klare Quellbäche stürzen die Waldschluchten herab und werden in Goldfischteichen gesammelt; Hegewild, Fasanen und Chöre von Singvögeln beleben die grüne Einsamkeit. Manche Tempel sind wegen ihrer Nachtigallen, schöngefiederten Enten oder ähnlichen Getiers berühmt, andere durch Legenden und historische Traditionen merkwürdig. Hier wird dem andächtigen Pilger der alte Stamm einer Tanne gezeigt, welche der heilige Tensin pflanzte, dort ein Bambusstrauch, der Angelrute eines berühmten Helden entsprossen, oder der Kirschbaum, wo ein liebendes Mädchen ihr tränennasses Gewand aufhing, ehe sie sich verzweifelnd in das Meer stürzte, das ihren Geliebten verschlang.
Die Kami-Höfe sind mit ihren schönen Umgebungen die beliebtesten Lustorte aller Volksklassen. Man ergeht sich im kühlen Haine mit Frau und Kind, lagert mit den Freunden schmausend und Verse machend am Wasser, füttert das Hegewild und die Goldfische, oder genießt träumend der herrlichen Aussicht. Die gastfreien Priester nehmen Teil an allen Freuden; sie gehören meist den höheren Ständen an und sind verheiratet, gehen im gewöhnlichen Leben bewaffnet und unterscheiden sich in Haartracht und Kleidung wenig von den Laien; bei Feierlichkeiten dagegen soll ihr Anzug der Hoftracht von Miako gleichen, die Oberpriester führen dann den krummen Säbel und die Zeremonienmütze Kamuli. Die Priesterfrauen tragen ihr Haar nach Art der Mikado-Damen; sie sind Gehilfinnen beim Gottesdienst, reinigen und segnen die Hallen, verrichten ausschließlich die Einsegnung der Neugeborenen und führen in Gemeinschaft mit Priestern und Laien die heiligen Gesänge aus. Die Beschäftigung der Priester besteht neben dem Darbringen der Opfer und Wahrnehmung der Festgebräuche vorzüglich im Empfange der Pilger und Verfertigung mannigfacher Talismane, Ablasszettel und Schriften über die Merkwürdigkeiten des Kami-Hofes. An den Feiertagen halten sie Predigten, lesen Legenden und Wundergeschichten vor und legen sie den Andächtigen aus. Beim Gepränge der Festprozessionen werden viele Laien verwendet und dazu in kostbare, im Tempel verwahrte Gewänder gekleidet. — Die Opfer bestehen meist in Esswaren: Reis, Kuchen, Fischen, Früchten, Tee und Saki. Warmblütige Tiere sollen jetzt nur selten geopfert werden, auch steht das Tieropfer mit dem Wesen des Kultus in Widerspruch. In den ältesten Zeiten aber wären der Sage nach zur Versöhnung böser Geister selbst Menschen geschlachtet worden.
Wer seine Andacht im Tempel verrichtet, soll sich vorher gehörig reinigen; er sprengt Wasser aus dem davor aufgestellten Becken, tritt an den Eingang und schlägt mit dem dort herabhängenden Seil an das muschelförmige Gong über der Tür, — oder klatscht dreimal in die Hände, — um den Kami zu rufen; oft wiederholen die Priester durch Trommel- oder Glockenschlag diese Ankündigung. Der Andächtige verrichtet dann am Eingang stehend oder niederknieend gesenkten Hauptes ein stilles Gebet und wirft beim Weggehen einige Kupfermünzen vor den Altar.
Eine Hauptvorschrift des Shinto-Dienstes ist das Wallfahrten. Kämpfer und Siebold nennen zweiundzwanzig Wallfahrtsorte, deren vornehmster der oft erwähnte Tempel des Ten-zio-daï-zin in der Landschaft Isye ist; dahin pilgern Anhänger fast aller japanischen Sekten. Haupterfordernis der Wallfahrt ist Reinheit; auch dem Hause des Pilgers darf während seiner Reise nichts Unreines nahen, ein Strohseil hängt zur Abwehr böser Geister quer vor der Tür. Die beiden Tempel von Isye dürfen nur in Begleitung der Priester betreten werden, welche die Andachtsübungen der Pilger leiten und dafür Gebühren beziehen. Den älteren, inneren gründete nach den japanischen Annalen der Kaiser Sui-nin im Jahre 5 n. Chr., und weihte dort seine jüngste Tochter zur Oberpriesterin; den zweiten soll der Daïri Yuliak um 477 n. Chr. gebaut haben. Nach Klaproth würde bei der Thronbesteigung jedes Mikado ein an dessen Statur gemessenes Bambusrohr nach Isye gebracht und während seines Lebens im äußeren Tempel bewahrt, bei seinem Verscheiden aber mit der Namens-Inschrift versehen und in den inneren Tempel versetzt; diese Stäbe dienten als Sinnbilder der mit ihrem Tode in die Zahl der Kami tretenden Erbkaiser. Im inneren Tempel sollen außerdem ein Strohhut, ein Strohmantel und ein Grabscheit — Embleme des Ackerbaues, der als Grundlage der japanischen Kultur gilt — hinter einem geheimnisvollen Vorhang bewahrt werden, welcher nach dem Volksglauben das Bild der Gottheit verhüllt. — Die Pilger empfangen in Isye gegen eine Geldgebühr das Ofarraï, ein Holzkästchen mit dem Ablassschein, der nachher sorgfältig am besten Orte des Hauses aufbewahrt wird. Der Ablass dauert aber nur ein Jahr; die Ofarraï-Kästchen werden daher in Massen durch das ganze Land verschickt, und zu Neujahr, dem Feste der Reinigung, mit den Kalendern aller Orten um ein Geringes verkauft. Nach Isye ziehen Pilger aller Stände; nur die Buddha-Priester sollen, als unrein durch die Leichenbestattung, den Tempeln nicht nahen dürfen. Eine Tafel mit der Chiffre des Sonnengottes findet sich in fast allen japanischen Häusern, außer denen der Sekte Ikosyo, welche die reine Lehre des Buddha Amida bewahrt und jeden anderen Kultus verabscheut. — Die japanischen Pilger tragen sonderbarer Weise dasselbe Abzeichen wie früher die abendländischen, nämlich eine Kamm-Muschel an Hüten und Mänteln.