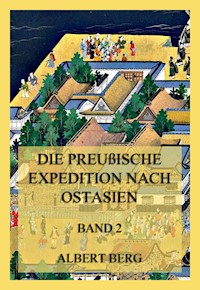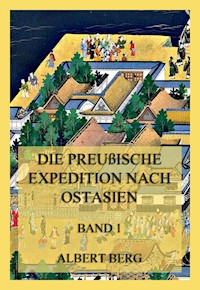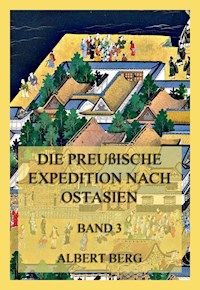
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die preußische Ostasien-Expedition, auch als "Eulenburg-Expedition" bekannt, war eine diplomatische Mission, die Friedrich Albrecht zu Eulenburg im Auftrag Preußens und des Deutschen Zollvereins in den Jahren 1859-1862 durchführte. Ihr Ziel war es, diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu China, Japan und dem damaligen Siam aufzubauen. Die wichtigsten Teilnehmer der Expedition waren Friedrich Albrecht zu Eulenburg, Lucius von Ballhausen (Arzt), Max von Brandt (Attaché), Wilhelm Heine (Maler), Albert Berg (Künstler), Karl Eduard Heusner, Fritz von Hollmann, Werner von Reinhold, Ferdinand von Richthofen und Gustav Spiess. Der Expedition standen drei Kriegsschiffe des preußischen Ostasiengeschwaders zur Verfügung, die SMS Arcona, die SMS Thetis und die SMS Frauenlob. Dies ist Band drei von vier der Aufzeichnungen zu dieser Expedition. Der Text folgt den Originalausgaben, die zwischen 1864 und 1873 erschienen, wurde aber in wichtigen Wörtern und Begriffen der heute aktuellen Rechtschreibung angepasst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die preußische Expedition nach Ostasien
Band 3
ALBERT BERG
Die preußische Expedition nach Ostasien, Band 3, A. Berg
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849662288
Quelle: [Berg, Albert]: Die preussische Expedition nach Ost-Asien. Bd. 3. Berlin, 1873. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/berg_ostasien03_1873>, abgerufen am 13.05.2022. Der Originaltext aus o.a. Quelle wurde so weit angepasst, dass wichtige Begriffe und Wörter der Rechtschreibung des Jahres 2022 entsprechen.
Cover Design: Cropped, By Koa-public - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78051662
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
VORWORT.1
CHINAS BEZIEHUNGEN ZUM WESTEN BIS 1860.4
I. DIE ÄLTEREN BERÜHRUNGEN UND DIE HANDELSBEZIEHUNGEN BIS ZUM ERLÖSCHEN DES MONOPOLS DER ENGLISCH-OSTINDISCHEN KOMPANIE 1834.4
II. DER OPIUM-HANDEL UND DER OPIUM-KRIEG.48
III. DIE ZUSTÄNDE NACH DEM FRIEDEN VON NANKING.110
IV. DIE TAE-PIN-BEWEGUNG.. 129
V. DER LORCHA-KRIEG.181
VI. DIE OPERATIONEN DER TAE-PIN.223
VII. DIE ABWEISUNG DER GESANDTEN BEI TA-KU 1859 UND DER ENGLISCH-FRANZÖSISCHE FELDZUG GEGEN PEKING 1860.242
REISEBERICHT.316
XIII. SHANGHAI.316
VORWORT.
Die Vollendung dieses Werkes und der »Ansichten aus Japan, China und Siam« musste sich notwendig lange verzögern, weil gegen meine schweren Bedenken das Ganze, nicht nur die in meinen Beruf schlagende künstlerische, sondern auch die schriftstellerische Arbeit mir allein übertragen wurde. Die Herstellung von sechzig großen Blättern für das Folio-Werk und achtundvierzig kleineren für das Octavo-Werk erforderte beträchtliche Zeit, wegen des fremdartigen Details, ohne dessen eingehende Charakteristik Darstellungen exotischer Gegenstände wenig Wert haben, und wegen der für die meisten Blätter gewählten Technik der Federzeichnung, welche allein die Sicherheit der fotolithographischen Faksimilierung verbürgte. Die beiden letzten Hefte des Folio-Werkes sollen noch im Laufe des Winters erscheinen; der Druck des vierten, letzten Bandes dieses Octavo-Werkes kann schnell gefördert und im Frühjahr vollendet werden.
Die schriftstellerische Arbeit, die mich Jahre lang meinem Beruf entfremdete, hätte ich bei richtiger Würdigung der Schwierigkeiten kaum übernommen. Erst bei der Redaktion wurde mir klar, dass mit der bloßen Schilderung unserer Erlebnisse in Ost-Asien wenig getan sei. Der Abschluss der preußischen Verträge mit Japan und China ist eine kurze Episode in der Entwickelung des Verkehrs mit diesen Ländern, eine einzelne Szene aus einem inhaltreichen Drama, deren Vorgänge Bedeutung und Leben nur als Teile des Ganzen gewinnen. Die Tätigkeit des Grafen zu Eulenburg in beiden Ländern fiel in merkwürdige Perioden dieser Entwickelung. In Japan war es die Zeit der blutigsten Anschläge gegen die Fremden und heftiger politischer Gärung, welche, damals in tiefes Dunkel gehüllt, die bald nachher erfolgte Umwälzung einleitete. In China war die angemaßte Oberhoheit des Himmelssohnes über alle Reiche des Erdenrundes von den Westmächten eben zum ersten Mal äußerlich gebrochen worden, im Bewusstsein des Kaisers und seiner vertrauten Räte aber keineswegs so vollkommen erstorben, dass sie sich nicht gegen den preußischen Vertrag noch in heftigen Paroxysmen gewehrt hätte. Die Genehmigung des Vertrages war der letzte amtliche Akt des Kaisers Hien-fun und wurde unter sonderbaren Umständen erteilt. Unter den Vertragsverhandlungen bereitete sich der Staatsstreich vor, welcher gleich nach unserer Abreise aus Peking die fremdenfeindlichen Großen beseitigte und das Fortbestehen der Gesandtschaften in der Hauptstadt möglich machte. Das Alles zu vollem Verständnis zu bringen, bedurfte es einer Darstellung der ganzen Entwickelung des Fremdenverkehrs, der Verträge und Kriege mit jenen Ländern. Im Zusammenhang und mit einiger Gründlichkeit ist dieser Stoff niemals behandelt worden; selbst die Vorarbeiten sind dürftig.
Die Geschichte des Fremdenverkehrs mit China, das wichtigste Stück dieses Bandes, machte große Schwierigkeit. Diese Arbeit ist in der Form keineswegs abgerundet; sie wäre kürzer und klarer geworden, wenn ich sie auf einige Monate fortgelegt, dann nochmals durchgearbeitet hätte, was weder den Wünschen der Königlichen Regierung noch meiner Neigung entsprach. So möge denn der Leser sich durcharbeiten. Die Substanz ist aus zuverlässigen Quellen geschöpft; für die letzten ereignisreichen zwanzig Jahre boten die in den Archiven zu Kanton, im Sommerpalast bei Peking und an anderen Orten erbeuteten chinesischen Dokumente, deren größter Teil bis jetzt nur in den Publikationen des englischen Parlamentes abgedruckt ist, ein reiches Material. Des Chinesischen unkundig musste ich die von den bewährtesten englischen Dolmetschern gelieferten Übersetzungen benutzen, die ich gewissenhaft wiedergab. Alle Zitate stammen aus unzweifelhaft echten Dokumenten. — Für den Tae-pin-Aufstand, der einen wesentlichen Teil dieser merkwürdigen Entwickelung bildet, hielt ich mich an die zuverlässigen Werke von Meadows, Lindesay Brine und Andrew Wilson. Die ersten Akte dieses Dramas entält der einleitende Teil, die weitere Entwickelung während unserer Anwesenheit in China der Reisebericht, und das Ende ein Anhang am Schluss des vierten Bandes.
Fehler entält der China behandelnde Teil gewiss so gut wie der japanische, doch glaube ich im Wesentlichen die Wahrheit berichtet zu haben. Ich bin mir bewusst, dem Stoff unparteiisch, ohne vorgefasste Meinung gegenübergestanden, und keine Mühe gespart zu haben, bin mir aber ebenso klar bewusst, in der historischen Forschung, — wie in der Behandlung der deutschen Sprache, — nur ein Dilettant zu sein.
Die Würden und Titel der chinesischen Staatsdiener gab ich nach den englischen Übersetzungen wieder, die ungefähr ebenso treu sein mögen, wie Rangbezeichnungen, aus antiken Sprachen in moderne übersetzt.
Die chinesischen und die siamesischen Namen in diesen beiden Bänden und auf den Karten sind, soweit sie nicht im Deutschen feste Schreibart angenommen haben, in Professor Lepsius’ Alphabet gedruckt. In vielen Fällen kann ich aber nicht dafür bürgen, dass die gegebene Aussprache auch nur annähernd die richtige ist. Die meisten im einleitenden Abschnitt vorkommenden Namen hörte ich niemals nennen, sondern kenne sie nur aus englischen, teils auch aus deutschen Büchern. Oft ist in verschiedenen Werken die Schreibart so grundverschieden, dass nur der Zusammenhang die Identität der abweichenden Versionen erkennen lässt. Die feinen Nuancen der Aussprache, für welche Professor Lepsius diakritische Zeichen gibt, sind nur Sinologen geläufig.
Die Übersichtskarten in diesem und dem letzten Bande sind lediglich zu Orientierung des Lesers bestimmt und machen keinen anderen Anspruch; dem genannten Zweck sind alle anderen Rücksichten geopfert. Für China wurden die Karten der neuesten englischen Werke benutzt, für Siam die Karte des Herrn Professor Kiepert in Dr. Bastians Reisewerk.
Die Illustrationen zum Reisebericht über China sollen mit den auf Siam bezüglichen dem 4. Bande beigegeben werden. Ein Register zu diesen beiden Bänden und eine Liste der benutzten Werke folgen am Schlusse des vierten Bandes.
Die Fahrten der Thetis und der Elbe sind in diesen Bänden nicht beschrieben worden. Die interessante Reise der Thetis, seit sie Shanghai verließ bis zu ihrem Eintreffen vor der Mündung des Menam verdiente erzählt zu werden. Elbe lief nach dem Aufenthalt in Japan nur Punkte an, welche auch Arkona besuchte; die persönlichen Erlebnisse und Anschauungen ihres Kommandanten sind aber in dessen eigenem Werke niedergelegt.
Berlin, im Januar 1873.
A. Berg.
CHINAS BEZIEHUNGEN ZUM WESTEN BIS 1860.
I. DIE ÄLTEREN BERÜHRUNGEN UND DIE HANDELSBEZIEHUNGEN BIS ZUM ERLÖSCHEN DES MONOPOLS DER ENGLISCH-OSTINDISCHEN KOMPANIE 1834.
Chinas Berührungen mit der antiken Welt waren weder unmittelbare noch folgenreiche; die Nachrichten darüber sind dürftig und kaum der Aufzählung wert. Arrian spricht von Thinae oder Sinae, die aus dem fernsten Asien Seide gebracht hätten. Nach chinesischen Berichten schickte Ho-ti, ein Kaiser der Han-Dynastie, 94 n. Chr. Gesandte nach dem Westen, und unter Trajan soll ein chinesisches Heer, Tartaren verfolgend, bis an das kaspische Meer gelangt sein. — Der zunehmende Gebrauch von Seide im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung lässt auf Handelsverkehr zwischen dem römischen Reiche und China schließen, der aber wohl kaum direkt betrieben wurde. Marcus Antoninus schickte 161 eine Gesandtschaft nach China, über deren Schicksale man keine Nachrichten hat. — Konstatiert ist eine frühe hebräische Einwanderung in das chinesische Reich; die jüdische Gemeinde von Kae-fun-fu wurde im 17. und 18. Jahrhundert von Europäern besucht und bestand noch vor wenigen Jahren 1).
Erst die Araber brachten einige Kenntnis von China nach dem Westen. Renaudot hat die Berichte zweier arabischen Reisenden aus den Jahren 850 und 877 übersetzt, welche nicht nur zu denen des Marco Polo, sondern in vielen Stücken auch auf die heutigen Zustände passen. Ihr »Kan-fu« ist wahrscheinlich Kanton, wo noch jetzt eine sehr alte Moschee steht. »Die Stadt liegt an einem großen Fluss, einige Tagereisen von seiner Mündung, so dass das Wasser dort süß ist.« Die Erzählungen von häufigen Feuersbrünsten, von Verzögerungen im Schiffsverkehr, von der unredlichen Behandlung der fremden Kaufleute und Schiffseigner, die, weil das Übel einmal eingerissen ist, jede Unbilde und Bedrückung leiden müssen, erinnern lebhaft an jüngst vergangene Zeiten. Die Mündung des Perl-Flusses nennen die Araber das »Tor von China«, wahrscheinlich eine Übersetzung von Hu-men, das die Portugiesen mit Bocca Tigris wiedergaben. — Die Reisenden erwähnen auch die Ernährung des Volkes aus öffentlichen Speichern bei Hungersnot, die Salzsteuer, welche noch heute besteht, den Bambus als Prügelwerkzeug; sie beschreiben den Gebrauch des Tees, das chinesische Kupfergeld, Porzellan, den Reisbranntwein, die Anstellung öffentlicher Lehrer, den buddhistischen Götzendienst und die Unwissenheit der Chinesen in der Astronomie, in welcher die Araber ihre ersten Lehrer wurden.
Aus diesen und anderen Berichten geht deutlich hervor, dass die Araber lange vor der mongolisch-tartarischen Eroberung Seehandel nach China trieben. Ibn Batuta, welcher bald nach derselben das Reich der Mitte besuchte, gedenkt u. a. des von den Mongolen eingeführten Papiergeldes und seiner Entwertung durch übermäßige Ausgabe, aus welcher die Regierung unredlichen Gewinn gezogen habe. Chinesische Dschunken segelten damals bis Kalkutta. — Der Islam fand besonders im 13. Jahrhundert in China starke Verbreitung; seine Bekenner haben dort ohne wesentliche Störung bis auf den heutigen Tag freie Religionsübung genossen, und wurden häufig zu wichtigen Staatsämtern befördert; in den nordwestlichen Provinzen bilden sie einen starken Bruchteil der Bevölkerung.
Als erster christlicher Gesandter kam 1246 der Mönch Giovanni Carpini, von Papst Innozenz IV. abgeschickt, nach China. Er begab sich durch Russland zunächst zu Baatu-Khan, der an der Wolga lagerte, und wurde von da nach dem Hofe des Groß-Khans der Mongolen geführt, welcher ihn gütig aufnahm und mit einem huldreichen Schreiben an den Papst entließ. Carpini beschreibt die ungeheure Anhäufung von Schätzen bei den Mongolenfürsten; er freut sich über die Ähnlichkeit des buddhistischen mit dem römischen Ritus, und zieht daraus den Schluss, dass jene Asiaten entweder schon Christen seien, oder bald werden müssten — Nestorianische Gemeinden scheinen damals über weite Strecken des nord-östlichen Asien verbreitet gewesen zu sein 2). Der Mönch Rubruquis, den Ludwig der Heilige 1253, während seines Kreuzzuges, zu dem Mongolen-Khan sandte 3), spricht von einem nestorianischen Bischof in Sin-gan und zehn Kirchen in verschiedenen Städten. Auch er nahm den Weg über Russland und fand auf der ganzen Reise viele Europäer als Sklaven und Handwerker unter den Mongolen. Die auffallende Übereinstimmung des buddhistischen Lama-Cultus mit den Gebräuchen der römischen Kirche ließ Rubruquis vermuten, dass ersterer aus einem entstellten christlichen Gottesdienst, vielleicht dem nestorianischen, abgeleitet sei. — Um dieselbe Zeit ging der armenische König Haïton nach China, um sein Reich dem Mongolen-Khan zu übergeben; er berichtet gleichfalls von zahlreichen Christen, die er auf der Reise traf. Marco Polo fand nestorianische Gemeinden in Šen-si, damals einer der blühendsten Provinzen von China, und in einer Stadt am Jangtsekiang, wo ein nestorianischer Christ, vom Kaiser auf drei Jahre mit der Regierung betraut, 1274 mehrere Kirchen gebaut hatte.
Die Geschichte des Marco Polo ist bekannt. Zwei venezianische Edle, Matthias und Nicolas Polo, gelangten an den Hof des Kublai-Khan, der sie freundlich aufnahm und bei ihrer Abreise zu baldiger Rückkehr nach China aufforderte. Schon 1274 erschienen sie dort, begleitet vom jungen Marco, mit einem Schreiben Papst Gregor X. an den Mongolen-Kaiser. Marco gewann des Herrschers Gunst, blieb siebzehn Jahre in dessen Dienst und erhielt nur schwer die Erlaubnis zur Heimkehr. Was er von den Schätzen des großen Reiches und der Pracht des Mongolenhofes berichtet, trug ihm bei den Venetianern den Namen Messer Marco Millione ein. Neuere Erfahrungen haben die Glaubwürdigkeit seiner Erzählung in besseres Licht gestellt.
Dem Aufenthalt des Marco Polo folgte unmittelbar der des Giovanni de Corvino, welcher, von Rom gesandt, 1288 in Peking erschien und gütig aufgenommen wurde. Trotz allen Widerstandes der Nestorianer durfte er eine Kirche bauen, und soll einige Tausend Chinesen getauft, auch viele Kinder in der lateinischen Sprache und den Glaubenslehren unterrichtet haben. Clemens V. machte ihn zum Bischof von Kam-ba-lu, — so hieß Peking bei den Tartaren, — und sandte ihm einige Priester zur Unterstützung. Einen würdigen Nachfolger hat er nicht gefunden; nach seinem Tode ging die Mission ein oder geriet in Vergessenheit.
Das 14. und 15. Jahrhundert bilden, soweit die Kenntnis des Verfassers reicht, in den Beziehungen des Westens zum chinesischen Reich eine Lücke; es ist, als wäre China durch die Portugiesen erst wieder entdeckt worden. Die Nachrichten über deren erstes Auftreten und über das der Niederländer und Engländer sind dunkel und verworren; die Abenteurer mochten weder den Wunsch noch die Ehrlichkeit haben, die Wahrheit zu sagen. Sehr bezeichnend ist die Tatsache, dass, — während in früheren Zeitaltern die Chinesen durchaus keinen Widerwillen gegen Fremde bewiesen und den Bekehrungsversuchen christlicher Missionare kaum Hindernisse bereiteten, während ihre klassischen Schriften die Wohltaten des Handels und den Nutzen preisen, welcher den Völkern aus dem Austausch ihrer Ideen und Erzeugnisse erwachse, — seit dem Erscheinen der seefahrenden Nationen eine ausgesprochene Abneigung, ja Feindschaft und Verachtung gegen dieselben hervortrat. Sie steigerte sich erheblich seit der Invasion der Mandschu, deren Unsicherheit auf dem chinesischen Thron ihren Argwohn gegen die Fremden genährt haben mag; begründet war sie aber wesentlich im Charakter und Auftreten der Seefahrer und der Missionare. Erstere gehörten großenteils zum Auswurf ihrer Heimat; selbst die besseren scheinen wilde Abenteurer gewesen zu sein, denen der Ruhm tollkühner Anschläge weit mehr galt als Unbescholtenheit; die Menge der Ankömmlinge aber zeigte sich knechtisch und kriechend gegen überlegene Macht, zu jedem Opfer der Ehre bereit, wo es ihr Vorteil erheischte; brutal, gewaltsam, treulos und jeden Verbrechens fähig, wo sie als die Stärkeren dadurch Gewinn erzielen konnten. Kein Wunder, wenn die Chinesen sie als feige Banditen ansahen und behandelten.
Als bald nach den Portugiesen die Holländer und die Engländer erschienen, machten die Fehden und die oft in Gewalttat ausartende Eifersucht dieser in Tracht und Antlitz einander so ähnlichen Europäer den schlechtesten Eindruck; alle Fremden galten für Hallunken, die keine andere Leidenschaft hätten als schrankenlose Gewinnsucht, und kein Mittel verschmähten, das zur Befriedigung ihrer Habgier führte. Die eifersüchtigen Ränke unter den verschiedenen Mönchsorden, welche in China auftraten, die leidenschaftliche Erbitterung und parteiliche Eitelkeit, mit welcher sie ihre Lehrstreitigkeiten führten, die widersprechenden Entscheidungen der Päpste und deren Eingriffe in die Hoheitsrechte der chinesischen Kaiser brachten dann auch den Christenglauben in Misskredit bei den Machthabern. Geringschätzung, Argwohn und systematische Ausschließung waren die natürlichen Folgen.
Der früheste Verkehr der seefahrenden Nationen mit China soll hier nur in allgemeinen Umrissen gezeichnet werden; eine kritische Geschichte desselben liegt außer dem Bereiche dieser Blätter. Für die späteren Perioden hat man nur mit den Resultaten dieses Abschnittes zu rechnen, die klarer zu Tage liegen als die Ereignisse.
Die ersten Seefahrten der Portugiesen nach China folgten bald auf die Gründung von Malakka. Von da sandte Alfons Albuquerque 1516 den Rafael Perestrello in einer chinesischen Dschunke ab, welche nach der Mündung des Tšu-kian 4) segelte. Perestrello scheint freundlich behandelt und nach Malakka zurückgekehrt zu sein, wo ein Geschwader von acht Schiffen ausgerüstet wurde, das unter Perez de Andrade 1517 vor dem Perl-Fluss erschien. Die portugiesischen Fahrzeuge wurden von Kriegsdschunken umringt und scharf bewacht; ihr Befehlshaber erlangte aber durch Bestechung und verständiges Betragen die Erlaubnis, mit zwei Schiffen nach Kanton hinaufzugehen, während die übrigen bei der Insel Hian-šan zurückblieben. Andrade machte in Kanton gute Geschäfte und betrug sich untadelhaft, erhielt aber plötzlich die Nachricht, dass sein Geschwader vor der Flussmündung von Piraten bedrängt sei und eilte zurück. — Der Ausgang des Unternehmens war günstig: mehrere Schiffe führten reiche Frachten nach Malakka, andere gingen mit Dschunken der Liu-kiu-Inseln nach der Küste von Mittel-China, wo Niederlassungen in Tsiuen-tsin, Nin-po und auf Tšu-san gegründet wurden. Die portugiesischen Ansiedler trieben dort eine Reihe von Jahren einträglichen Handel nach den benachbarten Küsten und nach Japan, bis die Provinzial-Regierung sie wegen schlechter Führung verbannte.
Bald nach der Reise des Perez de Andrade kam dessen Bruder Simon mit einem Geschwader nach China und landete auf der Insel Hian-šan. Er trat gewaltsam gegen die Landesbewohner auf und suchte sich auf der Insel festzusetzen, wurde aber mit Gewalt vertrieben. Die Portugiesen verlegten sich nun auf Seeraub und brachten durch wilde Grausamkeit ihr Geschlecht in den übelsten Ruf. Schlimme Folgen hatte die Ruchlosigkeit des Simon Andrade zunächst für den ersten portugiesischen Gesandten, Thomas Pirez, welcher 1520 von Kanton nach Peking reiste, um vom Kaiser die Erlaubnis zum Bau von Faktoreien zu erwirken. Bei seiner Ankunft war man dort schon von den Missetaten des Andrade unterrichtet; Pirez wurde nach vielen Demütigungen unter strenger Bewachung wieder nach Kanton geschleppt, dort misshandelt, eingekerkert und mutmaßlich hingerichtet. — Die Provinzial-Regierung scheint schon damals auf jeden direkten Verkehr der Europäer mit dem Kaiserhofe eifersüchtig gewesen zu sein.
Alfons de Mela, der bald nach Simon Andrade und ohne von dessen Gewalttaten zu wissen, mit acht Schiffen nach dem Perl-Fluss kam, wurde von vornherein feindselig behandelt und verlor viele Leute. Nachher scheinen die Beziehungen sich friedlicher gestaltet zu haben. Die neuen Ankömmlinge mussten durch Unterwürfigkeit gut machen, was die wilde Rohheit ihrer Vorgänger verdarb; sie würgten jede Demütigung hinunter, um die Vorteile des Handels zu genießen. Über die Umstände, unter welchen die festere Gestaltung des Verkehrs sich vollzog, fehlen die Nachrichten; von rühmlichen Taten mag sie kaum begleitet gewesen sein. Die Portugiesen erwirkten wohl alle Zugeständnisse der Mandarinen durch Schmeichelei und Bestechung; denn einer Machtentfaltung, welche ihren Forderungen hätte Nachdruck geben können, waren sie nicht fähig. Die Chinesen mögen unterscheiden gelernt haben zwischen friedfertigen Kaufleuten und gesetzlosen Abenteurern, wenn auch der Schatten, welchen das Auftreten der letzteren auf die ganze Nation und alle Europäer warf, sich so bald nicht verwischte. Die größte Wirkung muss auf die Landesbewohner der reiche Vorteil geübt haben, welchen sie selbst aus dem fremden Handel zogen. Ein beredtes Zeugnis bietet dafür die an den Kaiser gerichtete Petition eines Kantonesen, welche, von Davis ohne Datum abgedruckt, nach Inhalt und Zusammenhang in die letzte Zeit der Min-Dynastie gehört. Der fremde Handel war, wie nach ernsten Konflikten häufig geschah, verboten worden. Der Bittsteller macht nun geltend, dass ein großer Teil der öffentlichen Ausgaben durch die von den ausländischen Kaufleuten erhobenen Steuern aufgebracht werde; dass, wenn keine fremden Schiffe kämen, sowohl öffentliche als Privat-Interessen darunter litten. Er bittet deshalb, dass den Franken der Handel wieder gestattet werde und zählt die daraus entspringenden Vorteile auf: den regelmäßigen Tribut der fremden Völker und die von den Kaufleuten zu Bestreitung der lokalen Ausgaben erhobenen Zölle; den zum Unterhalt der Garnison erforderlichen Zuschuss, der nur durch Steuern auf den fremden Handel aufgebracht werden könne; den Gewinn der einheimischen Kaufleute, dessen Wohltaten die ganze Bevölkerung fühle u. s. w. — Dieses Gesuch und einige andere Dokumente — statistische Aufstellungen chinesischer Beamten über den fremden Handel — beweisen deutlich, dass man die dem Lande daraus entspringenden Vorteile wohl zu schätzen wusste, wenn auch den Ausländern gegenüber stets vorgegeben wurde, man dulde sie nur aus Gnade und trotz dem aus ihrer Anwesenheit dem Lande erwachsenden Schaden.
Vielfach mögen freilich die Nachteile des Fremdenverkehrs dessen Vorteile überwogen haben; das beweist u. a. die Vertreibung der Portugiesen aus Nin-po im Jahre 1545. Dem friedfertigen Teile der Ansiedler mussten die wilden Freibeuter, die in zahlreichen Horden die Küsten beunruhigten und frech das Innere des Landes durchstreiften, oft einen schweren Stand bereiten. Es gab darunter merkwürdige Naturen, deren Verwegenheit, Unternehmungslust und Zähigkeit Bewunderung erregen, wenn auch die meisten kaum mehr als rohe Banditen waren. Hier möge noch einmal des Mendez Pinto 5) gedacht werden, welcher als würdiger Vertreter dieser Menschenklasse gelten kann. An den Küsten von Tše-kian kreuzend, erkundet er eine Insel bei Nin-po, wo die mit reichen Schätzen gefüllten Gräber siebzehn chinesischer Fürsten liegen. Pinto und seine Gesellen beladen dort ihre Fahrzeuge mit Gold und Silber, müssen aber einen Teil der Beute an die nachsetzenden Chinesen wieder ausliefern. Dann leiden sie Schiffbruch; nur vierzehn retten das Leben, werden aber aufgefangen, gemartert, nach Nanking geschleppt, dort zu öffentlicher Peitschung und Verlust eines Daumens verurteilt. Man schickt sie nach Peking. Auf der Reise haben sie Gelegenheit, die guten Sitten, bürgerliche Ordnung, den Gewerbefleiß und die Gerechtigkeitsliebe der Landeskinder zu bewundern, wovon Pinto lebendige Schilderungen gibt. In Peking verurteilt man die Portugiesen nochmals zu einjähriger Zwangsarbeit; aber noch vor Ablauf des Strafmaßes gewinnen sie die Freiheit, erreichen die Küste und schiffen sich nach Nin-po ein, werden aber vom Schiffer auf einer wüsten Insel ausgesetzt, von Piraten aufgenommen und kommen, durch Stürme verschlagen, nach Japan. — Ein Kern von Wahrheit ist in Pintos Berichten leicht zu erkennen, nicht aber die Grenze der Lüge.
Die Gründung von Macao und das frühere Verhältnis dieser Kolonie zur chinesischen Regierung sind in Dunkel gehüllt. Die Halbinsel Gaü-men, auf welcher die Stadt entstand, bildet die südöstliche Spitze der großen Insel Hian-šan und hängt mit derselben durch einen schmalen Isthmus zusammen. Schon 1537 sollen die bestochenen Mandarinen den Portugiesen erlaubt haben, auf dem unbewohnten Vorgebirge Schuppen zum Trocknen ihrer Waren zu bauen, welche unter der Bezeichnung »Tribut« eingeführt wurden. Bald entstanden auch steinerne Wohngebäude; ohne Einspruch ließ man die Bevölkerung anwachsen. Die Portugiesen bauten Festungswerke und richteten eine eigene Regierung ein, ohne Zweifel unter Konnivenz der erkauften Lokal-Behörden, aber ohne ausdrückliche Zustimmung des Kaiserhofes, mit welchem ein Vertrag darüber niemals geschlossen wurde. Die Hoheitsrechte, welche die Regierung von Lissabon wiederholt beanspruchte, sind ihr in der Tat bis in neuere Zeit hartnäckig verweigert worden 6). Die Portugiesen haben immer behauptet, das Territorium sei ihnen als Ersatz für gewisse Dienste abgetreten worden, welche sie den Chinesen zur Unterdrückung der Seeräuber geleistet hätten. Dem widersprechen aber die Tatsachen. Sie entrichteten jährlich eine bestimmte Summe als Grundzins an den Hof von Peking und erhielten dafür die Erlaubnis, auf der Halbinsel zu wohnen und sich selbst zu regieren, übten diese Rechte aber nur ad nutum des Kaisers, der sie jeden Augenblick vertreiben konnte. Ein chinesischer Zivil-Gouverneur bewachte, in Macao wohnend, unter dem Statthalter von Kuan-tun die portugiesischen Behörden und regierte die dort ansässigen Chinesen im Namen des Kaisers; chinesische Offiziere untersuchten jährlich die portugiesischen Festungswerke, und chinesische Zollbeamte erhoben Abgaben von portugiesischen Schiffen. Kein neues Haus, keine Kirche durfte ohne Einwilligung der Mandarinen gebaut werden. Schon 1573 zogen diese eine Mauer quer über die Landenge und schnitten jeden freien Verkehr mit dem Inneren ab. Die Mandschu-Kaiser erklärten nach Unterwerfung des Reiches die Kolonisten in Macao ausdrücklich für Untertanen der Ta-tsin-Dynastie. Erst in neuester Zeit hat Portugal einen ähnlichen Vertrag mit der chinesischen Regierung geschlossen, wie die anderen westlichen Völker.
Die Spanier erlangten für den Verkehr in Macao und Kanton bald ähnliche Zugeständnisse wie die Portugiesen. Der Besitz der Philippinen bot ihnen wesentliche Vorteile; dennoch blieb ihr Handel unbedeutend. Man glaubt, dass ein großer Teil des Warenverkehrs sich in Manila konzentriert hätte, wenn dort Speicher zur zollfreien Wiederausfuhr eingerichtet worden wären. Zuweilen berührten fremde Schiffe Manila, um Reisladungen einzunehmen und dadurch die schweren Hafengebühren in Kanton zu vermeiden; aber selbst diesen Handelszweig drückte die spanische Regierung.
Nach dem Eingehen der von Giovanni de Corvino in Peking errichteten Mission zu Anfang des 14. Jahrhunderts scheint in China das Christentum nicht wieder gepredigt worden zu sein, bis 1579 die ersten Jesuiten nach Kanton kamen. Miguel Ruggiero und Matteo Ricci wurden damals die Gründer der katholischen Missionen in China. Letzterer trat anfangs in Bonzentracht auf, fand aber darin bei den gebildeten Klassen wenig Eingang. Er nahm nun die Kleidung der Studierten an und erwarb sich schnell deren Gunst durch seine physikalischen Kenntnisse. Man hörte seine Vorträge gern und zeigte sich auch zur Annahme des Christenglaubens geneigt, soweit derselbe zu den Satzungen des Konfuzius stimmte, nahm aber Anstoß an den Lehren von der Fleischwerdung, der Dreieinigkeit, von der Erbsünde und der Hölle. Ricci sah ein, dass der Versuch, das Vorurteil der Chinesen gewaltsam zu durchbrechen, ihre alten Sitten zu ändern, die Totenopfer und andere abergläubische Gebräuche als gottlos abzuschaffen, ihm jede Aussicht auf Erfolg verschließen würde. Er statuierte deshalb einen Unterschied zwischen bürgerlichen und kirchlichen Verrichtungen, ließ viele durch uraltes Herkommen geheiligte und im frommen Gefühle der Chinesen eingewurzelte Gebräuche unangetastet, und sah seine Bekehrungsversuche bald mit glänzendem Erfolge gekrönt. Nach siebzehnjährigem Aufenthalt im südlichen China ging Ricci nach Peking und wurde durch Gunst eines Eunuchen dem Kaiser genannt, der seine Geschenke annahm und ihm eine Wohnung anweisen ließ. Andere Jesuiten kamen nach und gründeten, der Bekehrungsart des Ricci folgend, Gemeinden in mehreren Städten zwischen Kanton und Peking. In den nächsten Jahrzehnten blühten durch ganz China christliche Genossenschaften auf; Kirchen soll es um die Mitte des 17. Jahrhunderts in allen größeren Städten des Reiches gegeben haben; die Bekehrten wurden nach Hunderttausenden gezählt.
In Peking, wo die Jesuiten schon zwei Kirchen hatten, gewann um die Mitte des 17. Jahrhunderts ein Deutscher, Pater Adam Schall aus Köln, bedeutenden Einfluss. Er goss für den letzten Min-Herrscher Kanonen, wusste dann auch die Gunst des jungen Mandschu-Kaisers Šun-tši zu gewinnen, wurde dessen Lehrer und Direktor des astronomischen Bureau. Sein Freimut und vielseitiges Wissen, besonders physikalische Kenntnisse, verschafften ihm großes Ansehen und seine Erfolge waren so außerordentlich, dass spätere Jesuiten sie als übernatürliche Gnadenwunder berichten. Ein anderer Deutscher, Ferdinand Verbiest, wurde Schalls Amtsgehilfe und Nachfolger.
Wie in Japan, so hatte auch in China die Bekehrung guten Fortgang, solange die klugen Jesuiten allein arbeiteten. Bald folgten aber andere Mönchsorden, deren Wüten gegen die abergläubischen Gebräuche der Chinesen Ärgernis erregte. Freilich gab die Lehre des Ricci ihrer Eifersucht eine bequeme Handhabe, denn sie vertrug sich keineswegs mit strenger Rechtgläubigkeit. Die Totenopfer und andere Gebräuche, welche er als bürgerliche duldete, wurden von den Dominicanern als götzendienerisch verdammt und allen chinesischen Christen unter Androhung der Höllenstrafen verboten. Papst Innozenz X. bestätigte dieses Urteil, das Alexander VII. auf Vorstellung der Jesuiten wieder aufhob. Die Einmischung der Päpste und die erbitterten Angriffe der Dominicaner, welche sich auch auf andere von den Jesuiten mit großer Einsicht der chinesischen Auffassung angepasste Formen der Lehre bezogen, machten bald die Mandschu-Regierung argwöhnisch gegen alle Missionare; während der Minderjährigkeit des Kaisers Kan-gi wurde ihr Bekehrungseifer als staatsgefährlich verdammt. Schall soll vor Gram gestorben sein; Verbiest musste sich verstecken. Letzteren erhob Kan-gi, als er großjährig die Regierung antrat, zum Direktor der Sternwarte; die vertriebenen Geistlichen durften zu ihren Kirchen zurückkehren. Der Kaiser erklärte sogar 1692 in einem Edikte den Christenglauben für erlaubt und nahm im Lehrstreit Partei für die Jesuiten; ein Dekret vom Jahre 1700 bestätigt, dass der Ausdruck Tien, wörtlich Himmel, allein den wahren Gott bezeichne, und dass die von Ricci erlaubten Zeremonien bürgerlicher, nicht kirchlicher Art seien. Dem trat aber, trotz Alexander VII. Entscheidung, ein Bischof Maigrot entgegen, welcher den Ausdruck Tien für »Gott« verbot und jene Gebräuche als Götzendienst verdammte. Papst Clemens XI., welchem das Dekret des chinesischen Kaisers vorlag, entschied wieder zu Gunsten der Dominicaner, und der zu Schlichtung des Streites entsandte apostolische Vicar Tournon verbot nach Empfang des päpstlichen Ediktes 1705 den chinesischen Christen die Ausübung aller durch dasselbe verdammten Zeremonien. — Nun erließ Kan-gi einen Befehl, nach welchem die der Lehre des Ricci folgenden Missionare im Lande geduldet, alle anderen aber mit Verfolgung bedroht wurden. — Der Patriarch Mezzabarba, der 1720 in China erschien, um den päpstlichen Willen durchzusetzen, fand den Kaiser unbeugsam in seinem Entschluss, den Päpsten keinerlei Gewalt über seine Untertanen einzuräumen, und musste Zugeständnisse machen, um den katholischen Glauben nicht gänzlich aus dem Reiche der Mitte verbannt zu sehen.
Der folgende Kaiser, Yun-tšin, vertrieb bei seiner Thronbesteigung 1723 alle Missionare als Ruhestörer. Einige hielten sich unter Verkleidungen in den Provinzen versteckt; wenige Jesuiten durften unter dem Einfluss mächtiger Beschützer in Peking bleiben. — Kien-lon, welcher 1735 den Thron bestieg, verfuhr mit äußerster Strenge gegen die Christen; die in den Provinzen versteckten Geistlichen wurden eingekerkert, die Gemeinden auseinandergesprengt. Wer den Glauben nicht abschwören wollte, musste fliehen. Die Jesuiten in Peking wandten vergebens alle Mittel auf, den Kaiser zur Milde zu stimmen; erst 1785 befreite Kien-lon die noch lebenden Priester aus dem Kerker und erlaubte ihnen, das Land zu verlassen.
Einzelne katholische Missionare sammelten seitdem im Verborgenen wieder Gemeinden um sich, wurden aber zu Zeiten mit Härte verfolgt. Der letzte Jesuit verließ Peking erst 1823 aus eigenem Antriebe. Eine zahlreiche Christengemeinde hielt sich dort trotz aller Verbote unter eingeborenen Priestern bis in die neueste Zeit. Das Religionsedikt, das Tau-kuan nach dem Frieden von Nanking zu Gunsten der Christen erlassen musste, scheint kaum praktische Folgen gehabt zu haben. Erst die französischen Verträge von 1858 und 1860 setzten die katholischen Missionare in ihre alten Rechte ein.
Nach den Portugiesen und Spaniern kamen im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts zunächst Holländer, dann Engländer, Dänen, Schweden, Franzosen, Amerikaner nach Kanton. Deutsche Schiffe erschienen dort wahrscheinlich erst in diesem Jahrhundert. — Die russische Regierung ließ 1806 durch Krusenstern in Kan-ton Versuche zu Anknüpfung des Seehandels machen, dem die chinesische durch ein Verbot begegnete; nur über Kiak-ta sollten mit dem Slavenreich Waren getauscht werden. Dieser Landhandel konnte einzig unter dem Schutz von Monopolen gedeihen, und wurde von russischer Seite durch Verbote der Einfuhr chinesischer Produkte zur See lange begünstigt.
Während Macao Hauptsitz des Handels der Portugiesen und Spanier blieb, wandten sich alle anderen Nationen fast ausschließlich nach Kanton. Ihre größeren Schiffe mussten wegen der Wassertiefe bei Wam-poa, etwa eine Meile stromabwärts, ankern; der Geschäftsverkehr aber konzentrierte sich in Kanton selbst, wo im Laufe der Zeit die Handelsgesellschaften der verschiedenen Nationen am Ufer des Perl-Flusses Faktoreien gründeten. Jede derselben hatte ihren Vorsteher, der als verantwortliches Haupt seiner Landsleute galt, die heimische Regierung aber keineswegs amtlich vertrat. Wären sie dazu ermächtigt gewesen, so hätten doch die Mandarinen jede Beziehung zu denselben als unter ihrer Würde zurückgewiesen; denn in China können Kaufleute nicht Beamte sein, nicht mit Beamten auf dem Fuß der Gleichheit verkehren. Schon dadurch wurde ein solches Verhältnis unmöglich, dass die chinesischen Kaiser bis in die neueste Zeit die Souveränität auswärtiger Staaten nicht gelten ließen. Der ernste Kampf um solche Anerkennung begann erst, als nach Aufhebung des Monopoles der englisch-ostindischen Gesellschaft für China die großbritannische Regierung zu Wahrung der Handelsinteressen 1834 königliche Kommissare nach China sandte. Der Frieden von Peking endete diesen Kampf 1860. Vor Aufhebung jenes Monopoles wurde aller Verkehr mit den Mandarinen durch chinesische Kaufleute vermittelt.
Der Geschäftsbetrieb in Kanton muss bald nach Gründung der ersten Faktoreien die feste Gestalt angenommen haben, die er mit geringen Modifikationen bis 1834 behielt: die chinesische Regierung verlieh das Monopol für den ausländischen Handel einer beschränkten Zahl einheimischer Kaufleute, welche für das gute Betragen der Fremden bürgten und deren Verkehr mit den Behörden vermittelten. Diese Hon-Kaufleute 7) standen unter Aufsicht der Mandarinen, mit welchen sie ihren Gewinn teilten. Die Fremden durften die Stadt nicht betreten und wurden in den Faktoreien streng bewacht. Den Chinesen gegenüber waren sie formell und faktisch rechtlos und hatten kein Mittel in Händen, der willkürlichen Bedrückung zu begegnen. Die Mandarinen erpressten das Äußerste und schraubten ihre Ansprüche immer höher. Das veranlasste periodische Konflikte, die häufig zu Suspendierung des Handels führten; die Vorteile desselben waren aber auf beiden Seiten so groß, dass Wege zur Einigung immer wieder gesucht und gefunden wurden. Wollten die Ausländer willkürlichen Übergriffen entgegentreten und sich des despotischen Verfahrens der chinesischen Justiz erwehren, so sperrten die Mandarinen gleichfalls den Handel; der Gewalt gegenüber waren Jene einzig auf innere Tüchtigkeit angewiesen. Die Rohheit und der Nationalhass der Schiffsmannschaften in Wam-poa und Kanton erzeugten oft blutige Händel der Seeleute unter sich und mit der chinesischen Bevölkerung, aus welchen den Handelsvorstehern schlimme Verlegenheiten erwuchsen. Vom europäischen Völkerrecht hatten die Chinesen keine Ahnung; sie betrachteten alle Fremden als Untertanen des Himmelssohnes und glaubten sich berechtigt, gegen deren Vergehen mit der landesüblichen Grausamkeit zu verfahren, die Blut für Blut fordert und auch den Schuldlosen trifft. So fiel in Kanton mancher Unschuldige unter dem Schwerte des chinesischen Henkers, ein Opfer der Habgier und Schwäche seiner Landsleute, die ihn lieber auslieferten, als den Vorteil des Handels entbehrten. Am häufigsten fehlten darin die Portugiesen, welche eher jede Schmach ertrugen, als die Freundschaft der Mandarinen auf das Spiel setzten.
Die Portugiesen konnten niemals verwinden, dass sie den Handel mit anderen Völkern teilen mussten, dessen Vorteile sie so lange allein genossen; ihre eifersüchtigen Ränke, das Konspirieren mit den Mandarinen gegen die anderen Nationen dauerten bis in dieses Jahrhundert. Ganz ist wohl keines der seefahrenden Völker von dem Vorwurf freizusprechen, dass es in China seine Ehre dem Vorteil opferte. Den Engländern aber, deren Handel bald jeden anderen überflügelte, gebührt trotz vielen Missgriffen der Ruhm, zuerst der Willkür würdig begegnet zu sein und der Gesittung des Westens die gebührende Stellung in China erkämpft zu haben.
Eine zusammenhängende Darstellung derjenigen Periode, welche mit dem Jahre 1834 abschließt, wäre eine dankenswerte Arbeit, wenn sie die Verfassung der verschiedenen Handelsgesellschaften, die Einrichtung des fremden Gemeinwesens in Kanton, seine Beziehungen zu den Chinesen, die Art des Geschäftsbetriebes, kurz die ganze Gestaltung und die Wandlungen des Verkehrs in klares Licht setzte. Vielleicht gingen die wichtigsten Fundgruben für solche Arbeit beim Brande der Faktoreien mit deren Archiven unter? Die dem Verfasser zugänglichen Berichte sind fragmentarisch und lückenhaft; viele Tatsachen entbehren darin der Begründung; die Einrichtungen stehen fertig da, ohne dass sich ihre Entwicklung erkennen lässt; so muss denn Manches dunkel bleiben.
Die Fremden verkehrten in diesem Zeitraum mit den Kantonesen ohne den Schutz und Zügel einer legalen Autorität. Die Unmöglichkeit, auf gesetzlichem Wege Recht zu erlangen, und die Notwendigkeit, durch das eigene Auftreten sich Ansehen zu verschaffen, machte sie schlau und vorsichtig, aber auch willkürlich und anmaßend. Die verachtete Stellung, welche ihnen durch Verschließung der Stadt angewiesen wurde, erhöhte die Reizbarkeit der Ausländer, die sich, je niedriger ihre Bildungsstufe und soziale Stellung, desto erhabener wähnten über jeden Sohn der blumigen Mitte. Die Art der Berührung, wie sie sich zwischen den Fremden und den Kantonesen gestaltete, musste zu gegenseitigem Verkennen, zu Hass und Verachtung führen. Wenn auch unter den Handelsvorstehern und den Hon-Kaufleuten immer achtbare Charaktere waren, die einander schätzen lernten, so konnte dieser stillere Verkehr doch wenig Einfluss auf die öffentliche Meinung üben. Die Faktorei-Beamten, Supercargos und Schiffsmannschaften kamen fast nur mit habgierigen Offizianten des Zollamtes und dem Gesindel der Vorstädte in Berührung. Ihr Auftreten gegen diese, — das ihrer Gesittung zufolge gewaltsamer und willkürlicher gewesen sein mag als billig, — und die blutigen Schlägereien der Schiffsmannschaften unter sich bestimmten vorwiegend den Ruf der Ausländer bei dem besseren Teil der kantonesischen Bevölkerung. Der Hass derselben steigerte sich im Laufe der Jahrzehnte zu leidenschaftlicher Wut und wurde zu einer Hauptwurzel der späteren Übel. Wie aber diese Feindschaft wirklich auf der Abschließung beruhte, zeigt in schlagender Weise der Umstand, dass jede Spur davon geschwunden ist, seitdem Kanton einige Jahre von einer englischen Garnison besetzt war, seit die besseren Klassen seiner Bevölkerung und die Fremden sich im täglichen Umgang kennen lernen mussten.
Die Unmöglichkeit, durch indirekten Verkehr mit einflussreichen Mandarinen in Kanton Abhilfe gegen Unrecht und drückende Übelstände zu erlangen, trieb die Fremden zu vielfachen Versuchen, in Berührung mit dem Kaiserhofe zu treten, durch Gesandtschaften in Peking Einrichtungen für den Handel zu erwirken, welche ihn auf die feste Basis gesetzlicher Bestimmungen stellen und vor Eingriffen der Provinzial-Behörden sichern möchten, — zugleich auch den direkten Verkehr mit letzteren anzubahnen. Von diesen wurden alle solche Versuche als Eingriffe in ihre Rechte angesehen, der Erfolg derselben von vornherein mit allen Mitteln hintertrieben. So unumschränkt durch das weite Reich der Wille des Himmelssohnes gilt, — welcher jeden Augenblick frei verfügen kann über Leben und Eigentum des höchsten Würdenträgers wie des geringsten Tagelöhners, — so ist doch China in gewissem Sinne als ein Staaten-Bund unter gemeinsamem Oberhaupte anzusehen. Die Statthalter sind tatsächlich unumschränkte Herren in den Provinzen und werden von Peking aus erst dann zur Rechenschaft gezogen, wenn ihre Verwaltung zu Aufständen geführt hat, welche sie nicht selbst bezwingen können. Sie sind für den fremden Handel in gleichem Maße verantwortlich, wie für alle anderen Vorgänge in ihrem Gebiete. So lange die Ausländer nicht »rebellierten«, solange ihre »Auflehnung« von den Statthaltern unterdrückt werden konnte, mochte die Zentral-Regierung niemals eingreifen; sie blieb häufig selbst dann indifferent, wenn die Fremden durch gewaltsames Auftreten sich eigenmächtig zu ihrem Rechte verhalfen und von den Statthaltern wichtige Zugeständnisse erzwangen. Im sittlichen Bewusstsein der Chinesen ist jede Auflehnung gegen Unrecht und Willkür gerechtfertigt. Die Konflikte der Fremden in Kanton hatten keine andere Bedeutung, als die Auflehnung der eigenen Untertanen gegen die Behörden; — denn das Bewusstsein, dass der Himmelssohn der alleinberechtigte Herrscher der Welt sei, war noch bis in die neueste Zeit so stark bei den Chinesen, dass es ihnen gar nicht einfiel, die Fremden anders anzusehen, als für Untertanen ihres Kaisers. So konnten diese in der späteren Zeit zu Kanton Gewalt üben, welche in jedem anderen Lande zum Kriege geführt haben müsste. Fand man in Peking ihre Forderungen gerecht oder fühlte man sich zu schwach zum Widerstande, so wurde, — ganz wie bei Auflehnungen der eigenen Untertanen, — der Statthalter abberufen, getadelt, vielleicht degradiert. Man schickte einen anderen hin, mit dem Auftrage, die rebellischen Barbaren zu zähmen, zu zügeln; aber an einen Krieg dachte man eben so wenig, als den Fremden bestimmte Rechte zu gewähren, welche ja den absoluten Willen des Himmelssohnes beschränkt hätten. In diesem einen Punkte liegt die große, im früheren Verkehr mit China verkannte Schwierigkeit. So viele Gesandten nach Peking gingen, um feste Zugeständnisse zu erlangen: keinem scheint eingefallen zu sein, dass jeder Vertrag bei den chinesischen Herrschern das Bewusstsein der Gleichberechtigung anderer Souveräne voraussetzte, ein Bewusstsein, das ihnen nicht durch reiche Geschenke und prächtige Aufzüge, sondern nur dadurch einzupflanzen war, dass ihre Macht einmal angesichts der Hauptstadt und des ganzen Reiches gebrochen, ihre Dynastie bedroht wurde. Das geschah erst 1860. Alle früheren Gesandtschaften hatten gar keinen, die Kriege nur geringen Erfolg, gleich lokalen Aufständen, die den Thron nicht bedrohten. Die Gesandten wurden, mochten sie sich den von der chinesischen Etikette geforderten bedeutsamen Formen der Untertänigkeit fügen oder nicht, ohne jedes Zugeständnis eines Rechtes und höchstens mit gnädigen Redensarten fortgeschickt, alle Verträge abgelehnt. Die Kriege betrachtete man in Peking als Rebellionen gegen die Statthalter; die erzwungenen Verträge wurden nicht gehalten. Denn wer durfte dem Willen des Himmelssohnes Gesetze vorschreiben? Der Übergang zu vertragsmäßigen Beziehungen mit China war kaum ein anderer, als der Übergang vom Absolutismus zur Verfassung im Leben europäischer Staaten; der Herrscher entäußert sich zu Gunsten des Volkes eines Teiles der Rechte, welche seine Vorgänger durch alle Zeitläufte besessen haben; das Volk, das früher rechtlos seinem Willen unterworfen war, soll ihm nun in einem Vertragsverhältnisse gegenüberstehen. So entäußert sich der Himmelssohn durch jeden Vertrag mit fremden Fürsten der angestammten Oberhoheit.
In China ist das Bewusstsein von der Berechtigung der unumschränkten Macht des Kaisers, nicht nur über das eigene Reich, sondern über die ganze Welt, eng und unzertrennlich verwachsen mit der auf zweitausendjähriger Entwickelung fußenden, tief eingewurzelten Weltanschauung des Volkes. Das Reich der Mitte ist so groß, seine Gesittung so ausgeprägt, dass alles außerhalb Liegende nur Zubehör, alle fremde Kultur nur mangelhaft sein kann. Von den wirklichen Verhältnissen der Raumverteilung hatte man ebenso wenig eine Ahnung als von der Bildung anderer Völker. China ist die Welt, an deren äußersten Grenzen in rauer nebliger Ferne Barbarenstämme hausen, welche die Sonne nur düster beleuchtet. Weit weniger als wir Europäer den Papua, sahen die Söhne der blumigen Erde den Fremdling aus dem Westen für Ihresgleichen an; in der öden Ferne, an den Grenzen der Natur wohnend, gehörte er gleichsam einem anderen Elemente an 8). — Der Kaiser ist nach der uralten Weltanschauung der Chinesen der Sohn des Himmels »Tien«. Dieses Wort bedeutet übertragen Vorsehung, Weltordnung, ewige Gerechtigkeit, und bezeichnet so ganz das höchste geistige weltregierende Prinzip, dass die Jesuiten gewiss mit Recht den Ausdruck »Gott« durch »Tien« übersetzten. Zur vollen Gleichbedeutung mit dem monotheistischen Begriff fehlt ihm allerdings, aber auch nur eine einzige Eigenschaft: es drückt nicht den persönlichen Gott, den bewussten Willen aus. Diesen Begriff kennen die Chinesen nicht; sie haben ihn, wie es scheint, verloren 9). Tien bezeichnet die Ewigkeit, Vollkommenheit, Unendlichkeit, sittlich das höchste Gute, Wahre, Rechte, die unumstößliche Weltordnung, und in diesem Sinne ist der chinesische Kaiser der erwählte Sohn, der Vertreter des Himmels, berufen, die Welt zu regieren, die göttliche Ordnung auf Erden aufrecht zu halten; er ist nicht nur der rechtmäßige Beherrscher von China, sondern der vom Himmel eingesetzte Herr der Welt, sein Willen unumschränkt und unantastbar.
Als erwählter Sohn des Himmels ist nun der Kaiser nicht nur absoluter Herr, sondern er ist auch für das Wohl und Wehe des Reiches, — der Welt, — und das Glück seiner Untertanen — aller Menschen — verantwortlich. Alles Unheil, das dieselben von außen betrifft, verschuldet der Kaiser. Lebt er nicht mehr im Einklange mit der himmlischen Weltordnung, so werden die Menschen heimgesucht; dann tut der Herrscher Busse, legt ein öffentliches Schuldbekenntnis ab und strebt, sich durch Opfer und Gebet wieder in Harmonie mit der höchsten Wesenheit zu setzen. Große Kalamitäten, welche das Reich betreffen, sind ein Zeichen, dass der Kaiser nicht mehr der Erwählte des Himmels, in monotheistischem Sinne ausgedrückt, »dass die göttliche Gnade von ihm gewichen ist«. Nicht nur Bedrückungen und Invasionen, sondern auch Misswachs, Erdbeben, Überschwemmungen und andere Paroxysmen der Natur haben, als Zeichen, dass nicht der rechte Himmelssohn auf dem Thron sitzt, in China zu Aufständen und zum Sturz von Dynastien geführt. Legitimität in unserem Sinne kennt die chinesische Anschauung nicht; durch seine Geburt hat Niemand ein Recht auf den Thron, und die Primogenitur hat gar keine Bedeutung. Als erwählter Himmelssohn muss aber der Kaiser am besten wissen, wer berufen und würdig ist, sein Nachfolger zu werden; er wählt denselben natürlich unter seinen Söhnen und Agnaten, denn die Familie des Erwählten ist selbstredend auch die vornehmste, die vorzüglichste des Reiches. Nur in diesem Sinne ist der Thron von China erblich. Der Kaiser ernennt seinen Nachfolger im Testament; dieser hat aber erst durch seine Handlungen und durch den Segen, den er über das Reich verbreitet, zu beweisen, dass er wirklich der Erwählte des Himmels ist. Das Volk glaubt es, solange es ihm wohl geht. Wird es aber von Unheil betroffen, so folgt es leicht jedem Führer zum Kampfe gegen den vermeintlichen Usurpator, der, unberufen auf dem Throne sitzend, das Verderben des Reiches verschuldet. Das hereingebrochene Unheil beweist ja, dass die Verbindung mit der lenkenden Weltordnung unterbrochen ist. Der Kaiser allein darf zum Himmel beten; als dessen Vertreter regiert er das Volk. Sitzt nun ein Falscher auf dem Throne, so ist der Aufruhr berechtigt, geboten. Rebellen kämpfen mit dem Fanatismus von Gottesstreitern, die berufen sind, den Willen der Vorsehung durchzusetzen, das Reich von dem unrechtmäßigen, weil nicht mehr begnadigten Herrscher zu befreien und den rechtmäßigen, erwählten Himmelssohn auf den Thron zu setzen. Das ist, abgesehen von den menschlichen Leidenschaften, auf deren Boden ja die meisten politischen Bewegungen wurzeln, der ostensible Zweck aller chinesischen Rebellionen und die Idee, welche die Massen treibt, für die Selbstsucht der Führer ihr Leben zu lassen. So viele Umwälzungen es im Laufe der Jahrtausende in China gegeben hat: die unumschränkte Macht des Herrschers ist niemals, vielleicht auch nicht in Gedanken angetastet worden. Das politische Grundprinzip steht auch heute noch unangefochten da und wurzelt so tief im Bewusstsein des Volkes, vor allem der gebildeten Klassen, welche seinen Kern bilden, dass man sich über den fremdenfeindlichen Fanatismus der altchinesischen Partei nicht wundern darf. Die einheimischen Umwälzungen waren immer nur Rebellionen, niemals Revolutionen; sie richteten sich niemals gegen ein politisches Prinzip, sondern immer nur gegen Personen; sie bezweckten keine Umgestaltung des Systems, keine Erkämpfung von Rechten für die Untertanen. Und was den Söhnen des blumigen Reiches niemals eingefallen war, das wollten jetzt die fremden Barbaren erzwingen! Der Kaiser sollte nicht mehr unumschränkter Gebieter sein, und Fremdlinge waren es, die ihm Gesetze vorschrieben! Das war unerhört und widersinnig!
Die Niederländer, welche zunächst nach den Portugiesen kamen, hatten wenig Erfolg mit ihren Handelsunternehmungen nach China, bis von Batavia aus 1624 eine Niederlassung auf der Südwestküste von Formosa gegründet wurde. Die dort angelegte Festung nannte man Zeeland. Das Aufblühen dieser Kolonie sahen die Spanier und Portugiesen mit großem Neide; sie hatten alle Versuche der Niederländer, in China Fuß zu fassen, offen und heimlich hintertrieben, und die chinesische Regierung verbot denselben auch jetzt noch den Handelsverkehr. Die Holländer scheinen nun aber von Zeeland aus die chinesische Schifffahrt so lange gestört zu haben, bis man ihnen die gewünschten Zugeständnisse machte. Dagegen mussten sie die Pescadores-Inseln räumen und sich auf die Festung Zeeland beschränken, wo sie Verbindungen mit den Eingeborenen anknüpften und die angrenzenden Landstriche anbauten. Nach dem Sturze des Min-Hauses flüchteten zahllose Chinesen in das Ausland; 25,000 Familien sollen sich damals auf Taiwan oder Formosa niedergelassen haben. Die Holländer begünstigten anfangs die Einwanderung in der Nähe ihrer Kolonie; in der Folge wuchs sie ihnen über den Kopf und förderte wesentlich ihre Vertreibung von der Insel.
Sonderbarerweise scheint der Festung Zeeland von den holländischen Gesandten, welche 1654 von Batavia nach der chinesischen Hauptstadt gingen, in ihren Verhandlungen mit den kaiserlichen Räten niemals gedacht worden zu sein. Die Tartaren mögen, damals ganz neu in der Herrschaft, von der Geographie des Landes wenig gewusst, vielleicht auch nicht geahnt haben, dass die batavischen Sendboten und die Ansiedler auf Formosa demselben Barbarenstamme angehörten. Jene aber mussten sich freuen, dem Usurpator gegenüber von der Kolonie zu schweigen; denn das frühere Abkommen war noch mit Beamten des Min-Kaisers geschlossen worden. — Die Gesandtschaft wurde in Kanton mehrere Monate aufgehalten, ehe sie die Reise nach Peking antreten durfte; unterwegs empfingen die tartarischen Behörden sie überall höflich. In Peking sollen ihr die Jesuiten entgegengewirkt haben; die Gewährung von Handelsprivilegien, nach welcher sie strebten, hätten die Holländer auch ohne das wohl kaum erreicht, trotz allen Demütigungen, welche sie duldeten. Man scheint sie gefoppt und verspottet zu haben 10). Sie verrichteten willig den knechtischen Gruß des Ko-to nicht nur vor der Person des Kaisers, sondern auch vor den ihnen von seiner Tafel zugeteilten Bissen. Die Sitte des Ko-to besteht darin, dass der Grüßende sich auf beide Knie niederwirft, die Hände auf den Boden stützt und mit der Stirn dreimal die Erde berührt. Dreimaliges Niederwerfen und neunmaliges Kopfstoßen ist der Gruß der tributpflichtigen Vasallen; als solche bekannten sich die Niederländer durch Vollziehung dieser Form, als sie mit den Gesandten abhängiger Staaten vor den Kaiser geführt und gleich diesen behandelt wurden. Trotz aller Willfährigkeit und der reichen Bestechung der kaiserlichen Räte mussten sie Peking ohne das geringste Zugeständnis oder Versprechen verlassen; das kaiserliche Geschenk von 300 Unzen Silber für den Statthalter von Batavia mag gegen die Kosten der Sendung kaum in Anschlag gekommen sein.
Der Vertreibung der Holländer aus Formosa durch den chinesischen Seehelden Kuo-Šin oder Coxinga, welcher 1662 die Festung Zeeland nahm, ist schon im I. Bande dieses Werkes gedacht. Coxinga hatte mit seiner starken Flotte den Tartaren in Mittelchina lange Widerstand geleistet, musste sich aber nach einer Niederlage bei Nanking an die Küste von Fu-kian zurückziehen und betrieb von da aus die Eroberung von Formosa. Er gründete dort ein eigenes Reich, welches erst sein Enkel 1683 den Mandschu-Herrschern übergab.
Eine zweite holländische Gesandtschaft, welche 1667 nach Peking ging, scheint nicht besser behandelt worden zu sein und hatte eben so wenig Erfolg als die erste. — 1795 schickte die batavische Regierung abermals eine glänzende Gesandtschaft unter Titsingh nach der chinesischen Hauptstadt. Man glaubte in der Kolonie, dass die Sendung des Lord Macartney an seinem vornehmen Auftreten und seiner Unwillfährigkeit, sich dem chinesischen Hofzeremoniell zu unterwerfen, gescheitert sei, und befahl deshalb Titsingh, sich jede Demütigung gefallen zu lassen 11). Die Holländer erreichten aber eben so wenig ein Zugeständnis, als Lord Macartney, und hatten, wahrscheinlich wegen ihrer knechtischen Fügsamkeit, auf der Rückreise die schimpflichste Behandlung zu erdulden.
Von England ging 1596 das erste Unternehmen zu Anknüpfung des Handels mit China aus. Die drei zu diesem Zwecke ausgerüsteten Schiffe scheiterten jedoch auf der Reise, und der Versuch wurde unter Königin Elisabeth nicht erneut. Erst im Frühjahr 1637 gelangten vier englische Schiffe unter Kapitän Weddell nach Macao, wo die Portugiesen jede Anknüpfung des Handels hintertrieben. Nach vergeblichem Bemühen, seinen Unterhändlern Eingang in Kanton zu verschaffen, beschloss Weddell, mit den Schiffen selbst den Fluss hinaufzugehen. Sie erreichten die Festungswerke an der Bocca Tigris, wo ihnen kaiserliche Dschunken mit Mandarinen und Dolmetschern entgegen kamen. Weddell gab seine friedfertigen Absichten kund und bat, gleich den Portugiesen zum Handelsverkehr zugelassen zu werden. Die Mandarinen versprachen auch, günstig an ihre Vorgesetzten in Kanton zu berichten und nach sechs Tagen das Gesuch zu beantworten; die englischen Schiffe gingen im Fluss unter der weißen Flagge vor Anker. Die Portugiesen hatten die Briten aber als Seeräuber verschwärzt, und als solche wurden diese nun behandelt. Zur Nachtzeit armierten die Chinesen ihre Werke an der Bocca und feuerten am Morgen mehrere Schüsse auf ein Boot der Engländer, das zum Wasserholen nach dem Ufer ruderte. Sie trafen nicht. Die Engländer aber hissten ohne Weiteres die Blutflagge, legten sich, die einströmende Flut benutzend, dicht unter die chinesischen Werke und brachten mit vollen Breitseiten das schlecht gezielte Feuer derselben in wenig Stunden zum Schweigen. Als ihre Boote mit etwa hundert Mann sich den Werken näherten, lief die Besatzung davon. Die Briten landeten ungehindert, hissten auf den Wällen ihre Flagge, schifften während der Nacht sämtliche Geschütze ein und demolierten die Schutzwehren. Weddell ließ nun mehrere Dschunken anhalten und sandte durch deren Boote ein Schreiben nach Kanton, worin er die Mandarinen des Treubruches zieh, seinen Angriff als Notwehr rechtfertigte und in höflicher Sprache um Handelsfreiheit bat. Schon am nächsten Tage kam ein chinesisches Boot unter weißer Flagge mit einem Mandarinen niederen Ranges, dessen Vorgesetzte sich auf kaiserlichen Dschunken hinter einer Landspitze befanden. Weddell gab nochmals seine friedfertigen Absichten kund und erhielt nun die Erlaubnis, Unterhändler nach Kanton zu schicken, wo man die ganze Schuld auf die Portugiesen schob und den Engländern gegen Herausgabe der Geschütze die gewünschten Ladungen lieferte.
Das war das erste Auftreten der Briten, bedeutsam für die Zukunft. Das Beispiel von Weddells Entschlossenheit scheint durch die ganze Geschichte der englischen Beziehungen zum Reiche der Mitte fortgewirkt zu haben.
Die politischen Umwälzungen in China und die Seeräuberflotten, welche damals die Küsten beunruhigten, mögen die Engländer von der Fortsetzung ihrer Unternehmungen in den nächsten Jahrzehnten abgeschreckt haben. 1664 kamen einige Schiffe der ostindischen Kompanie nach Macao; die Handelsagenten durften landen und in der Stadt wohnen; aber die Mandarinen verlangten übermäßige Hafengelder für jedes Schiff, das nach Kanton hinaufginge, und behandelten die Engländer mit wachsendem Argwohn. Diesen wurde die verschärfte Bewachung unerträglich; sie zogen sich nach vielen Vexationen auf ihre Schiffe zurück und segelten wieder nach Bantam. Die Ränke der Portugiesen bewirkten auch in diesem Falle das Scheitern der englischen Bemühungen. — In den folgenden Jahren richteten die Agenten der ostindischen Kompanie in Bantam ihr Augenmerk auf die mittelchinesischen Häfen; sie knüpften Handelsbeziehungen in A-moi und Nin-po an und traten 1670 in Verbindung mit dem in Taiwan herrschenden Coxinga, welcher die Engländer wahrscheinlich als Rivale der Holländer stark begünstigte. Mit ihm schlossen sie einen förmlichen Vertrag, »dass sie ihre Waren nach Gefallen an Jeden verkaufen oder vertauschen und ebenso kaufen dürften; dass der König ihnen gegen jede Beschädigung durch seine Untertanen Recht schaffen sollte; dass sie immer Zutritt zu seiner Person hätten; dass sie ihre Dolmetscher und Schreiber nach eigenem Ermessen wählen dürften; dass keine Soldaten oder andere chinesische Beamten ihnen zur Bewachung oder Begleitung aufgedrängt würden; dass alle vom König angekauften Waren zollfrei wären, alle andere Einfuhr aber eine Wertsteuer von drei Prozent zahlen sollte«. Die Bestimmungen dieses merkwürdigen Vertrages beweisen, dass die Schwierigkeiten des Verkehrs damals ganz ähnliche waren, wie in unseren Tagen. Ihre Geschütze und Munition mussten die englischen Schiffe während des Aufenthaltes im Hafen abgeben. — Mit der Zeit wurde dieser Handel unbequem; die Kompanie gab 1681 ihre Beziehungen zu Tae-wan und A-moi wieder auf und trachtete, sich in Fu-tšau und Kanton einzurichten.
Der englische Handel in Nin-po und A-moi scheint nur so lange geblüht zu haben, als diese Plätze vom Tartarenjoch frei blieben; die neue Dynastie war unsicher auf dem Throne und wohl deshalb dem Fremdenverkehr besonders abhold. Um 1685 versuchte die East-India-Company in A-moi wieder Fuß zu fassen und bemühte sich ernstlich, in regelmäßige Verbindung mit Kanton zu treten. Aber die eifersüchtigen Ränke der Portugiesen, welche alle Schiffe der Briten von Macao ausschlossen und die Mandarinen gegen sie aufhetzten, blieben ein unüberwindliches Hindernis.
Bei den Tartaren setzte sich der Argwohn fest, dass die Engländer unter dem Schein des Handels politische Zwecke verfolgten. — Als 1689 das englische Schiff Defence nach Kanton kam, forderte der Hop-po oder Steuer-Direktor 2484 Tael 12) Hafengelder, begnügte sich aber schließlich mit 1500 Tael. Einer von der Schiffsmannschaft tötete einen Chinesen, und in dem daraus entstandenen Straßen-Krawall wurden der Schiffsarzt und mehrere Matrosen erschlagen. Nun wollten die Mandarinen das Schiff nicht segeln lassen, wenn nicht eine Busse von 5000 Tael erlegt würde; der Kapitän bot 2000, führte aber, als diese nicht angenommen wurden, sein Schiff ohne Weiteres den Fluss hinab und gewann unangefochten die See. — Bald nach diesem Ereignis muss die englische Faktorei entstanden sein. In einem Schreiben des Direktoriums der Kompanie an ihren Handelsvorsteher in Kanton vom Jahre 1699 heißt es: »Wir haben den Auftrag von Seiner Majestät erhalten, Euch und Diejenigen, welche nach Euch zu unseren Handelsvorstehern in China ernannt werden, zum königlichen Bevollmächtigten (minister) oder Konsul für das englische Volk zu ernennen, und denselben alle mit diesem Posten verbundene Amtsgewalt zu verleihen.« 13)
Das ganze 18. Jahrhundert hindurch hatte der Handel mit großen Schwierigkeiten, vor Allem mit der Habgier der Beamten, zu kämpfen, welche sich an den Fremden zu bereichern suchten. Zwischen ehrenhaften Kaufleuten und gewissenlosen Abenteurern machte man wenig Unterschied; alle Fremden hafteten solidarisch für die Vergehen Einzelner. Die Maxime, nach welcher man sie behandelte, drücken folgende von Père Prémare aus einer chinesischen Schrift übersetzten Worte aus: »Die Barbaren sind gleich Bestien, und nicht nach denselben Grundsätzen zu regieren wie Chinesen. Wollte man versuchen, sie nach den hohen Gesetzen der Weisheit zu leiten, so würde das nur zur ärgsten Verwirrung führen. Die alten Könige haben das wohl gewusst und regierten deshalb die Barbaren durch Missregierung. Deshalb ist Missregierung bei weitem die beste Art, sie richtig zu leiten.« Nach diesen Grundsätzen entzog man ihnen selbst die Wohltaten der chinesischen Rechtspflege. »Die Fremden«, heißt es in den Aufzeichnungen der englischen Faktorei, »werden nicht nach Gesetzen, sondern nach der Willkür der Mandarinen regiert, und der Grund, dass nicht noch mehr Unzuträglichkeiten vorkommen, liegt nur darin, dass die Regierungsbeamten noch lieber durch Erpressung ihre Taschen füllen, als harte Maßregeln ergreifen.« — Oft mussten, wie gesagt, schuldlose Menschen für geringe Versehen, die schlimme Folgen gehabt hatten, der chinesischen Justiz ausgeliefert werden, nicht zum Verhör, sondern zu grausamer Hinrichtung. Solches Verfahren erbitterte natürlich auch den besseren Teil der Fremden; die gewissenloseren rechtfertigten damit ihre eigenen Gewalttaten, welche sie Vergeltung nannten, die aber unter geordneten Verhältnissen Mord, Seeraub und Brandstiftung geheißen hätten.
Schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts führten die Konflikte häufig zu Sperrungen des Handels; 1727 forderten die Engländer zuerst Befreiung von den unerträglichen Lasten. Außer dem sogenannten »Geschenk« von 1950 Tael, das jedes Schiff neben den ansehnlichen Hafengebühren erlegen musste, hatten die Chinesen den Handel mit einer Wertsteuer von 16 Prozent belastet und für die Verproviantierung der Schiffe schwere Abgaben gefordert. — Anfangs erteilten sie einem einzigen Kantonesen, den sie den »kaiserlichen Kaufmann« nannten, später mehreren »Hon-Kaufleuten« das Recht des Handels mit den Ausländern. Diese Monopol-Kaufleute wollten sich nun zu einem »Hon«, einer Kompanie-Firma, vereinigen, um die Fremden nach Willkür drücken zu können, wogegen letztere sich mit gutem Erfolg beim Vizekönig von Kuan-tun verwahrten. In den übrigen Punkten wurde auf die Drohung, den Handel nach A-moi oder einer anderen Küstenstadt zu verlegen, Abhilfe versprochen, aber nicht geleistet. 1728 belegte man sogar die Ausfuhr der ostindischen Kompanie mit einer neuen Steuer von 10 Prozent. Das Monopol der Gesellschaft erstreckte sich nämlich nur auf den direkten Handel mit England, nicht auf den Handel zwischen China und Ostindien, welcher ganz frei war. Die sogenannten »country-ships«, welche letzteren vermittelten, pflegten nun reiche Ladungen von Rohmaterial aus Indien und der Malakka-Straße nach Kanton zu bringen, während die europäischen Kompanie-Schiffe wenig importierten. Da nun aus der Einfuhr der »country-ships« bedeutende Abgaben in die kaiserlichen Kassen flossen, aus der der Kompanie-Schiffe aber fast gar keine, so fanden die Chinesen billig, deren Ausfuhr recht hoch zu besteuern.
In den nächsten Jahren scheint sich der Zustand kaum gebessert zu haben; 1734 sandte die Kompanie nur ein Schiff nach Kanton. Ein anderes, der Grafton, wurde versuchsweise nach A-moi geschickt; die dortigen Mandarinen waren aber noch raubsüchtiger als die in Kanton; chinesische Kaufleute, die nicht mit ihnen verbündet waren, durften gar nicht mit den Engländern verkehren, und der Grafton segelte schließlich nach Kanton zurück. — Ähnlich ging es 1736 dem Kompanie-Schiff Normanton in Nin-po; die Mandarinen verlangten das Unmögliche und der Normanton ging ebenfalls nach Kanton.
Kien-lon erließ den Fremden bald nach seiner Thronbesteigung den Ausfuhrzoll von 10 Prozent und das sogenannte »Geschenk«; an Hafengeldern sollten nur die unter der Bezeichnung »Measurage« begriffenen Abgaben fortbestehen. Als das betreffende Dekret in der öffentlichen Audienzhalle zu Kanton feierlich verlesen werden sollte, teilten die Hon-Kaufleute den Fremden vorher mit, dass sie sich dabei auf beide Kniee niederzuwerfen hätten. In einer allgemeinen Versammlung gab man sich jedoch das Wort, diese Zumutung abzuweisen und verharrte auch dabei. Unfehlbar hätte solche Demütigung viele andere nach sich gezogen und die Lage der Fremden noch verschlimmert. — In demselben Jahre, 1736, kamen im Ganzen zehn europäische Schiffe nach Kanton: vier englische, zwei holländische, zwei französische, ein dänisches und ein schwedisches. — Der Erlass des Kien-lon verbesserte nicht wesentlich die Lage; die Behörden fuhren bis zum Jahre 1829 fort, das »Geschenk« in seinem vollen Betrage zu erheben, und die Erpressungen steigerten sich trotz aller Vorstellungen. Die Hon-Kaufleute scheinen die Mandarinen und die Fremden, welche sich früher nicht so fern standen, gegeneinander aufgehetzt und das Aufhören jedes unmittelbaren Verkehrs zwischen denselben absichtlich herbeigeführt zu haben. Der Zweck war, beide Teile zu hintergehen und im Trüben zu fischen.
Gegen Ende des Jahres 1741 kam zuerst ein englisches Kriegsschiff nach China: der Centurion unter Kommodore Anson lief, auf einer Weltumsegelung begriffen, Macao an, nahm auf der Weiterreise das von Acapulco kommende spanische Silberschiff und brachte dasselbe, um Proviant verlegen, in den Perl-Fluss. Den Chinesen war die Wegnahme des fremden Schiffes sehr fatal. In Kanton wollten die Hon-Kaufleute dem Kommodore die verlangten Lebensmittel nicht liefern, wenn er nicht persönlich nach Macao übersiedele; denn, wenn er in der Faktorei bleibe, so seien sie Bürgen für ihn und würden schweren Ersatz, vielleicht gar ihr Leben verwirken, sollte es dem Kommodore einfallen, an der chinesischen Küste ein Schiff zu nehmen. Dieser antwortete schließlich, er habe nur noch Brot für fünf Tage an Bord und werde Kanton ohne Proviant nicht verlassen. Der Handelsvorsteher drängte die Hon-Kaufleute, auf die Mandarinen zu wirken, aber vergebens; »die Beamten, hieß es, hätten ihre besonderen Ansichten über Schiffe, die sich auf dem Meere herumtrieben, um andere fortzunehmen«. Zuletzt wurde Jenen aber die Gegenwart des englischen Schiffes so unheimlich, dass sie unter der Hand einem Kaufmann die Lieferung der Lebensmittel erlaubten. — Die Wegnahme ihres Silberschiffes veranlasste die spanische Regierung, Kriegsschiffe vor den Kantonfluss zu legen, wodurch dem Handel der Engländer in den folgenden Jahren viel Abbruch geschah. Ein Versuch, mit A-moi in Verkehr zu treten, scheiterte abermals an den maßlosen Forderungen der dortigen Beamten.
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts erneuten die Fremden in Kanton ihre Bemühungen, den Unbilden ein Ziel zu setzen. Hauptpunkte ihrer Beschwerde waren damals folgende: Die willkürlich verzögerte Ausladung der Schiffe; Diebstähle an den aufgestapelten Waren; Verunglimpfung der Fremden durch periodisch erneute öffentliche Anschläge, worin sie der schändlichsten Verbrechen geziehen und der Verachtung des Volkes preisgegeben wurden; Erpressungen der Unterbeamten unter falschen Vorwänden, und die Verweigerung des Zutritts zu den höheren Beamten. Wahrscheinlich hätten die Fremden durch feste Haltung und Einmütigkeit Abhilfe erlangt, denn die Chinesen zogen aus dem Handel zu großen Gewinn, um nicht jede mögliche Forderung zu gewähren. Das 1754 versuchte Mittel musste, konsequent angewendet, unfehlbar wirken; die ankommenden Schiffe blieben nämlich vor der Flussmündung, bis der Vizekönig versprochen hatte, jene Beschwerden in Erwägung zu ziehen. Aber man gab zu schnell nach und es blieb bei dem leeren Versprechen. — Gewiss war es schwierig, die kleine, aus den verschiedensten Elementen bestehende, durch keine Stammverwandtschaft, Gesetze oder Autorität verbundene Gemeinde in Kanton zu einmütigem Handeln zu vermögen. Die niedrige Gesinnung, Eifersucht und Schwäche Einzelner musste jedes energische Auftreten der Gemeinschaft hemmen. Die Portugiesen wussten geschickt zu intrigieren, und sobald auch nur ein einziges Supercargo sich unzeitig den Forderungen der Chinesen fügte, so gaben diese sicher nicht nach. Die Vorsteher der Faktoreien hatten wohl Autorität über ihre Unterbeamten und die ihnen zugewiesenen Schiffe, nicht aber über die anderen, welche keiner Handelsgesellschaft gehörten. Praktisch scheint auch die im Jahre 1699 den englischen Handelsvorstehern verliehene konsularische Amtsgewalt niemals ausgeübt worden zu sein; im Gegenteil geht aus besonderen Fällen deutlich hervor, dass die Vorsteher keine Autorität über die der ostindischen Kompanie nicht gehörenden »country-ships« hatten. Unter sich waren die Handelsvorsteher durch keine Art von Verfassung zu einer Gemeinschaft verbunden, und gewiss schon aus Nationalstolz auf Vorrang und Führung sehr eifersüchtig. So mussten die Zustände hoffnungslos bleiben. Die blutigen Händel der Schiffsmannschaften unter sich waren auch nicht geeignet, den Chinesen Achtung vor den Ausländern einzuflößen: bei Wam-poa mussten damals den Matrosen verschiedener Nationalitäten besondere Inseln zur Erholung angewiesen werden, um den mörderischen Schlägereien ein Ende zu machen.
Da 1754 nichts erreicht worden war, so trachteten die Engländer ernstlich, ihren Handel nach Nin-po zu verlegen, wohin im folgenden Jahre die Faktorei-Beamten Harrison und Flint abgingen. Sie wurden gut aufgenommen; die verlangten Abgaben schienen geringer als in Kanton. Der Fu-yuen oder stellvertretende Gouverneur zeigte sich den Fremden geneigt und versprach die Erfüllung fast aller ausgesprochenen Wünsche. Wahrscheinlich überschritt er damit seine Befugnis; denn als 1756 die Holdernesse in Folge jener Zusagen nach Nin-po kam, befahl der Vizekönig der Provinz, dass alle Feuerwaffen und Munition aus dem Schiffe genommen und dieselben Zölle bezahlt werden sollten, wie in Kanton. Der Fu-yuen konnte sich diesem Befehle nicht offen widersetzen, vollzog ihn aber ebenso wenig, sondern sandte ihn zur Entscheidung nach Peking. Unterdessen erklärten die Mandarinen sich zu Handelsgeschäften bereit, wenn ihnen die Hälfte der Kanonen ausgeliefert würde: sie erhielten für sich 2000 Tael und wussten es so zu wenden, dass zuletzt die Abgaben ungefähr das Doppelte der in Kanton üblichen betrugen. Kein Engländer durfte am Lande wohnen, und bei der Abreise wurden sie, offenbar auf höhere Eingebung, bedeutet, dass für die Zukunft in Nin-po kein Handel erlaubt sei, »weil der Kaiser die bedeutenden Einkünfte aus den Zwischenzöllen für die zu Lande nach Kanton gehenden chinesischen Waren nicht einbüßen wolle«. Auch den Fremden in Kanton wurde amtlich mitgeteilt, dass ihr Handel auf diesen Platz beschränkt bleiben müsse.
Trotzdem gaben die Engländer ihr Vorhaben nicht auf. Die chinesische Regierung hatte durch Zerstörung der alten Faktorei in Nin-po, durch Verbannung aller Kaufleute, welche 1756 mit den Engländern handelten, und durch Aufstellung von Kriegsdschunken, die jedem fremden Schiffe den Weg verlegen sollten, den Ernst ihres Willens bewiesen. Dessen ungeachtet begab sich Flint 1759 abermals nach Nin-po, wurde aber ausgewiesen. Des Chinesischen vollkommen mächtig, wusste er nun auf eigene Hand nach Peking zu gelangen, dort die Gunst angesehener Männer zu gewinnen und seine Klagen vor den Kaiser zu bringen. In Begleitung eines kaiserlichen Bevollmächtigten kam er nach Kanton zurück 14); die Fremden aller Nationalitäten wurden vor die Mandarinen beschieden und benachrichtigt, dass der Hop-po, — gegen den sich besonders ihre Klagen richteten, — degradiert und ein anderer an seiner Stelle ernannt sei; dass ihnen außer der Steuer von 6 Prozent auf alle Waren und dem »Geschenk« von 1950 Tael sämtliche Abgaben vom Kaiser erlassen seien. — Dabei blieb es aber nicht. Der Vizekönig erwartete wohl nur die Abreise des kaiserlichen Spezial-Kommissars, um die Fremden ihre unverzeihliche Frechheit büßen zu lassen. Er ließ zunächst Flint zu sich rufen, gewährte jedoch das Gesuch der Handelsvorsteher, denselben begleiten zu dürfen. Am Tore des Palastes verlangten die Hon-Kaufleute, dass die Fremden einzeln hineingingen; diese bestanden aber darauf, sich nicht zu trennen. Im inneren Hofe der Audienzhalle wurden sie nun von den Offizianten ergriffen und vor den Vizekönig gezerrt; es entstand eine Balgerei, in welcher die an Zahl stärkeren Chinesen die Fremden zu Boden warfen: diese sollten nach Landessitte vor dem Vizekönig knieen. Als sie sich aber faustgerecht wehrten und jede Erniedrigung gewaltsam zurückwiesen, befahl der Vizekönig, von ihnen abzulassen. Er teilte ihnen einen Erlass mit, durch welchen Flint für seinen Versuch, gegen den Befehl der Behörden in Nin-po einzudringen, des Landes verwiesen und ein Kantonese, der vorgeblich die Fremden durch Abfassung einer Bittschrift an den Kaiser verräterisch unterstützt haben sollte, zum Tode verurteilt war. Bei Degradierung des Hop-po, welcher Anlass zu Beschwerden gegeben habe, sollte es bleiben. — Die Hinrichtung eines den Fremden ganz unbekannten Chinesen wurde alsbald in ihrer Gegenwart vollzogen. Flint hielten die Mandarinen fest und setzten ihn in einem Hause bei Macao gefangen, wo man ihn glimpflich behandelte, aber von jedem Verkehr abschnitt. Ein von den Franzosen, Dänen, Schweden und Niederländern in der englischen Faktorei unterschriebener Protest gegen seine Verhaftung blieb unbeachtet. Flint wurde vom März 1760 bis zum November 1762 festgehalten, dann in Wam-poa an Bord eines eben absegelnden englischen Schiffes gebracht.
Die Provinzial-Behörden verzeihen es niemals, wenn Fremde sich mit Beschwerden an den kaiserlichen Hof wenden. Selbst jetzt, da die Verträge geschlossen sind und Vertreter der westlichen Mächte in unmittelbarem Verkehr mit den höchsten Beamten der Zentralgewalt stehen, umgehen die Mandarinen in den geöffneten Häfen oft deren Befehle.
Die erzählten Vorfälle steigerten in Kanton das gegenseitige Übelwollen; in den darauf folgenden Jahrzehnten waren die Zusammenstöße zwischen Ausländern und Chinesen häufiger und blutiger als jemals. Nur die Portugiesen ließen sich nach den englischen Berichten alles gefallen und opferten dem Vorteil Ehre und Bewusstsein. Aus dem Jahre 1773 wird folgendes Ereignis berichtet. Ein Chinese war in Macao erschlagen worden; der Verdacht des Mordes fiel auf einen Engländer Scott, der von den Kolonialbehörden verhaftet wurde. Der portugiesische Gerichtshof fand trotz allen Zeugenverhören nicht den schwächsten Beweis für die Schuld des Angeklagten; trotzdem forderten die Mandarinen peremtorisch dessen Auslieferung und drohten mit Sperrung des Handels. Die Portugiesen waren überzeugt von der Unschuld des Scott; ein Mitglied des Senates sprach offen aus, dass dessen Auslieferung ehrlos wäre; trotzdem beschloss die Majorität sich zu fügen, und lieferte wirklich den Schuldlosen zur Schlachtbank.