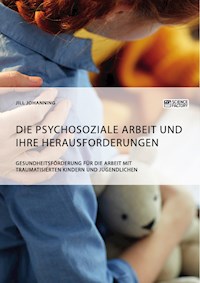
Die psychosoziale Arbeit und ihre Herausforderungen. Gesundheitsförderung für die Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen E-Book
Jill Johanning
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Helfende Berufe erfahren eine hohe soziale Anerkennung und werden von den Beschäftigten nicht selten als Berufung empfunden. In der psychosozialen Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen fällt es jedoch oft schwer, den nötigen emotionalen Abstand zu den Geschichten der Betroffenen einzuhalten. Dies kann zu einer Mehrfachbelastung der Mitarbeiter führen. Jill Johanning zeigt auf, welche Probleme entstehen können, wenn die Arbeit in helfenden Berufen und das Privatleben nicht angemessen voneinander getrennt werden. Mögliche Folgen sind Burnout, Depressionen oder eine sekundäre Traumatisierung. Um dem entgegenzuwirken, verweist die Autorin auf präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen, die beispielsweise von Institutionen frühzeitig implementiert werden können. Statt die Problematik weiter zu tabuisieren, werden helfende Personen nicht länger als Wohltäter, sondern als Individuen mit eigenen Bedürfnissen und Grenzen gesehen. Aus dem Inhalt: - Trauma; - Stress; - Burnout; - Helfersyndrom; - Prävention
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 62
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1 Arbeitsbelastung und Traumata – eine Einleitung
2 Der Begriff „Stress“ und das transaktionale Stressmodell von Lazarus
3 Folgen von psycho-emotionalem Stress
3.1 Chronische Stresszustände aufgrund von anhaltender Dauerbelastung
3.2 Burnout-Syndrom
3.3 Depressionen
4 Psychische Belastung am Arbeitsplatz
5 Arbeitsbelastung in psychosozialen Berufsgruppen
6 Traumata
6.1 Der Begriff „Trauma“
6.2 Die posttraumatische Belastungsstörung
6.3 Klassifikation der Traumata
6.4 Sekundäre Traumatisierung
7 Theoretische Anwendung des Lazarus-Modells
7.1 Konfrontation mit den Geschichten der traumatisierten Kinder und Jugendlichen
7.2 Trennung von Arbeit und Privatleben
8 Präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen
8.1 Selbstsorge der sozial-psychologisch Arbeitenden
8.2 Fürsorge durch die Institutionen
9 Fazit
Literaturverzeichnis
1 Arbeitsbelastung und Traumata – eine Einleitung
„Burnout ist nach Angaben der Techniker Krankenkasse (TKK) für das Fehlen von 40 000 Arbeitskräften pro Jahr in Deutschland verantwortlich“ (Steinlin/ Dölitzsch/ Fischer/ Lütdke/ Fegert/ Schmid 2015, S. 8)
„In der Detailanalyse zeigt sich, dass insbesondere Berufe betroffen sind, in denen alltäglich eine helfende Haltung gegenüber anderen Menschen gefordert wird.“ (Jegodtka/ Luitjens 2016, S. 195)
2 Der Begriff „Stress“ und das transaktionale Stressmodell von Lazarus
Als Stress wird ein „Zustand des Ungleichgewichts“ (Franzkowiak/ Franke 2018) bezeichnet. Mit den Begriffen Stress und Stressbewältigung werden die Reaktionen auf Herausforderungen in einer als wichtig eingeschätzten Situation beschrieben. Diese Herausforderungen fordern Menschen zu einer Reaktion heraus, können die vorhandenen Mittel und Fähigkeiten des Menschen aber auch überschreiten. Als Stressoren werden Reizereignisse definiert, die „vom Organismus eine Anpassungsreaktion verlangen“ (Franzkowiak/ Franke 2018). Stress entsteht, weil der Mensch nicht nur das, was mit ihm und in seiner Umgebung geschieht wahrnimmt, sondern dies auch bewertet (vgl. Müller-Timmermann 2010, S. 96). Der beschriebene Stress kann sowohl negative als auch positive Auswirkungen haben. Positiver Stress wird als Eu-Stress bezeichnet, negativer Stress als Dis-Stress (vgl. (Franzkowiak/ Franke 2018). Eu-Stress entsteht, wenn die Tätigkeit oder der Zustand, die auf den Menschen einwirken, nicht als Belastung empfunden wird. Dis-Stress hingegen wird als unangenehm empfunden und führt zu negativen körperlichen, geistigen und seelischen Folgen (vgl. Habermann-Horstmeier 2017, S. 14). Dies kann sich auch in Form von Gefühlen wie Angst und Hilflosigkeit zeigen. Der negative Stress ist häufig mit der Erfahrung eines drohenden oder realen Verlustes der Handlungskontrolle verbunden und führt zu Handlungsverhinderung und Ausweichverhalten (vgl. Franzkowiak/ Franke 2018).
Seit den siebziger Jahren ist die Anzahl an Publikationen zum Thema Stress deutlich angestiegen und es wurden zahlreiche wissenschaftliche Texte und Ratgeber veröffentlicht. Verschiedene Fachdisziplinen wie Medizin, Soziologie, Pädagogik und Psychologie beschäftigen sich mit dem Thema Stress. Es existieren verschiedene Begriffserklärungen und Konzepte, da es im Leben viele Bedingungen und Situationen gibt, die zum einen Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und des Lernens darstellen, zum anderen aber auch zu der Beeinträchtigung des Befindens und zu Krankheit durch negativen Stress führen können (vgl. Bamberg/ Busch/ Ducki 2003, S. 37). Es gibt verschiedene Modelle zur Stressentstehung, von denen eines das Stressmodell von Richard Lazarus ist. Im Vordergrund des Modells steht die subjektive Bewertung einer Situation. Neben dem Modell von Lazarus existieren auch andere Ansätze zur Erklärung von Stress und dessen Entstehung. Dazu gehören das Modell der Ressourcenkonservierung von Hobfoll, das Person-Environment-Fit Model von Caplan und van Harrison (vgl. Barthold/ Schütz 2010, S. 27) und das biologische Stresskonzept von Selye. Dieser bezeichnet mit dem Begriff Stress allgemein die Auswirkungen von Belastungen auf lebende Körper. Selyes Forschungsarbeiten zeigen, dass verschiedene körperliche und seelische Belastungen zu körperlichen Veränderungen führen. Diese können, wenn sie über eine längere Zeit andauern, eine ernsthafte Bedrohung für den Körper darstellen (vgl. Kaluza 2007, S. 4). Des Weiteren lässt sich als Stressbegriff der von Greif und Kollegen nennen, welche Stressoren als „negativ zu verstehenden externe oder innerpsychische Reize [beschreiben], die assoziiert sind mit unerwünschten Reaktionen“ (Muschalla/ Linden 2013, S. 32). In diesem Kapitel der Arbeit wird allerdings das transaktionale Stressmodell von Lazarus genauer betrachtet, da dieses in der Stressforschung großen Einfluss erlangt hat und von den meisten Autoren anerkannt wird (vgl. Bartholdt/ Schütz 2010, S. 27).
Die zentrale Annahme des transaktionalen Stressmodells liegt darin, dass ein Mensch Belastungen nicht passiv ausgesetzt ist, sondern dass „zwischen der Person und ihrer Umwelt eine prozeßhafte, dynamische und wechselseitige Beziehung besteht“ (Bossong 1999, S. 5). Stress tritt auf, wenn Aspekte von einem Menschen wahrgenommen werden, die dessen Kräfte deutlich beanspruchen oder überfordern und das Wohlgefühl bedrohen können (vgl. Bossong 1999, S. 5). Das bedeutet, dass Stress an sich nicht existiert, sondern nur das ist, was von einem Menschen als Stress bewertet wird. Diese psychologische Stressperspektive betont demnach die Bedeutung der kognitiven Einschätzung einer belastenden Situation (vgl. Franzkowiak/ Franke 2018). Verschiedene Menschen reagieren in derselben Situation auf unterschiedliche Weise. Kaluza nennt als Alltagssituationen auf die unterschiedlich reagiert werden als Beispiel eine Prüfung, einen Streit oder einen verlegten Hausschlüssel (vgl. Kaluza 2005, S. 33).
In Stresssituationen werden im Körper des Menschen Hormone freigesetzt, unter anderem Cortisol und Adrenalin, die zu verschiedenen Reaktionen wie der Freisetzung von Zucker im Blut, der Anspannung der Muskeln und dem Anstieg der Konzentration führen (vgl. Kleinschmidt 2015, S. 12). Oppolzer benennt verschiedene Reaktionen, zu denen sowohl der Anstieg des Pulses, der Atemfrequenz, des Blutdrucks und der Zucker- und Fettkonzentration im Blut als auch die Weitung der Pupillen zählen. Ebenfalls kann die Aktivität des Verdauungstraktes eine Veränderung aufweisen (vgl. Oppolzer 2010, S. 16). Nach dem Modell von Lazarus hängt die Beurteilung eines Stressors primär von der individuellen Bewertung ab. Einen entscheidenden Einfluss darauf, ob und mit welcher Intensität und Qualität neuroendokrine Stressreaktionen ausgelöst werden, hat die kognitive und emotionale Stellungnahme zu einer bestimmten Anforderung (vgl. Kaluza 2005, S. 33).





























