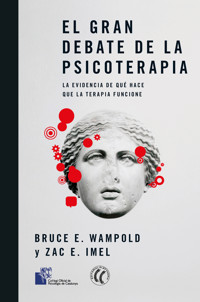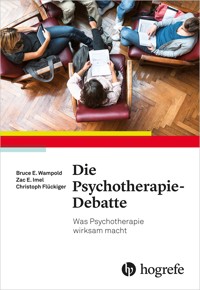
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die zweite Auflage des Titels "The Great Psychotherapy Debate" von Bruce E. Wampold und Zac E. Imel liegt nun in der deutschsprachigen Adaption von Christoph Flückiger vor. Das Buch gibt einen umfassenden Überblick über die psychologische Therapieforschung, ihre Geschichte und über die verschiedenen Ansätze, die zur Untersuchung der Wirksamkeit verwendet werden. Zentrale therapeutische Methoden und Interventionen werden verständlich dargestellt und anhand aktueller Forschungsliteratur kritisch hinterfragt. Die Autoren vergleichen die herkömmlichen Untersuchungsansätze, die nur die Betrachtung spezifischer Wirkfaktoren berücksichtigen, mit dem eigens von ihnen entwickelten Kontextmodell, das von methodenübergreifenden Einflüssen ausgeht. Dafür stellen sie beide Modelle dar, leiten Hypothesen zur Therapiewirksamkeit ab und überprüfen anschließend ihre Annahmen anhand der aktuellen empirischen Literatur. Nach diesem Vergleich kommen sie zu dem Fazit, dass übergreifende Faktoren, wie etwa die Therapeuteneigenschaften, für die Wirksamkeit der Psychotherapie eine wichtige Rolle spielen. Damit versöhnen sie nicht nur unterschiedliche Ansätze, sondern sie ermutigen auch Kliniker dazu, pragmatisch-integrativ und methodenübergreifend zu arbeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 835
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Bruce E. Wampold
Zac E. Imel
Christoph Flückiger
Die Psychotherapie-Debatte
Was Psychotherapie wirksam macht
Aus dem Amerikanischen von Michael Ackert und Christoph Flückiger, unter Mitarbeit von Judith Held, Christine Wolfer und Jan Westenfelder
Deutschsprachige Ausgabe herausgegeben von Christoph Flückiger
Die Psychotherapie-Debatte
Bruce E. Wampold, Zac E. Imel, Christoph Flückiger
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Psychologie:
Prof. Dr. Guy Bodenmann, Zürich; Prof. Dr. Lutz Jäncke, Zürich; Prof. Dr. Franz Petermann, Bremen; Prof. Dr. Astrid Schütz, Bamberg; Prof. Dr. Markus Wirtz, Freiburg i. Br.
Prof. Dr. Bruce E. Wampold, PhD, ABPP
University of Wisconsin-Madison
School of Education
Department of Counseling Psychology
317 Education Building
1000 Bascom Mall
Madison, WI 53706-1326, USA
Prof. Dr. Zac E. Imel, PhD
University of Utah
Department of Educational Psychology
1705 Campus Center Drive
RM 327
Salt Lake City, UT 84112-9255, USA
Prof. Dr. Christoph Flückiger, PhD, SwissBPP
Universität Zürich
Psychologisches Institut
Leiter Fachr. Allgemeine Interventionspsychologie und Psychotherapie
Binzmühlestr. 14/04
8050 Zürich, Schweiz
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Psychologie
Länggass-Strasse 76
3000 Bern 9
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
Fax +41 31 300 45 93
http://www.hogrefe.ch
Lektorat: Dr. Susanne Lauri, Jan Westenfelder
Herstellung: Edith Biedermann, Daniel Berger
Umschlagabbildung: © frankreporter by istockphoto
Umschlaggestaltung: Claude Borer, Riehen
Satz: Mediengestaltung Meike Cichos, Göttingen
Format: EPUB
Das vorliegende Buch ist eine Übersetzung aus dem Amerikanischen. Der Originaltitel lautet „The Great Psychotherapy Debate“ von Bruce E. Wampold und Zac E. Imel.
Second edition published 2015
© 2015 Bruce E. Wampold and Zac E. Imel
All rights reserved. Authorized translation from English language edition published by Routledge, an imprint of Taylor & Francis Group LLC.
1. Auflage 2018
© 2018 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-456-95681-7; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-456-75681-3)
ISBN 978-3-456-85681-0
https://doi.org/10.1024/85681-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Geleitworte
Psychotherapie, Wissenschaftsmodelle und Argumentationslust
Prof. Dr. Christoph Flückiger, Universität Zürich
Auf dem Wege zu einem psychotherapeutischen Kernwissen
Prof. Dr. Bernhard Strauß, Universität Jena
Psychotherapie: Alles Placebo, alles Dodo, alles fliegt?
Prof. Dr. Winfried Rief, Universität Marburg
Neue Wege in der Psychotherapieforschung
Prof. Dr. Wolfgang Lutz, Universität Trier
Kapitel 1 Die Geschichte der Medizin, der Methoden und der Psychotherapie
Konzeptuelle und empirische Fortschritte in der Psychotherapie
Medizin
Die Ursprünge der Medizin als Heilpraxis
Materialismus, Spezifität und Placebo als kritische Konzepte der modernen Medizin: Die Beiträge von René Descartes, Benjamin Franklin und Louis Pasteur
Das Medizinische Metamodell
Randomisierte Designs als der „Goldstandard“
Die Entwicklung der Randomisierung und der Vergleichsdesigns
Einführung von Placebokontrollbedingungen zur Eliminierung von Störvariablen
Die Entstehung der Psychotherapie als Heilpraxis
Die Ursprünge der Psychotherapie
Theoretische Ausrichtungen
Forschungsmethoden, Wirksamkeit der Psychotherapie und die Entwicklung störungsspezifischer Behandlungen
Forschungsmethoden zur Entwicklung spezifischer Wirksamkeit
Evidenzbasierte Behandlungsverfahren
Evidenzbasierte Praxis in der Psychologie
Fortschritte und Rückschritte
Spirituelle und humanistische Aspekte
Kultur und Kontext
Gemeinsame Faktoren und der Prozess der Psychotherapie
Die Rollen des Therapeuten als Katalysator des Wandels und der Patient als aktiver Teilnehmer
Zusammenfassung
Kapitel 2 Das Kontextuelle Metamodell
Psychotherapie als sozial eingebettete Heilpraxis
Definitionen und Terminologie
Definition der Psychotherapie
Terminologie
Abstraktionsebenen
Alternativen zu spezifischen Theorien der Psychotherapie
Theoretische Integration
Technischer Eklektizismus
Gemeinsame Faktoren
Das Kontextuelle Metamodell
Ein beziehungsbasiertes Modell der Psychotherapie – das Kontextuelle Metamodell
Zusammenfassung
Kapitel 3 Kontextuelles Metamodell versus Medizinisches Metamodell
Progressive Forschungsentwicklung
Wissenschaftsphilosophie: Lakatos und Forschungsprogramme
Zulässigkeit von Evidenz: Was gilt als empirischer Beweis?
Effektstärken in Metaanalysen
Erweiterungen und Kernpunkte von Metaanalysen
Hypothesenbildung im Medizinischen Metamodell und Kontextuellen Metamodell
Medizinisches Metamodell
Kontextuelles Metamodell
Zusammenfassung
Kapitel 4 Absolute Wirksamkeit
Der durch Metaanalysen bestätigte Nutzen der Psychotherapie
Heuristische Übersichtsarbeiten klinischer Studien: unkontrolliertes Chaos?
Eysenck (1952): der erste Anlauf, die Literatur zur Wirksamkeit zusammenzufassen
Eysenck legt nach
Interventionspakete in Metaanalysen: Ordnung entspringt dem Chaos
Smith und Glass (1977) und Smith et al. (1980)
Kritikpunkte an den frühen Metaanalysen
Die Ergebnisse von Smith et al. auf dem Prüfstand
Derzeitiger Stand der absoluten Wirksamkeit: die Zunahme von klinischen Studien und Metaanalysen
Weitere Evidenz für die Absolute Wirksamkeit
Klassifizierung wirksamer Psychotherapien
Die Wirksamkeit von Psychotherapie im klinischen Umfeld
Schädliche Behandlungen?
Definition der Schädigung
Evidenz für schädliche Auswirkungen
Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse für schädliche Behandlungen
Fazit
Kapitel 5 Relative Wirksamkeit
Schulenstreit und aktueller Stand des Dodo-Bird-Verdikts
Medizinische und Kontextuelle Modellvorhersagen
Forschungsmethoden zur Feststellung der relativen Wirksamkeit
Forschungsstrategien zur Feststellung der relativen Wirksamkeit in Primärstudien
Metaanalytische Methoden zur Überprüfung der relativen Wirksamkeit
Allegiance oder Allegiance-Effekt
Evidenz für den Allegiance-Effekt
Der Nachweis der relativen Wirksamkeit
Die prämetaanalytische Periode: ein Blick auf das Chaos
Systematische Metaanalysen: Die Suche nach Objektivierbarkeit
Metaanalysen in spezifischen Bereichen
Kritik an der metaanalytisch einheitlichen Wirksamkeit
Fazit
Kapitel 6 Therapeuteneffekte
Ein entscheidender und vernachlässigter Faktor
Designfragen
Geschachteltes Design
Gekreuztes Design
Relative Vorteile des geschachtelten und des gekreuzten Designs
Die Größe des Therapeuteneffekts
Die Einschätzung des Therapeuteneffekts
Fazit
Kapitel 7 Allgemeine Effekte
Die Gemeinsamkeiten stimmen optimistisch
Allianz oder Arbeitsbündnis
Zusammenhang zwischen der Allianz und dem Therapieerfolg
Methodische Probleme
Behandlungsspezifität und Allianz: Allianz als spezifische Komponente, Klärung des Bündnisses in der Allianz und der direkten/indirekten Effekte
Beiträge des Patienten und des Therapeuten zu der Allianz
Frühe Symptomveränderung und Allianz
Zunahme der Allianz im Laufe der Therapie
Fazit zur Bedeutung der Allianz
Erwartungen, Placeboeffekte und kausale Attribution
Placeboeffekte
Erwartungsforschung in der Psychotherapie
Andere gemeinsame Faktoren
Zusammenfassung der Evidenz für allgemeine Effekte
Kapitel 8 Spezifische Effekte
Wie robust können spezifische Effekte vorausgesagt werden?
Komponentenstudien
Die Designs: Das Tor zum Erkenntnisgewinn
Evidenz aus Komponentenstudien
Die Logik der Kontrolle allgemeiner Faktoren in Placebobedingungen
Metaanalysen der Pseudoplacebos
Wechselwirkungen zwischen Patientenvariablen und der Behandlung
Evidenz aus der Interaktion der Behandlung mit psychologischem Defizit
Evidenz für andere Interaktionen der Behandlung mit Patientencharakteristika
Adhärenz und Kompetenz
Theoretische Überlegungen
Evidenz für die Adhärenz und Kompetenz
Fazit – Adhärenz und Kompetenz
Mediatoren und Veränderungsmechanismen
Design
Evidenz für Mediatoren und Veränderungsmechanismen
Evidenz für die (relative) Mediation in Studien mit zwei Vergleichsbehandlungen
Schlussfolgerungen: Mediation und Veränderungsmechanismen
Zusammenfassung der Evidenz für spezifische Effekte
Kapitel 9 Konsequenzen der wissenschaftlichen Debatten
Schlussfolgerungen für Theorie, Politik und Praxis
Implikationen für die Theorie
Das Kontextuelle Metamodell als ein progressives Forschungsprogramm
Das Medizinische Metamodell kann die empirische Evidenz nicht erklären
Die Bedeutung der Behandlungen
Politik
Forschungsschwerpunkte
Qualitätsverbesserung
Praxis
Perspektive des Therapeuten
Patientenperspektive
Training und Supervision
Abschließende Bemerkungen
Literaturverzeichnis
Sachwortverzeichnis
Die Autoren
|7|Geleitworte
Psychotherapie, Wissenschaftsmodelle und Argumentationslust
Prof. Dr. Christoph Flückiger, Universität Zürich
Psychotherapieforschung ist ein Paradebeispiel interdisziplinärer Forschung. Sie bietet eine hervorragende Illustration dessen, wie die Forschungsparadigmen der einzelnen Disziplinen die Interpretation der Forschungsresultate mit beeinflussen. In den USA wird Psychotherapieforschung vorzugsweise in drei akademische Schulen betrieben, die sich unter anderem an ihren basalen Forschungsparadigmen orientieren: den Schools of Medicine, den Departments of Psychology und den Schools of Education. Während im deutschen Sprachraum die beiden ersten Schulen in der Psychotherapieforschung und den daran angegliederten psychotherapeutischen Aus- und Weiterbildungen vertreten sind, wird hierzulande Psychotherapieforschung kaum als primärer Gegenstand der Erziehungswissenschaften wahrgenommen.
Dies ist insofern relevant, als sich die Autoren der englischen Ausgabe dieses Buches vorzugsweise als Vertreter der dritten Schule verorten lassen bzw. sich dort ihre akademischen Sporen verdient haben. Die University of Wisconsin-Madison ist in den Universitäts-Rankings eine der US-Top-Universitäten der Erziehungswissenschaften und will sich durchaus als empirische Speerspitze dieser Tradition verstanden wissen. Die Schools of Education haben substantiell zur Entwicklung und Verbreitung empirischer Arbeitsinstrumente in geschachtelten, hierarchisch gegliederten Versuchsdesigns beigetragen. Das Denken in Mehrebenenmodellen und die damit verbundene kritisch-rationale Interpretation von Forschungsresultaten ist fundamentaler Teil, wenn nicht gar Identifikationsmerkmal, der an diesen Schulen angegliederten akademischen Ausbildungen. Empirische Forschungsresultate lassen sich aus dieser Perspektive, etwas überspitzt ausgedrückt, grundsätzlich nur aufgrund der geschichtlich eingebetteten Wissenschaftsdiskurse und dahinter liegenden Forschungsparadigmen interpretieren. Was zählt, ist das Aufdecken der Argumentationslogiken und der dahinter liegenden Grundannahmen, die kaum noch hinterfragt werden. Das vorliegende Buch ist eine rigorose Anwendung dieses Spirits, insbesondere bezüglich des in der Psychotherapieforschung aktuell vorherrschenden „Medizinischen“ Metamodells.
Die Ausgangslage ist so einfach wie einleuchtend: Stellen Sie sich vor, ein charismatischer Lehrer würde eine Studie vorstellen, in der er seine eigens entwickelte Methode „A“ an acht Schülern anwendet und mit acht anderen Schülern kontrastiert, die er mit der Standardmethode „B“ unterrichtet. Die Randomisierung sowie die gesamte Studienverantwortung liegen beim selben Lehrer. Das Schulergebnis misst er mit Mitteln, die insbesondere auf seine Methode „A“ zugeschnitten sind. Zudem werden die Fortschritte der Schüler durch einen Mitentwickler der Methode „A“ beurteilt. Die Resultate eines wenig geläufigen statistischen Tests weisen darauf hin, dass die zugeschnittenen Messmittel einen Effekt in Richtung der Methode „A“ auf|8|weisen, die sich jedoch beim allgemeinen Lernfortschritt der Standardmethode „B“ nicht zeigen; weitere Maße zeigen keine Effektivitätsunterschiede zwischen „A“ und „B“. In den Limitationen wird darauf hingewiesen, dass möglicherweise weniger erfahrene Lehrer in der von den Autoren entwickelten Methode „A“ weniger erfolgreich sein würden. Der Lehrer interpretiert die Ergebnisse in die Richtung, dass seine Methode „A“ bei gut geschulten Lehrern der Standardmethode „B“ überlegen ist. Als Eltern eines Schülers würden Sie sich vielleicht einige Fragen stellen, wenn Sie aufgefordert würden, Ihr Kind unbedingt zu diesem Lehrer zu schicken. Beispielsweise: Lässt sich die Studie replizieren? Sind die Resultate auf andere Lehrer generalisierbar? Wer bestimmt den Schulerfolg? Zeigen sich die Resultate in geläufigeren statistischen Methoden? Will der Lehrer vorzugsweise seine Methode „A“ verkaufen? Ist mein Kind bei diesem Lehrer gut aufgehoben?
Vielleicht wären Sie bei der Beurteilung einer strukturell vergleichbaren Studie nachsichtiger, die nicht auf dem Gebiet der Grundschulpädagogik, sondern von einem der renommiertesten Herzchirurgen veröffentlicht wurde – in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift mit hohem Impact Factor? Vielleicht würden Sie Ihre Meinung nicht ändern wollen. Doch Hand aufs Herz, hätten Sie die Studie eines Herzchirurgen ebenso kritisch hinterfragt, wenn sie ohne den Vergleich mit der Lehrkraft eingeführt worden wäre? Und was wäre, wenn die Studie von einem anerkannten Psychotherapeuten veröffentlicht worden wäre?1
Auch wenn es sich bei der oben angesprochenen Studie ganz bestimmt um einen Einzelfall handelt, so lassen sich daraus für die Psychotherapie interessante, allgemeine Fragen ableiten: Wie wirksam ist Psychotherapie ganz generell? Lassen sich psychotherapeutische Ansätze ausmachen, die wirksamer sind als andere? Wie lassen sich Studien charakterisieren, die wirksamere Psychotherapien dokumentieren? Ist die höhere Wirksamkeit ein Effekt einer spezifischen Therapie oder eher Resultat der Wahl der Kontrollgruppe? Haben Forscher- und Therapeuteninteressen Einfluss auf die Forschungsresultate? Sind einzelne Ansätze uniform wirksam, oder unterscheiden sich die Therapeuten in ihrer Wirksamkeit? Haben soziokulturelle Aspekte einen Einfluss auf die Wirksamkeit von Psychotherapie? Und zu guter Letzt: Was macht psychotherapeutische Interventionen wirksam?
Dieses Buch versucht die oben gestellten Fragen mittels theoriegeleiteter, metaanalytischer Methoden zu beantworten. Metaanalysen fassen die Forschungsresultate einzelner Wirksamkeitsstudien systematisch zusammen. Die Autoren machen transparent, welche Einschluss- und Ausschlusskriterien für einen fairen Psychotherapiewirksamkeitsvergleich relevant sein können und verdeutlichen so, warum verschiedene Metaanalysen zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen können. Aus dieser Perspektive bietet das Buch eine Einführung in metaanalytisches Interventionsdenken, das nicht nur für die Psychotherapie selbst, sondern auch für andere Humaninterventionen relevant sein kann. Aus gutem Grund hat die Methode der Metaanalyse ihre Geburtsstunde und ihre Bewährung auf dem Gebiet der Psycho|9|therapie erfahren, sodass daraus reichlich gelernt werden kann. Vorneweg: Psychotherapie ist ganz generell bei vielen Menschen, die unter üblichen psychischen Belastungsfaktoren leiden, erstaunlich wirksam.
Die vorliegende deutschsprachige Adaption der englischsprachigen Zweitausgabe der Great Psychotherapy Debate versucht einen soziokulturellen Spagat, der grundsätzlich nur scheitern kann. Die meisterhaft verfassten englischsprachigen Originaltexte beziehen sich vorzugsweise auf den US-Kontext; so beziehen sich viele exemplarische Beispiele und Veranschaulichungen auf die englischsprachige Hauptleserschaft. Diese Perspektive ist auch aus internationaler Sicht insofern berechtigt, als beispielsweise mehr als zwei Drittel der veröffentlichten Studien zum Zusammenhang zwischen der Arbeitsallianz und dem Therapieergebnis in Nordamerika durchgeführt worden sind. Aus diesem Blickwinkel ist es durchaus sinnvoll, den US-Kontext zu erwähnen und zu verstehen. Möglicherweise wären Sie jedoch trotzdem erstaunt, wenn in einer deutschen Eins-zu-eins-Übersetzung von „Rassenvergleichen“ die Rede wäre. Der Lesefluss würde wohl deutlich gehemmt.
Den Spagat versuchten wir so zu lösen, dass wir einerseits den US-Kontext beibehalten haben, andererseits jedoch versucht haben, ihn mit kürzeren Einführungen und Hinweisen zu deutschsprachigen Entwicklungen etwas aufzuweichen. Diese Hinweise und Ergänzungen sind jedoch nicht als umfassende Aufarbeitungen zu verstehen, sondern eher als Heftpflaster gedacht, um einige für deutschsprachige Ohren schmerzende Stellen etwas zu entschärfen. Dies ist uns nicht umfassend gelungen. Sie werden beispielsweise trotzdem lesen können, dass Freuds Vorlesung an der Clark University 1909 als ein Meilenstein der Psychotherapie genannt wird, ohne auf die viel früher publizierten Arbeiten zur Hysterie einzugehen. Nichtsdestotrotz versuchten das gesamte Übersetzerteam und ich, den Text so zu glätten, dass die Hauptaussagen und die möglichst universellen Argumentationslogiken ins Zentrum gestellt werden.
Personen werden im Text einfachheitshalber in männlicher Form ausgeschrieben (z. B. Therapeuten, Patienten, Beobachter); es werden damit jedoch alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen.
Lassen Sie sich von der in diesem Buch gepflegten Argumentationslust anstecken! Die rigorose empirische Analyse des Medizinischen Metamodells wird die nächsten Generationen von Psychotherapeuten und Interventionsforschern intensiv beschäftigen. Die in diesem Buch skizzierte Ausarbeitung eines kontextuellen Metamodells ist nicht abgeschlossen, sondern womöglich eher ein prägnanter Paukenschlag einer breiten Auseinandersetzung!
|10|Auf dem Wege zu einem psychotherapeutischen Kernwissen
Prof. Dr. Bernhard Strauß, Universität Jena
Das erstmalig 2001 erschienene, in der zweiten englischsprachigen Auflage (2015) gemeinsam mit Zac E. Imel verfasste, Buch The Great Psychotherapy Debate von Bruce E. Wampold erregt(e) Aufsehen in der Welt der Psychotherapieforschung. Umso wichtiger ist es, dass nun eine deutschsprachige Adaption des Buches unter Mitwirkung von Christoph Flückiger vorliegt!
Eine zentrale Botschaft des Buches – basierend auf zahlreichen systematischen Übersichten und Metaanalysen von Originalarbeiten – stellt die durchaus verbreitete Sicht in Frage, wonach die positiven Wirkungen der Psychotherapie eher auf spezifischen Effekten beruhen, eine Sicht, die den Autoren zufolge eher einem medizinischen Modell entsprechen würde. Nach Wampolds und Imels Analysen der absoluten und relativen Wirksamkeit von Psychotherapie und der Bedeutung der allgemeinen Wirkfaktoren (einschließlich der Person des Therapeuten) kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die vorliegende Evidenz eher ein kontextuelles denn ein medizinisches Modell der Psychotherapie stützen würde.
Dies erklärt, dass bis heute immer wieder das schon in den 1930er-Jahren von Saul Rosenzweig verwendete Zitat des Dodo-Vogels aus Lewis Carrolls Geschichte von Alice im Wunderland „Jeder hat gewonnen, und jeder hat einen Preis verdient“ angeführt wird, wenn es gilt, die vergleichende Psychotherapieforschung zu bewerten. Der Ausspruch des Vogels hat in der Geschichte von Alice im Wunderland einen Hintergrund, der vielen Psychotherapeuten nicht bekannt ist, der aber ein sehr passendes Paradigma für den psychotherapeutischen Prozess darstellt:
„Alice und ein bunt zusammengewürfelter Haufen Kreaturen sind gerade einem Tränensee entstiegen, klitschnass und durchfroren. Nachdem der Versuch der Maus fehlschlägt, die Gruppe mit trockenen Erzählungen aus der mittelalterlichen Geschichte Englands zu wärmen, bringt der Dodo-Vogel die Petition ein, „die Konferenz zwecks Adaptation wirkungsvollerer Direktiven zu vertagen“ und meint, dass ein „Freiwahlrennen“ das beste Mittel wäre. So steckt er einen nicht ganz runden Kreis ab, „aber es kommt nicht darauf an, dass der Kreis wirklich rund ist“, sagte er. Dann stellte er die ganze Gesellschaft nebeneinander am Rande auf. Es gab nicht das Kommando 1-2-3-los, sondern jeder rannte los, wann er wollte, so dass man nicht ohne weiteres erkennen konnte, wann das Rennen zu Ende war. Als sie jedoch nach einer halben Stunde alle trocken waren, rief der Dodo plötzlich: Schluss des Rennens! Die Gesellschaft umdrängte ihn und fragte: Wer hat denn gewonnen? Zur Beantwortung dieser Frage benötigte der Dodo seinen ganzen Verstand. Er setzte sich und hielt sich lange eine Pfote grüblerisch an die Stirn (das ist die Haltung, in der gewöhnlich erhabene Denker auf Bildern zu sehen sind). Die anderen warteten schweigend. Schließlich verkündete der Dodo: Jeder hat gewonnen, jeder hat einen Preis verdient!“ (die Zitate sind der Ausgabe von Alice im Wunderland der Edition Holz im Kinderbuchverlag Berlin von 1989, entnommen).
|11|Unter Psychotherapieforschern finden sich durchaus unterschiedliche Haltungen zu dem Verdikt des (in der Realität längst ausgestorbenen) Vogels, die – wie ein geschätzter Kollegen zu sagen pflegt – „Dodoisten“ und die „Antidodoisten“, und natürlich sind wie bei den meisten wissenschaftlichen Fragestellungen auch Glaube, Überzeugung und Identifizierungen im Spiel.
Wampold und Imel können aber mit einem „progressiven Forschungsprogramm“ aufwarten, welches sich vor allem auf die mittlerweile hoch entwickelte Methode der Metaanalysen stützt, die es – anders als systematische Reviews narrativer Natur – erlaubt, spezifische Hypothesen bezüglich alternativer Modelle zu prüfen. Wenn wir die Bedeutung des Ansatzes für den lange anhaltenden Schulenstreit in der Psychotherapie einmal beiseitelassen, dann erscheinen die in diesem Buch berichteten Ergebnisse bestens geeignet, unser Wissen über die Wirkung von Psychotherapie zu erweitern und gewissermaßen zu legieren.
In der Psychotherapie der letzten Jahre ist eine zunehmende Modularisierung zu beobachten, die in einer Fülle an vermeintlichen Neuentwicklungen resultierte, also spezifische Therapieverfahren für spezifische Störungen, die mit vermeintlich ebenso spezifischen Veränderungsmechanismen arbeiten und die meistens mit neuen Bezeichnungen versehen wurden, auch wenn wesentliche Elemente dieser Behandlungskonzepte in der Geschichte der Psychologie und Psychotherapie längst beschrieben sind. Dies tangiert ein Problem in der Psychotherapie(forschung), das man als eine „Geschichtsvergessenheit“ bezeichnen könnte und das auch damit zusammenhängt, dass die Psychologie nach wie vor danach sucht, eine Wissenschaftsdisziplin zu werden, die – ähnlich wie die Naturwissenschaften – über ein Basis- oder Kernwissen verfügt.
Marvin Goldfried hat in einem bemerkenswerten Aufsatz mit dem Titel „Consensus in Psychotherapy Research and Practice: Where have all the findings gone?“ auf diesen Aspekt hingewiesen und sich auf eine 1991 von Arthur W. Staats im American Psychologist publizierte Arbeit („Unified Positivism and Unification Psychology“; Staats, 1991) bezogen. In diesem Artikel macht Staats deutlich, dass die Psychologie bisher nicht einheitlich definiert werden kann, ihre Uneinheitlichkeit sich sogar verschlimmere angesichts der Tatsache, dass sich die Psychologie den Profilen moderner Wissenschaften zwar annähert, gleichzeitig aber daran scheitert, wesentliche Phänomene zu erklären. Es gäbe zu viele Methoden, die nicht aufeinander bezogen sind, zu viele Einzelbefunde, Methodenprobleme, viele verschiedene theoretische Sprachen und unterschiedliche philosophische Positionen.
Die Sicht von Staats wurde immer wieder in Postulaten für mehr Integration in der psychologischen Forschung und in wissenschaftssoziologischen Diskussionen über die Frage eines Kernkonsensus in den Wissenschaften aufgegriffen. Hier ist beispielsweise Cole (1992) mit seiner bemerkenswerten Abhandlung „Making Science: Between Nature and Society“ zu nennen, der eine Wissenschaft prototypisch als ein System definiert, in dem es ein Kernwissen gibt (core of knowledge). Das Kernwissen wird gleichgesetzt mit anerkanntem Wissen, das am ehesten im Kontext naturwissenschaftlicher Befunde auszumachen ist (wohingegen die „Research Frontier“ eher umstrittene Befunde umfasst und eher mit den Sozialwissenschaften verbunden wird). Diese Aufteilung ist aber letztendlich künstlich, da Cole selbst |12|bspw. gezeigt hat, dass die Nichtübereinstimmungen von Bewertungen wissenschaftlicher Befunde in den Naturwissenschaften genauso groß sind wie in den Sozialwissenschaften. Letztendlich kommt er zu der sehr pessimistischen Einschätzung: “There may not be significantly more consensus in evaluating new scientific ideas then there is in judging nonscientific items such as human beauty, new works of arts, or Bordeaux wines” (Cole, 1992, S.19). Auch Marvin Goldfried (2000) bezieht sich auf Coles Theorie und meint, dass Sozialwissenschaftler an der Grenze ihrer Forschung möglicherweise genauso viel Uneinigkeit und umstrittene Befunde erlebten wie die Naturwissenschaftler, dass die Sozialwissenschaftler (zu denen er die Psychotherapieforscher rechnet) im Unterschied zu den Naturwissenschaftlern aber große Schwierigkeiten hätten, sich überhaupt auf ein Kernwissen zu einigen. Dies gilt natürlich auch für die Psychotherapie.
Die Evidenz, die Wampold und Imel in diesem Buch zusammenfassen, stellt zumindest für die Wirkung und Wirkweise von Psychotherapie ein Kernwissen dar, wobei es ein wesentliches Verdienst in der Debatte ist, explizit auf die Bedeutung der Person des Psychotherapeuten hinzuweisen. Es ist ganz erstaunlich, dass in der Psychotherapieforschung über lange Jahre die Auffassung vorherrschte, dass die Person des Psychotherapeuten eine „Konstante“ sei, der man keine besondere Aufmerksamkeit schenken muss. Therapeutenvariablen wurden zwar gelegentlich mit untersucht, dabei zeigte sich aber meistens, dass zumindest objektivierbare Kennzeichen des Therapeuten, wie Alter, Geschlecht oder ausbildungsbezogene Merkmale, relativ wenig Vorhersagekraft für den Therapieerfolg haben (vgl. Castonguay & Hill, 2017). Erst in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten wurde deutlich, dass es eine große Varianz zwischen Psychotherapeuten gibt, die auch beinhaltet, dass einige Psychotherapeuten regelhaft gute Psychotherapien „produzieren“ (die „supershrinks“), während andere mit einer gewissen Konsistenz ihren Patienten wenig helfen können. Wampold und Imel zeigen entsprechend, dass die Ergebnisvarianz, die durch die Person des Therapeuten erklärt wird, doch so beträchtlich ist, dass wir uns in Zukunft mit deren Hintergründen sehr viel mehr beschäftigen müssen.
Ein breites Kernwissen und ein kontextuelles Modell von Psychotherapie sind natürlich wichtige Voraussetzungen für Bestrebungen, integrative oder „allgemeine“ Modelle von Psychotherapie zu entwickeln. Die Konzeptualisierung eines kontextuellen Modells von Psychotherapie wird dazu beitragen können, aktuelle Integrationsbemühungen, wie sie bspw. durch die Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) unternommen werden, zu fördern und hat einen engen Bezug zu längst vorliegenden Konzepten, wie dem von Klaus Grawe entwickelten Modell der Psychologischen Psychotherapie, das sich momentan in Zeiten der Modularisierung vielleicht schwertut und nun gar droht, im deutschen Sprachraum in Vergessenheit zu geraten (vgl. Grawe, 1998).
Die Autoren weisen darauf hin, dass eine kulturelle Adaptation evidenzbasierter Therapien bedeutsam sei. Sicher sind die basalen Aussagen der Autoren auch für unser Psychotherapie- und Gesundheitssystem gültig, auch wenn hier noch eine intensive Forschung der tatsächlichen Realisierung psychotherapeutischer Modelle im Sinne einer patientenorientierten Forschung notwendig bleibt. Diese ist auch eine wesentliche Voraussetzung für die politische Konsequenz von Forschung, die die bei|13|den Autoren fordern, nämlich den Zugang zur Psychotherapie für jene zu fördern, die diesbezüglich bisher eindeutig unterprivilegiert sind!
|14|Psychotherapie: Alles Placebo, alles Dodo, alles fliegt?
Prof. Dr. Winfried Rief, Universität Marburg
Das Buch The Great Psychotherapy Debate war beim Ersterscheinen ein Paukenschlag und hat bis heute nur wenig an Aktualität verloren. Alle psychotherapeutischen Ansätze haben höchst unterschiedliche Theoriegebäude entwickelt, um die Wirkungsweise ihrer Interventionen zu erklären, und trotz dieser höchst unterschiedlichen Theoriegebäude resultieren die Therapieverfahren in nur wenig unterschiedlichen Globaleffekten. Es ist offensichtlich, dass hier ein Denkfehler bei den meisten Vertretern von Psychotherapieverfahren vorliegen muss, der wissenschaftlich weiter analysiert werden muss. Die Autoren machen beeindruckend deutlich, dass die einseitige Sicht auf spezifische Wirkfaktoren völlig den Blick vernebelt, wie es offensichtlich empirisch bestens belegt wirklich zur Gesamtwirkung einer psychotherapeutischen Intervention kommt. Insofern lebt das Buch ganz wesentlich von der Polarisierung zwischen „echter, spezifischer Wirkung eines Treatments“ (wie von Therapieschulenvertretern vorgegeben, so dass das Treatment nicht auf Placeboeffekte oder andere unspezifische Faktoren zurückzuführen ist) und „gemeinsamen Faktoren“ (common factors).
Als Placeboforscher muss ein solcher Ansatz direkt Wohlgefallen auslösen. Die Idee von wahren, auf die spezifischen Wirkfaktoren zurückführbaren Therapieeffekten erscheint einem aus der Perspektive der Placeboforschung schnell als theoretische Illusion, die sich bei näherer Betrachtung als wenig hilfreich erweist. Der Einfluss des Behandlungskontextes, die Art der therapeutischen Beziehungsgestaltung, subjektive Erwartungen und Vorerfahrungen von Patienten wurden in der Placeboforschung als wesentliche Faktoren, die den Behandlungserfolg determinieren können, auch experimentell nachgewiesen (Rief, Bingel, Schedlowski & Enck, 2011).
Wie in dem vorliegenden Buch ausgeführt, kommt die Grundidee klinischer Studien aus der Medizin und impliziert, in einer Kontrollbedingung alle unspezifischen Faktoren abzugreifen, so dass in der Verum-Bedingung die Summe der unspezifischen und spezifischen Faktoren abgebildet wird und durch Subtraktion die wahren Faktoren analysiert werden können (additives Modell). In einem solchen Modell stecken diverse Grundannahmen, die zwischenzeitlich wissenschaftlich nicht bestätigt werden konnten. So ist eine Idee, dass die unspezifischen Faktoren in der Placebo- und in der Verum-Gruppe identisch sind. Aber kann dies denn überhaupt sein? Auch hier hilft ein kleiner Blick in die medizinisch-pharmakologische Forschung: Nehmen wir an, der Proband in der Placebogruppe hat eine neutrale Einstellung zum Medikament und verspricht sich dadurch wenig Positives. Über den Behandlungsverlauf wird sich vermutlich auch an dieser Erwartung wenig ändern. Sehen wir denselben Probanden in der Verum-Gruppe, so kann es sein, dass erste Ansetzeffekte mit leichten Nebenwirkungen die Überzeugung auslösen, ein wirkungsvolles Medikament einzunehmen, wodurch sich die Erwartungen an einen Behandlungserfolg erhöhen. Spürt der Teilnehmer dann vielleicht auch wirklich eine leichte Verbesserung, steigert sich seine positive Erwartung an einen Behandlungserfolg. Damit sind aber Er|15|wartungen und weitere psychologische Faktoren der Behandlung bei Teilnehmern in der Verum-Gruppe deutlich anders als bei Teilnehmern in den Placebogruppen.
Diese Parallele lässt sich durchaus auch auf die Psychotherapieforschung übertragen. Wird einer aktiven Behandlung eine kurze psychoedukative Phase vorgeschaltet, die primär Behandlungserwartungen optimiert, wird die nachfolgende Behandlung deutlich besser abschneiden, unabhängig von der dort verwendeten Technik. Das Kontextuelle Metamodell von Wampold hat entsprechend frühzeitig auf die Rolle von Patientenerwartungen hingewiesen. Entsprechend finden sich auch aktuell in der Psychotherapieforschung Unterschiede bei Behandlungsarmen mit gleicher Therapiebezeichnung (man bedenke nur die unterschiedlichen Therapieeffekte, die man bei Angststörungen unter dem Behandlungsnamen „KVT“ finden kann) in Abhängigkeit davon, welche Behandlungserwartungen geschürt wurden. Der dramatische Allegiance-Effekt (Munder, Brütsch, Leonhart, Gerger & Barth, 2013), der in manchen Analysen von Therapiestudien die gesamten Effekte erklären kann und auch oftmals als Erklärung bei gefundenen Unterschieden zwischen therapeutischen Maßnahmen herhalten kann, bestätigt den großen Einfluss solcher Effekte auf Behandlungsergebnisse.
Wenn sich nun jedoch die unspezifischen Effekte in den Kontrollbedingungen von den unspezifischen Effekten in den Behandlungsbedingungen unterscheiden, so fällt bereits hiermit das aus der Medizin entliehene additive Modell von spezifischen und unspezifischen Faktoren. Werden als unspezifische Faktoren Aspekte wie Patientenerwartungen oder therapeutische Beziehung gesehen, so wird bereits daran schnell deutlich, dass ein einfaches additives Modell kaum das grundsätzliche Entstehen von Therapieeffekten erklären kann, sondern unser Verständnis eine Modifikation erfahren muss. Man muss wohl einen Interaktionsterm aus spezifischen und unspezifischen Behandlungsfaktoren annehmen, der ggf. über die Zeit der Behandlung auch noch veränderbar ist. So kann ein Patient eine Behandlung nach dem Erstgespräch beim Therapeuten sehr hoffnungsfroh beginnen und die therapeutische Beziehung sehr positiv einschätzen, was beides eine gute Prädiktion von Behandlungserfolg darstellt. Treten jedoch nach wenigen Wochen die erhofften Behandlungserfolge vielleicht nicht auf, sondern diverse Nebenwirkungen und Probleme, steht auch zunehmend die therapeutische Beziehung auf dem Prüfstand, und ggf. sinken die Behandlungserwartungen. Aus diesem Beispiel werden zwei wichtige Aspekte deutlich: Unspezifische Behandlungsfaktoren interagieren eng mit spezifischen Behandlungseffekten, und diese Interaktion sowie überhaupt der Verlauf der unspezifischen Wirkfaktoren kann über die Zeit deutlich variieren und somit bei Behandlungsbeginn eine andere Rolle spielen als in der Mitte der Behandlung oder bei Behandlungsende. Somit können Behandlungseffekte zum einen durch das komplexe Zusammenwirken verschiedener Behandlungsfaktoren (mit Interaktionseffekten!) beschrieben werden und müssen zum anderen als Prozessmodell über die Zeit verstanden werden, wobei der Beitrag einzelner Faktoren und einzelner Interaktionen variieren kann. Auch wenn dies auf den ersten Blick komplizierter klingen mag, so spricht doch die gesamte klinische Forschung sowohl in der Medizin als auch im Bereich Psychotherapie für diese Aussage, und das Kontextuelle Metamodell von Wampold hat hierfür schon früh den Weg gezeigt.
|16|Damit wird eine Stärke und zugleich auch eine Schwäche der Hauptideen dieses Buches deutlich. Man kann nicht über Placeboeffekte sprechen, wenn nicht vorher jemand behauptet hat, es gäbe „wahre Effekte“, die frei von den Placebomechanismen sind. Man kann nicht über „gemeinsame Faktoren“ sprechen, wenn nicht vorher jemand behauptet hat, es gäbe „spezifische Faktoren“. So lebt der Charme dieses Buches von der Polarisierung, die letztendlich von der evidenzbasierten Gesundheitsforschung aufgestellt wurde und hier ihren Gegenpunkt erfährt. Um dieses Gedankenspiel weiter voranzutreiben, kann die Frage gestellt werden: Sind gemeinsame Faktoren immer noch gemeinsame Faktoren, wenn ich eine Psychotherapieform danach optimiere, diese gemeinsamen Faktoren besser umzusetzen als zuvor? Wenn der Nachweis gelingt, dass die Therapie dadurch wirkungsvoller wird, wäre dies bei der neuen Therapie ja ein spezifischer Vorteil im Vergleich zur alten Therapie; damit hätte die neue Therapie mehr „spezifische Faktoren“, oder?
Diese Überlegungen machen deutlich, dass die Zukunft nicht in der Dichotomisierung von gemeinsamen Faktoren versus spezifischen Faktoren liegen kann. Demgegenüber können wir weiterhin von Wirkfaktoren sprechen, die allerdings interagieren können und sich über die Zeit auch verändern können (deshalb benötigt man ggf. auch ein Prozessmodell). Therapien können höchst unterschiedlich sein in der Umsetzung solchet Wirkfaktoren, und dies dürfte in vielen Fällen Unterschiede in der Wirksamkeit von Behandlungen erklären.
Die Erstausgabe des Buches The Great Psychotherapy Debate war eine Provokation und war als Provokation gedacht. Umso bedauerlicher ist es, wenn dieses Buch und der dahinterstehende Denkansatz zur Harmonisierung und Gleichschaltung zwischen verschiedenen Behandlungsrichtungen missbraucht wird. Das auch in diesem Buch beschriebene „Dodo-Bird-Verdikt“ dient oftmals den Interessen einzelner Psychotherapievertreter, jedoch weniger der Psychotherapie als Ganzem. So wird oftmals der Kampf für die Psychotherapie mit der übermächtigen Anzahl von Evidenznachweisen der kognitiven Verhaltenstherapie geführt, und es wird postuliert, dass ja damit auch alle anderen Psychotherapieverfahren gleich wirksam sind und deshalb alle Psychotherapie irgendwie toll ist. Der Dodo fliegt also, egal was an ihm dran hängt. Hier würde ich der Neuauflage des Buches in deutscher Sprache wünschen, dass es eher wieder zu Provokation beiträgt und nicht als Medium zur falsch verstandenen Harmonisierung und Gleichschaltung von Psychotherapien verwendet wird. Die vielen vergleichbaren Effekte bei vergleichenden Therapiestudien sind eine Herausforderung für die Psychotherapieforschung, die jedoch keinesfalls als Gleichwertigkeit aller Psychotherapien gewertet werden dürfen. Viele Faktoren und deren Zusammenwirken können vergleichbare Endergebnisse von zwei Behandlungsarmen bedingen. Vergleicht man die oftmals mehrere hundert Patienten großen Stichproben der Pharmaforschung mit den oftmals sehr kleinen Gruppen in der Psychotherapieforschung, so ist unschwer zu erkennen, dass manche Gleichheit einfach auf fehlende Power in der Studie zurückzuführen ist und damit auf unzureichende finanzielle Finanzierung von Psychotherapiestudien. Des Weiteren gibt es durchaus auch Therapiestudien, die unterschiedliche Ergebnisse erbracht haben. Am aussagekräftigsten sind ggf. jene, in denen jener Behandlungsarm besser abgeschnitten hat, der weniger im Interesse der Versuchsleiter lag, so dass die Studienergebnisse |17|gegen die Allegiance-Effekte der Studie ausfallen. Darüber hinaus wird aktuell ein Behandlungsverfahren vor allem dann als wirkungsvoll angesehen, wenn es gegen „supportive Therapie“ besser abschneidet, da diese eher als „Placebobedingung“ der Psychotherapie angesehen wird, dabei jedoch gerade die sogenannten gemeinsamen Faktoren durchaus in substantiellem Umfang umsetzt. Diesen differentiellen Vorteil haben sowohl manche KVT-Verfahren als auch einige psychodynamische Behandlungsarme zu erlangen geschafft. Darüber hinaus kann es offensichtlich deutliche Effektivitätsunterschiede geben, obwohl angeblich die gleiche Behandlung umgesetzt wurde. Auch hieraus kann geschlussfolgert werden, dass es Unterschiede in der therapeutischen Effektivität von Behandlungsarmen gibt, allerdings ggf. an anderen Stellen als erwartet, und die spezifischen Wirkungsmodelle einer Behandlung als isolierter Faktor überbewertet werden.
Somit weist dieses Buch abschließend auch etwas in Richtung der Zukunft, in der Kontextfaktoren einer Behandlung in ihrem hohen Stellenwert erkannt und ausreichend gewürdigt werden, hierbei jedoch einen von verschiedenen Wirkfaktoren darstellen, die zum Behandlungserfolg beitragen. Des Weiteren kann die Bedeutung von gemeinsamen Faktoren (allerdings nicht als alleiniger Wirkfaktor!) nicht ausreichend betont werden. Wie auch eigene Arbeiten deutlich machen, führt die Optimierung gemeinsamer Faktoren in Behandlungsarmen zu einer deutlichen Effektivitätssteigerung (Rief et al., 2017). Gemeinsame Faktoren sollten also nicht als Mitläufer einer Behandlungsbedingung gesehen werden, sondern als aktiv zu optimierender Prozess im Rahmen der Psychotherapie. Aber Psychotherapie ist auch deutlich mehr als Einwirkungen des Kontextes oder subjektive Erfolgserwartungen.
Trotzdem kann alleine die Optimierung dieser Faktoren manchmal den Durchbruch in Behandlungsprozessen bringen. Dabei hängt dies jedoch nicht von einer isolierten Betrachtung solcher Faktoren ab, sondern von deren Interaktion mit Krankheitsfaktoren und Krankheitsmechanismen (bei einer Zwangserkrankung laufen andere Prozesse ab als bei einer chronischen Schmerzstörung!), genauso, wie diese mit subjektiven Krankheits- und Behandlungsannahmen der Patienten und der bedeutsamen Personen in ihrem Umfeld interagieren können. Vor diesem Hintergrund kann die Simplifizierung in gemeinsame und spezifische Faktoren hoffentlich bald überwunden werden, so dass Therapieeffekte durch die Interaktion verschiedener Wirkfaktoren über die Zeit präziser und zuverlässiger beschrieben werden können.
|18|Neue Wege in der Psychotherapieforschung
Prof. Dr. Wolfgang Lutz, Universität Trier
Die zweite Auflage und Übersetzung des Buches The Great Psychotherapy Debate, neu zusammengestellt von Bruce E. Wampold, Zac E. Imel und Christoph Flückiger, stellt erneut eine „alte“ und gleichzeitig „neue“ Theorie in den Vordergrund: Die verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren haben etwa vergleichbare Wirkungen oder zeigen nur geringe Wirkungsunterschiede, da ihnen gemeinsame Wirkfaktoren zugrunde liegen. So alt die Idee ist (sie wurde insbesondere von Gene V. Glass bereits vor rund 40 Jahren erstmals empirisch untersucht), so kontrovers wird sie nach wie vor diskutiert. Dennoch erscheint das Buch, welches eine vermeintlich alte These aufgreift, aktuell und hilfreich. Auch wenn wir den Diskurs/Streit zu diesem Thema zwischen den kognitiv-verhaltenstherapeutischen Verfahren (der mit Abstand am besten untersuchten theoretischen Grundorientierung) und den psychodynamischen Verfahren (als der ältesten theoretischen Grundorientierung) in diesem Vorwort einmal nicht fokussieren, so ist doch die Debatte auch für moderne Therapieverfahren von Relevanz.
Das Buch von Wampold, Imel und Flückiger macht erneut deutlich, wie wichtig es ist, in der Psychotherapieforschung von einfachen Vergleichen von Verfahren zu komplexeren Modellen zur Unterstützung der differentiellen und adaptiven Indikationsentscheidungen voranzuschreiten, welche auch negative Therapieverläufe berücksichtigen bzw. zu deren Optimierung beitragen. In diesem Feld ist dringend ein Forschungsausbau nötig, damit wir nicht in einer sich immer weiterdrehenden Spirale von neu entwickelten Verfahren, welche doch nur vergleichbare Ergebnisse zeigen, haften bleiben. Ich möchte dies im Folgenden etwas näher ausführen.
Eine Verbesserung der Evidenzbasierung ist von zentraler Bedeutung für die Weiterentwicklung der Psychotherapie als wissenschaftlich fundiertes und gesellschaftlich anerkanntes Verfahren zur Behandlung psychischer Störungen. Während in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl neuer therapeutischer Verfahren entwickelt wurde, zum Teil auf der Basis standardisierter Behandlungsmanuale, und deren Wirksamkeit in randomisiert kontrollierten Studien (RCT) zufriedenstellend nachgewiesen werden konnte, so konnte auf der Seite der zentralen Wirkmechanismen und Prozessvariablen doch relativ wenig Fortschritt verzeichnet werden. Zugleich ist aber zu beobachten, dass viele neuere Behandlungsverfahren, z. B. Verfahren der dritten Welle innerhalb der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) oder mentalisierungsbasierte Verfahren in der psychodynamischen Tradition, spezifische Behandlungsempfehlungen für spezifische Diagnosegruppen hervorbringen und ihrem Anspruch auf Originalität durch eigenständige Zertifikate und Weiterbildungsmodule Ausdruck verleihen. Eine vergleichbare Entwicklung – allerdings stärker auf klinischen Fallberichten und neuen klinischen Ideen beruhend – findet sich auch in den systemischen oder humanistischen Grundorientierungen. Einer großen Zahl von zum Teil originellen und beliebten Neuentwicklungen steht eine geringe differentielle Evidenz im Vergleich zu bereits etablierten Verfahren wie z. B. der KVT gegenüber.
Betrachtet man nun die Effektstärken gut untersuchter, evidenzbasierter Verfahren, weisen diese auf die gut belegte durchschnittliche Wirksamkeit psychotherapeu|19|tischer Interventionen hin. Demzufolge sind die Verfahren für viele Patienten wirksam, für einige sogar hochwirksam, wohingegen andere Patienten keinen Nutzen aus der Behandlung ziehen können.
Das bedeutet, dass dieselbe Behandlung eine differentielle Wirksamkeit für unterschiedliche Patienten aufweisen kann. Vorrangiges Ziel der Psychotherapieforschung sollte es daher nun sein, insbesondere die Behandlung jener Patienten zu verbessern, die aus dieser keinen Nutzen ziehen. Klaus Grawe forderte bereits Ende der 1990er-Jahre einen Paradigmenwechsel in der Psychotherapieforschung. Er postulierte eine Abkehr von einer Methodenorientierung (Treatment A vs. Treatment B) hin zu einer Patienten- und Erfolgsorientierung. Dabei sind die beiden folgenden Fragen wegweisend: Welche Therapie ist für welchen Patienten am erfolgreichsten? Wie können therapeutische Strategien optimal im Laufe der Behandlung an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden (insbesondere für solche Patienten mit einem Risiko für einen negativen Verlauf)?
Die oben aufgeführten Fragen lassen sich im Rahmen einer differentiellen Indikation beantworten und entsprechen der Idee einer personalisierten Medizin (Precision Medicine Initiative) oder auch der patientenorientierten Psychotherapieforschung. Die Idee ist die Auswahl einer Behandlung, eines geeigneten Behandlungssettings, eines Therapeuten und spezifischer Interventionsstrategien, die basierend auf Empirie für einen spezifischen Patienten voraussichtlichen den größten Nutzen bringen werden. Für den Bereich der psychologischen Interventionen bzw. der Psychotherapie wurden ebenfalls bereits einige Modelle und Konzepte von mehreren Arbeitsgruppen erarbeitet. Diese Algorithmen ermitteln Vorhersagen für neue Patienten aufgrund von Daten der bereits behandelten Patienten oder auf der Basis sehr intensiver Messungen an einem Patienten etwa in der Wartezeit. So lässt sich etwa die Wahrscheinlichkeit errechnen, mit der ein Patient von einer KVT oder einer interpersonalen Therapie oder einer medikamentösen Behandlung profitieren würde und eine optimale Behandlung für die spezifischen Patientenbedingungen ermitteln. Derzeit werden unterschiedliche statistische Implementierungen und Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis diskutiert. Diese Erprobung in der Praxis muss jetzt zeigen, inwieweit hierdurch eine Behandlungsoptimierung stattfinden kann.
In einem zweiten Schritt geht es um die Frage, wie therapeutische Strategien optimal für einen Patienten nutzbar gemacht werden können. Diese Strategie impliziert die wiederholte Erhebung relevanter Erfolgsmaße im Verlauf der Therapie und die Rückmeldung der therapeutischen Fortschritte, um damit die Voraussetzung für Anpassungen des therapeutischen Vorgehens an mögliche Veränderungen des Patienten zu liefern. Es zeigt sich, dass Therapeuten ohne weitere Unterstützung kaum in der Lage dazu sind, valide Vorhersagen über das Behandlungsergebnis ihrer Patienten zu treffen. Ein solches Feedbacksystem kann durch differentielle, d. h. an den Verlauf des Patienten angepasste, klinische Unterstützungstools (clinical support tools) ergänzt werden. Diese geben den Therapeuten Anregungen zum Umgang mit kritischen Phasen in der Therapie.
Wie bereits ausgeführt, kann das Buch von Wampold, Imel und Flückiger als ein weiterer Beleg für die Notwendigkeit einer differenzierteren Forschung, wie oben kurz skizziert, angesehen werden. In diesem Bereich scheint ein dringender For|20|schungsausbau nötig, damit das hohe Niveau der psychotherapeutischen Versorgung etwa in der Bundesrepublik evidenzbasiert erhalten oder sogar ausgebaut werden kann. Gerade auch die im internationalen Vergleich sehr gute, wenn auch eher aufwändige Aus- und Weiterbildung in Deutschland macht es möglich, dass Aus- und Weiterbildungskandidaten sowohl die störungsspezifischen als auch die allgemeinen Wirkfaktoren kennenlernen sowie eine gute Forschungsbasis mitbringen, um gezielt auch schwierigen Patienten helfen zu können, welche mit einer einfachen Therapie „von der Stange“ nicht erfolgreich behandelt werden können.
Details zur angesprochenen Studie siehe: Fava, G. A., Ruini, C., Rafanelli, C., Finos, L., Salmaso, L., Mangelli, L. & Sirigatti, S. (2005). Well-being therapy of generalized anxiety disorder. Psychotherapy and Psychosomatics, 74, 26–30.
|21|Kapitel 1 Die Geschichte der Medizin, der Methoden und der Psychotherapie
Konzeptuelle und empirische Fortschritte in der Psychotherapie
Psychotherapie muss das dichotome Denken von Patienten nicht übernehmen; Grautöne sind entscheidend. Das Unausgesprochene oder Tabuisierte kann für den Inhalt eines Gesprächs entscheidend sein. Psychotherapie und psychologische Interventionsforschung bilden hier keine Ausnahme. Das Streben nach Fortschritt kann sowohl Nutzen als auch Kosten haben: Gerade das, was als veraltet gilt und verbannt wird, kann Wesentliches enthalten, Fortschritt sich gelegentlich als heiße Luft entpuppen. Andererseits kann sich Innovation als äußert sinnvoll erweisen, und es kann schädlich sein, sich nostalgisch an die Vergangenheit zu klammern. Dieses Buch stellt primär eine kritische Prüfung der Fortschritte in der Psychotherapie dar. Verborgene, vergessene oder ignorierte Forschungsaspekte werden aufgedeckt und diskutiert.
Es ist eine romantische Vorstellung, dass wissenschaftlicher Fortschritt auf dem gesammelten wissenschaftlichen Wissen basiert. Vielmehr ist Fortschritt ein Ergebnis menschlichen Handelns; und dieses menschliche Handeln wird durch eine Vielzahl von möglicherweise allzu menschlichen Faktoren mitbeeinflusst. Wissenschaftliche Fortschrittsrhetorik und wissenschaftliche Befunde sind nicht immer deckungsgleich. Empirische Daten müssen interpretiert werden und sind nicht per se objektiv. Erwartungen, Wertvorstellungen, Vorurteile, gesellschaftspolitischer Status und Methoden können die Interpretation beeinflussen. Interventionswissenschaften sind möglicherweise besonders anfällig für diese Einflüsse, da die Komplexität groß ist und kulturelle, politische und monetäre Faktoren oft verborgen in den empirischen Untersuchungsgegenstand mit hineinspielen können. In den meisten Fällen wird Psychotherapie in westlichen Gesundheitssystemen praktiziert, die sich stark an medizinischen Richtlinien und Standards orientieren. Psychologische Interventionen lassen sich jedoch nur sehr schwer in das Raster der Medikamentenforschung pressen. Das Hauptziel dieses Buches ist, ein für psychologische Interventionen sinnvolles Rahmenmodell zu diskutieren und daraus zentrale Grundannahmen abzuleiten. Dieses Modell haben wir in den vorangegangenen Büchern und Manuskripten als „Kontextuelles Metamodell“ bezeichnet. Das vorliegende Buch versucht, den aktuellen empirisch-wissenschaftlichen Stand des Kontextuellen Metamodells zusammenzufassen.
|22|Um den aktuellen Stand der psychologischen Interventionsforschung besser zu verstehen, versuchen wir in einem ersten Schritt, wichtige Meilensteine im Verlauf der Psychotherapie- und Medizingeschichte aufzuzeigen. Mehrere miteinander verflochtene Stränge werden wir dabei thematisieren: die Geschichte des medizinischen Fortschritts, die Geschichte des Fortschritts der empirischen, quantitativen Forschungsmethoden und die Entwicklungsgeschichte psychologischer Interventionen und der Psychotherapie in westlichen, liberalistischen Gesellschaften. Eigentlich könnte jeder dieser Bereiche ein eigenes Buch füllen; uns geht es jedoch bewusst um eine verkürzte Gesamtübersicht, um die zentralen Aspekte des aktuellen Forschungsstands besser zu verstehen und miteinander in Verbindung zu bringen.
|23|Medizin
Medizinische Interventionen im medizinischen Kontext, verkürzt „die Medizin“, ist die dominierende Heilpraxis in westlichen Gesellschaften. Sie hat die professionelle und institutionelle Kraft, wissenschaftliche Erkenntnisse zur Heilung von Krankheiten, zur Linderung körperlicher Leiden und zur Verlängerung des Lebens zu definieren und für die Gesellschaft nutzbar zu machen. Allerdings ist die moderne Medizin eine relativ neue gesellschaftliche Entwicklung. Sie entstammt einer Tradition von Heilpraktiken, deren Großteil sie lieber nicht als ihre direkten Vorfahren verstanden wissen möchte.
Die Ursprünge der Medizin als Heilpraxis
Heilpraktiken werden seit den frühsten anthropologischen Überrestfunden dokumentiert und diskutiert:
Nach Sir William Osler (1932) ist der Wunsch, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, ein Merkmal, das Hominiden von ihren Artverwandten unterscheidet. … Obwohl nichts über die frühesten Medikationen oder über den ersten Arzt bekannt ist, so stammt das früheste Porträt eines Arztes möglicherweise aus der Cro-Magnon-Zeit, 20 000 v. Chr. (Haggard, 1934; Bromberg, 1954). Die behaarte und tierähnliche Erscheinung hatte möglicherweise große psychologische Wirkung, und es ist wahrscheinlich, dass die Behandlung darin bestand, ein Vehikel für psychologische oder Placeboeffekte zu sein, ohne eine eigentliche „intrinsische“ Wirksamkeit (Model, 1955). (Shapiro & Shapiro, 1997b, S. 3)
Tatsächlich ist es unmöglich, in der Geschichte der Menschheit eine Zivilisation zu finden, in der Medizin, Rituale und Heiler nicht zentrale Merkmale der Kultur waren (Shapiro & Shapiro, 1997b; Wilson, 1978). Während sich die Gesellschaften entwickelten, war der menschliche Geist dazu prädisponiert, Erklärungen zu physikalischen, geistigen und somatischen Phänomenen zu finden (Gardner, 1998). Die Erklärungen variierten je nach Kultur und besitzen ihre eigene Entwicklungsgeschichte und in sich kohärente Logik – die Kunst jedoch, in sich stimmige Erklärungen zu verwenden, um Behandlungen durchzuführen, überspannt Kulturen und Zeit. Aus dieser Perspektive stellt das Wesen der Heilpraxis eine zentrale Komponente in der Beschreibung jeder Kultur dar, da Kultur- und Heilpraktiken stark ineinander verflochten sind. So schlugen beispielsweise die Pythagoreer vor, den Körper als eine Beschaffenheit von vier Säften anzusehen (nämlich: Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle). Psychologische Charakterzüge manifestierten sich in verschiedenen Mischungen dieser Säfte; Krankheit entstand dann, wenn die Körpersäfte, von denen man annahm, dass sie durch Ernährung, Wetter und Klima beeinflusst werden, unausgewogen waren (Morris, 1997; Shapiro & Shapiro, 1997b; Wampold, 2001a). Apache-Schamanen, aufwändig in Tierfelle und Masken gekleidet, praktizierten Tanz-, Trommel-, Rassel-, Gebets- und Gesangsrituale, um die bösen Geister mit schutzgebenden Geistern zu ersetzen (Morris, 1997). Die traditionelle chinesische Medizin (TCM), die in |24|dem I Ging („Buch der Wandlungen“) und dem Huangdi Neijing Suwen („Der Klassiker des Gelben Kaisers zur Inneren Medizin“) beschrieben ist, postulierte unter anderem fünf Elemente: Wasser, Feuer, Holz, Metall und Erde sowie Kombinationen des Yins und Yangs. Krankheiten wurden mit fünf Geschmacksrichtungen, fünf Getreidearten und fünf Aromen behandelt. (So wurden beispielsweise scharfe Lebensmittel verwendet, um den Zerfall der Leber zu verhindern oder saure Lebensmittel benutzt, um die Leber zu entleeren.) Diese Behandlung wurde durch Akupunktur ergänzt, die in China seit mehr als 2 500 Jahren lebhaft praktiziert wird (Shapiro & Shapiro, 1997b). Die Arzneibücher der europäischen Medizin des siebzehnten Jahrhunderts enthielten hingegen Substanzen wie Vigos Pflaster (Vipernfleisch mit lebenden Würmern und Fröschen), Fuchslunge, Moos aus den Schädeln von gewaltsam Umgebrachten, Gascoignes Pulver (Bezoar, Bernstein, Perlen, Krabbenaugen und -scheren und Korallen), menschlicher Urin, verschiedene Geschlechtsorgane, Exkremente unterschiedlichster Herkunft, menschliche Plazenta, Speichel von fastenden Menschen und Asseln (Shapiro & Shapiro, 1997b).
Es gibt keinen Grund, alte oder indigene Heilpraktiken grundsätzlich zu romantisieren; viele dieser Verfahren waren unwirksam und einige davon gefährlich (Shapiro & Shapiro, 1997a, b). Hippokrates verordnete beispielsweise eine Diät, die Gemüse und Früchte ausschloss, was zu Vitaminmangel führte. Akupunktur konnte aufgrund nicht sterilisierter Nadeln Hepatitis verursachen – eine tödliche Krankheit, die in China jahrhundertelang weit verbreitet war und viele Menschenleben forderte. Dehydrierende Verfahren wie Aderlass, Erbrechen, Einläufe und Blutegel „haben mehr Patienten als jede andere Behandlung in der Geschichte der Medizin getötet“ (Shapiro & Shapiro, 1997a, S. 18). Tatsächlich ist George Washington ohne Zweifel von seinem Arzt getötet worden, der die Mandelgeschwüre mit einer Vielzahl von Verfahren behandelte, die die natürliche Austrocknung aufgrund des Fiebers zusätzlich verstärkten. Ob nun wirksam oder unwirksam, Kulturen entwickelten Erklärungen für Krankheiten und Behandlungsmethoden – jede Erklärung und die damit verbundene Behandlung stand im Einklang mit den Überzeugungen und Praktiken der Kultur und prägte in vielerlei Hinsicht Merkmale der Gesellschaft.
Obwohl die Ursprünge der westlichen wissenschaftlichen Medizin bis zu den alten Griechen zurückverfolgt werden können, blieben die meisten Behandlungen in Europa und den Vereinigten Staaten nach modernen Standards der Medizin schätzungsweise bis zum neunzehnten Jahrhundert unwirksam.
Materialismus, Spezifität und Placebo als kritische Konzepte der modernen Medizin: Die Beiträge von René Descartes, Benjamin Franklin und Louis Pasteur
Moderne Medizin basiert auf basalen philosophischen Annahmen, die bis in die Renaissance zurückverfolgt werden können. Die philosophischen Errungenschaften der Renaissance mit ihrem Fokus auf Materialismus und Spezifität sowie deren Überprüfbarkeit erlaubt es der modernen Medizin, logische, wissenschaftliche Erklärungsmodelle zu generieren und in aufwändigen Forschungsdesigns zu testen. Ma|25|terialismus, im Sinne eines allgemeinen philosophischen Begriffs, betrachtet Materie als alleinige Grundlage der Wirklichkeit und versucht damit, Phänomene als Folge der Wechselwirkungen verschiedener Arten der Materie zu erklären. Angewandt auf Medizin impliziert Materialismus, dass jeder Körperzustand, darunter vor allem Krankheit, ein physisches Substrat hat. Spezifität ist eine logische Folge des Materialismus. Medizinische Behandlungen sind auf spezifische Krankheiten bezogen. Eine Behandlung ist dann spezifisch, wenn die Komponenten der Behandlung einer Krankheit diejenigen physikalisch-chemischen Aspekte des Körpers verändern, die für die Krankheit verantwortlich sind. Allgemein gesprochen beruht Spezifität in der Medizin auf nachweisbaren Veränderungen der physikalisch-chemischen Prozesse, die für die Krankheit verantwortlich gemacht werden, und entweder einer Beseitigung der Erkrankung (d. h. Heilung) oder einer Verringerung der Schwere der Störung. Spezifische Behandlungen gehen grundsätzlich über das hinaus, was durch den Geist bewirkt werden kann, wie zum Beispiel die Stärkung der Hoffnung, die Verbesserung der Heilungserwartungen und psychologische Konditionierung. Obwohl Materialismus schon in der Philosophie der alten Griechen diskutiert wird, hat sich die Spezifität in der Medizin erst seit der Entwicklung materialistischer Wissenschaften wie Anatomie und Physiologie etabliert. Spezifische Ursachenzuschreibungen ermöglichten es, Forschungsdesigns zu entwickeln, um die Effekte von Behandlungen adäquat zu untersuchen.
Bevor Benjamin Franklin (einer der Gründerväter der USA) und Louis Pasteur ihre Beiträge zur modernen Medizin leisten konnten, musste zuerst ein philosophisches Problem gelöst werden: Zwischen körperlichen und psychischen Störungen wurde in den meisten alten Kulturen nicht unterschieden. So reichen Anatomie und Physiologie alleine nicht aus, um körperliche Krankheiten von psychischen Störungen zu trennen. Wenn sich die Medizin anschickte, die materiellen Grundlagen von Erkrankungen zu finden, so lagen diese Bestrebungen zum großen Teil im Bereich der offensichtlichen körperlichen Erkrankungen, sodass eine Unterscheidung zwischen den physiologisch beobachtbaren und psychisch erfahrbaren Störungen notwendig wurde. Es war unter anderen René Descartes im frühen siebzehnten Jahrhundert, der die Unterscheidung zwischen Geist und Körper hervorhob, obwohl es wohl nicht seine Absicht war, diese Trennung in den Dienst der Medizin zu stellen. Dennoch hatte diese Unterscheidung Bestand, sodass beispielsweise die Universitäten ihre Fakultäten in materielle Naturwissenschaften und geisteswissenschaftliche Kulturwissenschaften trennten. Und so war es möglicherweise eine der zentralsten Leistungen der modernen Psychologie, die naturwissenschaftlichen Beobachtungswissenschaften und geisteswissenschaftlichen Erfahrungswissenschaften wieder in einem akademischen Fach zusammenzuführen. Natürlich bleibt zu erwähnen, dass in den letzten Jahrzehnten breite, fächerübergreifende Forschungsinteressen entstanden sind, um das Zusammenspiel von Körper und Geist besser zu verstehen, und so beispielsweise in den Neurowissenschaften der klassische Körper-Geist-Dualismus kaum mehr haltbar ist (Miller, 1996).
Im Fortschreiten der Wissenschaften und der damit verbundenen wissenschaftlichen Methoden wurde es offensichtlich, dass die meisten in den Arzneibüchern beschriebenen Substanzen nicht wirksam waren. Tatsächlich schienen nur sehr weni|26|ge für bestimmte Krankheiten wirksam zu sein (z. B. Fingerhut für Herzinsuffizienz oder Chinarinde gegen Malaria; Shapiro & Shapiro, 1997b). Im Jahr 1785 wurde der Begriff „Placebo“ ins medizinische Lexikon aufgenommen. Er wurde auf Behandlungen angewendet, die biochemisch als unwirksam bekannt waren, aber den Wunsch des Patienten nach einer Behandlung zufriedenstellten (Shapiro & Shapiro, 1997b). Der Begriff, so Walach (2003), stammt aus dem lateinischen Psalmvers „Placebo domino in regione vivorum“ („Ich werde dem Herrn gefallen in dem Land der Lebenden“), der im Mittelalter als ein Gebet am Sterbebett gesungen wurde. Weil andere die Totenwache in der Nacht oft übernahmen und dafür Geld erhielten, lastete dem Begriff Placebo ein „fast betrügerischer Ersatz des Echten“ an (Walach, 2003, S. 178). Wie in den kommenden Diskussionen deutlich werden soll, finden Placebobedingungen und Placeboeffekte in mehrere Kontroversen in Medizin und psychologischer Interventionsforschung Eingang. Aus der Perspektive dieses Buches ist ein psychologisches Verständnis der Placebowirkung entscheidend für das Verständnis der Psychotherapie. Nichtdestotrotz lastet dem Begriff des Placebos seit dem Beginn seiner Nutzung eine minderwertige, „unspezifische“ Wirkung an, im Sinne der Verabreichung irgendeiner Substanz, um die Patienten zufriedenzustellen. Dies wurde als ethisch anstößig angesehen, und nicht wenige, die für die offensichtlich heilende Wirkung des Placebos eintraten, waren in den Augen ihrer Zeitgenossen Scharlatane und begaben sich in existentielle Gefahr, wie dies beispielsweise Franz Anton Mesmer zu spüren bekam.
Zeitgleich zur Entstehung des Begriffs Placebo hatte der Pariser Arzt Mesmer eine lukrative medizinische Praxis. Seine Stammkundschaft setze sich aus der Pariser Elite zusammen, aber seine Praxis war auch umstritten. In seiner Dissertation behauptete Mesmer (1766/1980), dass einige Krankheiten durch die Blockierung des normalen Flusses einer unsichtbaren universalen Flüssigkeit, die er animalischen Magnetismus nannte, verursacht würden. Der Arzt könne die Gesundheit durch die Beseitigung von Blockaden wiederherstellen, und nach einiger „Forschung“ fand Mesmer heraus, dass er Objekte mit tierischem Magnetismus „aufladen“ und damit seine Kunden heilen konnte (Buranelli, 1975; Gallo & Finger, 2000; Gauld, 1992; Pattie, 1994). Der Erfolg dieser Behandlungen wurde gut dokumentiert und führte zu einer immensen Popularität im späten achtzehnten Jahrhundert.
Der kampflustige Mesmer, der bereits in mehrere Kontroversen verstrickt war, kam unter intensive Beobachtung. Die Medizin, darin bestrebt Praktiken zu unterbinden, die unwissenschaftlich waren, fand Mesmers Heilungen unbequem. Als Reaktion darauf gründete der französische König Ludwig XVI im Jahre 1784 eine Königliche Kommission unter dem Vorsitz von Benjamin Franklin, mit der Aufgabe, „Mesmerismus“ zu untersuchen (Gould, 1991). Bei einigen von der Kommission entworfenen Experimenten wurden die teilnehmenden Patienten in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei die eine Gruppe in Kontakt mit „magnetisierten“ Objekten kam und die andere Gruppe mit nicht magnetisierten Objekten, von denen sie jedoch glaubte, sie seien magnetisiert (d. h. nach moderner Terminologie ein Placebo). Es wurde streng darauf geachtet, dass die Patienten nicht wussten, ob sie ein magnetisiertes Objekt erhielten, wodurch eine der ersten, wenn nicht die erste, „Verblindung“ in einer Studie sichergestellt wurde (hier eine einseitige Verblindung der Patienten, jedoch nicht |27|der Behandler/Untersucher). Dieses Design erlaubte es der Königlichen Kommission, zu zeigen, dass es bei den Heilungen der beiden Gruppen keinerlei Unterschiede gab und dass Mesmers Heilungen nicht auf die spezifische „magnetische“ Behandlung zurückzuführen waren.
Der bereits erwähnte Naturforscher Stephen Jay Gould (1989) brachte die Prüfung und Diskreditierung von Mesmer als eine der frühesten und beispielhaftesten Demonstrationen der Verwendung wissenschaftlicher Methode vor, um Pseudowissenschaft und Scharlatanerie zu entlarven. Jedoch sind zwei Aspekte in Mesmers Fall eingebettet, die nicht vergessen werden sollten. Zunächst sei angemerkt, dass sich erstaunlicherweise beide Behandlungen als wirksam erwiesen, wie bereits von der Königlichen Kommission festgestellt wurde. Zweitens standen Mesmers Theorien der Erkrankung und der Behandlung im Einklang mit den zur damaligen Zeit bestens dokumentierten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Messmer begründete seine Behandlungen auf den Theorien von Sir Isaac Newton, der ein Jahrhundert zuvor wichtige Axiome der Mechanik und die Weiterentwicklung der Mathematik vorangetrieben hatte (Gleick, 2003). So wurde Mesmer nicht auf der Grundlage der Wirksamkeit der Behandlung oder der theoretischen Fundierung des damaligen Wissensstandes diskreditiert. Die Kritik lag vielmehr in den Befunden, dass der vorgeschlagene spezifische Heilungsmechanismus fraglich war. Die Forderung nach Spezifität wurde in Folge zum Standard psychischer Gesundheitsbehandlungen. Diese Forderung jedoch für pharmakologische sowie psychologische Methoden nachzuweisen, hat sich bis heute als äußerst schwierig erwiesen, wie wir später aufzeigen werden. Nichtsdestotrotz war die von der Königlichen Kommission vorgenommene Untersuchung ein auffälliges Ereignis und ein Meilenstein, der die akademische Professionalisierung der Medizin vorantrieb.
Die dritte wegweisende Person in der Entwicklung der modernen Medizin war Louis Pasteur, der Vater der Keimtheorie. (Zugegeben, es könnten legitime und begründete Anspruche der Vaterschaft durch Robert Koch gestellt werden.) Pasteur zeigte die optimale Mischung von Theorie und Experiment, um, wie der Philosoph Ernest Renan hierzu bemerkte, „Natur solange auszuhorchen“, bis bestimmte Beweise für Mutmaßungen vorliegen. Der rote Faden von Pasteurs Arbeit war, dass er in der Lage war, Rückschlüsse auf die Existenz und die Eigenschaften von Objekten zu ziehen, die zu klein waren, um direkt beobachtet zu werden (Latour, 1999).
In den 1850er-Jahren war die Chemie, befreit von den Überresten der Alchemie und der Identitätssuche, das herausragende Gebiet der Wissenschaften, welches nach chemischen Erklärungen für die meisten Naturphänomene suchte, einschließlich biologischer Prozesse. Der allgemeine Konsensus der damaligen Zeit war, dass der Gärungsprozess, der den Zerfall von Zucker zu Alkohol förderte, durch eine nicht beobachtbare „zersetzende Störung“ zu erklären war. Dieser chemische Prozess konnte von einer gärenden Lösung auf eine andere übertragen werden. Für die Alkoholhersteller war der Prozess jedoch unzuverlässig, und die chemische Erklärung hatte wenig pragmatischen Wert. Auf der Grundlage seiner früheren Arbeit in der Kristallographie von organischen Substanzen, scharfer Beobachtung und systematischer Experimente stellte Pasteur die Hypothese auf, dass lebende Mikroorganismen für die Fermentation verantwortlich waren und somit für die Gärung nicht ausschließ|28|lich chemische, sondern biochemische Prozesse verantwortlich sind. Diese Entdeckung führte zu weiteren Schlussfolgerungen, einschließlich der Vermutung, dass Krankheit durch Mikroorganismen verursacht werden könnten, und stellt somit den Ursprung der Infektionstheorie dar. Die Paarung von Theorie und Experiment führte zu neuen medizinischen Praktiken mit nachweisbarem Nutzen, darunter die Entwicklung von Impfstoffen mit geschwächten Krankheitserregern und die Sterilisation der medizinischen Umgebung, die zur Verminderung von Krankheitsübertragungen führte. Zu guter Letzt: Die industrielle Pasteurisierung von Lebensmitteln förderte die Haltbarkeit von Konservenfleisch bis Marmelade; wobei biochemische Prozesse zur Lagerung von Lebensmitteln beispielsweise für die Käseproduktion oder Weinherstellung innerhalb und außerhalb Frankreichs in verschiedensten vorindustriellen Gesellschaften schon seit Jahrtausenden genutzt wurden!
Zwei Aspekte der Pasteur’schen Geschichte sind von entscheidender Bedeutung; einer davon ist in der Retrospektive offensichtlich und der andere illustrativ, um die subtilen Schlussfolgerungen für die Philosophie der Wissenschaft zu veranschaulichen. Angewendet auf die Medizin, erfordert Materialismus physikalische Erklärungen für Erkrankungen; die Infektionstheorie war genau das, was die Ärzte wollten – sie kam „wie bestellt.“ Nicht nur, dass Krankheit geheilt oder verhindert werden konnte, sogar der zugrundeliegende Mechanismus konnte in einer nachweisbaren Weise demonstriert werden. Keine Zweifel, es gab keinen Mangel an hypothetisch angenommenen Mechanismen vor der Zeit von Pasteur. Es war sein ausgeklügelt konstruierter und am Ende unumstößlicher Nachweis, wie Mikroorganismen Krankheiten verursachen können und die darauffolgenden Entwicklungen, die den Status der Erklärungen veränderten.
Aus heutiger Sicht machte die philosophisch-ontologische Erklärung der Krankheit als Folge von Pasteurs Arbeiten über Fermentation einen deutlichen Schritt nach vorne, und die Idee der spontanen Entstehung von Mikroorganismen scheint absurd zu sein (siehe Latour, 1999), was uns zum zweiten Punkt betreffend Pasteurs Geschichte bringt. Im Jahr 1864 entfachte sich die epistemologische Schlacht erst richtig: Zu der Zeit wurde chemische Zersetzung als die Erklärung für Fermentation angenommen; die beobachteten Mikroben waren demnach spontan entstanden und nicht die Ursache der Gärung. Die Befürworter einer Erklärung der Fermentation basierend auf Mikroorganismen wurden als Verrückte betrachtet, etwa, wie heute über Mesmer gedacht wird. Die Organismen waren vorhanden, aber im Nachhinein, und nicht prozessbegleitend. In den 1860er-Jahren waren weder die „zersetzende Störung“, die die Gärung katalysierte, noch die Mikroben, die Gärung verursachen, beobachtbar.
Pasteur hat seine Experimente auf eine raffinierte Weise entworfen, sodass die biochemischen Prozesse indirekt beobachtbar wurden. Zudem hat er eine Theorie geschaffen, um die experimentellen Ergebnisse stringent zu erklären. Er überzeugte die wissenschaftliche Welt auch rhetorisch in Publikationen und Präsentationen von dem Vorzug seiner Erklärungen – Letzteres genau so schwierig wie Ersteres. In gewissem Sinne „verschworen“ sich Pasteur und die Mikroorganismen; weder der eine noch die anderen hätten alleine die Infektionstheorie zur Entstehung von Krankheiten hervorgebracht (Latour, 1999).
|29|Was Wissen in einem bestimmten Fachbereich ausmacht, hängt teilweise von den Menschen, die Forschung betreiben, Theorien schaffen und die wissenschaftliche Gemeinschaft beeinflussen, ab. Der Stand des Wissens ist oft mit zentralen sozialgesellschaftlichen Errungenschaften verbunden und wird vom aktuellen „Zeitgeist“ beeinflusst. Das Wesen der Psychotherapie selbst ist die Antwort auf unsere Anforderungen in den aktuellen Gesellschaften. Die Art dieser Anforderungen bildet den Möglichkeitsraum dessen, was wir als Wissen akzeptieren. Kliniker, Forscher und Entscheidungsträger beeinflussen, was das aktuelle Wissen beinhaltet und was als solches akzeptiert wird. Descartes, Franklin und Pasteur spielten, zusammen mit anderen, in dieser kritischen Periode des neunzehnten Jahrhunderts eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Voraussetzungen, die notwendig waren, um die Grundmodelle der modernen Medizin zu bilden. Dieses Modell war auch für Krankheiten mit psychischen Symptomen äußerst erfolgreich, sodass beispielsweise die durch Typ I Diabetes verursachten neurologischen Folgeschäden durch den klinischen Einsatz von Insulin gegen erhöhten Blutzuckerspiegel reduziert oder verzögert werden konnten. Zentral erscheint hier, dass durch das bessere Verständnis der biochemischen Ursachen und der damit verbundenen Therapien der massive psychische Leidensdruck der Folgeerkrankungen von Patienten gelindert werden konnte.
Das Medizinische Metamodell
Das Medizinische Metamodell, mit den zentralen Vorannahmen des Materialismus und der Spezifität, eingebettet in die wissenschaftlichen Errungenschaften der Anatomie, Physiologie, Mikrobiologie und weiterer naturwissenschaftlicher Disziplinen, lässt sich für unsere Zwecke etwas holzschnittartig in fünf Merkmalen beschreiben. Möglicherweise sind diese Merkmale vereinfachend. Zentral erscheint uns jedoch nicht deren Wahrheitsgehalt, vielmehr sollen die Merkmale das aktuelle, gesellschaftlich akzeptierte Modell der Medizin in seinen Grundzügen umschreiben. Es geht uns hier also nicht darum, wie sich die aktuelle Medizin primär selbst definiert, sondern darum, was die Gesellschaft von der Medizin aktuell erhofft und erwartet.
Krankheit oder Störung
Das erste Merkmal ist die Beschreibung und Kategorisierung der Symptome, Erkrankungen, Leiden und psychischen Störungen. Damit wird die Frage beantwortet, an was genau die Patienten leiden. Die Patientinnen und Patienten vertrauen dem Arzt ihre Symptome an, die zusammen mit der Krankheitsgeschichte, direkten Untersuchungen und Labortests zu einer Einschätzung führen, inwieweit der Patient an einer Krankheit leidet und an was der Patient leidet. Es bestehen somit zwei Fragen: Ist der Patient effektiv krank oder verunglückt (oder simuliert er) oder hat sein (Risiko-) Verhalten kaum Krankheitswert? Falls er krank ist, an welcher spezifischen Krankheit leidet er? Einige prophylaktische Interventionen sind darauf ausgelegt, Krankheiten zu verhindern (z. B. Impfung, Zahnpasta); solche primären präventiven Interventionen |30|sind im Allgemeinen jedoch auch auf spezifische Symptome und ein damit verbundenes Risiken bezogen.
Biologische Erklärung
Ausgehend von der materialistischen Haltung der Medizin ist das zweite Merkmal eine vorzugsweise biologische Erklärung für die Krankheit oder Störung. Zum Beispiel wird Influenza durch ein Virus verursacht, welches die Zellen in der Nase, im Rachenraum und der Lunge des Menschen befällt, wo es repliziert wird und mutiert. Natürlich werden Erklärungen zunehmend anspruchsvoller, da die Wissenschaft den Krankheitsprozess mehr und mehr beleuchtet. Nicht selten wird sich eine Erklärung als falsch herausstellen und mit einer besseren Alternative ersetzt. So wurden Magengeschwüre anfänglich mit überschüssiger Säure, später mit Stress oder würziger Nahrung und noch später mit dem Bakterium H. pylori erklärt. Zentral bleibt jedoch: Die materialistische Haltung der Medizin verleiht der rationalen Erklärung vorzugsweise einen biologischen Charakter.
Spezifischer auf die Krankheit bezogener Veränderungsmechanismus
Das dritte Merkmal des Medizinischen Metamodells beinhaltet, dass die Grundlage für die Behandlung auf der Ebene des biologischen Systems festgelegt sein sollte, welches für die Verursachung der Krankheit verantwortlich ist. Es besteht somit eine spezifische Erklärung dafür, wie die medizinische Intervention die Krankheit beseitigt, die Schwere mildert oder die Dauer der Krankheit verkürzt. Wenn die Ursache von Magengeschwüren ein Überschuss an Säure aufgrund von Stress oder unangepasster Ernährung wäre, würde der Veränderungsmechanismus dazu führen, dass Säuren neutralisiert und Ernährungsgewohnheiten verändert werden. Wenn eine H. pylori-Infektion nachgewiesen würde, so würde der Veränderungsmechanismus ein spezifisches Antibiotikum einschließen, das diese Infektion bekämpft und die Symptome verändert.
Therapeutische Verfahren
Das Vorhandensein einer Erklärung und des Veränderungsmechanismus führen logischerweise zur Gestaltung einer spezifischen Behandlung, also eines therapeutischen Verfahrens, das die Verabreichung einer Substanz (d. h. eines Medikaments) oder die Durchführung eines Verfahrens (beispielsweise einer Operation) umfasst. Aufgrund der Erklärung der überschüssigen Säure durch Stress (Erklärung) und des Ziels, Säure zu verringern (Veränderungsmechanismus), würde die Verabreichung einer Substanz naheliegen, welche dafür bekannt ist, Säure zu neutralisieren (d. h. eine alkalische Substanz, ein säurebindendes Mittel, welches beispielsweise Calciumcarbonat enthält). Wenn eine Infektion durch